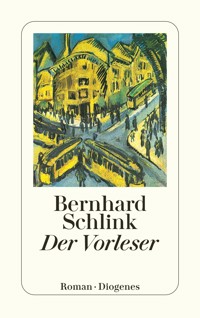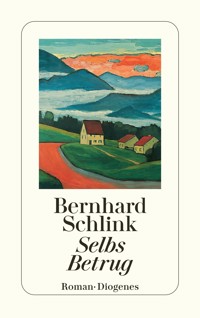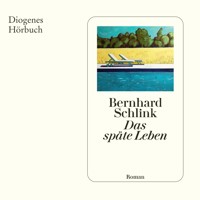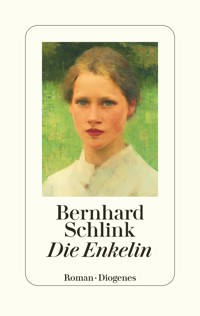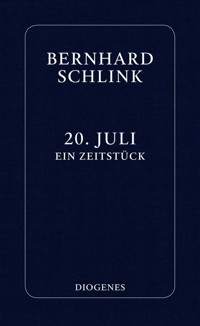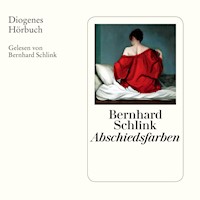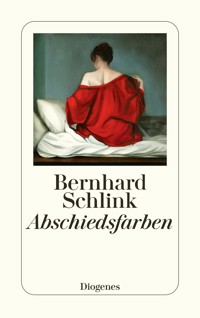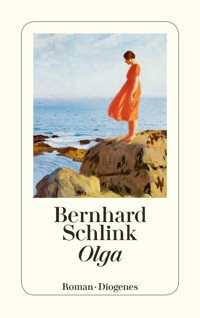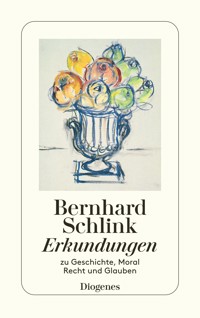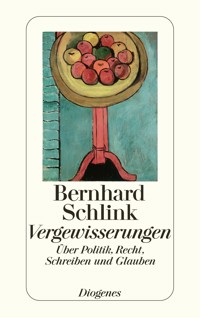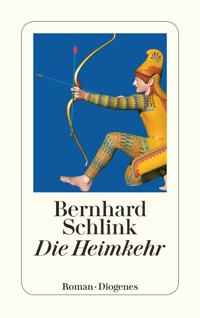
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Fragment eines Heftchenromans über die Heimkehr eines deutschen Soldaten aus Sibirien entdeckt Peter Debauer Details aus seiner eigenen Wirklichkeit. Die Suche nach dem Ende der Geschichte und nach deren Autor wird zur Irrfahrt durch die deutsche Vergangenheit und offenbart auch Peter Debauers Geheimnisse.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 363
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Bernhard Schlink
Die Heimkehr
Roman
Die Erstausgabe erschien 2006 im Diogenes Verlag
Umschlagillustration: ›Rekonstruktion des Westgiebels des Aphaia-Tempels in Ägina‹ (Ausschnitt)
Copyright © Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst/ Glyptothek, München
Rekonstruktion: Vinzenz Brinkmann und Ulrike Koch-Brinkmann
Foto: Renate Kühling
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2012
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 23722 1 (4. Auflage)
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5] ERSTER TEIL
1
Die Ferien meiner Kindheit verbrachte ich bei den Großeltern in der Schweiz. Meine Mutter brachte mich zum Bahnhof, setzte mich in den Zug, und wenn ich Glück hatte, konnte ich sitzen bleiben und kam nach sechsstündiger Fahrt an dem Bahnsteig an, an dem der Großvater mich erwartete. Wenn ich Pech hatte, mußte ich an der Grenze umsteigen. Einmal saß ich danach weinend im falschen Zug, bis ein freundlicher Kondukteur mir die Tränen trocknete und mich nach ein paar Stationen in einen anderen Zug setzte und dem nächsten Kondukteur anvertraute, der mich auf die gleiche Weise an den übernächsten weitergab, so daß ich von einer Stafette von Kondukteuren ins Ziel befördert wurde.
Ich genoß die Bahnfahrten: das Vorüberziehen der Landschaften und Orte, die Geborgenheit des Abteils, die Selbständigkeit. Ich hatte Fahrkarte und Paß, Proviant und Lektüre, brauchte niemanden und mußte mir von niemandem etwas sagen lassen. In den Schweizer Zügen vermißte ich die Abteile. Dafür war jeder Sitzplatz ein Fenster- oder Gangplatz und mußte ich nicht befürchten, in der Mitte eines Abteils eingezwängt zu werden. Außerdem war das helle Holz der Schweizer Sitze schmucker als das deutsche rotbraune Plastik, wie das Grau der Waggons, die dreisprachige [6] Aufschrift »SBB – CFF – FFS« und das Wappen mit dem weißen Kreuz im roten Feld edler waren als das schmutzige Grün mit der Aufschrift »DB«. Ich war stolz, ein halber Schweizer zu sein, auch wenn ich die Schäbigkeit der deutschen Züge heimatlich fand wie die Schäbigkeit der Stadt, in der meine Mutter und ich wohnten, und der Menschen, mit denen wir lebten.
Der Bahnhof der großen Stadt am See, an dem meine Reise endete, war ein Kopfbahnhof. Ich mußte nur den Bahnsteig entlanggehen und konnte den Großvater nicht verfehlen: groß und kräftig, mit dunklen Augen, buschigem weißen Schnurrbart und Glatze, in heller Leinenjacke, mit Strohhut und Spazierstock. Er strahlte Verläßlichkeit aus. Er blieb für mich groß, auch als ich ihn überragte, und kräftig, auch als er sich auf den Spazierstock stützen mußte. Noch als ich Student war, nahm er mich beim Gehen gelegentlich an der Hand. Es machte mich verlegen, war mir aber nicht peinlich.
Die Großeltern wohnten am See ein paar Orte weiter, und wenn das Wetter schön war, nahmen Großvater und ich nicht die Bahn, sondern das Schiff. Am liebsten hatte ich den großen, alten Raddampfer, in dessen Mitte man die ölig glänzenden bronzenen und stählernen Stangen und Kolben der Maschine arbeiten sah. Er hatte viele Decks, offene und geschlossene. Wir standen auf dem vorderen offenen Deck, atmeten den Wind und sahen am Ufer die kleinen Städte auftauchen und verschwinden, um das Schiff die Möwen kreisen und auf dem See die Segelboote mit ihren prallen Segeln prunken und die Wasserskifahrer ihre Kunststücke vollführen. Manchmal sahen wir hinter den Bergen die [7] Alpen, und der Großvater nannte die Gipfel beim Namen. Jedesmal kam es mir wieder wie ein Wunder vor, daß die Straße des Lichts, die die Sonne aufs Wasser wirft, ruhig gleißend in der Mitte und an den Rändern in tanzende Splitter zerspringend, mit dem Schiff mitwanderte. Ich bin sicher, daß schon der Großvater mir erklärt hat, daß das seine optische Richtigkeit hat. Aber noch heute kommt es mir jedesmal wie ein Wunder vor. Die Straße des Lichts beginnt da, wo ich gerade bin.
[8] 2
Im Sommer, als ich acht war, hatte meine Mutter kein Geld für meine Fahrkarte. Sie fand, ich weiß nicht, wie, einen Fernfahrer, der mich bis zur Grenze mitnehmen und dort einem anderen Fernfahrer übergeben sollte, der mich bei den Großeltern absetzen würde.
Treffpunkt war der Güterbahnhof. Meine Mutter hatte zu tun und konnte nicht bleiben; sie stellte mich mit meinem Koffer an die Einfahrt und schärfte mir ein, mich nicht von der Stelle zu rühren. Ich stand und sah jedem vorbeifahrenden Lastwagen ängstlich entgegen und erleichtert und enttäuscht hinterher. Sie ragten höher, dröhnten lauter und stanken schwärzer, als ich bisher bemerkt hatte. Es waren Ungetüme.
Ich weiß nicht, wie lange ich gewartet habe. Ich hatte noch keine Uhr. Nach einer Weile setzte ich mich auf den Koffer und sprang mehrmals auf, wenn es schien, als werde ein Lastwagen langsamer und wolle anhalten. Schließlich hielt einer an, der Fahrer hob mich und den Koffer ins Fahrerhäuschen und der Beifahrer in das hohe Bett hinter der Fahrerbank. Ich solle den Mund halten, den Kopf nicht über den Bettrand strecken und schlafen. Es war noch hell, aber auch als es dunkel wurde, konnte ich nicht schlafen. Am [9] Anfang drehten sich Fahrer oder Beifahrer ab und zu um und schimpften, wenn mein Kopf über den Bettrand ragte. Dann vergaßen sie mich, und ich sah hinaus.
Mein Blickfeld war klein, aber ich konnte durch das Seitenfenster neben dem Beifahrer die Sonne untergehen sehen. Vom Gespräch zwischen Fahrer und Beifahrer verstand ich nur Bruchstücke; es ging um Amerikaner, Franzosen, Lieferungen und Zahlungen. Beinahe hätte mich das gleichmäßig schlagende Geräusch, die gleichmäßige, gedämpfte Erschütterung eingelullt, als der Lastwagen über die großen Platten fuhr, aus denen der Belag der Autobahn damals bestand. Aber bald war die Autobahn zu Ende, und wir fuhren über schlechte, bergige Landstraßen, auf denen der Fahrer den Schlaglöchern nicht ausweichen konnte und ständig rauf- und runterschalten mußte. Es war eine unruhige Fahrt durch die Nacht.
Immer wieder hielt der Lastwagen an, tauchten Gesichter in den Seitenfenstern auf, stiegen Fahrer und Beifahrer aus, öffneten die Ladetür und schoben und schichteten auf der Ladefläche. Manche Stationen waren Fabriken und Lager mit hellen Lampen und lauten Stimmen, andere dunkle Tankstellen, Parkplätze und Feldwege. Vielleicht haben Fahrer und Beifahrer mit der Erledigung ihrer Aufträge noch die Besorgung eigener Geschäfte verbunden, geschmuggelt oder gehehlt und dadurch länger gebraucht als geplant.
Jedenfalls waren wir zu spät an der Grenze, war der andere Lastwagen schon weg und saß ich ein paar Stunden im Morgengrauen auf einem Platz in einer Stadt, deren Namen ich nicht mehr weiß. Um den Platz standen eine Kirche, das [10] eine und andere neue Haus und mehrere Häuser ohne Dächer und mit leeren Fenstern. Im ersten Licht der Sonne kamen Leute und bauten einen Markt auf; sie brachten Säcke, Kisten und Körbe auf großen, flachen, zweirädrigen Karren, zwischen deren Gestänge sie sich mit einer Schlinge über der Schulter gespannt hatten. Ich hatte die ganze Nacht vor dem Kapitän und dem Steuermann des Lastwagens Angst gehabt, vor einem Überfall durch Piraten, einem Unfall und davor, ich müsse aufs Klo. Jetzt hatte ich ebensoviel Angst davor, jemandem aufzufallen, der dann über mich verfügen würde, wie davor, daß niemand mich bemerken und sich um mich kümmern würde.
[11] 3
Das Haus, in dem die Großeltern wohnten, war von einem Architekten gebaut worden, der in der Welt herumgekommen war. Weit vorstehendes, von kunstvoll zugehauenen Holzstreben gestütztes Dach, ein trutziger Erker im ersten und ein mit Wasserspeiern geschmückter Balkon im zweiten Geschoß, die Fenster mit Stein in Stein gefügten Rundbogen – das Haus war kolonialer Landsitz, spanische Burg und romanisches Kloster. Aber alles paßte zusammen.
Außerdem hielt der Garten es zusammen: links zwei hohe Tannen, rechts ein großer Apfelbaum, vor dem Haus eine alte, dichte Buchshecke und die rechte Seite des Hauses mit wildem Wein bewachsen. Der Garten war groß; zwischen Straße und Haus lag eine Wiese, neben dem Haus gab es auf der rechten Seite Gemüsebeete, Tomaten- und Bohnenstauden, Himbeer- und Johannisbeerbüsche, eine Brombeerhecke und einen Komposthaufen, auf der linken Seite einen breiten Kiesweg, der zur rückwärtigen Seite des Hauses führte, zu dem von zwei Hortensienbüschen gerahmten Eingang. Der Kies knirschte unter den Schritten, und wenn der Großvater und ich vor dem Eingang standen, hatte die Großmutter uns schon kommen gehört und machte die Tür auf.
Das Knirschen des Kieses, das Summen der Bienen, der Klang der Hacke oder des Rechens bei der Gartenarbeit – [12] seit den Sommern bei den Großeltern sind es Sommergeräusche. Wie der bittere Geruch des sonnenwarmen Buchses und der faulige des Komposts Sommergerüche sind. Wie die Stille des frühen Nachmittags, in der kein Kind ruft, kein Hund bellt und kein Wind weht, Sommerstille ist. Durch die Straße, an der meine Mutter und ich wohnten, führte dichter Verkehr; wenn die Straßenbahn oder ein Lastwagen vorbeifuhren, klirrten die Scheiben, und wenn beim Abriß und Aufbau der zerbombten Nachbarhäuser die Baumaschinen im Einsatz waren, zitterten die Böden. Bei den Großeltern gab es kaum Verkehr, nicht vor dem Haus und nicht im Ort. Wenn ein Pferdefuhrwerk vorbeifuhr, hieß mein Großvater mich Schaufel und Eimer holen, und in aller Ruhe folgten wir dem Fuhrwerk und sammelten die Pferdeäpfel für den Komposthaufen ein.
Im Ort gab es den Bahnhof, die Schiffsanlegestelle, ein paar Geschäfte und zwei oder drei Gasthöfe, darunter einen alkoholfreien, in dem die Großeltern manchmal am Sonntag mit mir zu Mittag aßen. Jeden zweiten Tag ging der Großvater einkaufen und machte die Runde vom Milch- und Käsegeschäft zur Bäckerei und zum Lebensmittelgeschäft der Genossenschaft, manchmal zur Apotheke oder zum Schuster. Er trug seine helle Leinenjacke und eine ebenso helle Leinenkappe, hatte in der Jackentasche ein Büchlein, das die Großmutter aus hier und da anfallendem leeren Papier nähte und in das sie die Einkaufsaufträge schrieb, hielt mit der einen Hand seinen Stock und an der anderen mich. Ich trug die alte, lederne Einkaufstasche, die, weil wir jeden zweiten Tag einkaufen gingen, nie so voll war, daß ich mich beim Tragen schwergetan hätte.
[13] Ging der Großvater jeden zweiten Tag mit mir einkaufen, um mir eine Freude zu machen? Ich liebte die Einkaufsgänge: den Appenzeller und Greyerzer Geruch im Milch- und Käsegeschäft, den Duft des frischen Brots in der Bäckerei, die Warenfülle im Lebensmittelgeschäft. Es war so viel schöner als der kleine Laden, zu dem mich meine Mutter schickte, weil sie bei ihm anschreiben lassen konnte.
Nach dem Einkaufen gingen wir an den See, fütterten die Schwäne und Enten mit altem Brot und sahen den Schiffen zu, die vorbeifuhren oder an- und ablegten. Auch hier war es ruhig. Die Wellen schlugen schmatzend an die Ufermauer – auch das ein Sommergeräusch.
Dann gab es noch die Geräusche des Abends und der Nacht. Ich durfte aufbleiben, bis die Amsel gesungen hatte. Wenn ich im Bett lag, hörte ich kein Auto und keine Stimmen; ich hörte die Kirchturmuhr die Zeit schlagen und auf der Strecke zwischen Haus und See halbstündlich den Zug vorbeifahren. Zunächst zeigte der seeaufwärts gelegene Bahnhof dem seeabwärts gelegenen mit einem Glockenton an, daß der Zug den Bahnhof verließ, wenige Minuten drauf fuhr der Zug vorbei, und wieder einige Minuten später signalisierte der seeabwärts gelegene Bahnhof die Abfahrt des Zugs. Dieser Bahnhof war weiter weg als der andere; ich hörte den zweiten Glockenton nur schwach. Eine halbe Stunde später kam der seeaufwärts fahrende Zug und wiederholten sich die Geräusche in umgekehrter Reihenfolge. Kurz nach Mitternacht fuhr der letzte Zug. Danach rauschte vielleicht noch der Wind in den Bäumen oder der Regen auf dem Kies. Sonst war es völlig still.
[14] 4
Nie hörte ich, wenn ich im Bett lag, Schritte auf dem Kies. Meine Großeltern gingen abends weder aus, noch bekamen sie Besuch. Erst als ich schon mehrere Sommer bei ihnen gewesen war, begriff ich, daß sie abends arbeiteten.
Anfangs hatte ich mir keine Gedanken gemacht, wovon sie lebten. Mir war klar, daß sie ihr Geld nicht wie meine Mutter verdienten, die morgens aus dem Haus ging und am späten Nachmittag wiederkam. Mir war auch klar, daß vieles, aber nicht alles, was auf den Tisch kam, in ihrem Garten gewachsen war. Ich wußte sogar schon, was Rente ist, hörte die Großeltern aber nie jammern, wie ich zu Hause beim Einkaufen oder im Hausflur ältere Leute über ihre Rente jammern hörte, und stellte sie mir daher auch nicht als Rentner vor. Ich stellte mir ihre finanzielle Situation überhaupt nicht vor.
Als mein Großvater starb, hinterließ er Lebenserinnerungen. Erst aus ihnen erfuhr ich, woher er kam, was er gemacht und wovon er gelebt hatte. So gerne er auf unseren Spaziergängen und Wanderungen erzählte, so wenig erzählte er von sich. Dabei hätte er manches zu erzählen gehabt.
Er hätte von Amerika erzählen können. In den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts war sein Vater nach einem [15] Erdrutsch, der sein Haus und seinen Garten verwüstet hatte, das Leben im Dorf leid und wanderte, wie viele andere aus dem Dorf, mit Frau und vier Kindern nach Amerika aus. Die Kinder sollten wackere Amerikaner werden. Mit dem Zug nach Basel, mit dem Schiff nach Köln und weiter mit Zug, Schiff und Wagen nach Hamburg, New York, Knoxville und Handsborough – die Lebenserinnerungen berichten von der Großartigkeit des vollendeten Kölner Doms, der Weite der Lüneburger Heide, dem ruhigen und dem stürmischen Meer, der Begrüßung durch die Freiheitsstatue und in Amerika von Begegnungen mit Verwandten, die schon früher ausgewandert und reüssiert oder gescheitert waren. In Handsborough starben zwei Geschwister meines Großvaters, und ein hartherziger Verwandter erlaubte nicht, daß sie auf, sondern nur, daß sie neben seinem Friedhof begraben wurden – endlich verstand ich die Photographie aus dem Schlafzimmer der Großeltern, die vor einem kleinen, hübschen, von schmiedeeisernem Gitter mit steinernem Tor umgebenen Friedhof zwei durch Bretter abgesteckte, armselige Gräber zeigte. Die Auswanderer kamen zurecht, wurden aber nicht glücklich. Sie hatten Heimweh, eine Krankheit, die tödlich sein kann. Großvaters Erinnerungen berichten, wie oft in der Kirche des Dorfs verlesen und im Kirchbuch vermerkt wurde, daß der Soundso in Wisconsin oder in Tennessee oder in Oregon an Heimweh gestorben war. Fünf Jahre nachdem die Auswanderer zu sechst aufgebrochen waren, kehrten sie zu viert mit den großen Koffern, die ihnen der Schreiner des Dorfs gefertigt hatte, heim.
Mein Großvater hätte auch von Italien und Frankreich erzählen können. Nachdem er Weberei und Spinnerei gelernt [16] hatte, arbeitete er mehrere Jahre in Turin und Paris, und wieder offenbaren seine Erinnerungen, wie interessiert er die Sehenswürdigkeiten besichtigt und Land und Leute kennengelernt hat, den kärglichen Lohn, die elenden Wohnungen und den Aberglauben der Arbeiter und Arbeiterinnen in Piemont, den Konflikt zwischen Katholizismus und Laizismus und das Erstarken des Nationalismus in Frankreich. Wieder offenbaren die Erinnerungen auch, wie ihn das Heimweh gequält hat. Die Übernahme der Leitung einer Schweizer Spinnerei, die Eheschließung und Gründung eines Hausstands, der Kauf eines Hauses auf Schweizer Boden – endlich lebte er nicht mehr wider die eigene Natur, sondern mit ihr.
Als er am Vorabend des Ersten Weltkriegs in die Leitung einer deutschen Spinnerei wechselte, mußte er die Heimat nicht aufgeben. Er wurde ein Grenzgänger, bis in der Inflation nach dem Ersten Weltkrieg sein Gehalt schon in Deutschland und erst recht in der Schweiz nichts wert war. Er versuchte, es sofort nach Erhalt für Dinge von bleibendem Wert auszugeben, und noch heute habe ich eine der schweren, wollenen Decken, die er zahlreich aus einem aufgelösten deutschen Pferdelazarett erworben hat und die tatsächlich unverwüstlich sind. Aber Pferdedecken nähren die Frau, die gesund und kräftig sein, schwanger werden und gebären soll, nicht, und so übernahm der Großvater wieder die Leitung einer Schweizer Spinnerei.
Er hat den Deutschen die Treue gehalten. Immer hat ihn das Schicksal der Deutschen im Ausland bewegt – vielleicht weil er dachte, sie müßten so heimwehkrank sein, wie er oft heimwehkrank gewesen war. Wenn die Großmutter kochte, [17] half er ihr, und zu seinen Pflichten gehörte, das kugelige metallene Netz mit dem gewaschenen, nassen Salat vor die Haustür zu tragen und zu schwenken, bis der Salat trocken war. Wieder und wieder passierte es, daß er lange nicht wiederkam und die Großmutter mich nach ihm schickte. Dann fand ich ihn vor der Haustür stehen und versonnen auf die Tropfen sehen, die er beim Schwenken über die Steinplatten vor dem Eingang verstreut hatte. »Was ist, Großvater?« Die Tropfen erinnerten ihn an die in die Welt zerstreuten Deutschen.
Nachdem die Großeltern den Ersten Weltkrieg, die Grippe und die Inflation überstanden hatten, nachdem der Großvater mit der Leitung der Schweizer Spinnerei Erfolg und auch zwei Patente angemeldet und profitabel verkauft hatte, kam endlich der Sohn. Ab jetzt ist in die Lebenserinnerungen gelegentlich eine Photographie eingeklebt: mein Vater mit gefalteter papierener Mütze auf dem Kopf und Steckenpferd zwischen den Beinen, die Familie am Tisch im Gartenhäuschen, mein Vater in Anzug und mit Krawatte am ersten Tag auf dem Gymnasium, die Familie mit Fahrrädern, jeder mit einem Fuß auf dem Boden und einem auf dem Pedal, als gehe es sofort los. Einige Photographien lagen lose in den Lebenserinnerungen. Mein Großvater als Schüler, als junger Ehemann, als Ruheständler und wenige Jahre vor seinem Tod. Immer schaut er ernst, traurig, verloren vor sich hin, als nehme er niemanden wahr. Auf dem letzten Bild ragt sein altersdünner Hals mit dem zerfurchten Gesicht aus dem weiten Hemdkragen wie der Kopf einer Schildkröte aus dem Panzer; der Blick ist furchtsam geworden und die Seele bereit, sich hinter Menschenscheu und Eigensinn zurückzuziehen. Er hat mir einmal erzählt, daß er lebenslang an [18] Kopfschmerz litt, von der linken Schläfe über das linke Ohr zum Hinterkopf, »wie die Feder am Hut«. Über Depressionen hätte er zu mir nicht gesprochen, und er wußte wohl gar nicht, daß Traurigkeit, Verlorenheit und Furchtsamkeit einen Befund darstellen können, der einen Namen hat – wer wußte das damals schon. So weit, daß er nicht aufstehen, nichts machen, nicht arbeiten konnte, ging es nur selten.
Mit fünfundfünfzig setzte er sich zur Ruhe. Die Arbeit in den Spinnereien war Brotberuf gewesen, seine Leidenschaft hatte der Geschichte, der Gesellschaft, der Politik gehört. Er kaufte mit Freunden eine Zeitung und wurde deren Herausgeber. Aber mit ihrer Position zur Schweizer Neutralität stand die Zeitung gegen die öffentliche Meinung, und mit ihren geringen finanziellen Mitteln war sie dem Konkurrenzkampf nicht gewachsen. Er und seine Freunde hatten mit dem Unternehmen mehr Sorgen als Freude und mußten es nach einigen Jahren wieder aufgeben. Immerhin hatte die Tätigkeit als Herausgeber den Großvater in Kontakt mit Verlegern gebracht, und seine letzte, Abend um Abend zusammen mit der Großmutter besorgte Arbeit war die Redaktion einer Heftereihe »Romane zur Freude und zur guten Unterhaltung«.
[19] 5
Der Liebe zur Geschichte lebte er in den Büchern, die er las, und auf den Wegen, die er mit mir machte. Kein Spaziergang, keine Wanderung, kein Marsch, wie er gerne sagte, auf dem er mir nicht Begebenheiten aus der Schweizer und deutschen Geschichte und besonders der Militärgeschichte erzählte. Er hatte einen schier unerschöpflichen Schatz von Schlachtplänen im Kopf, die er mit dem Spazierstock auf den Boden zeichnete: Morgarten, Sempach, Sankt Jakob an der Birs, Grandson, Murten, Nancy, Marignano, Roßbach, Leuthen, Zorndorf, Waterloo, Königgrätz, Sedan, Tannenberg und viele andere, die ich vergessen habe. Dazu hatte er die Gabe, lebendig und packend zu erzählen.
Ich hatte Lieblingsschlachten, deren Geschichte ich immer wieder hören wollte. Die Schlacht bei Morgarten. Herzog Leopold führt die Blüte der österreichischen Ritterschaft wie zu einer Jagdpartie; er will einen leichten Sieg erringen, die vermeintlich waffen- und wehrlosen Eidgenossen zu Paaren treiben und rasche Beute machen. Aber die Eidgenossen sind kampferprobt und -bereit. Sie wissen, wofür sie kämpfen: für die Freiheit, für Haus, Herd, Weib und Kind. Sie wissen auch, wo Leopold vorrücken wird. Der Ritter von Hünenberg, guter Nachbar und Freund der Eid[20] genossen, hat einen Pfeil in ihr Lager geschossen und daran ein Pergament mit einer Warnung geheftet. So erwarten sie das österreichische Heer, das zwischen dem Ägerisee und der Höhe Morgarten hindurchmuß, auf der Höhe. Als es sich auf der schmalen Straße staut und drängt, rollen sie Felsbrocken und Baumstämme hinab und werfen die einen in den See, dann brechen sie hervor und machen die anderen nieder. Die Ritter, die fliehen wollen, werden von den schweren Rüstungen ins nasse Grab gezogen.
Die Tapferkeit der Eidgenossen beeindruckte mich. Zugleich beschäftigte mich der Pfeilschuß des Ritters von Hünenberg. War das nicht Verrat? Schmälerte der Verrat nicht die Tat der Eidgenossen?
Der Großvater nickte. »Das hat dein Vater auch gefragt.«
»Und?«
»Der Ritter war frei. Er mußte nicht zu den Österreichern halten, sondern konnte sich auch auf die Seite der Schweizer oder auf keine Seite schlagen.«
»Aber er hat nicht an der Seite der Schweizer gekämpft. Er hat heimlich gehandelt.«
»Er hätte den Schweizern nicht mehr helfen können, wenn er mit ihnen gekämpft hätte. Wenn man das Richtige nur heimlich machen kann, wird es durch die Heimlichkeit nicht falsch.«
Ich wollte wissen, was aus dem Ritter von Hünenberg geworden war, aber mein Großvater wußte es nicht.
Die Schlacht von Sempach. Wieder vertrauen die Österreicher auf ihre schweren Rüstungen, wieder verkennen sie Kampfgeschick und Kampfesmut der Hirten und Bauern. Zwar gelingt es den Eidgenossen bis Mittag nicht, mit ihrem [21] Angriffskeil in die speerstarrende Front der Österreicher einzubrechen. Aber am heißesten Tag des Jahres läßt die Sonne das Eisen der Ritter glühen und schwerer und schwerer werden. Als Arnold Winkelried so viele Speere packt, wie er kann, sich in sie stürzt und sie unter sich begräbt, sind die Österreicher zu ermattet, als daß sie dem Einbruch der Eidgenossen noch viel entgegenzusetzen hätten. Wieder erleiden sie eine völlige Niederlage.
Anfänglich erstaunte mich nur, daß Arnold Winkelried bei seiner Heldentat noch den langen Satz sagen konnte: »Eidgenossen, ich will der Freiheit eine Gasse schlagen. Sorgt für mein Weib und meine Kinder!«
Aber mein Großvater ruhte nicht, bis ich begriff, daß die Österreicher verloren, weil sie aus dem Schaden von Morgarten nicht klug geworden waren. »Die Unterschätzung der Schweizer, die schweren Rüstungen, die Widrigkeiten der Natur, diesmal nicht des Wassers, sondern der Sonne – Fehler zu machen kann niemand vermeiden. Aber niemand muß den gleichen Fehler noch mal machen.«
Als ich diese Lektion begriffen hatte, kam die nächste. »Es gilt, nicht nur aus dem Schaden klug zu werden, den man erleidet, sondern auch aus dem, den man zufügt.« Er erzählte von den Engländern, die die Franzosen im Hundertjährigen Krieg mit ihren langen Bogen Schlacht um Schlacht besiegten, aber fassungslos waren, als die Franzosen schließlich auch lange Bogen bauten und erfolgreich einsetzten.
Die Schlacht bei St. Jakob an der Birs. Schon der Name der Gegner der Eidgenossen klang furchterregend: Armagnaken. Der Großvater beschrieb das Heer von 30000 Mann: Söldner aus Frankreich, Spanien und England, am Ende des [22] Hundertjährigen Kriegs kampfgestählt, aber auch zu Raub und Grausamkeit verkommen. Der französische König braucht sie nicht mehr und stellt sie gerne den Österreichern gegen die Eidgenossen zur Verfügung und den nach der Krone begehrenden Dauphin an ihre Spitze. Dagegen stehen 1500 Eidgenossen. Nicht zum Angriff, sondern nur zur Erkundung ausgeschickt, aber vom ersten siegreichen Scharmützel zum nächsten und zum übernächsten verführt, haben sie schließlich das ganze Heer der Armagnaken gegen sich. Sie ziehen sich in das Siechenhaus von St. Jakob zurück und halten es bis in den Abend und bis zum letzten Mann. Die Armagnaken siegen, erleiden aber so hohe Verluste, daß sie die Lust am Krieg verlieren und Frieden schließen.
»Was gibt es daraus zu lernen?«
[23] 6
Es gab noch ein anderes Feld, von dem mein Großvater Geschichten über Geschichten zu erzählen wußte: Fehlurteile. Auch hier hatte ich Lieblingsgeschichten, die er mir immer wieder erzählen mußte. Auch hier hatten wir Gespräche über die Moral der Geschichten. Sie waren schwierig. Denn obwohl die Ungerechtigkeit das Fehlurteil definiert, haben die berühmten Fehlurteile oft eine über die Ungerechtigkeitswirkung hinausgehende historische Bedeutung und schlägt die Ungerechtigkeits- manchmal sogar in eine Gerechtigkeitswirkung um.
Der Prozeß des Grafen von Schmettau gegen den Müller Arnold. Der Müller verweigert dem Grafen die Pacht, weil der Landrat ihm durch die Anlage eines Karpfenteichs das Wasser abgegraben habe, worauf der Graf ihn verklagt. Der Graf gewinnt in der ersten, der zweiten und der letzten Instanz vor dem Kammergericht in Berlin. Der Müller schreibt an Friedrich den Großen, der Begünstigung, Bestechung und schändliches Lumpenwerk argwöhnt und anordnet, daß die Richter ins Gefängnis geworfen werden, der Landrat abgesetzt, der Karpfenteich zugeschüttet und das Urteil gegen den Müller aufgehoben wird. Das war Willkür und Unrecht, denn die Mühle hatte reichlich Wasser, die Pacht [24] hätte erwirtschaftet und gezahlt werden können, und der Müller war ein Spitzbub. Aber es begründete das Ansehen Friedrichs als eines gerechten Königs und Preußens als eines Staats, in dem vor dem Richter alle gleich sind, der Schwache wie der Starke, der Arme wie der Reiche.
Bei der Geschichte vom Prozeß gegen die Jungfrau von Orleans verkehrt sich die Ungerechtigkeits- zwar nicht in eine Gerechtigkeitswirkung, hat aber doch einen Ertrag, der anders schwerlich zu haben gewesen wäre. Sechzehnjährig kommt Johanna, das schöne Bauernmädchen, an den Hof Karls, der zu schwach ist, die Engländer zu besiegen und sich in Reims zum französischen König krönen zu lassen. Frankreich ist drauf und dran, unter die Herrschaft der Engländer zu fallen. Das Wunder will, daß Johanna das französische Heer in die Schlacht und zum Sieg führt, daß sie Orleans erobert, Karls Krönung zum französischen König ermöglicht und auf Paris marschiert. Da wird sie gefangengenommen und an die Engländer verkauft. Der König, der sie vielleicht befreien könnte, tut nichts. Die Standhafte wird gefoltert und vergewaltigt, von Bischof Pierre Cauchon wegen Zauberei und Hexerei zum Tode verurteilt und verbrannt. Aber Prozeß und Urteil machen sie zur Märtyrerin Frankreichs, zur Symbolgestalt seiner Befreiung, und zwanzig Jahre später sind die Engländer vertrieben. Wie es ohne den Müller Arnold keinen preußischen Rechtsstaat gegeben hätte, so ohne Johanna keine Befreiung Frankreichs.
Eine Geschichte war dagegen nur gräßlich. Sie war allerdings auch nicht berühmt. 1846 liebt Mennon Elkner, die schöne Tochter eines protestantischen Schneiders in Nancy, Eugen Duirwiel, den Sohn des katholischen Scharfrichters, [25] und wird wiedergeliebt. Der Scharfrichter, dem die Liebe der beiden von einer Nachbarin des Schneiders überbracht wird, will eine Heirat nicht zulassen und preßt Mennon eine Erklärung ab, daß sie sich von Eugen lossagt. Sie ist doppelt verzweifelt; sie hat den Geliebten verloren und ist schwanger. Die beiden toten Knaben, die sie zur Welt bringt, vergräbt sie im Garten. Aber wieder hat die Nachbarin spioniert; Mennon wird verhaftet, des doppelten Kindesmords angeklagt und zum Tod durchs Schwert verurteilt. Man ahnt schon, was kommt. Aber es kommt noch viel schlimmer. Eugen hat vom Vater das Amt des Scharfrichters übernommen und betritt den Richtplatz zu seiner ersten Hinrichtung, von der er nur weiß, daß er sie an einer doppelten Kindsmörderin vollziehen muß. Als er Mennon erkennt, erblaßt er, ihm schwindelt, wanken die Knie und zittern die Hände. Vom Vater, der bei ihm steht, ermahnt und von den Amtspersonen gedrängt, schlägt er zweimal zu, verwundet Mennon an Kinn und Schulter, wirft dann das Schwert weg und will und kann nicht mehr. Aber die Stunde der Hinrichtung muß eingehalten, die Scharfrichterfamilienehre gerettet werden – der Vater ist außer sich und stürzt sich mit dem Messer auf Mennon, um das Werk des Sohns zu vollenden. Mit jedem Stich wird die Menge der Zuschauer unwilliger. Dann stürmt sie den Richtplatz.
Die Großmutter, die mir, wenn ich sie bat, Gedichte über die Schlachten von Lützen und Hochstädt, über den Müller Arnold und Johanna von Orleans aufsagte, kannte auch ein dichter- und kunstloses Gedicht über das Schicksal der schönen Mennon auswendig. Wenn der Großvater mit der Geschichte bis zum Aufruhr der Menge gekommen war, [26] brach er ab. »Frag die Großmutter. Sie erzählt das Ende viel besser.«
Das ganze Gedicht kann ich nicht mehr. Die letzten beiden Strophen gehen etwa so:
Die Henker steinigt man von allen Seiten, sie finden unter Qualen ihren Tod. Kann man Mennon zur Rettung nun geleiten? Sie lebet noch, sie flehet noch zu Gott! Man trägt sie hoffnungsvoll zum Lazarette, allein, dort stirbt sie bald in ihrem Bette.
Fünf Opfer zählt die gräßliche Geschichte. Obwohl aus wahrer Liebe sie entsprang, fand sie ihr Ende auf dem Blutgerichte. Wem macht das nicht in tiefster Seele bang? Mögen die Opfer dort, im besser’n Leben,
[27] 7
Nur über die Poesie trat die Großmutter gelegentlich mit den Kriegen, Schlachten, Heldentaten, Prozessen und Urteilen in Berührung, die den Großvater beschäftigten. Sie hielt Krieg für ein dummes, dummes Spiel, das zu lassen Männer noch nicht reif waren und vielleicht nie reif sein würden. Sie sah dem Großvater seine kriegerische Leidenschaft nach, weil er sich mit ihr gegen den Alkohol, den sie für eine fast so schlimme Geißel wie den Krieg hielt, und für das Frauenstimmrecht verbündet hatte und ihre andere, friedliche, weibliche Sicht- und Denkweise immer respektierte.
Vielleicht war es überhaupt der Respekt, der diese Ehe gestiftet hatte und zusammenhielt. Eines Sommers, als der Großvater in Italien arbeitete, besuchte ihn seine Mutter. Sie kam, ihn daran zu erinnern, daß es an der Zeit sei, eine Familie zu gründen, und erzählte ihm von den Töchtern, bei denen er annehmen durfte, daß er nicht abgewiesen würde, falls er sich um sie bewerben sollte. Dabei erzählte sie ihm auch von seiner Base, die sie bei einem Begräbnis getroffen und die ihr gut gefallen hatte. Im Sommer darauf besuchte der Großvater seine Eltern, half bei der Heuernte und machte einsame Wanderungen zu den Burgen der Heimat, zu denen ihn sein geschichtliches Interesse zog, bis seine Mutter [28] ihn aufforderte, einmal seine Tante zu besuchen. Dort traf er die Base, die er seit der Kindheit nicht mehr gesehen hatte. Eine Photographie aus diesen Jahren zeigt eine junge Frau mit üppigem dunklem Haar, wachem, stolzen Blick, einem Mund, dessen volle Lippen Sinnlichkeit versprechen und um den es zugleich zuckt, als wolle die schöne Frau jeden Moment fröhlich loslachen. Man fragt sich, wo die jungen Männer der Heimat ihre Augen hatten und wieso die Base auf ihren Vetter mit dem schon damals schütteren Haar wartete. Der beschreibt in seinen Lebenserinnerungen eine kurze Unterhaltung am Fenster, bei der er »überrascht war über ihre klugen Gedanken, die sie in ruhiger und fester Art bei gleichwohl bescheidenem Wesen ihrem zu Überheblichkeit neigenden Vetter gegenüber äußerte«. Danach wurden ein paar Briefe gewechselt, »was wir uns geschrieben haben, ist mir nicht mehr in Erinnerung«, der schriftliche Heiratsantrag wurde schriftlich angenommen, nach einem Jahr wurde Verlobung und nach noch mal einem Hochzeit gefeiert.
Ich weiß nicht, ob die Ehe glücklich war. Ich weiß aber auch nicht, ob die Frage nach dem Glück ihrer Ehe sinnvoll ist und ob die Großeltern sie sich selbst gestellt haben. Sie haben das Leben zusammen gelebt, in guten und in schlechten Tagen, haben einander geachtet und sich aufeinander verlassen. Ich habe nie erlebt, daß sie ernstlich gestritten hätten, aber oft, daß sie sich geneckt, gescherzt und gelacht haben. Sie hatten Freude aneinander und auch daran, sich miteinander zu zeigen, sie mit dem stattlichen Mann, der mein Großvater im Alter wurde, er mit der schönen Frau, die sie bis ins Alter blieb. Aber immer lag ein Schatten über den [29] beiden. Alles war gedämpft: ihre Freude aneinander, ihr Scherzen und Lachen, ihre Gespräche über die Dinge der Welt. Der frühe Tod meines Vaters hatte einen Schatten auf ihr Leben geworfen, der nie wich.
Auch das begriff ich erst, als ich Großvaters Lebenserinnerungen las. Manchmal haben die Großeltern meinen Vater erwähnt, so angelegentlich, so selbstverständlich, daß ich nicht das Gefühl hatte, sie wollten sich der Auskunft über ihn verweigern. Ich erfuhr, welche von Großvaters Geschichten Vaters Lieblingsgeschichten gewesen waren, daß er Briefmarken gesammelt, im Chor gesungen, Handball gespielt, gezeichnet und gemalt und viel gelesen hatte, daß er kurzsichtig, ein guter Schüler und ein tüchtiger Jura-Student gewesen war und keinen Militärdienst geleistet hatte. Im Wohnzimmer hing ein Bild von ihm. Es zeigte einen schlanken jungen Mann im Fischgrätenknickerbockeranzug vor einer Mauer stehend, den rechten Arm auf ein Sims gestützt und die Waden übereinandergelegt. Die Haltung war entspannt, aber der Blick durch die Brille ungeduldig, als warte der junge Mann, was als nächstes passiert, um sich, wenn es nichts taugt, rasch anderem zuzuwenden. Ich fand Intelligenz, Entschlossenheit und ein bißchen Arroganz in seinem Gesicht, aber vielleicht nur, weil ich diese Eigenschaften selbst gerne haben wollte. Die Stellung unserer Augen war ähnlich, schräg, das eine Auge mehr als das andere. Sonst bemerkte ich keine Ähnlichkeit.
Das genügte mir. Meine Mutter sprach gar nicht von meinem Vater und hatte auch kein Bild von ihm aufgehängt oder -gestellt. Ich hatte von den Großeltern gehört, daß er mit dem Schweizerischen Roten Kreuz im Krieg gewesen [30] und umgekommen sei. Im Krieg geblieben, gefallen, vermißt – ich habe diese Formeln der Endgültigkeit als Kind so oft gehört, daß sie mir lange wie Grabsteine vorkamen, an denen man nicht rüttelt. Die Porträtaufnahmen von Männern in Uniform, manchmal mit schwarzem Flor am Silberrahmen, die ich bei Schulkameraden sah, berührten mich so unangenehm wie die kleinen Bildchen der Toten, die in manchen Ländern auf Grabsteinen zu finden sind. Als lasse man den Toten ihre Ruhe nicht, zwinge sie ans Licht, verlange von ihnen noch im Tod Haltung. Wenn das die Art war, wie Witwen ihrer toten Männer sichtbar gedachten, dann war mir lieber, daß meine Mutter auf das sichtbare Gedenken verzichtete.
[31] 8
Wenn der Abendbrottisch abgeräumt, das Geschirr gespült und die Blumen im Garten gegossen waren, machten sich die Großeltern an die Arbeit und redigierten die »Romane zur Freude und zur guten Unterhaltung«. Sie setzten sich an den Eßtisch, zogen die Deckenlampe herunter und lasen und korrigierten die Manuskripte, die langen Druckfahnen und die auf das Format der Hefte umbrochenen gehefteten Druckvorlagen. Manchmal schrieben sie auch; sie bestanden darauf, daß jedes Heft am Ende einen kurzen, belehrenden und bildenden Aufsatz enthielt, und wenn keiner vorlag, schrieben sie selbst einen: über die Bedeutung des Zähneputzens, den Kampf gegen das Schnarchen, das Züchten von Bienen, die Entwicklung des Postwesens, die Regulierung der Linth durch Konrad Escher, die letzten Tage Ulrich von Huttens. Sie schrieben auch die Romane um, wenn sie eine Passage unbeholfen, unglaubwürdig oder unanständig fanden oder ihnen eine bessere Pointe einfiel. Der Verleger ließ ihnen freie Hand.
Als ich nicht mehr nach dem Gesang der Amsel ins Bett mußte, durfte ich mit am Tisch sitzen. Im Licht der tiefen Lampe der helle Tisch, darum herum das dunkle Zimmer – ich liebte die Atmosphäre und fühlte mich in ihr geborgen. [32] Ich las oder lernte ein Gedicht oder schrieb einen Brief an die Mutter oder einen Eintrag ins Ferientagebuch. Wenn ich die Großeltern unterbrach und etwas fragte, bekam ich immer eine freundliche Antwort. Gleichwohl scheute ich mich zu fragen; die Konzentration der Großeltern war spürbar, die Bemerkungen, die sie austauschten, waren knapp, und ich kam mir mit meinen Fragen geschwätzig vor. So las, lernte und schrieb ich still. Manchmal hob ich vorsichtig, um sie’s nicht merken zu lassen, den Kopf und sah sie an: den Großvater, dessen dunkle Augen aufmerksam auf die Arbeit vor ihm, aber auch verloren in die Ferne schauen konnten, und die Großmutter, die alles mit Leichtigkeit tat, mit einem Lächeln las und mit leichter, schneller Hand schrieb und korrigierte. Dabei wird die Arbeit sie schwerer angekommen sein als ihn; während er nur Bücher über Geschichte mochte und zu den Romanen, die sie betreuten, ein sachliches, nüchternes Verhältnis hatte, liebte sie Literatur, Romane wie Gedichte, hatte ein sicheres Gespür für literarische Qualität und muß unter der Beschäftigung mit den banalen Texten gelitten haben.
Ich durfte sie nicht lesen. Das eine und andere Mal wurde ich, wenn sie über einen Roman redeten, neugierig. Ich bekam zu hören, ich müsse den Roman nicht lesen; über seinen Gegenstand gebe es einen besseren Roman, eine bessere Novelle von Conrad Ferdinand Meyer oder Gottfried Keller oder welchem Klassiker auch immer. Die Großmutter stand auf und brachte mir das bessere Buch.
Als sie mir die überzähligen Exemplare der gehefteten Druckvorlagen als Sudelpapier mit nach Hause gaben, schärften sie mir entsprechend nachdrücklich ein, sie nicht [33]
[34] 9
In den ersten Sommern fanden die Großeltern das Leben, das ich mit ihnen lebte, zu einsam für mich und versuchten, mich mit Kindern gleichen Alters in Kontakt zu bringen. Sie kannten die Nachbarn, redeten mit der einen und anderen Familie und erreichten, daß ich zu Geburtstagsfesten, Ausflügen und Besuchen im Schwimmbad eingeladen wurde. Ich merkte, daß sie die Einladungen mit Liebe und Geduld erreicht hatten, und traute mich nicht, sie abzulehnen. Aber ich war jedesmal froh, wenn das Ereignis vorbei und ich wieder bei den Großeltern war.
Oft verstand ich die Mundart nicht, in der die Kinder sprachen. Ich verstand ihre Anspielungen nicht. Ihr Schulsystem, ihre Schul- und Freizeitaktivitäten, ihre soziale Organisation waren völlig anders als meine. Während sie um vier oder fünf Uhr aus der Schule und von schulisch veranstaltetem Sport oder Chorsingen oder Theaterspielen nach Hause kamen, war ich mir nach der Schule mit meinen Spielgefährten Nachmittag um Nachmittag selbst überlassen. Die Banden, die wir bildeten, und die Kriege, die wir führten, waren harmlos. Aber auf die gesitteten Gesellschaftsspiele der Schweizer Kinder hatten sie mich nicht vorbereitet.
[35] Sogar im Schwimmbad ging es anders zu, als ich es kannte. Im Wasser wurde nicht gekämpft, niemand wurde ins Wasser gestoßen, niemand unter Wasser getaucht. Es wurde Wasserball gespielt, schnell und fair, von Mädchen und Jungen gemeinsam und gleichberechtigt. Das Schwimmbad war eine vom Ufer in den See gebaute Holzkonstruktion; auf einem Lattenrost, zwanzig auf zwanzig Meter groß, unter der Wasseroberfläche von ein Meter auf eins siebzig abfallend, auf Pfähle gestellt, an drei Seiten von höher gestellten Umkleidekabinen und Laufstegen umgeben, konnten sich die Nichtschwimmer tummeln; an der sich zum See öffnenden vierten Seite mußte man nur unter einem Seil durchtauchen, um hinauszuschwimmen. Einmal konnte ich den Schweizer Kindern damit imponieren, daß ich aus lauter sozialer Verzweiflung auf das Dach der äußersten Umkleidekabine kletterte und von dort in den See sprang.
Vielleicht wären aus den Kontakten doch noch Kameradschaften und Freundschaften geworden, wenn wir uns öfter gesehen hätten. Aber bald nach meiner Ankunft bei den Großeltern brachen die Schweizer Kinder in die Ferien auf, oder sie waren schon weg und kehrten erst kurz vor meiner Abreise wieder zurück. Einen Jungen und mich verband das Interesse an der Eroberung der beiden Pole. War Cook ein Schwindler und Peary ein Dilettant, Scott groß oder töricht oder beides und Amundsen nur von Ehrgeiz besessen oder von einer Mission erfüllt? Auch der Vater des Jungen schien mich zu mögen. »Du hast die Augen deines Vaters«, sagte er, als wir uns das erste Mal sahen. Er sagte es mit einem freundlichen, traurigen Lächeln, das mich mehr verwirrte als die Bemerkung selbst. Aber trotz der guten Vorsätze, die [36] der Junge und ich faßten, kam unser Briefwechsel nicht zustande.
Also blieb es bei Ferien ohne gleichaltrige Spielgefährten. Es blieb bei den immer gleichen Spaziergängen an den See, Wanderungen durch eine Schlucht, um einen Weiher und über die Höhe mit Blick auf See und Alpen. Es blieb bei den immer gleichen Ausflügen auf die Burg in Rapperswil, zur Insel Ufenau, ins Großmünster, in Museen und in die Kunsthalle. Das Gleichmaß der Wanderungen und Ausflüge gehörte ebenso zu den Ferien wie das der Gartenarbeit. Äpfel, Beeren, Salat und Gemüse ernten, Beete hacken, Unkraut jäten, verwelkte Blumen abschneiden, die Hecke stutzen, Gras mähen, den Kompost schichten, die Kannen füllen und gießen – wie diese Arbeiten sich natürlich wiederholten, kam mir auch die Wiederholung der anderen Aktivitäten natürlich vor. Auch die immer gleichen Abende am Tisch unter der Lampe gehörten zu dem natürlichen Rhythmus der Ferien.
[37] 10
Ein Sommer war anders als die anderen. Einen Sommer lang hatte ich eine Spielgefährtin. Ein Mädchen aus einem kleinen Dorf im Tessin verbrachte die Ferien bei seiner Großtante im Nachbarhaus. Das ging nicht gut. Die Großtante, kränkelnd und schlecht zu Fuß, hatte sich vorgestellt, ihre Großnichte würde ihr vorlesen, mit ihr Patience legen und sticken wollen. Die Großnichte hatte sich auf die nahe große Stadt gefreut. Außerdem konnte die Großtante kaum Italienisch und die Großnichte kaum Deutsch.
Dabei hatte Lucia die Gabe, den Sprachunterschied einfach zu vernachlässigen. Als sie mich durch den Zaun auf italienisch ansprach und ich auf deutsch antwortete, ich verstünde sie nicht, redete sie weiter, als hätte ich das von ihr eröffnete Gespräch sinnvoll aufgegriffen. Dann schwieg sie und wartete, bis ich etwas über die Schule sagte, auf der ich Latein lernte, und redete weiter. Sie strahlte mich so hoffnungsvoll und ermunternd an, daß auch ich weiterredete; ich erzählte, was mir einfiel, und versuchte schließlich, aus den lateinischen Vokabeln, die ich in zwei Jahren gelernt hatte, italienische Wörter zu formen. Sie lachte, und ich lachte mit.
Dann kam der Großvater, redete auf italienisch zu ihr, [38] und aus ihr sprudelte es zurück, Sätze, Lacher, Jauchzer, das schiere Glück. Ihre Wangen glühten, ihre dunklen Augen leuchteten, und wenn sie lachend den Kopf schüttelte, schwang ihr braunes, lockiges Haar. Mich überfiel ein Gefühl, bei dem ich noch nicht wußte, was es ist und wie es heißt, aber merkte, welche Wucht es hat. Der schöne gemeinsame Augenblick war entwertet. Lucia hatte ihn verraten, ich hatte mich blamiert. Ich habe die Peinigung der Eifersucht später stärker erlebt. Aber ich war ihr nie so hilflos ausgesetzt wie bei diesem ersten Mal.
Sie ging vorbei. Bei den Unternehmungen dieses Sommers, auf die der Großvater und ich Lucia mitnahmen, ließ sie mich immer wissen, daß sie und ich zusammengehörten, sosehr sie und Großvater auch auf italienisch miteinander flirteten. »Sie hat euch beide verzaubert«, lächelte die Großmutter, wenn Großvater und ich uns für eine Unternehmung mit Lucia schönmachten. Auf die Schiffsfahrt auf die Ufenau kam die Großmutter, wie jedes Jahr, mit; sie liebte Conrad Ferdinand Meyer, kannte die vielen hundert zweizeiligen Strophen seines Gedichts »Huttens letzte Tage« auswendig und feierte auf der Insel ihre Vertrautheit mit dem Dichter und mit dem Gedicht und der Dichtung überhaupt. Auch sie ließ sich von Lucia verzaubern, von ihrer Bewunderung, ihrer Zutraulichkeit, ihrer Fröhlichkeit. Als auf der Heimfahrt Lucia und ich ihnen gegenübersaßen, nahm der Großvater die Hand der Großmutter – die einzige Zärtlichkeit, die ich je zwischen ihnen sah. Heute frage ich mich, ob sie sich vergebens eine Tochter gewünscht oder vielleicht sogar eine Tochter verloren hatten. Damals war ich einfach glücklich; der Tag auf der Insel war schön gewesen, [39] der Abend auf dem See war schön, die Großeltern hatten sich und uns lieb, und Lucia hatte meine Hand genommen.
Habe ich sie geliebt? Ich hatte von der Liebe ebensowenig einen Begriff wie von der Eifersucht. Ich freute mich auf Lucia, hatte Sehnsucht nach ihr, war enttäuscht, wenn wir uns sehen wollten, aber nicht konnten, war glücklich, wenn sie glücklich war, und unglücklich, wenn sie unglücklich und mehr noch, wenn sie ärgerlich war. Ihr Ärger konnte von einem Moment auf den anderen aufflammen. Wenn ihr etwas nicht gelang, wenn ich sie nicht verstand oder sie mich nicht, wenn ich zu ihr nicht so aufmerksam war, wie sie es erwartete. Oft fand ich ihren Ärger nicht gerecht, aber über Gerechtigkeit zu streiten, war sprachlich aussichtslos, obwohl ich aus iustitia richtig giustizia gemacht hatte. Ich glaube, Lucia war an Diskussionen über Gerechtigkeit ohnehin nicht interessiert. Ich lernte, ihre Fröhlichkeit und ihren Ärger wie das Wetter zu nehmen, mit dem man auch nicht rechten, sondern das man nur beglückt oder betrübt hinnehmen kann.
Wir hatten nur wenig Zeit für uns allein. Lucia mußte mit ihrer Großtante Patience legen und sticken, sie mußte ihr den Kopf und die Füße massieren, und sie mußte ihr zuhören. »Wenn sie mich schon nicht verstehen kann, soll sie mir wenigstens zuhören«, sagte die Großtante zu meiner vergebens um Verständnis für Lucia werbenden Großmutter. Lucia wollte möglichst viel von dem mitmachen, was Großvater und ich machten, von Spaziergängen, Wanderungen und Ausflügen bis zur Arbeit im Garten. Sogar beim Pferdeäpfeleinsammeln war sie einmal dabei. Manchmal saßen wir im Baumhaus, das wir mit Großvaters Hilfe im [40] Apfelbaum gebaut hatten. Aber wie stets war das Bauen schöner gewesen als das Spielen im fertigen Haus, und außerdem litten wir unter unserem Sprachproblem weniger, wenn wir in Aktion waren. Wir haben auch am Ende der Ferien keine Adressen ausgetauscht. Was sollten wir mit ihnen?
Auch von der Schönheit hatte ich keinen Begriff. Lucias Lebendigkeit, ihre Aufmerksamkeit, ihre Zugewandtheit, ihre tanzenden Locken, ihre Augen, ihr Blick, ihr Mund, ihr perlendes, sprudelndes, glucksendes Lachen, ihr Witz, ihr Ernst, ihre Tränen – es war alles eins, und ich konnte es nicht in Wesensart, Verhaltensweisen und Aussehen auseinanderlegen.
Nur Lucias Grübchen hatte für mich eine eigene, besondere Faszination. Daß die Stirn über dem inneren Ende der linken Braue immer so glatt sein und auf einmal ein Grübchen zeigen konnte. Es war ein Grübchen der Ratlosigkeit, der Verlegenheit, der Enttäuschung und der Traurigkeit. Es rührte mich, weil es zu mir sprach, wenn Lucia nicht mit mir sprechen wollte oder konnte. Auch wenn sie ärgerlich war, tauchte es auf und freute mich, so unglücklich mich ihr Ärger machte und so bedacht ich war, ihn nicht durch ein Zeichen der Freude zu steigern.
Als ich mich ein paar Jahre später in eine Klassenkameradin verliebte, hatte ich einen Begriff von Schönheit, Liebe und Eifersucht, und hinter dem, was ich erlebte, trat die begrifflose Erfahrung mit Lucia ganz zurück. Ich hatte das Gefühl, ich verliebte mich das erste Mal. Ich vergaß sogar Lucias Abschiedsgeschenk.