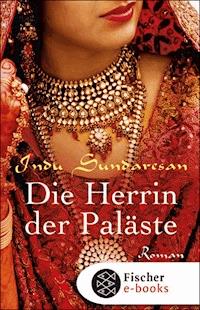
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Glanz des Pfauenthrons: Die große Indiensaga über die Tochter des Kaisers, der das Taj Mahal baute. Prinzessin Jahanara lebt inmitten der Pracht des indischen Hofes. Aber als ihre Mutter stirbt, kann ihr Vater, Mogulkaiser Shah Jahan, diesen Verlust kaum ertragen. Er bürdet Jahanara alle Pflichten auf, die der Hof und das Mogulreich verlangen. Während er das grandiose Grabmal, das Taj Mahal, bauen lässt, muss Jahanara lernen, die Fäden der Macht in der Hand zu behalten. Und ihr eigenes Glück? Der Kaiser will, dass sie nur ihm dient. Darf sie überhaupt hoffen, die Liebe zu finden?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 543
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Indu Sundaresan
Die Herrin der Paläste
Roman
Aus dem Amerikanischen von Marion Balkenhol
Fischer e-books
Für meine Mutter Madhuran
und
meine Tochter Sitara
Eins
Nach Mitternacht … wurde dem Baum im Obstgarten des Glücks eine Tochter geboren; woraufhin die Fiebertemperatur (mizaj-i-wahhaj) die Grenzen alles Maßvollen überschritt … Dieses unerwartete Ereignis und die herzzerreißende Katastrophe stürzte die Welt in Verwirrung.
– aus »padshah nama«, der Chronik des Abdul Hamid Lahori in W. E. Begley und Z. A. Desai, Taj Mahal: The Illumined Tomb
Burhanpur
Mittwoch, 17. Juni 1631
17 Zi’l-Qa’da A. H. 1040
Die abgerissenen, erschöpften Schreie der Kaiserin durchdrangen die Nachtluft und zerstoben wie kleine Kiesel. Ein Uhr nachts. Die bevorstehende Morgendämmerung, noch Stunden entfernt, tauchte den Horizont in gespenstisches Grau. Öllampen, diyas, und Kerzen flackerten in einem plötzlichen Luftzug und verbreiteten Licht aus den Gemächern, die auf den Fluss Tapti hinausgingen.
Mumtaz Mahal schrie erneut, diesmal ohne einen Laut von sich zu geben, nur die Lippen entblößten ebenmäßige weiße Zähne, die Augen waren geschlossen.
»Mama«, sagte Jahanara verzweifelt und nahm die Hand ihrer Mutter zwischen ihre jungen, starken Hände. »Soll ich dir noch etwas Opium geben?«
Mumtaz schüttelte den Kopf und lehnte sich in die Kissen zurück, kalte Schauer quälten ihren Körper, nachdem sie einen langen Tag und eine Nacht gelitten hatte. Jetzt, da die Wehe vorbei war, entspannten sich ihre Gesichtszüge. Die perfekte Form der Nase, die makellose Rundung des Kinns, die glänzende Haut, die großen Augen in allen Grauschattierungen brachten ihre unermessliche Schönheit wieder zur Geltung. Trotz ihrer achtunddreißig Jahre hatte sie eine jugendliche Frische bewahrt.
Mogulkaiserin Mumtaz Mahal, die Erwählte des Palasts – ein Titel, den Mogulkaiser Shah Jahan ihr ein paar Jahre nach ihrer Vermählung verliehen hatte – überließ ihre Hand dem tröstenden Griff ihrer älteren Tochter. Gleich würden die Schmerzen wieder einsetzen. Während sie unter Mühen ihr vierzehntes Kind in neunzehn Ehejahren zur Welt brachte, empfand sie Dankbarkeit, denn sie war mit einem Mann verheiratet, den sie mehr liebte als alle anderen – mit Khurram. Er nannte sich seit vielen Jahren Shah Jahan, aber für sie war er noch immer Khurram – den Namen hatte sein Großvater, Mogulkaiser Akbar, ihm bei seiner Geburt gegeben.
In ihren Ohren dröhnte es. Opium. Kurz überlegte sie, in die filigrane Silberschüssel zu greifen und ein süßes Bällchen zu nehmen, vermischt mit Datteln, Tamarindensaft, gemahlenen Cashewkernen und Mandeln, verziert mit Rosinen. Fünf davon hatte sie bereits gegessen, seitdem ihr Fruchtwasser abgegangen war … wie lange war das her? Doch das Opium, das zuvor immer gewirkt hatte, verstärkte diesmal nur den Schmerz, und sie zögerte, noch mehr zu nehmen. Die Hebammen mit ihrem ständigen Geschnatter und den guten Ratschlägen sagten, es werde dem Kind, das in ihr bereits Gestalt angenommen habe, nicht schaden. Mumtaz glaubte ihnen nicht. Wieder begann ihr Leib zu pochen, und sie stöhnte, voller Sorge, dass Khurram es hören könnte. Bestimmt war er in der Nähe, obwohl er das Entbindungszimmer nicht betreten durfte. Über ein paar Vorschriften konnte sich selbst der Herrscher des Mogulreichs nicht hinwegsetzen.
Eine Schar Hebammen flatterte durch den Raum, hielt aber gebührenden Abstand von dem Bett, in dem die Kaiserin lag. Mumtaz konnte ihre Berührung noch nicht ertragen.
Jahanaras Finger spannten sich an, und ihre Mutter keuchte: »Lass mich los, beta.«
Das Mädchen gehorchte ängstlich und bedeckte stattdessen ihr Gesicht mit beiden Händen. Als Mumtaz sich aufraffen konnte, streckte sie blind eine Hand aus.
Zu ihrer Linken sagte eine Stimme: »Ich bin auch hier, Mama. Ich werde dich trösten. Wenn du nicht willst, dass deine Hände zu fest gehalten werden, dann umfasse ich sie nur leicht.«
Die Mogulkaiserin seufzte. Sie wandte sich ihrer zweiten Tochter zu, Roshanara, dann wieder Jahanara. Wie ähnlich die beiden sich doch waren, obwohl ihnen dieser Vergleich missfallen würde. Dabei musste sie im Stillen schmunzeln. Jahan war siebzehn, gertenschlank und von aufrechter Gestalt. Sie hatte ein schmales Gesicht mit scharfen Konturen, voller Flächen und Kanten, ihre dichten Augenbrauen waren gezupft und wölbten sich über den Augen, die Haare waren bei der Hitze nach hinten gekämmt und fielen in einem Zopf über ihren Rücken. Roshan war eine weichere Ausgabe ihrer älteren Schwester, ihre Haut leuchtete heller, grün gesprenkelt die Augen, das Gesicht rund. Trotz dieser äußerlichen körperlichen Reife war sie erst vierzehn. Zwischen ihr und Jahan lagen nur drei Jahre – aber ein ganzes Leben, was die Auffassungsgabe betraf. Sie sollte eigentlich nicht hier sein, doch sie hatte darauf bestanden, und Mumtaz hatte nachgegeben, unfähig, sich zu streiten, nachdem die Wehen eingesetzt hatten. Immerhin würden die Mädchen eines Tages selbst Kinder bekommen, sollten sie ruhig sehen, lernen und erfahren, was eine Frau in ihrem Leben zu tun hatte. Zwischen den beiden herrschte bereits eine leichte Rivalität. Aber, dachte Mumtaz, sie war hier, um sie unter Kontrolle zu halten, denn sie brauchten die Hand einer Mutter. Khurram bot da keine große Hilfe, er liebte das eine Kind zu sehr und war dem anderen gegenüber gleichgültig.
Als ihr Leib sich unter der nächsten Wehe verkrampfte, fragte sich Mumtaz, warum ihre Gedanken so klar waren. Sie konnte sich nicht daran erinnern, bei den dreizehn vorangegangenen Geburten überhaupt gedacht zu haben. Diese Erfahrungen waren einfach gewesen, problemlos, stechender Schmerz im Kreuz, ein kurzer Zug Opium, schon kam das Kind, erfüllte den Raum mit seinem Geschrei, und jeder nachfolgende Schrei zauberte ein Lächeln auf die Gesichter. Draußen hörte man Khurram lachen, wenn er die gute Nachricht erhielt, das Ohr an die Holztür gepresst. Sie dachte an jene Jahre, als Khurram und sie mit den Kindern ins Exil geschickt wurden und durch das Reich irren mussten, verfolgt von den Truppen seines Vaters, des Mogulkaisers Jahangir. Ein paarmal war sie in einem Zelt am Straßenrand niedergekommen. Selbst jetzt, in relativ friedlichen Zeiten, in denen das gesamte Reich in ihren Händen lag, hörte Mumtaz noch die donnernden Hufe der sie verfolgenden Pferde in der Ferne und spürte die überwältigende Angst um ihr Leben, falls man ihrer habhaft würde.
Nicht alle Kinder hatten überlebt. Vor Jahanara hatte sie ein Mädchen zur Welt gebracht, das mit drei Jahren gestorben war, und Mumtaz hatte Mühe, sich an den Namen zu erinnern … und an das Gesicht. Damals hatten sie noch in der Gunst des Mogulkaisers Jahangir gestanden, daher hatte er seinem Sohn und seiner Schwiegertochter sein Beileid zum Tod dieses Kindes geschickt. Ein paar andere waren Totgeburten, eine Gnade, denn so hatte sie keine Zeit, eine Bindung zu ihnen aufzubauen. Manche waren in den ersten Tagen gestorben, andere, wie das älteste Mädchen, hatten die Pocken oder ein rätselhaftes, hartnäckiges Fieber nicht überlebt, gerade als sie anfingen zu krabbeln, zu laufen, zu brabbeln oder zu sprechen. Doch sie hatte noch immer sechs Kinder. Jahan und Roshan – die beiden einzigen Mädchen – waren jetzt bei ihr, und vier prächtige Jungen, die mit ihrem Vater im Vorraum warteten. Wenn auch dieses Kind überlebte … Sanft berührte sie ihren Bauch, und zum ersten Mal kam ihr der Gedanke – wenn dieses Kind überleben und sie selbst nicht sterben würde, dann wären es sieben. Noch immer hatte sie ein paar Jahre vor sich, in denen sie gebären konnte, und obwohl Khurram und sie schon so viele Jahre verheiratet waren, trotz der Bürde des Reichs, trotz der Frauen in seinem Harem, kam er bestimmt weiterhin zu ihr ins Bett. Daher würde es weitere Kinder geben. Am Ende lag das, wie alles andere auch, in Allahs Händen.
»Jahan, du bist jetzt so alt, dass du bald heiraten kannst«, sagte sie matt, als die Wehe vorüber war.
»Ach ja?« Und dann leise: »Ja.« Aus diesem Wort sprach so viel Sehnsucht, dass Mumtaz ihre Tochter genauer betrachtete. So war es ihr in dem Alter auch ergangen, lange bevor sie ins heiratsfähige Alter kam, und sie hatte nicht Jahans Geduld besessen. »Wir werden darüber sprechen, wenn es dir bessergeht, Mama.«
»Dein Bapa und ich haben uns unterhalten«, sagte Mumtaz, und die Worte kamen ihr schnell über die Lippen, denn sie war fest entschlossen, diesen kostbaren Moment der Ruhe zu nutzen. Plötzlich war ihr mit aller Klarheit bewusst geworden, was ihr zustoßen würde. Und nun erwachte in ihr die Sorge, Khurram vorher nicht sehen zu können … sie wollte doch sein Gesicht sehen, ihn berühren, seine Stimme hören. Aber auch ihren Kindern gegenüber hatte sie Verpflichtungen. Sie winkte müde. »Komm näher.«
Sie hatte Jahan gemeint, doch auch Roshanara beugte sich dicht über sie. »Am Hofe gibt es einen amir aus guter Familie, die schon seit Generationen dem Mogulreich dient. Sie stammen aus Persien, Nachfahren des Schah, aber das Land ihrer Vorfahren ist in Badakhshan. Dein Papa und ich werden dich nicht zu einer Heirat zwingen, die du nicht willst, Jahan, aber …«
»Du weißt, dass dein Wille auch meiner ist, Mama«, sagte Jahanara. »Wozu das alles jetzt? Wir haben danach noch reichlich Zeit, spare dir deine Kräfte für das Kind.«
Die Kaiserin Mumtaz Mahal schloss erschöpft die Augen und blieb so lange reglos auf dem Bett liegen, dass die beiden Mädchen sich bestürzt ansahen. Roshanara beugte sich vor und flüsterte ihrer Mutter ins Ohr: »Wie heißt er, Mama?«
»Najabat Khan.«
Die Mädchen wussten beide nichts über Mirza Najabat Khan. Sie waren erst ein paarmal am Hofe auf dem Balkon der zenana hinter dem Thron ihres Vaters gewesen. Sie hatten den Namen der Notabeln, die dem Mogulkaiser vorgestellt wurden, keine Beachtung geschenkt und sich stattdessen vom glitzernden Gold und Silber bezaubern lassen, der absoluten Stille in einem gedrängt vollen Raum, den Reihen der Männer, die ihre Häupter unter den Turbanen ehrfürchtig vor ihrem Bapa neigten.
Mumtaz holte tief Luft, als ihr erneut stechender Schmerz ins Kreuz fuhr. »Jahan, hol deinen Vater.«
Jahanara stand auf. Die Befehle ihrer Mutter wurden befolgt, kaum waren sie über ihre Lippen gekommen. Als ihr klarwurde, was ihre Mutter von ihr verlangte, schwankte sie. »Bapa kann nicht hereinkommen, Mama.«
»Bis jetzt nicht«, sagte Mumtaz. »Aber ich will ihn hierhaben.«
Die Hebammen griffen nach ihren Schleiern, zogen sie über den Kopf und nahmen eine unterwürfige Haltung ein, noch bevor der Großmogul in den Raum trat. Eine von ihnen schnalzte missbilligend mit der Zunge, doch Mumtaz achtete nicht darauf.
»Sag ihm, er soll kommen.«
Jahanara verneigte sich vor ihrer Mutter. »Er wird hier sein, Mama, sobald ich die Tür öffnen kann.«
»Geh, Roshan«, sagte Mumtaz zu ihrer jüngeren Tochter. »Ich möchte jetzt mit eurem Bapa allein sein.«
Schmollend entfernte sich Roshanara vom Bett ihrer Mutter und setzte sich zu den Sklavenmädchen, die ihr an der Wand Platz gemacht hatten. Als Jahanara die Hand auf die kalte Türklinke legte, hörte sie, wie die Hebamme murmelte: »Der Kopf ist zu sehen, Eure Majestät. Es dauert nicht mehr lange.«
Prinzessin Jahanara Begam lehnte sich an die Tür und rieb ihren schmerzenden Nacken. Seit dreißig Stunden lag ihre Mutter in den Wehen, und jetzt endlich zeigte sich der Scheitel des Kindes. Zunächst war diese Niederkunft wie so viele andere verlaufen, die Jahanara miterlebt hatte. Die Sklavinnen hatten gelacht und die Geburt eines Sohnes angekündigt. Die weise Erste Hebamme saß in einer Ecke (und hielt selbst Hof unter den weniger bedeutenden Hebammen), nickte zu den Scherzen, strickte eifrig, um die Finger geschmeidig zu halten für den Moment, in dem sie gebraucht wurde. Bis auf das Opium hatte Mumtaz nur Äpfel zu sich nehmen wollen. Jahanara hatte sie geduldig klein geschnitten und ihre Mutter damit gefüttert. Die Äpfel kamen aus den Tälern Kaschmirs, sehr klein und rund, wie Kirschen. Ihr Duft verbreitete sich in diesem heißen Juni im ganzen Raum – mitten in der Ebene und meilenweit von den kühlen Bergen Kaschmirs entfernt –, und allen lief das Wasser im Munde zusammen. Doch die Früchte waren für die Mogulkaiserin, und niemand, nicht einmal ihre Kinder, Prinzessinnen von königlicher Geburt, hatte ein Anrecht darauf. Dann, in den letzten paar Stunden, hatte sich etwas verändert. Nicht etwa, dass Mumtaz zu lange in den Wehen gelegen hatte, sondern dass sie sich zu sehr bemüht hatte, ihr leerer Blick während der Kontraktionen, die tadellos klare Unterhaltung dazwischen. Als würde sie nie wieder Zeit finden zu sprechen.
Bei diesem Gedanken raffte Jahanara die Röcke ihrer ghagara und eilte auf der Suche nach ihrem Vater durch den düsteren Korridor. Als sie das Ende erreicht hatte, streckte jemand einen Arm aus und hielt sie an. Außer Atem blieb sie stehen.
»Was ist los, Aurangzeb? Warum bist du wach? Du solltest im Bett sein, das hier ist Frauensache.«
Die Gestalt ihres Bruders löste sich aus dem Schatten. Mit seinen dreizehn Jahren war er fast so groß wie sie. Auch Aurangzeb war dünn, doch während Jahanaras Gang und ihre Haltung Selbstsicherheit ausstrahlten, war er in dem Alter, in dem die viel zu langen Arme und Beine unbeholfen am Körper baumelten.
»Geht es Mama gut, Jahan? Kann ich zu ihr?«
Entrüstet trat Jahanara zurück. »Mama hat nach Bapa verlangt – ich bin auf dem Weg, ihn zu holen, und selbst er sollte jetzt nicht in ihren Gemächern sein. Wie kommst du darauf, dass man dich zu ihr lassen sollte?«
Geistesabwesend schüttelte er den Kopf, als hätte er sie nicht gehört. »Warum sollte ich nicht zu ihr dürfen? Du bist doch bei ihr. Was ist los? Ist das Kind geboren? Warum dauert es so lange?«
Seine Hand lag noch immer auf ihrem Arm, und Jahanara schüttelte sie mit ungeduldiger Geste ab. Im Halbdunkel dieses äußeren Korridors im Palast von Burhanpur verzog Prinz Aurangzeb für einen Moment schmerzhaft den Mund. Dabei war es nicht so, als könnten sie ihn alle nicht ausstehen, dachte Jahanara. Aurangzeb war einer von ihnen, sie hatten denselben Vater und dieselbe Mutter – das allein war in jener Zeit sehr ungewöhnlich, denn Bapa hätte zahlreiche Frauen und Konkubinen haben können –, nichts verwässerte ihre Abstammung. Doch die Stimmung zwischen ihnen und Aurangzeb war leicht gereizt. Es war … seine Intensität, sein ausgeprägtes Selbstbewusstsein (in ihren Augen völlig fehl am Platze; er war ein Kind, hatte noch nichts geleistet und würde wahrscheinlich auch in Zukunft nichts leisten), sein Beharren darauf, was er für richtig und falsch hielt.
Mit Nachdruck sagte sie: »Sei nicht so töricht, das Entbindungszimmer zu betreten, Aurangzeb. Vergiss nicht, dass du ein königlicher Prinz bist und dich an die Regeln zu halten hast.«
Ihr Bruder hatte sich zu den Türen am anderen Ende des Korridors umgedreht, blieb aber bei Jahanaras Worten stehen. Sie ließ ihn stehen und lief zu ihrem Vater, denn sie wusste, dass die beiläufige Erwähnung von Schicklichkeit (die Aurangzeb hoch und heilig war) ihm Einhalt geboten hatte. Sie beeilte sich, das Herz schlug ihr bis zum Hals. Die wachhabenden Eunuchen, die sich vor ihr verneigten, sah sie nicht. Wo war Bapa? Wo steckte er nur? Sie stürmte in die Gemächer ihres Vaters und rüttelte ihn wach.
»Mama hat nach dir verlangt«, sagte sie und schluchzte. »Geh zu ihr. Sie stirbt.«
Als Mogulkaiser Shah Jahan die Gemächer betrat, hatte Mumtaz inzwischen ihr vierzehntes gemeinsames Kind zur Welt gebracht und schlief. Jahanara und er hatten zwanzig Minuten draußen gestanden, sich an den Händen gehalten und den Schreien der Mogulkaiserin, dann dem Jammern des Kindes gelauscht. Die Haremsmutter, Satti Khanum, hatte ihren Kopf zur Tür herausgestreckt, nachdem sie angeklopft hatten, und gesagt: »Ihrer Majestät geht es gut, Eure Majestät. Dumme Göre« – dies an Prinzessin Jahanara gerichtet –, »dass du deinen Vater mit solchen Ängsten aus dem Schlaf reißt.«
»Ich möchte sie sehen, Satti«, hatte Shah Jahan gebeten.
»Gleich, jetzt nicht. Ihr könnt die Geburt selbst nicht mit ansehen. Bleibt draußen, Eure Majestät, ich werde Euch rufen.«
Also hatte man sie stehenlassen, und sie hatten mit dem Ohr an der Holztür gelauscht. Sie hatten die Schreie des Kindes gehört, einen Seufzer von Mumtaz, die Stille, nachdem sie eingeschlafen war. Dann hatte Satti die Tür für ihren Mogulkaiser geöffnet.
Das Kind war ein Mädchen und lag in einer Ecke des Raums in einer Wiege aus Gold und Silber. Die Frauen – Hebammen und Sklavinnen – zogen sich unauffällig zurück, als Shah Jahan sich flüchtig über das Kind beugte. Es war wach, in feine Seide gewickelt, und schaute ihn mit lebhaften blauen Augen an.
»Hat Ihre Majestät dem Kind einen Namen gegeben, bevor sie einschlief?«, fragte Shah Jahan.
»Sie hat …« Roshanara eilte zu ihrem Vater und packte ihn am Handgelenk. »Sie hat Goharara vorgeschlagen, Bapa. Gefällt dir der Name?«
»Alles, was deine Mutter wünscht, soll geschehen, Liebes. Geh.« Er stieß sie von sich. »Ich muss allein mit ihr sein.«
Er trat ans Bett, setzte sich auf einen niedrigen Hocker, den jemand dort für ihn hingestellt hatte, und legte die Hände auf seine Schenkel. Seine Knie waren bis auf Brusthöhe angezogen. Während das Dunkel der Nacht langsam wich, betrachtete er seine Frau, bemerkte das Heben ihrer Brust, wenn sie einatmete, bewunderte die reine Schönheit ihrer Gesichtszüge. Dessen würde er nie müde werden. Er legte die breite Hand auf ihre Stirn, aber Mumtaz rührte sich nicht. Ihre Haut war zu warm, dachte er und schnippte ein Mal mit den Fingern, ohne sich umzudrehen. Eine Sklavin brachte eine Schüssel Wasser, mit Rosenöl parfümiert, und ein weiches Handtuch, das er ins Wasser tauchte und seiner Gemahlin auf die Stirn legte.
»Du musst bald gesund werden, mein Liebling«, sagte er sanft. »Wir müssen den Thron von Hindustan genießen, jetzt, nachdem wir besitzen, wofür ich hart gearbeitet habe.«
Vier Jahre zuvor hatte Shah Jahan einen blutigen Kampf um dieses Reich geführt. Er hatte seine Brüder, seine Vettern, seine Neffen gnadenlos umgebracht, denn auch sie wären mit ihm nicht anders verfahren. Noch immer gab es kleinere Aufstände, und ein solcher hatte sie an die südliche Grenze des Reichs bis nach Burhanpur geführt, wo sie einst Jahre in einer Art Exil gelebt hatten. Hier waren einige ihrer Kinder geboren, und der Thron mit seinem enormen Juwelenschatz – Hunderte von Meilen weit weg im Norden, in Agra – erschien ihnen damals unerreichbar. Doch Mumtaz und er herrschten jetzt über dieses mächtige, erstaunlich blühende Land. Ihre Namen würden für immer in die Geschichte eingehen, und wenn die Nachwelt über das Mogulreich sprechen würde, dann mit leiser, ehrfürchtiger Stimme. Und sein Name sowie der Name seiner Geliebten würden für alles stehen, was mit Mogulherrschaft zu tun hatte. Kaiser Shah Jahan war nicht unbedingt zimperlich – auf jeden Fall hatte er die Krone auf seinem Haupt nicht gerade seiner Bescheidenheit zu verdanken, denn sein eigener Vater hatte einen anderen Sohn zum Erben bestimmt und ihn, Shah Jahan, aus Indien vertrieben.
Mumtaz Mahal regte sich. Die kleine, fahrige Bewegung wurde von allen Anwesenden im Raum wahrgenommen, die ihren Herrscher am Bett seiner Frau beobachteten. Sie war seine Welt, und alle hatten gelernt, ihre Herrscherin als die Gesamtheit ihrer Welt zu betrachten. Diese Aufgabe fiel der Dienerschaft nicht schwer, denn wenn sie den Wünschen der Mogulkaiserin nachkamen, wurde ihnen ein gewisser Wohlstand zuteil, sie hatten Einfluss in der zenana und konnten sicher sein, den Kopf auf den Schultern zu behalten und den nächsten Tag zu erleben.
Als sie wieder ruhiger atmete, nahm Shah Jahan das Handgelenk seiner Gemahlin und drückte seine Lippen in ihre Armbeuge. Das Kind in der Wiege erhob sein dünnes Stimmchen, und eine Amme mit prallen Brüsten erhob sich, um es zu stillen. Diese Frau war zuvor unter vielen anderen ausgewählt worden, die sich im Palast vorgestellt hatten, allesamt sauber, die Haare gekämmt, die Zähne sorgfältig mit Zweigen vom Niembaum gereinigt. Den königlichen Nachwuchs zu stillen bedeutete Reichtümer, unvorstellbaren Überfluss, vielleicht sogar die Zuneigung des Kindes. Wenn es ein Junge war, könnte es eines Tages die Krone von Hindustan tragen und sich auch als Erwachsener noch an die Frau erinnern, die ihn gestillt hatte. Satti hatte diese vom Glück begünstigte Frau mit ihrem breiten Bauerngesicht, ihrem üppigen, rundlichen Körper, dem sauberen Mund und der honigsüßen Milch ausgesucht.
»Ist sie gesund, Khurram?«
In seiner Hast, sich vom Hocker zu erheben, taumelte Shah Jahan und kniete sich neben das Bett seiner Frau. Er legte die Arme über ihre Taille und ihre Schenkel. »Ja, Geliebte. Und du, Arju?« So nannte er sie auch, Arju, die Kurzform von Arjumand, der Name, unter dem sie geboren wurde.
Sie brauchte lange, um zu antworten. »Ich bin erschöpft. Diesmal … war es schwerer. Ich freue mich über diesen Augenblick, in dem ich dich sehe.«
»Was soll das Gerede?«, fragte er leichthin, obwohl das Herz in seiner Brust heftig zu pochen begann. Also stimmte etwas nicht. Noch nie war Arjumand derart bekümmert gewesen. Die Geburt eines Kindes war ein Anlass zur Freude, und ganz gleich, wie sehr sie gelitten hatte, sie hatte ihn immer glücklich angelächelt, wenn er zu ihr gekommen war. Die nach den besorgten Worten seiner Tochter aufgetauchten Befürchtungen, die Satti Khanum an der Tür eine Zeitlang zerstreut hatte, stiegen wieder in ihm auf. Als sich die Lippen seiner Gemahlin bewegten, beugte er sich über sie, legte seine Wange an die ihre und erlaubte ihr nicht, zu sprechen. Sie würde bestimmt wieder auf die Beine kommen.
»Lass mich nach den hakims schicken«, sagte er.
»Wazir Khan?« Ihre Stimme war kaum zu hören. »Er weiß nichts über Frauensachen, und er wurde noch nie in die zenana gelassen. Was könnte er schon ausrichten?«
»Aber du …«
»Mir geht es gut, Khurram. Ich bin erschöpft, mehr nicht. Alles ist gut, jetzt, da ich dich gesehen habe. Bleibst du hier?«
»Ja«, sagte er schlicht und spürte, wie ihre Wimpern über seine Haut strichen, als sie die Augen schloss und einschlief.
Als der Tag über Burhanpur anbrach und die Stimmen der Muezzine erklangen, um die Gläubigen zum Gebet zu rufen, verließ Shah Jahan seine Gemahlin, die noch immer schlief, und suchte seine Gemächer auf, um zu beten. Langsam ging er durch die zenana, abgespannt von der Nachtwache an Mumtaz’ Seite. In der letzten Stunde war Jahanara zu ihm gekommen, hatte sich neben ihn gesetzt und ihren Kopf an seine Schulter gelehnt, während sie Mumtaz Mahal beobachteten. Als er ging, ließ er seine Tochter an der Seite ihrer Mutter. Auch sie schlief, noch immer auf dem Boden sitzend, an die Matratze gelehnt, ihr Gesicht an Mumtaz’ Hand.
Zwei Stunden nachdem Mogulkaiser Shah Jahan seine Gemahlin in ihren Gemächern verlassen hatte, erwachte Prinzessin Jahanara mit dem Gefühl entsetzlicher Angst. Die Hand ihrer Mutter fühlte sich kalt an. Jahanara fuhr hoch und sah, dass die Brust sich nicht mehr hob und senkte, das Gesicht wirkte ruhig, als schliefe sie noch.
»Bapa«, heulte sie auf. Ihre Stimme holte die Haremsdamen scharenweise in die Gemächer. Sie schob sie beiseite und lief mit tränenüberströmtem Gesicht hinaus, durch die Korridore bis in das Zimmer ihres Vaters. Sie wusste nicht, was sie ihm sagen sollte, wie sie es ihm beibringen sollte. Noch im Laufen wusste sie, dass sich mit diesem Augenblick ihrer aller Leben verändert hatte. Wer würde jetzt auf sie aufpassen? Wer würde sich um Bapa kümmern? Er war der oberste Herrscher des Mogulreichs, aber er würde ein Leben ohne die Frau, die er liebte, nicht für lebenswert erachten.
Zwei
Und dieser Schatz an Bescheidenheit, diese Truhe der Keuschheit wurde gemäß des Brauchs der vorübergehenden Bestattung (amanat) in Burhanpur beigesetzt, in dem Gebäude (imarat) innerhalb des Gartens von Zainabad, der sich auf der anderen Seite des Flusses Tapti befindet; und besagtes Gebäude ist inmitten eines Wasserbeckens errichtet.
– aus »padshah nama«, der Chronik des Abdul Hamid Lahori in Begley und Desai, Taj Mahal: The Illumined Tomb
Burhanpur
Mittwoch, 17. Juni 1631
17 Zi’l-Qa’da A. H. 1040
Das Kind, das auf die Welt gekommen war und seine Mutter daraus vertrieben hatte, hatte man weggebracht. Die Schreie der Kleinen verhallten mit den Schritten der Amme. Kurz nachdem der dritte pahar des Tages angeschlagen wurde, nach der Mittagsstunde, setzte der Regen ein. Der Tag hatte klar wie ein Diamant begonnen, die Sonne strahlte, die Hitze war erstickend. Dann hatten sich am Himmel über Burhanpur ein paar dunkle, schwere Regenwolken angesammelt. Der erste Blitzstrahl umriss die schwarzen Steine der Festung an den Ufern des Tapti, der erste Donnerschlag ließ die Fensterscheiben des Raumes erzittern, in dem Mumtaz Mahal entbunden hatte.
Dann öffneten sich die Himmel, und der zunächst sanfte Regen steigerte sich zu wildem Tosen. Nur wenige Stunden nachdem die Mogulkaiserin ihren letzten Atemzug getan hatte, wurde sie beigesetzt und mit der nassen Erde bedeckt – muslimische Vorschriften und die Hitze erlaubten bei Bestattungen keine Verzögerungen.
Sie standen in einer Reihe hinter dem imam und hielten sich an den Händen: Jahanara, Dara, Shah Shuja, Roshanara, Aurangzeb … sogar Murad, der erst sieben Jahre alt war. Murad rückte näher an Jahanara heran. Seine größte Sorge war, dass die Reiherfeder schlaff herabhängen könnte, die Bapa ihm vor zwei Tagen als Verzierung für den Perlenschmuck an seinem Turban geschenkt hatte. Unauffällig betastete er seinen Kopf. Der Turban saß fest an der Stirn. Murad wischte sich die Nase ab, und der imam setzte seinen Singsang fort. Die Hand seiner Schwester umklammerte die seine etwas zu fest. Als er mit den Fingern wackelte, sagte Jahanara: »Ruhig, Murad. Pass auf, was der imam sagt.«
Sie schauderte, und Aurangzeb an ihrer Seite sagte: »Ja, hör auf das Gebet für unsere Mama.«
Jahanara hatte diese Stelle im Zainabad Bagh am östlichen Ufer des Tapti gegenüber der Festung als vorübergehende Ruhestätte für ihre Mutter ausgesucht. Sie müsste nur den Kopf wenden, dann sähe sie die Fenster der Gemächer, in denen Mama gestorben war. Bei diesem Gedanken drehte sie sich tatsächlich um und erblickte eine einsame, weiß schimmernde Gestalt im riesigen Innenhof der Festung, die zwanzig Fuß über dem Wasserspiegel errichtet worden war. Bapa. Auch er stand da und beobachtete sie alle von weitem. Von Kummer erstickt, hatte er sich geweigert, mit zur Beerdigung zu kommen. Er wollte es nicht glauben und war fest überzeugt, er würde seine Gemahlin lebend wiederfinden, wenn er an dieser Bestattung nicht teilnähme.
Diesen Luxus konnte sich Jahanara nicht erlauben, denn mit dem Tod ihrer Mutter wurde sie Padshah Begam, die erste Dame im Harem. Die Statusveränderung ging beinahe unmerklich vor sich, sobald sie den Korridor entlanggelaufen war und die Tür zu den Gemächern ihrer Mutter hinter sich offen gelassen hatte. »Die Kaiserin ist tot«, hatten die Dienerinnen geklagt. In fadenscheiniger Ehrerbietung hatten die Eunuchen sich tiefer vor ihr verneigt. Ihr Vater war gerade aufgestanden, als sie in den Raum stürmte. Sie war kaum in der Lage gewesen, die Worte auszusprechen: Mama ist tot, Bapa. Er war ohnmächtig geworden und so hart aufgeschlagen, dass sein rechter Ellbogen noch eine ganze Woche schmerzen würde. Schon eine Stunde später drangen die ersten leisen Fragen an ihr Ohr.
Wo soll Ihre Majestät beigesetzt werden, Eure Hoheit? Jahanara hatte aufgeschaut und den Blick aus dem Fenster auf Zainabad Bagh gerichtet, auf das Wasserbecken in der Mitte der Gärten mit dem baradari, unter dessen flachem Dach Mama in mondhellen Nächten Unterhaltung für sie alle geboten hatte – Musik, Tanz, Wein und Essen.
Den Leichnam ihrer Mutter hatte sie gemeinsam mit Satti Khanum gewaschen. Wieder waren ihr die Tränen gekommen, als sie Mamas Gesicht mit dem reinen Gangeswasser abwischte, das sie zum Trinken verwendeten. Ein Mal. Zwei Mal. Ein drittes und letztes Mal mit kleinen, im Wasser aufgelösten Kampferwürfeln, um den Körper zu parfümieren. Drei seidene Totenhemden, übersät mit hundert winzigen Diamanten, wurden um Mumtaz Mahal geschlungen. Die Vorschriften verlangten schlichtes Tuch, doch Jahanara hatte zwanzig Näherinnen daran gesetzt, Diamanten in die Seide einzuarbeiten. Mumtaz’ Haar lag glatt im Nacken geschlungen. Jahanara hatte zwei Diamantstecker am Körper ihrer Mutter belassen, den Diamantring in der Nase, jeweils zwölf Armreife mit Diamanten an ihren Handgelenken und sich allen Argumenten verschlossen, den Schmuck zu entfernen.
»Sie ist Mogulkaiserin«, hatte sie gesagt. »Sie kann nicht wie eine Arme ins Grab gehen.«
Danach hatte ihr niemand widersprochen, nicht einmal Satti Khanum, die ihre Stimme in der zenana bei jeder Gelegenheit erhob.
Jahanara fand ihre Brüder vor den Gemächern ihres Vaters. Dara saß auf dem Boden und betrachtete seine Hände. Shuja weinte in einer Ecke. Murad schob ein hölzernes Spielpferd mit Wagen über den Teppich. Und Aurangzeb schritt so wütend auf und ab, dass seine bloßen Füße auf dem Steinboden des Vorzimmers platschten.
»Die Beisetzung wird nach der zweiten Wache stattfinden«, hatte Jahanara gesagt.
»Ich gehe nicht hin.« Das war Dara, der am ganzen Leib zitterte. Sein Gesicht war bleich, die Augen rot unterlaufen.
»Ich auch nicht«, hatte Murad gejammert. »Mama wird zurückkommen, wenn ich nicht zu ihrer Beisetzung gehe.«
»Wir alle werden dort sein«, hatte Jahanara mit lauter Stimme gesagt. In ihren Augen brannten Tränen, die sie jedoch ungeduldig wegwischte. Sie hatte keine Zeit für solche Schwächen, wer würde denn auf ihre Brüder aufpassen, wenn sie wieder anfing zu weinen? »Badet zuerst, ihr müsst sauber sein, und esst ein wenig, und wenn wir zum Zainabad Bagh gehen, um unsere Mutter in die Erde zu legen, werden wir uns so würdevoll verhalten, wie es sich für unseren Rang und Stand gehört. Kleidet euch in schlichtes Weiß.«
Beim Klang ihrer barschen Stimme hatten sich alle zu ihr umgedreht und sie ungläubig angesehen. »Sogar Bapa will nicht herauskommen«, hatte Dara gesagt.
Jahanara überlief ein Frösteln. Die Haut in ihren Handflächen war noch aufgeweicht von dem Wasser, mit dem sie den Leichnam ihrer Mutter gewaschen hatte. Stechender Schmerz war in eine alte Schnittwunde an ihrem Zeigefinger gefahren, die auch jetzt noch pochte, nachdem sie den Kampfer abgeputzt hatte. Doch Jahanaras Tränen mussten versiegen, denn sie war anscheinend die Einzige, die das Geschehen im Griff hatte. Nach dem unerwarteten, unerwünschten Tod ihrer Mutter waren alle anderen zusammengebrochen.
»Ich werde mit ihm sprechen«, hatte sie gesagt. Doch die Unterhaltung hatte sie nur in überwältigende Angst gestürzt. Noch nie hatte Jahanara ihren Vater derart hoffnungslos erlebt – seine belegte Stimme, die kraftlosen Bewegungen seiner Arme und Beine, die er nicht still halten konnte, das eigenartige Lachen im unpassenden Moment. Das hatte ihr Angst um sie alle eingejagt.
Sie drehte sich wieder zum baradari um. Es war ein kleines Gebäude, etwa dreißig Fuß lang, hatte ein flaches Dach und auf jeder Seite drei spitz zulaufende Bögen. Die Insel selbst in der Mitte des Wasserbeckens im Zainabad war kaum größer als der darauf errichtete baradari, den daher nur ein schmaler Streifen aus Gras und Schlamm umgab. Und auf diesem standen sie jetzt. Die Mitte des Pavillons war ausgehoben worden, das Erdreich in einer Ecke angehäuft. Der imam, der das Totengebet für ihre Mutter vorsprach, stand auf der ersten Treppenstufe.
Als er fertig war, ging Aurangzeb zu dem Mann hinauf und tippte ihm auf die Schulter. Der imam verneigte sich vor seinem Prinzen und trat zurück, bis er hinter den fünf Kindern stand. Nicht ein Mal hob er den Kopf, sein Unbehagen im alles beherrschenden Schweigen ringsum war zu spüren.
Jahanara zog den nassen Chiffonschleier vom Gesicht und wischte sich den Regen von Stirn und Augen. Dara hatte sich dagegen gewehrt, an der Bestattung teilzunehmen, weil ihm alles, was mit Tod und Sterben zu tun hatte, zuwider war, obwohl es sich um ihre Mutter handelte. Murad hatte nicht hier sein wollen, weil er noch ein Kind war. Und Aurangzeb … er hatte etwas gegen ihre – Jahanaras und Roshanas – Anwesenheit gehabt, weil sie Frauen waren und nicht an einem solchen Ritual in der Öffentlichkeit teilnehmen durften. So ging es auch dem imam, seine Abscheu war offensichtlich, er hatte den Blick beständig auf den Boden direkt vor seinen Füßen gerichtet, damit er sah, wohin er trat, mehr nicht. Dieser Mann – wie Aurangzeb, dachte Jahanara mit einem Anflug von Heiterkeit – war starr und eigensinnig wie ein Esel. Er war so vorsichtig gewesen, dass er nicht einmal gewagt hatte, Mumtaz’ zugedeckten Leichnam neben dem Grab anzuschauen, weil sie eine Frau war.
Murad weinte heiser, tiefe Schluchzer erschütterten seine kleine Gestalt. Er schauderte selbst bei dieser Hitze, in der alle anderen schwitzten, denn der Regen hatte die Schwüle lediglich verstärkt. Murad legte die Arme um Jahanaras Taille, klammerte sich an sie und verbarg das Gesicht in den feuchten Falten ihrer ghagara. Sie drückte ihm einen Kuss auf den Scheitel und sagte: »Schh. Schh, kleiner Bruder.«
»Er würde nicht so eine unwürdige Vorstellung abgeben, wenn du nicht hier wärst, um ihn zu trösten«, sagte Aurangzeb.
»Willst du wohl ruhig sein, Aurangzeb?« Dara sprach zum ersten Mal, seit sie zur Insel übergesetzt hatten. Die ganze Zeit hatte er mit gesenktem Kopf und finsterer Miene an Aurangzebs Seite gestanden. »Du hast genug gesagt. Du redest immer mehr, als du solltest. Solche Worte sind eine unwürdigere Vorstellung als ein kleiner Junge, der um seine Mutter trauert … oder als seine Schwester, die ihn tröstet.«
Aurangzeb, der auf der ersten Stufe zum baradari stand, lief vor Wut und Verlegenheit rot an, denn ihre gesamte Gefolgschaft war um sie herum versammelt, und trotz des prasselnden Regens waren Daras scharfe Worte deutlich zu vernehmen. Auf verschiedenen anderen Booten, die sacht auf dem Teich dümpelten, saßen die Staatsminister und beobachteten sie. Hatten sie es auch gehört?
Dara stellte sich an den Platz, den Aurangzeb verlassen hatte, und tätschelte dem schluchzenden Murad die Schulter.
Nachdem die Gebete gesprochen waren, wurde der Leichnam der Mogulkaiserin in das rechteckige Grab herabgelassen. Ihr Kopf zeigte nach Westen, Richtung Mekka. Zu sechst gingen sie die Stufen hinauf, stellten sich um das Grab und schauten auf die verhüllte Gestalt ihrer Mutter – den Vorschriften entsprechend war kein Sarg für sie gebaut worden. Dann schaufelten sie nacheinander mit den Händen feuchte Erde ins Grab. Der Schlamm spritzte auf das makellose Weiß des Tuchs, dessen Diamanten funkelten. Das Funkeln ließ nach, je mehr Erde sie hineinwarfen, und erlosch schließlich ganz.
In den Palästen der Festung am gegenüberliegenden Ufer des Tapti konnte der Mann vom höher gelegenen Innenhof aus diesen Vorgang nicht sehen, denn der starke Regen verwischte die Umrisse des baradari. Der Mann hielt einen weißen Schirm über sich. Jenseits der Festung von Burhanpur reichte Shah Jahans Autorität weit nach Hindustan hinein, und ein ganzes Reich wäre bereitwillig auf die Knie gefallen vor Dankbarkeit, hätte man nur Gelegenheit gehabt, diese kleine Pflicht zu erfüllen, sein majestätisches Haupt vor dem Regen zu schützen.
Großmogul Shah Jahan war äußerlich und innerlich durchkühlt. Seine Haut war feucht, sein Herz in so viele Teile zerbrochen, dass selbst das Atmen eine Qual schien. Er fragte sich, ob er noch viele Tage ohne Arjumand überstehen würde, ein Leben ohne sie war unvorstellbar. Würden seine Kinder in ein paar Tagen dieselben Pflichten für ihn erfüllen? Tränen rannen ihm über das Gesicht. Das Platschen des Regens auf dem weißen Leinenschirm dröhnte in seinen Ohren, die Falten seines weißen, an den Knöcheln zerknautschten churidar waren durchnässt, die unteren Ränder seines weißen kamis klebten am Stoff seines churidar. In den nächsten Jahren sollte er ausschließlich Weiß tragen. Seine Schultern sackten unter dem leichten Gewicht des in Gold eingefassten Schirmstiels nach vorn, und er spürte, wie er alt wurde. Auch in ihm war etwas gestorben.
Hinter ihm, etwa dreißig Schritte entfernt, standen zwei Frauen in aufrechter Haltung, den Schleier vor das Gesicht gezogen. Es waren die verbleibenden Mogulkaiserinnen. Die erste Frau, die Shah Jahan geheiratet hatte, war selbst von königlichem Geblüt, ihre Abstammung makellos – sie war mit dem Schah von Persien blutsverwandt. Die zweite Frau, die Shah Jahan nach seiner Vermählung mit Arjumand als seine dritte Frau geheiratet hatte, war die Enkelin des Mannes, der unter dem Mogulkaiser Jahangir Khan-i-khanan gewesen war, Oberbefehlshaber der kaiserlichen Truppen, ein mächtiger, hochgeachteter Mann.
Die erste Frau betrachtete ihren Gemahl nachdenklich. Sie war achtunddreißig, aber ihr letztes Kind, ihr erstes und einziges, war vor zwanzig Jahren zur Welt gekommen – 1612, in dem Jahr, in dem der Mogulkaiser Mumtaz Mahal geheiratet hatte. Seither, nachdem er diese Pflicht flüchtig erledigt und mit ihr ein Kind gezeugt hatte, wenn auch nur ein Mädchen, war er nicht wieder in ihr Bett gekommen. Was hatte ihn an Mumtaz bezaubert? Ein hübsches Gesicht? Das besaß sie auch. Anmut und Eleganz? Auch in dieser Hinsicht gab es an ihr nichts zu bemängeln. Edle Abstammung? Mumtaz war die Enkelin eines persischen Immigranten, eines Edelmanns zwar, der jedoch aus seinem Land verjagt worden war. Sie konnte sich nicht auf familiäre Bindungen zum Schah berufen, hatte keine königliche Abkunft vorzuweisen, und dennoch … sie war so lächerlich angehimmelt worden, dass die erste Frau Luft war, und die dritte – die nach der Heirat ebenfalls die Gelegenheit bekam, einen königlichen Nachkommen zur Welt zu bringen – war auch ein Nichts. Die erste Mogulkaiserin neigte den Kopf zur dritten Frau. Diese hatte ihm einen Sohn geboren, doch das Kind starb mit zwei Jahren.
Jetzt aber – und bei diesem Gedanken schmunzelte die erste Gemahlin –, jetzt war Mumtaz Mahal tot. Nun kam ihr Gemahl bestimmt zu ihnen zurück, denn wohin sollte er sonst? Sicher betrauerte er die verstorbene Mogulkaiserin angemessen, Glück und Zufriedenheit konnte er jedoch nur unter den Lebenden finden. Die erste Frau begann Pläne zu schmieden – welche Gemächer sie hier in Burhanpur und später in der Hauptstadt Agra belegen würde; welche Dienstboten sie behalten und welche sie entlassen würde; wen sie zum Ersten Eunuchen des Harems ernennen würde; wie sie Mumtaz’ sieben Kinder mit einer Pension abfinden könnte; wann sie Verhandlungen für die Heirat ihrer zwanzigjährigen Tochter beginnen konnte. Dann fiel ihr ein, dass man sie bei den Vorkehrungen für die Bestattung nicht um Rat gefragt hatte, wie es einer Padshah Begam des Harems zugestanden hätte. Dass ihre Kondolenzbotschaften, die sie in die Gemächer des Mogulkaisers geschickt hatte, nicht beachtet worden waren. Dass Satti Khanum, die offiziell den Titel Haremsmutter trug, in Wirklichkeit jedoch Mumtaz’ Erste Zofe gewesen war, nicht gekommen war, um der neuen mächtigen Frau in der zenana ihre Aufwartung zu machen. Dass stattdessen dieses Kind Jahanara alle Pflichten übernommen hatte, die sie, die erste Mogulkaiserin, für ihren Herrn hätte ausführen müssen, jetzt, da er es brauchte. Wie konnte eine Tochter die Stelle einer Gemahlin einnehmen?
Die erste Gemahlin trat von einem Fuß auf den anderen, verließ dabei, ohne es zu wollen, den Schutz des Schirms und wurde nass. Sie fluchte kaum hörbar, denn sie wagte nicht, ihre Stimme zu erheben. Selbst im Tod warf Mumtaz Mahal noch einen langen Schatten über die Frauen, die im Herzen ihres Gemahls keine Rivalinnen gewesen waren.
Aber wenigstens, dachte die erste Gemahlin, nach einem Halt suchend, wurde Mumtaz hier in Burhanpur beigesetzt, und hier blieb sie dann auch. In einem kleinen, unbedeutenden baradari am äußersten Rand des Reiches, in einer Stadt, die womöglich von den im Süden wütenden Sultanaten im Dekkan erobert wurde. Dann erinnerte sich bestimmt niemand mehr an sie, niemand spräche ihren Namen aus, die Nachwelt wüsste nichts mehr von dieser stürmischen, unvernünftigen Liebe, die ihren Gemahl (noch dazu meinen Gemahl, dachte die erste Frau boshaft) mit ihr verband.
Als Mogulkaiser Shah Jahan sich umdrehte und wieder in die Festung wankte, hakte sie sich bei ihm unter. Er ließ es zu, denn er hatte nicht einmal die Kraft, etwas dagegen einzuwenden.
Sie wusste nicht, wie sehr sie sich irrte. Mumtaz Mahal war in Burhanpur gestorben, aber für die Nachwelt sollte sie in dem prächtigen Grabmal weiterleben, das Mogulkaiser Shah Jahan ihr in Agra errichten lassen würde, vierhundertdreißig Meilen weit entfernt – im Taj Mahal.
Rauza-i-munavvara
Das leuchtende Grabmal
Da es im Süden jener großen Stadt auf einer lieblichen Anhöhe ein Stück Land gab (zamini), auf dem zuvor das Herrenhaus (manzil) des … Radja Jai Singh gestanden hatte, wurde es als Beisetzungsort (madfan) für die Pächterin des Paradieses auserwählt …
– aus »padshah nama«, der Chronik des Abdul Hamid Lahori
Agra
Mittwoch, 17. Juni 1631
17 Zi’l-Qa’da A. H. 1040
Von den Ästen der Tamarinde am Ufer des Yamuna erhob sich eine Schar Spatzen. Aufgescheucht, flogen die Vögel zunächst in die eine, dann in die andere Richtung, als versuchten sie zu begreifen, was sie gestört hatte, gerade als der Morgen über Agra dämmerte.
Der Mann unter dem Baum hob den Kopf und verfolgte den Flug der Vögel, bis ihr verwirrtes Zwitschern verklang. Mirza Raja Jai Singh nahm auf der Matte, die seine Dienstboten ihm ausgelegt hatten, den Lotussitz ein.
Die Nacht war noch nicht vorbei, doch die Dunkelheit verflüchtigte sich allmählich. Die Kälte der feuchten Erde drang durch die Matte. Zu dieser frühen Morgenstunde trug Jai Singh nur wenig – seine Brust war entblößt, seine chappals hatte er auf der Sandsteinterrasse seines Herrenhauses ausgezogen, bevor er die Treppe und den Abhang hinunter ans Wasser gegangen war. Er hatte nur einen weißen, an den Rändern mit einer schmalen Borte aus silbernem zari eingefassten dhoti aus Seide um seine Taille gebunden.
Raja Jai Singh wandte sich dem Wasser zu und sog die frische, feuchte Luft ein. Das war der Hinweis auf die Monsunregen, sie würden bald einsetzen, und jeden Morgen, wenn er aufstand und zur Tamarinde ging, würde er das weiche, schwammige Gras unter seinen nackten Füßen spüren, die durstige Erde würde singen, die Bäume würden in fröhlichem Grün ausschlagen.
Hinter sich hörte Raja Jai Singh, wie ein Dienstbote mit leiser Stimme zu einem anderen sagte: »Der mirza will nicht gestört werden.«
Mirza, dachte Jai Singh sarkastisch, er war als einfacher Edelmann geboren und würde als ein solcher sterben, trotz des Titels »Raja« und seines »Königreichs« Amber.
Jai Singh hatte das Vermögen seiner Familie und den Titel von seinem Großvater Raja Man Singh geerbt, nachdem Letzterer im Jahre 1615 gestorben war. Selbst als Lehnsmann des Mogulreichs war es Man Singh gelungen, mit der Extravaganz eines Königs zu leben. Sechzehnhundert Frauen bewohnten seine zenana, ein ansehnlicher Kinderschwarm, so viele Söhne, dass er sich nicht an alle Namen erinnern konnte. Am Ende hatte der Tod sie alle vor Man Singh ereilt, bis auf den Mann, der Jai Singhs Vater war. Daher war der gesamte Besitz, die Ländereien, die Paläste, der Überfluss an Gold- und Silberschmuck und dieses herrliche Herrenhaus in Agra in Jai Singhs Hände übergegangen, trotz der vielen Frauen und Kinder.
Er war ein vom Glück gesegneter Mann, dachte er. Selbst die Tatsache, dass er das Vermögen seines Großvaters fast unbehelligt hatte behalten können, war unter anderem der Gnade zu verdanken, ein Hindu zu sein, während die Mogulkaiser Muslime waren. Im Mogulreich war der Großmogul der einzige Hüter des Wohlstands, den er nach Belieben unter den Edelmännern an seinem Hof verteilte – dieser Wohlstand war ein Geschenk, ein Privileg, eine Belohnung für treue Dienste. Starb ein Edelmann, erlosch damit nach dem Heimfallrecht auch sein Anrecht auf seine Ländereien – seine Nachfahren konnten nichts erben, alles fiel an den Staat, an ihren Großmogul zurück. Das war die Theorie, in der Praxis ließ der Mogulkaiser für gewöhnlich einen flüchtigen Blick über das Vermögen schweifen und einen noch flüchtigeren über die Erben und ihre Treue zu ihm und übergab den Besitz fast vollständig an die nächste Generation. Aus irgendeinem Grund – den Jai Singh nicht in Frage stellte – waren hinduistische Rajas von dieser Heimfallregel ausgenommen, und Todesfälle in ihren Familien riefen nicht automatisch die königlichen Vollstreckungsbeamten auf den Plan.
Der Himmel vor Raja Jai Singh färbte sich blassrosa. Von seinem Sitzplatz aus konnte er, ohne den Hals recken zu müssen, die roten Sandsteinmauern des Forts von Agra sehen, die das Morgenrot aufnahmen. Erneut dachte er über sein Vermögen nach, über sein Glück, dieses prächtige haveli am Ufer des Yamuna zu besitzen – ein Stück Land, das von vielen Edelmännern bei Hofe begehrt wurde. Kleinfürsten, amirs, die neu am Hofe waren, oder auch solche mit einem Stammbaum wie Vollblüter betrachteten neidisch den üppigen Buschwald, der das Herrenhaus umgab, die frische Luft, die vom Fluss heraufwehte, die Aussicht auf das Fort, ja sogar die Nähe zur Festung, die es Jai Singh ermöglichte, sich auf Verlangen bei seinem Herrscher einzufinden, noch bevor die meisten amirs Zeit fanden, nach ihrem Kummerbund zu rufen. Doch das alles – das Land, der Titel, der Wohlstand – war wohlverdient. Denn Raja Jai Singh stammte aus einer Familie, die ihren Dienst an den Herrschern und am Reich bis in die Zeit des Großmoguls Akbar zurückverfolgen konnte. Doch seine Vorfahren waren nicht nur Diener gewesen – sie hatten auch ein paar wertvolle Verbindungen zum Haus der Großmoguln. Jai Singhs Urgroßtante, eine Prinzessin aus Amber, war Akbars Gemahlin und Mutter des Großmoguls Jahangir gewesen. Seine Großtante war Jahangirs Gemahlin gewesen. Der Sohn aus dieser Verbindung, Prinz Khusrau, war auf seinem Weg zum Thron leider von seinem Bruder, dem Großmogul Shah Jahan, umgebracht worden. Hätte Khusrau überlebt … wäre er Großmogul geworden, hätte Jai Singh bei Hofe vielleicht mehr Macht gehabt, die er geerbt hätte, statt sie sich erarbeiten zu müssen.
Er wartete, bis die Sonnenstrahlen den Himmel entflammten, bevor er sich gen Osten wandte und die Handflächen zur ersten Geste des surya namaskar – der Begrüßung der Sonne – aneinanderlegte. In dem Moment, als er seine Übungen ausführte, begegnete Mogulkaiserin Mumtaz Mahal vierhundert Meilen weit entfernt dem Tod. Raja Jai Singh träumte flüchtig von einem kleinen chattri, mit dem seine Asche bedeckt werden sollte, wenn er starb, hier am Ufer des Flusses, und die durchbrochenen Fenster des chattri würden die kühlen Brisen vom Yamuna filtern. Doch das sollte nicht sein, denn der Großmogul wollte Jai Singhs Land und das Herrenhaus einem höheren Zweck widmen. Dort sollten die Überreste seiner geliebten Gemahlin ihre letzte Ruhe finden.
Noch ahnte Jai Singh nicht, dass sein haveli vor Ende des Jahres abgerissen werden würde, um an seiner Stelle ein leuchtendes Grabmal zu errichten.
Drei
Auch wenn der Unvergleichliche Spender uns dank seiner Güte und Großherzigkeit eine so prächtige Gabe hatte zukommen lassen, die alle Vorstellungskraft übertrifft, weilt der Mensch, mit dem wir uns daran zu erfreuen gedachten, nicht mehr unter uns.
– Aus »padschah nama« der Amina Qazwini, in Begley und Desai, Taj Mahal: The Illumined Tomb
Burhanpur
Dienstag, 23. Juni 1631
24 Zi’l-Qa’da A. H. 1040
In Burhanpur verbrauchten sich die Tage von selbst, wie benommen gingen sie in die Nacht über und kamen zurück. Die Menschen in der Stadt vernahmen das Gurgeln in den Gefäßen der ghariyali, die sie mit Wasser füllten, um die Zeit zu messen, hörten die Männer auf die Messingscheibe über ihnen schlagen, um das Ende der Wachen zu verkünden, sahen das Hell in Dunkel übergehen, doch alles erschien ihnen in gewisser Weise unwirklich.
Die Geschäfte in der größten Basarstraße waren geöffnet, zum Schutz vor der Sonne waren Tücher über Pfähle gespannt, doch die Geschäfte liefen nicht wie sonst. Wenn überhaupt Geld den Besitzer wechselte – für Mehl und Reis, Gemüse, Kupferkessel, Gold und Silber –, dann nur widerwillig, während die eine Hand zögerte, die Münzen zu übergeben, und die andere die ersten Einkünfte seit einer Woche etwas zu gierig an sich riss. Auch nach ihren Einkäufen blieben die Kunden noch vor den Läden stehen und versuchten, eine Unterhaltung in Gang zu setzen, die nicht gestelzt klang. Sie sprachen über das Wetter (es war heiß, und zwar glühend), darüber, dass man sich nicht mehr auf den Regen verlassen konnte (und erneut über das Wetter), über die Anwesenheit des Großmoguls hier in Burhanpur (welch ein Segen für sie alle). Doch über Mumtaz Mahals Tod konnten sie nicht sprechen, ihnen fehlten die Worte. Die Männer auf den Straßen, die wenigen verschleierten Frauen aus höheren Schichten, die auf der Suche nach Waren umherirrten, die einfacheren Frauen, deren Gesichter für alle sichtbar waren – niemand hatte die Mogulkaiserin je gesehen, doch die Nachrichten aus dem Festungspalast, der düster über dem Basar aufragte, verbreiteten sich überall. Vor allem erfuhren sie von der Trauer ihres Mogulkaisers um seine verstorbene Gemahlin. Ein Tag nach ihrem Tod, nachdem man sie auf der kleinen Insel im Zainabad Bagh beigesetzt hatte, hörten sie, dass auch ihr Herrscher gestorben sei.
Bei dieser Nachricht verschlossen die Besitzer ihre Läden vorsichtig mit Holzläden und schlichen in ihre Häuser. Burhanpur versank in einen Wartezustand, begleitet von absoluter Stille und aufkeimender Furcht.
Auch die höchsten amirs des Reiches warteten Tag und Nacht vor der Festung von Burhanpur. Traditionell wechselten sich die Edelmänner ab und bewachten ihren Herrscher jeweils eine Woche lang oder mehr – sie richteten sich mit ihrem Gefolge im Innenhof hinter den ahadis ein, stellten ihre Schlaf- und Küchenzelte auf, verteilten ihre Männer im Halbkreis um die Paläste und an den Ufern des Tapti. Doch seitdem Mumtaz gestorben war, drängten sich alle Edelmänner von Burhanpur im Innenhof. Wenn die Nacht anbrach, loderten kleine Feuer auf, über denen Fleisch gebraten, Wasser gekocht und Wein gewärmt wurde. Ihre Stimmen waren gedämpft. Beklommenheit hatte sich breitgemacht. Als sich am sechsten Tag nach dem Tod der Mogulkaiserin einer von ihnen in Bewegung setzte, drehten sich alle voller Hoffnung zu ihm um. Er könnte etwas tun. Er war der Khan-i-khanan.
Mahabat Khan war der Oberbefehlshaber der kaiserlichen Truppen, in gewisser Weise der mächtigste Mann nach dem Mogulkaiser. Er war Soldat, und das Reich war seit Anbeginn durch das Schwert geformt, mit dem Blut gefallener Prinzen und Untertanen getränkt und durch Kriege, nicht durch Diplomatie entstanden. Daher besaß Mahabat mehr Autorität als der Großwesir, der nur Premierminister des Reiches war.
Sechs Tage lang hatte er im Schatten des Sonnensegels seines quadratischen Zeltes verweilt, hatte mit den anderen Edelmännern im Innenhof gegessen und getrunken, während er darauf wartete, dass sein Herrscher ihn zu sich rief. Das geschah dann auch endlich in der Gestalt von Ishaq Beg, Mir Saman oder Hofmeister der Mogulkaiserin Mumtaz Mahal.
»Seine Majestät wünscht Euch zu sehen, Mirza Mahabat Khan«, sagte Ishaq Beg und trat rechts hinter Mahabat. Aus den Augenwinkeln sah Mahabat, dass Ishaq Begs Rücken etwas zu steif war und er das Kinn zu arrogant vorgestreckt hatte. Er verhielt sich nicht wie ein Mann, der gerade seine Herrin und damit seine Arbeit und Existenzgrundlage verloren hatte. Der Khan-i-khanan stellte seinen Weinkelch auf den Tisch neben sich und nickte. Er stand auf, und alle um ihn versammelten Edelmänner erhoben sich mit ihm, den Blick fest auf ihn gerichtet, als könnte er ihnen bereits sagen, was er vorfinden würde, wenn er ihren Mogulkaiser aufsuchte.
Mahabat Khan spülte sich den Mund mit etwas Wasser aus und wartete, bis seine Diener ihm die Haare zurückgekämmt hatten und mit den Händen über seine Schultern und seinen peshwaz gefahren waren, um mit ihren breiten Fingern Falten zu glätten.
Ishaq Beg trat zurück, und als Mahabat an ihm vorbeiging, schaute er mit beinahe herablassendem Blick auf. Auf seinem Weg in die Festung, vorbei an den Wächtern, die auseinandertraten, um ihn hindurchzulassen, an den Eunuchen, die im äußeren Bereich der zenana herumschlichen, an den schwerfälligen Frauen, die den persönlichsten Bereich des Herrschers bewachten, ging ihm dieser Blick nicht aus dem Sinn. Diesen Frauen aus Kaschmir war befohlen worden, ihre Zungen so eifrig zu hüten wie ihren Mogulkaiser; ein Ausrutscher, ein falsches Wort, eine Frivolität, und man würde ihnen die Zunge abschneiden. Sie wurden für ihre Dienste reich belohnt und gnadenlos bestraft, wenn ihnen dabei auch nur das kleinste Missgeschick unterlief. Während Mahabat Khan sich den Gemächern Shah Jahans näherte, spürte er die Kühle, die vom duftenden Wasser des Flusses durch ein offenes Fenster hereinströmte. Er blieb stehen, als eine Wächterin aus Kaschmir ihm mit ihrem Speer den Weg versperrte.
Trotz seiner Stellung im Reich murrte Mahabat Khan nicht, als die Wächterinnen ihn durchsuchten. Sie nahmen ihm den Turban vom Kopf, hielten die Aigrette geschickt fest und fingerten in den Tuchfalten herum. Sie zersausten ihm das Haar mit den Händen, eine Klingenspitze könnte Schaden anrichten. Seine Kleidung wurde geschüttelt, sein Kummerbund überprüft, man strich über seine nackten Fußsohlen (er hatte sein Schuhwerk vor dem Haupteingang abgestellt). Dann traten die Frauen beiseite, und Mahabat fragte sich, ob sie ihre Suche nicht zu genau durchgeführt hatten, ob die anderen Edelleute, die vor den Herrscher gerufen wurden, jedes Mal eine ähnliche Demütigung über sich ergehen lassen mussten. Dann fiel ihm jedoch seine lange, wechselvolle Vergangenheit mit dem Mogulkaiser ein, und ihm kam der flüchtige Gedanke, dass auch er ihm nicht vertraut hätte, wären ihre Stellungen umgekehrt.
Als er die Gemächer Shah Jahans betrat, zauderte Mahabat, durch die herrschende Düsternis plötzlich mit Blindheit geschlagen. Die Fenster waren mit enggeflochtenen khus abgedichtet, die Ränder mit Seidentüchern bedeckt, um auch den kleinsten Lichtstrahl auszusperren. Eine Brise wirbelte durch den Raum, von den pankhas der fünfzehn Sklavinnen gefächelt, die in den Ecken und an den Wänden standen. Eine Kerze auf einem niedrigen Tisch in der Mitte verbreitete ein wenig Licht, das ringsum Schatten warf. Das alles nahm Mahabat in sich auf, während seine Augen sich langsam an das Dunkel gewöhnten. Frauenröcke raschelten, und zu seiner Rechten sah er den Zipfel einer ghagara zur Tür hinausschlüpfen, die eine Hand mit glitzernden Diamanten nach kurzem Zögern hinter sich zuzog. Die älteste Prinzessin, dachte er, Jahanara Begam. Jetzt würden sich alle auf sie verlassen und sich ratsuchend an ihre schmalen Schultern lehnen. Wer war noch da? Satti Khanum vielleicht. Aber Satti war trotz ihrer Vertrautheit mit den Angehörigen der kaiserlichen zenana letzten Endes eine Dienerin. Die Mutter des Mogulkaisers war tot, und er hatte den anderen Frauen seines Vaters nicht nahegestanden – besonders Mehrunnisa nicht, der letzten. Welche Frau könnte ihm schon helfen, seine Last zu tragen, wenn nicht dieses Kind?
Mahabat merkte, dass er sich in Gedanken verloren und sein Herrscher ihn noch nicht wahrgenommen hatte. Er spähte durch den Raum, sein Blick glitt von den Sklavinnen bis zum leeren Bett in der Mitte des Raumes und den beiden Stufen zu einer erhöhten, innenliegenden und mit Bögen verzierten Veranda, die über den Tapti blickte. Dort lehnte Shah Jahan in weißer Trauerkleidung an einem Pfeiler. Mahabat tappte durch den Raum, und als er sich seinem Herrscher näherte, blieb er stehen und vollführte den chahar taslim, beugte sich schwerfällig aus der Hüfte nach vorn, legte die rechte Hand auf den Boden und hob sie viermal an die Stirn. Als er den Gruß beendet hatte, richtete er sich stöhnend auf in der Hoffnung, dass es niemand gehört hatte. Dann wartete er wieder, den Blick zu Boden gerichtet. Er konnte erst sprechen, wenn Shah Jahan das Wort an ihn richtete.
Als die Stimme seines Herrschers an sein Ohr drang, erschrak Mahabat zutiefst.
»Du bist hier, Mahabat«, krächzte Shah Jahan so heiser, dass es beinahe unverständlich war.
»Ja, Eure Majestät. Stets zu Euren Diensten.« Jetzt schaute Mahabat zu dem Mann auf, der auf den Steinstufen saß, und ihm blieb das Herz stehen. Trotz der Dunkelheit sah er die Verwüstungen, die sechs Tage Weinen und Fasten hinterlassen hatten. Shah Jahans Gestalt schien wie verkümmert, die Haut spannte sich über den Wangenknochen, seine Augenlider waren angeschwollen, sein Rücken war gebeugt. Was Mahabat jedoch am meisten verblüffte, war das Weiß auf dem Kopf und im Gesicht – beinahe über Nacht, so schien ihm zumindest, waren die Haare des Herrschers ergraut. Mahabat hätte es nicht für möglich gehalten, wenn er es nicht selbst gesehen hätte. Er war versucht, eine Hand auszustrecken und auf die gefalteten Hände Shah Jahans zu legen, unterließ aber diese tröstende Geste. Was dachte er sich nur? Er konnte nicht wagen, seinen Herrscher zu berühren.
Auch Worte des Trostes vermochte er nicht auszusprechen. Was sollte er sagen? Dass die Mogulkaiserin allen fehlen würde, dass sie wahrhaftig das strahlendste Licht in Shah Jahans Palast gewesen sei, ihr Verlust sei so groß, dass sie alle trauerten? Mumtaz Mahal war das kostbarste Juwel in Shah Jahans zenana gewesen, und Mahabat stand es nicht zu, sich über eine Angehörige des kaiserlichen Harems zu äußern, und sei es noch so harmlos. Diese Lektion hatte er gelernt. Vor vielen Jahren – enttäuscht und ohne auf Ratschläge zu achten – hatte Mahabat den Mogulkaiser Jahangir davor gewarnt, seiner zwanzigsten Frau, Mehrunnisa, eine derart enorme Macht zu übertragen. Als Dank für seine Mühe wurde er von dieser Mogulkaiserin in einem Schachspiel vernichtend geschlagen (und das wurmte ihn noch immer) und nach Kabul geschickt, an den eisigen Rand des Reiches, um dort als »Gouverneur« zu dienen. Mahabat Khan war ein müder alter Mann in den Siebzigern und nicht mehr töricht. Er schwieg, den Kopf gesenkt, und sein Herz hämmerte gegen die Brust.
Schließlich ergriff Shah Jahan wieder das Wort. »Ich werde den Thron aufgeben, Mahabat.«
Sämtliche Vorsicht war vergessen, die Etikette verworfen.
»Das geht nicht, Eure Majestät«, rief Mahabat impulsiv. »Ihr seid noch ein junger Mann, erst neununddreißig. Ihr habt das ganze Leben vor Euch. Das hier ist das Reich, für das Ihr gekämpft und das Ihr gewonnen habt, es gehört von Rechts wegen Euch. Euer Großvater, Mogulkaiser Akbar, hat Euch als seinen Erben betrachtet. Ihr …« Mahabat verstummte, aber nur, um stattdessen zu schluchzen, was ihn überraschte. Er konnte seine Tränen nicht unterdrücken und fand, dass er tatsächlich alt und schwach wurde. Schließlich hätte er mit solchen Worten rechnen müssen, als Shah Jahan ihn zu sich rufen ließ. Er wischte sich über die Augen und wartete auf ein Lächeln oder eine spöttische Bemerkung des Mogulkaisers. Doch sein Monarch verhielt sich, als hätte er Mahabats Reaktion nicht einmal bemerkt. Er betrachtete nur seine dünnen Finger und dachte sorgfältig über Mahabats Worte nach.
»Ich will nicht mehr leben, Mahabat, geschweige denn weiter regieren. Was nützt mir der Besitz dieser Ländereien und der Wohlstand? Als … sie noch lebte, gab es etwas, wofür sich zu kämpfen lohnte, einen Grund, Mogulkaiser zu sein. Sie machte all die Jahre vergessen, in denen wir verfolgt und durch das Land gejagt wurden, wir konnten unsere schmerzenden Glieder auf festen Grund betten und bekamen den uns zustehenden Respekt.« Der Mogulkaiser hob den Kopf, und einen Moment lang sah Mahabat hinter den Verwüstungen, die der Kummer hervorgerufen hatte, den Machtwillen und die Selbstsicherheit, die Shah Jahan zum Monarchen gemacht hatten. »Allah selbst hat verfügt, dass ich König werde«, sagte Shah Jahan. »Mein Großvater wollte, dass ich nach meinem Vater herrschte. Mein Vater … er war verrückt nach einer bösartigen Frau, die ihn in die Irre leitete und einen anderen auf den Thron bringen wollte – du kennst diese Geschichte gut, Mahabat Khan, du warst daran beteiligt.«
»Ich weiß, Eure Majestät, und ich bitte für meine Rolle dabei um Vergebung«, sagte Mahabat. Nachdem man ihn als sogenannten Gouverneur quasi ins Exil nach Kabul geschickt hatte, war Mahabat an den Hof zurückgekehrt, hatte um eine Audienz gebeten und dann sich selbst und fast alle, die er kannte, damit überrascht, dass er in einem Putsch Mogulkaiser Jahangir und die Mogulkaiserin verhaftete. Doch er war ein schwacher Anführer gewesen – und diese Frau hatte eine verschlagene Art gehabt, denn trotz der strengen Bewachung war es ihr gelungen, mit Jahangir zu entkommen. Dann musste Mahabat seinerseits vor dem königlichen Paar fliehen. Später erklärte er sich bereit, den Sohn aus dem Reich zu jagen, der ihnen so viel Ungemach bereitete. Shah Jahan hatte Mahabat schon vergeben, bevor er Mogulkaiser wurde, doch er ließ keine Gelegenheit aus, ihn daran zu erinnern. Selbst angesichts des typischen Wankelmuts der Edelleute des Mogulreichs, die an einem Tag treu ergeben waren, am nächsten unbekümmert ihr Wort brachen, wies Mahabats Schicksal derart wilde Schwankungen auf, dass er selbst kaum fassen konnte, überhaupt noch am Leben zu sein.
»Mir war bestimmt, Mogulkaiser zu sein«, fuhr Shah Jahan mit viel weicherer Stimme fort, und Mahabat begriff, dass sein Monarch zum ersten Mal seit Tagen mit jemandem sprach. »Das Schicksal hatte mich dazu ausersehen, ein großer Herrscher zu sein. Aber es gibt Zeiten, Mahabat, in denen man allen Grund hat, abzudanken und den Ehrgeiz aufzugeben. Ohne« – und wieder zögerte er, nicht bereit, den Namen seiner Frau in Gegenwart eines anderen Mannes auszusprechen, der nur Minister war – »sie.« Shah Jahan fuhr sich mit der Hand über die Augen.
Im Gemach nebenan nieste jemand, und Mahabats Kopf fuhr zu der Tür herum, durch die Jahanara (wie er vermutete) hinausgegangen war, als er eintrat. Sie hatte die Tür geschlossen, das hatte er gesehen, doch jetzt stand sie ein paar Zollbreit offen. Jahanara aber hatte dieses Geräusch nicht gemacht – ein Mann hatte geniest. Einer der Prinzen? Niemand außer den königlichen Nachkommen würde es wagen, sich beim Lauschen an der Tür zu den herrschaftlichen Gemächern erwischen zu lassen. Wer war es?, fragte sich Mahabat. Dann sagte Shah Jahan: »Welcher von meinen Söhnen sollte deiner Meinung nach an meiner statt herrschen, Mahabat Khan?« Nun wusste er, warum er vor seinen Herrscher zitiert worden war.
Dara war sechzehn, Shuja fünfzehn, Aurangzeb dreizehn und Murad gerade mal sieben Jahre alt. Mahabat Khan hatte insgeheim eine klare Meinung über die Söhne des Mogulkaisers. Dara war ein respektloser Schnösel und dachte nur an sich. Shuja war wie ein junger Hund, er folgte und konnte nicht führen. Aurangzeb war eine Führungspersönlichkeit, jedoch unbeugsam und guten Ratschlägen nicht zugänglich – gefährliche Eigenschaften für einen Führer. Murad schließlich war … Murad war noch gar nichts, formlos und klein.





























