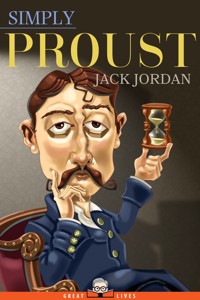12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Würdest du morden, um dein Kind zu retten? Hippokratischer Eid oder Mutterliebe: Im rasanten Thriller »Die Herzchirurgin« wird Ärztin Anna Jones vor eine unmögliche Wahl gestellt. Was wiegt schwerer: Der Eid einer Ärztin, ihren Patienten niemals zu schaden – oder der Instinkt einer Mutter, ihr Kind zu beschützen, koste es, was es wolle? Als die erfolgreiche Herzchirurgin Anna Jones eines Abends nach Hause kommt, ist ihre Babysitterin tot, ihr kleiner Sohn verschwunden. Die Entführer stellen Anna vor die Wahl: Entweder lässt sie den beliebten Politiker Ahmed Shabir, der als der nächste Premierminister gehandelt wird, in zwei Tagen auf ihrem OP-Tisch sterben; oder ihr Sohn wird sein Leben verlieren. Verzweifelt beginnt Anna zu ahnen, dass sie in Wahrheit überhaupt keine Wahl hat … Auch Krankenschwester Margot steht vor einem Dilemma. Sie hat enorme Schulden, beklaut die eigenen Kollegen. Kurz vor ihrer Entlarvung macht sie eine ungeheuerliche Beobachtung, die ihr Leben an den Abgrund rückt. Explosiv und hochdramatisch baut der britische Autor Jack Jordan seinen Thriller rund um ein unlösbares moralisches Dilemma auf: »›Die Herzchirurgin‹ hat mich vollkommen in den Bann gezogen ... Was für ein erschreckender Trip!« Bestseller-Autorin Gilly Macmillan
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 513
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Jack Jordan
Die Herzchirurgin
Thriller
Aus dem Englischen von Sigrun Zühlke
Knaur eBooks
Über dieses Buch
Würdest du morden, um dein Kind zu retten?
Hippokratischer Eid oder Mutterliebe: Im rasanten Thriller Die Herzchirurgin wird Ärztin Anna Jones vor eine unmögliche Wahl gestellt.
Was wiegt schwerer: der Eid einer Ärztin, ihren Patienten niemals zu schaden – oder der Instinkt einer Mutter, ihr Kind zu beschützen, koste es, was es wolle?
Als die erfolgreiche Herzchirurgin Anna Jones eines Abends nach Hause kommt, ist ihre Babysitterin tot, ihr kleiner Sohn verschwunden. Die Entführer stellen Anna vor die Wahl: Entweder lässt sie den beliebten Politiker Ahmed Shabir, der als der nächste Premierminister gehandelt wird, in zwei Tagen auf ihrem OP-Tisch sterben, oder ihr Sohn wird sein Leben verlieren.
Verzweifelt beginnt Anna zu ahnen, dass sie in Wahrheit überhaupt keine Wahl hat …
Auch Krankenschwester Margot steht vor einem Dilemma. Sie hat enorme Schulden, beklaut die eigenen Kollegen. Kurz vor ihrer Entlarvung macht sie eine ungeheuerliche Beobachtung, die ihr Leben an den Abgrund rückt.
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Motto
TEIL 1
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
TEIL 2
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
Danksagung
Sandra Jarrad
Meine beständige Inspiration für Mütter, die alles für ihre Kinder tun würden, genau wie Du es immer für mich getan hast. Dieses Buch wäre ohne Dich nicht möglich gewesen.
»Primum non nocere – Als Erstes keinen Schaden anrichten.«
– Hippokratischer Eid
»Ärzte unterliegen einem hohen Druck, psychisch zu erkranken […]. Daher überrascht es nicht sonderlich, dass unter Umständen bei denjenigen, die in unserem Berufsstand bis an die Spitze aufsteigen, einige der mit einer psychopathischen Persönlichkeit assoziierten Merkmale besonders ausgeprägt sind.«
– J. Pegrum, O. Pearce, The Royal College of Surgeons, August 2015
TEIL1
1
Anna
An meinem Hals ist Blut.
Nur ein einziger Tropfen, kaum größer als eine Sommersprosse. Ein geradezu winziges Detail, wenn man die gesamte Szene betrachtet. Vor mir liegt ein aufgeschnittener Mann mit blank liegenden Knochen, die schwarzen, teerbefleckten Lungenflügel auseinandergedrückt, um das Herz freizulegen. Und dennoch, trotz dieses dramatischen Anblicks drehen sich meine Gedanken um diesen kleinen Spritzer, der sich in meine Haut brennt.
Ich nehme das Skalpell von der linken Hand in die rechte und rolle mein Handgelenk, bis ich das befriedigende Knacken unter der Haut spüre.
Alle Augen sind auf mich gerichtet, schätzen die Ruhe meiner Hand im grellen Licht der OP-Leuchten ab. Auch unter ihren prüfenden Blicken bleiben meine Handflächen trocken und mein Griff ruhig und sicher. Doch unter meiner OP-Kluft schlägt mein Herz so heftig, dass ich es beinahe schmecken kann.
Peters Downings Herz hingegen liegt regungslos da.
Sein doppelter koronarer Bypass hatte vollkommen unkompliziert verlaufen sollen, bis es plötzlich anders kam. Nachdem ich mir den Weg durch seinen Brustkorb geschnitten und gesägt hatte, hatte ich versucht, aus einem Stück seiner Beinvene eine Umleitung für den blockierten Abschnitt der Aorta zu bauen, um wieder einen freien Blutzufluss zum Herzen zu ermöglichen. Als ich die Aortenklemme entfernte, um den Blutfluss wieder in Gang zu bringen, und die kaliumgesättigte Lösung wegspülte, die Peters Herz stillgelegt hatte, hätte es eigentlich aus seinem medizinisch induzierten Schlummer erwachen sollen.
Ich starre in seinen klaffenden Brustkorb und warte auf ein Zucken, eine Kontraktion, den ersten, lebensrettenden Ruck.
Nichts.
»Lunge aus, bitte.«
»Lunge aus«, wiederholt Dr. Burke.
»Zurück auf Maschine.«
»Zurück auf Maschine«, ruft Karin von der Perfusionsstation zurück.
Ich reiche meiner Assistentin das Skalpell und warte in der ohrenbetäubenden Stille. Als die Herz-Lungen-Maschine die Aufgabe des Herzens wieder übernommen hat, spüre ich, wie die Anspannung im Raum sich löst wie ein heißer, abgestandener Seufzer.
»Geben wir ihm noch eine Minute«, sage ich und klemme die Aorta erneut ab. »Das arme Ding ist wahrscheinlich vollkommen fertig.«
»Sind wir das nicht alle?«, witzelt Dr. Burke mit einem aufmunternden Zwinkern über seine Brille hinweg.
Eine mitfühlende Geste, aber wir wissen beide, dass ich hier auf mich allein gestellt bin. Bis zu diesem Punkt ist jede Operation ein Gemeinschaftswerk: Dr. Burke kümmert sich um die Medikation, die Beatmung und die Überwachung der Parameter; Karin kontrolliert die Herz-Lungen-Maschine, der Arzt am Fuß des Tisches entnimmt das Stück Beinvene für die Transplantation. Jeder Spezialist hat seine eigene Assistenz. Neben mir steht Margot, die mir Besteck und Tupfer anreicht. Aber wenn es ums Herz geht, liegt die Verantwortung allein bei mir.
Eine Hitzewelle versengt mir den Rücken, kribbelt mir über die Schulterblätter.
Konzentrier dich.
Ich mustere die Brusthöhle. Der Bypass ist gut gelungen, die Transplantate sind sauber gesetzt, mit luftdichten Verbindungen. Wir haben dem Herz Zeit gegeben, sich zu erholen, haben einen Medikamentencocktail verabreicht, um die elektrische Aktivität zu stimulieren, und haben auf metabolische Abweichungen von der Norm oder andere Probleme getestet, die wir eventuell übersehen haben könnten. Ich habe mein Werk wieder und wieder gecheckt und noch einmal versäubert, in der Hoffnung, auf einen Fehler zu stoßen, den ich beheben kann. Nichts hat funktioniert.
Ich werfe einen Blick auf die Uhr. Wir nähern uns rasch dem Ende des Vierstundenfensters, das wir haben, bevor das Herz unwiederbringlich Schaden nimmt. Sobald das verstrichen ist, wird jede weitere Sekunde zu einem Nagel am Sarg unseres Patienten.
Auf meiner Oberlippe kribbelt der Schweiß. Ich muss an den Rat denken, den mir mein Mentor einst gegeben hat:
Zeige niemals, dass du nervös bist. Wenn du in Panik gerätst, geraten sie ebenfalls in Panik. Du kannst ein Schiff nicht in den Hafen bringen, wenn die Mannschaft über Bord gesprungen ist.
Ich greife in die Brusthöhle und umschließe das Herz des Patienten mit der Hand, drücke es ein paarmal leicht zusammen und lasse wieder los, in dem Rhythmus, in dem es so lange geschlagen hat. Dann entlasse ich es sanft aus meinem Griff. Das Fleisch ist da, wo ich es berührt habe, rosig geworden und sieht beinahe hübsch aus, wie eine von der Kälte gerötete Wange.
»Versuchen wir es noch ein letztes Mal«, sage ich.
Langsam löse ich die Aortenklemme, verlängere das Leben des Patienten, so lange ich kann. Das Blut strömt in das Herz.
Nichts geschieht.
Wieder drücke ich das Herz, doch auch nachdem das Kalium ausgespült ist, fühlt es sich seltsam kalt an, feucht und glitschig.
Komm schon, Peter.
Meine Schultern verspannen sich, als ich mich über den Tisch beuge und meine ganze Kraft in die Bewegung lege, mit der ich das Herz massiere. Schweiß sammelt sich auf meinem Gesicht. Margot tupft jeden Tropfen schweigend ab.
Ich weiß nicht genau, wie viel Zeit vergangen ist – eine Minute, zehn –, doch als ich von der Brusthöhle aufblicke, am ganzen Körper schwitzend und hinter meiner Maske schwer atmend, wird mir klar, dass das gesamte Team mich mitfühlend ansieht. Da trifft es mich mit voller Wucht.
Dieses Herz wird nie wieder schlagen.
Stressschmerzen pulsieren hinter meinen Augen; die verspannten Muskeln in meinen Schultern krampfen. Ich blicke auf meine Hände hinunter, die von der Anstrengung schmerzen und zittern, und erlaube mir einen winzigen Seufzer.
»Herz aus, bitte.«
Karin nickt und wendet den Blick ab. Ein Mensch wird heute sterben, und wir werden seinen Tod orchestrieren. Ich mit dieser Anweisung. Sie, indem sie den Schalter umlegt.
»Herz aus«, bestätigt sie.
»Lunge aus, bitte.«
»Lunge aus«, antwortet Dr. Burke.
Und dann warten wir.
Die Herz-Lungen-Maschine kommt zum Stillstand. Die Schläuche leeren sich, während das Blut in das Kreislaufsystem des Patienten zurückfließt. Und dann das Unvermeidliche: die flache Linie eines reglosen Herzens auf dem EKG-Monitor. Das Schrillen des EKG-Alarms gellt durch uns alle hindurch, füllt den OP-Saal, hallt von den Apparaten wider, von den gefliesten Wänden und jeder Edelstahlfläche.
Ich sehe auf die Uhr.
»Zeitpunkt des Todes: 16 Uhr 53.«
2
Anna
Mein herzliches Beileid.«
Ein schwächerer Chirurg hätte in diesem Moment vielleicht auf seine Schuhe hinuntergeblickt. Zu sehr auf sich selbst bedacht, um den Blick der Angehörigen des verstorbenen Patienten auszuhalten, in dem Moment, wo ihnen das Herz bricht. Aber ich sehe Mrs Downing in die Augen und werde Zeugin von allem: des beinahe tonlosen, erschrockenen Luftholens, als der Schlag sie trifft, der Tränen, die in ihren Augen glänzen und dann überquellen. Neben mir tritt Schwester Val aus der Kardiologie nervös von einem Fuß auf den anderen.
Ich habe Mrs Downing beim Erstgespräch mit ihrem Mann kennengelernt und gesehen, wie sie mein Büro mit hoffnungsvoll federnden Schritten verließ. Es war ein Routineeingriff mit sehr geringem Risiko. Mein Ruf und meine Erfahrung halfen ihr, nachts in den Schlaf zu finden, und sie waren es auch, die ihren Ehemann dazu brachten, die Einverständniserklärung zu unterschreiben. Bald, wenn sich der erste Schock gelegt hat, wird sie mich dafür hassen.
»Hat er gelitten?«, fragt sie mit brechender Stimme.
»Nein. Er hat nichts gespürt.«
Vielleicht hält sie mich für kaltherzig, dass ich ihr direkt in die Augen sehen kann, aber ich bin einfach nur geübt darin. Mit der Zeit habe ich gelernt, Angehörige eines Patienten nicht mit allzu viel Anteilnahme anzusehen, damit sie sich nicht bevormundet fühlen, aber auch nicht mit allzu viel Traurigkeit, die sie mit Schuldbewusstsein verwechseln könnten. Hätte ich zu breit gelächelt, als ich auf sie zukam, hätte ich Mrs Downing falsche Hoffnungen gemacht. Eine Herzchirurgin muss Herzen nicht nur reparieren können, sie muss auch wissen, wie sie sie am schonendsten bricht.
»Mrs Downing«, sage ich ruhig und umkurve behutsam ihren Schock, »meine Kollegin Val wird Sie jetzt begleiten und alle Ihre Fragen beantworten. Wenn Sie irgendetwas brauchen, zögern Sie bitte nicht, darum zu bitten.«
Val nimmt Mrs Downings Hand und führte sie behutsam zum Stuhl. Sie schafft es, ihr Schluchzen zurückzuhalten, bis ich die Tür hinter mir schließe; erst dann darf die britische Selbstbeherrschung sich in nichts auflösen.
Unwillkürlich schließe ich die Augen und hole tief Luft, um mich zu sammeln, bevor ich mich auf den Weg zur Umkleide mache. Ich habe seit Längerem keinen Patienten mehr verloren, und mit einem Mal überkommt mich die Angst, dies könne der Anfang einer Pechsträhne sein. Doch ich schlage mir diesen Gedanken schnell aus dem Kopf.
Das ist nicht ein Scheitern nach einer langen Reihe von Erfolgen. Bleib auf dem Teppich.
Doch ob aus Gewohnheit oder Überzeugung, ich weiß, dass ich diese OP so schnell nicht aus dem Kopf bekommen werde.
Ich betrete den Umkleideraum und reiße mir auf dem Weg zu meinem Spind den Kittel vom Leib, dann verliere ich mich rasch in Gedanken, während ich mich umziehe.
»Alles in Ordnung?«
Margot steht an dem Spind neben meinem und bindet sich das Haar zum Pferdeschwanz. Der Ansatz muss nachgefärbt werden.
»Alles gut.«
Im Geist bin ich die gesamte OP noch einmal durchgegangen, habe wie besessen jedes Detail noch einmal unter die Lupe genommen, auf der Suche nach dem Augenblick, als Mr Downings Herz zu versagen begonnen hatte. Offensichtlich gelingt es mir nicht so gut wie sonst, meine Gedanken zu verbergen. So was macht ein Scheitern mit einem: Es verbeult die Rüstung, erlaubt kurze Blicke auf die empfindlichen Stellen dahinter.
»Sie hätten nicht mehr tun können.«
»Ich weiß«, lüge ich. »Danke.«
Ich spüre ihren Blick einen Herzschlag zu lang auf meinem Gesicht ruhen. Meine Stimme hat ausdruckslos und direkt geklungen. Ohne Emotion. Sie muss mich für herzlos halten. Vielleicht hat sie recht.
Bevor ich den Todeszeitpunkt festlege, bin ich immer unmenschlich kalt. Ich wühle mit derselben emotionalen Anteilnahme in einer Brusthöhle herum wie ein Elektriker, der neue Leitungen legt. Ich denke nicht an den Menschen, der unter den OP-Tüchern liegt, oder verschwende auch nur einen Gedanken an die Familienangehörigen, die draußen darauf warten, dass ihre Welt sich entweder geraderückt oder implodiert. Ich würde verrückt werden, wenn ich das täte. Erst wenn ich den OP-Saal verlasse, lasten die Folgen meines Handelns auf mir, und ich spiele die ganze Prozedur immer wieder im Kopf durch.
»Bereit für Samstag?«, fragt sie flapsig.
Das hatte ich vergessen. Mr Downings OP hat mich abgelenkt. Der Stress sickert augenblicklich in mich zurück.
In zwei Tagen werde ich eine der wichtigsten Operationen meiner Karriere durchführen: drei verstopfte Arterien von Ahmed Shabir mit Bypässen überbrücken. Shabir ist Abgeordneter des Wahlkreises Redwood und, falls man den Gerüchten Glauben schenken darf, der künftige Vorsitzende der Labour Party. Von allen Eingeweihten wird er nur »Patient X« genannt; sie sind darauf eingeschworen, die Operation vor der Öffentlichkeit geheim zu halten, um seine Chancen bei der nächsten Wahl nicht zu beeinträchtigen. Es geht doch nichts darüber, das Schicksal eines potenziellen Premierministers in den Händen zu halten.
»Natürlich.«
Margots Handy klingelt. Sie wirft einen Blick auf das Display und steckt es in die Handtasche, wo es sich ausklingeln kann. Ich erhasche einen Blick auf den Namen Nick, bevor es in ihrem Spind verschwindet, und hole mein eigenes Telefon aus meiner Tasche, um die Nachrichten zu lesen, die Zack und ich uns im Lauf des Tages geschickt haben.
Zack
Ich will nicht allein fahren, bitte. Du hast versprochen, du kommst mit.
Das hatte er mittags geschickt. Während mein Sohn eigentlich spielen sollte, hatte er mir geschrieben und sich Sorgen gemacht. Zwischen zwei OPs hatte ich ihm geantwortet; mir war so übel vor schlechtem Gewissen, dass ich mein Essen nicht anrührte.
Ich
Ich möchte mehr als alles andere auf der Welt mit dir in die Ferien fahren, aber ich habe sehr kranke Patienten, die ohne meine Hilfe nicht gesund werden können. Wir fahren in den Sommerferien irgendwohin, nur du und ich. Überleg dir schon mal, wohin du willst, ich kümmere mich dann darum. XXX
Zack
Immer sind die wichtiger
Darauf war mir nichts eingefallen.
»Schon was vor heute Abend?«
Margot dreht sich eine Zigarette und fährt mit der Zungenspitze am Rand des Papierchens entlang, bevor sie sie zuklebt und sich hinters Ohr steckt.
Sie hat jetzt schon ein paarmal versucht, eine Freundschaft zwischen uns zu erzwingen, fast als wäre das eine Challenge, die sie für sich selbst ausgerufen hat. Aber ich vermische berufliche Beziehungen nicht mit persönlicher
Zuneigung. Wenn Kollegen zu vertraut miteinander werden, passieren unvermeidlich Fehler. Ein Operationssaal ist keine Entspannungsoase. Eine gewisse Anspannung ist für alle Beteiligten wesentlich sicherer.
Ich nehme meine Jacke aus dem Spind und streife sie über.
»Nein, nichts Besonderes. Mein Bruder nimmt morgen meinen Sohn über die Osterferien mit nach Cornwall, also bleibe ich heute Abend bei ihm zu Hause, bevor er morgen fährt.«
Sie kennt das Leben einer Angestellten im öffentlichen Gesundheitsdienst gut genug, um zu fragen, warum ich nicht mitfahre. Zumindest dafür bin ich ihr dankbar.
»Wie kommt er so zurecht mit allem?«
Meine Hand erstarrt am Reißverschluss.
»Bitte?«
Ihre Augen weiten sich angesichts der plötzlichen Schärfe in meiner Stimme. Sie lässt den Blick auf meine Hände fallen.
»Na ja, Sie tragen Ihren Ring nicht mehr.«
Meine Wangen brennen, Zorn wallt in mir auf. Ich nehme die Tasche aus dem Spind und knalle ihn zu.
»Das ist privat«, fauche ich und drehe mich zur Tür um. »Wir sehen uns morgen.«
»Ja«, antwortet sie stumpf und murmelt dann leise vor sich hin.
Zicke.
Ich bleibe an der Tür stehen, eine ganze Reihe Erwiderungen auf der Zunge, gehe dann jedoch hinaus und schließe die Tür mit leisem Klicken.
Als ich an meinem Auto ankomme, erstarre ich.
In der verzerrten Spiegelung der Autoscheibe wirkt mein Gesicht beinahe wie ein Totenschädel: dunkle, umschattete Augenhöhlen, scharfe Wangenknochen und ein vorspringendes Kinn.
Wer um Himmels willen soll dich jetzt noch wollen?
Ich steige ein und werfe meine Handtasche auf den Beifahrersitz. Der Motor springt mit einem müden Grummeln an, und lauwarme Luft bläst aus der Lüftung gegen die beschlagene Windschutzscheibe. Ich lehne mich zurück und schließe die Augen.
Zack wird inzwischen zu Abend gegessen und es sich auf dem Sofa vor dem Fernseher gemütlich gemacht haben, während Paula die Küche aufräumt und noch ein paar andere Hausarbeiten erledigt, auf die sie dabei stößt. Wenn mir früher, in der Stadt, eine meiner Nachbarinnen angeboten hätte, mein Kind von der Schule abzuholen und die Geschirrspülmaschine einzuräumen, hätte ich ihr die Tür vor der Nase zugeknallt und die Kette vorgelegt. Schon beeindruckend, was ein paar Meilen und nackte Verzweiflung alles ändern können.
Dies ist das erste Mal seit sechs Stunden, dass ich mich hinsetzen kann, und ich spüre jedes meiner Gelenke. Der Gedanke, noch mit dem Hund auf einen Abendspaziergang zu gehen, erfüllt mich mit Schrecken, aber dann denke ich an Bärs kleines Gesicht, und mein Herz sinkt. Zack den Hund zu besorgen, den er sich so sehr gewünscht hatte, würde meine Abwesenheit weniger spürbar für ihn machen, hatte ich gehofft. Doch ich hatte nichts erreicht, außer der Liste derjenigen, die ich anscheinend immer wieder enttäusche, noch einen weiteren Namen hinzuzufügen.
Ich denke an mein Spiegelbild im Autofenster, wie erschöpft ich ausgesehen habe, und klappe die Sonnenblende herunter, um mich in dem kleinen Spiegel genauer zu betrachten. Meine Haut ist bleich, mein Gesicht wirkt unter dem leichten Make-up abgespannt, und ich habe dunkle Schatten unter den Augen. Besagte Augen sind blutunterlaufen, während meine Lippen beinahe jede Farbe verloren haben. Mit den Fingerspitzen ziehe ich die Haut straff, um die Zeit zurückzudrehen, und erstarre, als ich ihn sehe.
Der Blutspritzer ist immer noch an meinem Hals.
Panisch beuge ich mich vor und kratze mit den Fingernägeln an meiner Haut, bis sie wund und rot ist, während mein Puls aufgeregt unter meinen Fingerspitzen trommelt. Das Blut ist getrocknet und blättert ab. Als der Fleck endlich weg ist, sind lange, gezackte Kratzspuren an seine Stelle getreten. Ich schließe die Augen und sinke gegen die Rückenlehne zurück.
Der Impuls ist wieder da.
Es hat schon die ganze Zeit an mir genagt, seit das Herz sich geweigert hat, wieder anzuspringen. Wie ein Wurm in meinem Gehirn, der sich unentwegt windet und meine Konzentration zerfrisst. Ich reiße die Augen auf. Die müde Frau im Spiegel erwidert gereizt meinen Blick.
Ich schäle den Streifen falscher Wimpern vom rechten Auge, um das beinahe wimpernlose Lid bloßzulegen. Nur hier und da ist noch eine übrig.
Seit Wochen habe ich dem Drang nicht mehr nachgegeben. Einen Abend lang habe ich an losen Fäden gezogen, als ich auf dem Sofa saß, habe an meinen Nagelhäuten gezupft, bis sie bluteten, habe alles getan, um mich von dem einen abzulenken, das mich wirklich beruhigt: dem Zwang, der mich heimsucht, solange ich mich erinnern kann.
Meine Fingerspitzen kribbeln, als ich mir vorstelle, wie ich sie an die Augenlider hebe. Ich balle die Hände zu Fäusten, um das Verlangen zu zerquetschen, und zerdrücke dabei versehentlich die falschen Wimpern. Mit einem Fluch versuche ich, den Streifen wieder glatt zu ziehen, aber vergebens: Die Wimpern sind verkrumpelt wie die Beine einer toten Spinne, die steif in ihrem Netz hängt. Ich ziehe auch den anderen Streifen ab, drücke sie beide zu einem Ball zusammen und werfe sie in den Fußraum des Beifahrersitzes.
Der Drang ist nicht vergangen. Ich schiebe die Ärmel der Jacke hoch und inspiziere die Haare auf meinem Unterarm. Blonde, mürbe kleine Dinger, einige ziemlich schräg gewachsen, andere zweigeteilt nach Jahren des Ausreißens. Wenn ich es schon tue, sage ich zu mir selbst, dann sollte ich den Arm nehmen. Leichter zu verbergen. Weniger demütigend. Aber es ist einfach nicht dasselbe.
Zögernd hebe ich die Hand ans Auge, als könnte ich mich selbst überlisten, und betaste eine Wimper. Das Verlangen wird stärker, bis ich an nichts anderes mehr denken kann: Dieser eine, zwanghafte Gedanke blockiert wie ein dicker Stein mein Gehirn. Ich rolle die Wimper zwischen meinen Fingerspitzen, um den Moment voll auszukosten. Mir wird ganz schwindelig von dem Tauziehen in meinem Kopf, bevor ich schließlich nachgebe: und zupfe. Ein winziges Ploppen, gefolgt von unmittelbarer Erlösung. Erleichterung flutet über mich hinweg. Ich vollende das Ritual, indem ich die Wimper auf meine Zunge lege.
Dann schrecke ich zusammen, weil mein Handy klingelt, und erhasche dabei einen kurzen Blick auf mein Gesicht im Spiegel. Meine Wangen sind rosig vor Ärger, und ich schäme mich dermaßen, dass ich meinen eigenen Blick nicht erwidern kann.
Ich bin irre. Eine kranke, perverse Irre.
Ich schlucke die Wimper hinunter und reiße das Telefon aus der Tasche. Adams Name steht auf dem Display. Ich nehme den Anruf über die Freisprechanlage an und fahre los.
Sieh einfach zu, dass du nach Hause kommst.
»Hi«, sage ich verblüfft.
»Hi, alles okay?«
»Ja, ja. Und bei dir?«
»Auch. Ich bin gerade in Amsterdam gelandet, dienstlich, und dachte, ich melde mich mal.«
Es entsteht eine lange, angespannte Pause. Wir haben erst ein paar Worte gewechselt, und doch spüre ich bereits, wie sich mir die Nackenhaare sträuben. Ich erreiche die Ausfahrt des Parkplatzes und biege auf die Hauptstraße ab. Nicht mehr weit, und ich bin zu Hause.
»Bist du im Auto?«, fragt er.
»Ich komme gerade von der Arbeit. Gibt’s einen Grund, warum du anrufst?«
Ich halte an einem Zebrastreifen, während Adam am anderen Ende zögert. Eine Frau humpelt auf einen Rollator gestützt über die Straße, gebeugt, um das Gesicht vor dem eiskalten Wind zu schützen.
So wirst du auch bald sein, sagt die Stimme in meinem Kopf. Faltig und einsam.
Ich knirsche mit den Zähnen, bis die Kieferknochen knacken.
»Mein Anwalt will noch mal über das Geld verhandeln«, sagt Adam schließlich.
Das Lenkrad ächzt unter meinem Griff. Ich trete aufs Gaspedal. Der Motor heult auf, sodass die alte Frau zusammenzuckt, als sie den Bürgersteig auf der anderen Seite erreicht.
»Nein, du willst noch mal verhandeln.«
»Es tut mir leid, Anna.«
»Wenn du mehr verlangst, muss ich das Haus verkaufen. Das weißt du. Zack tut sich sowieso schon schwer mit den ganzen Veränderungen.«
»Ich bin pleite.«
Ich schnaube. »Wir sind alle pleite.«
»Nein, ich meine richtig pleite.«
Ich biege von der Hauptstraße ab und fahre The Avenue entlang, eine lange, gewundene Straße mit weit auseinanderstehenden Häusern. Meins liegt direkt hinter der Kurve am Ende einer kleinen privaten Stichstraße, nicht einsehbar von den anderen Häusern aus. Daneben sind nur Paulas Haus und ein kleines Wäldchen, das uns vom hinteren Teil des Krankenhausgeländes abgrenzt. Wenn ich daran denke, wie Adam und ich vor gut einem Jahr zum ersten Mal hierhergefahren sind in dem Glauben, ein Umzug aus London, aus der Stadt heraus, würde uns retten! Verzaubert von den langen Gartenwegen und der Vorstellung unseres eigenen kleinen Refugiums abseits des Getümmels.
»Der Grund, weshalb wir ein kleines Vermögen für unsere Anwälte ausgeben, ist, dass die für uns verhandeln«, sage ich, während ich in die Privatstraße einbiege. »Du hast mir versprochen, dass wir die Scheidung denen überlassen und unsere Kommunikation auf Zack konzentrieren.«
Kleine Steinchen prasseln gegen den Unterboden des Wagens. Links stehen Hecken, rechts ist der Wald. Weiter vorne taucht das Dach meines Hauses allmählich zwischen den Bäumen auf.
»Mein Anwalt hat dich kontaktiert, Anna. Du hast nicht reagiert.«
»Mein Gott, ich versuche hier, einen Vollzeitjob mit dem Dasein als Alleinerziehende unter einen Hut zu bekommen! Nimm mal ein bisschen Rücksicht darauf.«
Ich komme an meine Zufahrt und trete voll auf die Bremse.
Adam verteidigt sich, aber ich höre seine Worte nicht mehr. Meine gesamte Aufmerksamkeit wird von den Transportern einer Umzugsfirma beansprucht, die meine Auffahrt zuparken. Meine Haustür steht sperrangelweit offen, und als ich genauer hinsehe, erkenne ich Silhouetten hinter den Fenstern, die sich bewegen.
Da sind Leute in meinem Haus.
3
Anna
Ich hole so scharf Luft, dass ich beinahe daran ersticke. Das Geräusch stoppt Adam mitten im Satz.
»Was ist denn?«
»Da sind Gerichtsvollzieher im Haus!«
»Was?«
»Gerichtsvollzieher! Hier stehen überall Umzugswagen. Es sind Leute drin …«
»Bist du sicher? Wie sollen die denn reingekommen sein?«
»Spielt das jetzt eine Rolle? Wie pleite bist du genau?«
»Hör mal, dreh jetzt nicht durch, es wird alles gut. Ich kümmere mich darum. Ich sorge dafür, dass ich alles zurück…«
Ich lege auf, ziehe die Handbremse und stolpere benommen aus dem Auto. Hinter mir läuft der Motor weiter, und die Fahrertür steht offen, es piept vom Armaturenbrett. Ich kann an nichts anderes mehr denken als an Zack, der zusehen muss, wie Fremde sein Zuhause plündern. An seine Augen, die vor Tränen überquellen, während unser Hab und Gut Stück für Stück zur Tür hinausgetragen wird.
Oh, Gott. Paula muss sie direkt reingelassen haben. Sie ist einfach zu gut für diese Welt. Und so läuft das dann, oder? Wenn sie erst mal drin sind, haben sie freie Bahn und nehmen alles mit, was irgendwie von Wert ist. Denen ist egal, was Adam gehört und was mir.
Zwei Männer in schwarzen Overalls kommen heraus und gehen zu einem der Transporter.
»Stopp!«
Sie setzen ihr Gespräch in einer Sprache fort, die ich nicht verstehe, und gehen zum hinteren Teil des Fahrzeugs. Ich marschiere zu ihnen und pikse den Mann, der mir am nächsten steht, mit dem Finger in die Schulter.
»Entschuldigung.«
Der Fremde fährt herum. Er ist jung und sieht gut aus, mit braunen Augen und einem dunklen Dreitagebart. Er murmelt irgendetwas Giftiges, bevor er mir wieder den Rücken zudreht. Ein kleiner Spucketropfen ist auf meiner Wange gelandet. Ich wische ihn hastig weg und säubere meine Hand am Hosenbein.
»Hören Sie, was immer Sie hier vorhaben, es hat nichts mit mir zu tun. Mein Mann und ich lassen uns scheiden. Er wohnt hier nicht mehr, und er hat alles, was ihm gehört, mitgenommen … Hören Sie mir überhaupt zu?«
Die Männer reden immer noch miteinander, lachen mit den Rücken zu mir. Selbst wenn sie kein Englisch verstehen, würden sie mich doch normalerweise nicht einfach so ignorieren? Ich bin kurz davor, sie anzuschreien, als mich das Geräusch einer Bohrmaschine erschreckt und ich herumwirbele.
Es kommt aus meinem Haus.
Das Herz in der Kehle, renne ich zur Tür und sehe, dass der Boden mit Plastikplanen bedeckt ist. Sie knistern unter den Schuhen der Fremden, die durch meine Küche gehen, durch mein Esszimmer, sich auf der Treppe begegnen. Wo ich auch hinsehe, sind Männer mit kurz geschorenem Haar, dicken Muskeln, Tattoos, die unter dem Kragen hervorlugen, und schwarzen Handschuhen an den Händen. Der Gedanke, dass sie damit meine Sachen durchwühlen, ist so verletzend, dass ich ein Schluchzen gerade eben noch ganz hinten in der Kehle abfangen kann.
Ich trete durch die Tür und zucke zusammen, als ich aus dem Augenwinkel etwas über mir hängen sehe. Ein Mann starrt von einer hohen Leiter auf mich herab, den Bohrer in der Hand.
So wie es aussieht, montiert er eine kleine Kamera an der Wand.
Ich mache den Mund auf, um etwas zu sagen, als Putz in einer dicken Wolke auf mich herabregnet. Hustend und spuckend stolpere ich in den Flur, während hinter mir die Bohrmaschine dröhnt.
»Zack? Zack?«
Ich habe Staub in den Augen, der bei jedem Blinzeln schmerzhaft scheuert. Durch die Tränen hindurch erblicke ich einen riesigen Kerl, der die Treppe herunterkommt. Jede Stufe ächzt unter seinem Gewicht.
Wie viele sind das?
»Paula?«, rufe ich. Der Bohrer übertönt meine Stimme. »PAULA?«
Ich reibe mir die Augen, woraufhin es nur noch mehr wehtut, als der Staub tiefer ins Auge eindringt. Blind vor Tränen drehe ich mich im Flur um.
Bär müsste doch bellen. Warum bellt er nicht?
»Zack?«, brülle ich, genau in dem Augenblick, als die Bohrmaschine verstummt. Meine Stimme hallt durch den Eingangsbereich und trägt die Treppe hinauf bis zum Absatz. Mein Entsetzen schwingt schwer darin mit, selbst in ihrem Echo.
Paula muss Zack mit nach drüben genommen haben. Zumindest muss er das nicht mitan…
»Dr. Jones?«
Schwer atmend drehe mich zur Wohnzimmertür um.
»Setzen Sie sich doch zu uns«, sagt eine Stimme von drinnen.
Die lässige Einladung in mein eigenes Wohnzimmer genügt, um Kummer und Angst verfliegen zu lassen. Glühende Wut tritt an ihre Stelle; mir wird ganz heiß vor Zorn. Ich wische mir schnell die Tränen ab und eile ins Wohnzimmer.
Drei Männer blicken mir entgegen: zwei sitzen auf dem Sofa und einer im Sessel, jeder mit einem meiner Becher in der Hand.
»Setzen Sie sich«, sagt der Mann im Sessel mit derselben ruhigen Stimme wie eben. Die anderen beiden beobachten mich gespannt.
»Was glauben Sie eigentlich, mit wem Sie hier reden? Verschwinden Sie sofort aus meinem Haus!«
»Setzen. Sie. Sich.«
Der Mann sieht mich so eindringlich an, dass ich zurückzucke, als unsere Blicke sich treffen. Ich bin so wütend, dass ich zittere, und doch ertappe ich mich dabei, wie ich mich gehorsam in den freien Sessel am Kamin sinken lasse.
Der Mann mir gegenüber ist etwa vierzig. Sein dunkles Haar weist erste graue Haare auf, sein Anzug und das Hemd darunter wirken etwas zu eng für den muskulösen Körper. Die Männer auf dem Sofa scheinen jünger zu sein und sind über und über tätowiert. Einer hat den Schädel kahl geschoren und einen kräftigen Kiefer, der andere kurzes blondes Haar und Aknenarben auf den Wangen. Aus der Ecke über ihren Köpfen beobachtet mich eine winzige Kamera. Ich hätte sie vielleicht gar nicht bemerkt, hätte sich nicht die untergehende Sonne auf der anderen Seite des Fensters in der Linse gespiegelt.
Ich drehe mich im Sessel um, halte Ausschau nach weiteren Kameras und finde eine an der gegenüberliegenden Wand. Sie ist so klein wie meine Fingerspitze und ganz weiß, sodass sie fast nahtlos mit dem weißen Hintergrund der Wand und der Decke verschmilzt. Wenn man nicht wüsste, wonach man suchen muss, würde man sie kaum wahrnehmen.
Das sind keine Gerichtsvollzieher.
»Die werden Sie überall im Haus finden«, sagt der Mann, der mir gegenüber im Sessel sitzt.
Seine Gegenwart allein ist Respekt einflößend, von seiner tiefen, rauen Stimme bis zu seinem muskulösen Körper, der beinahe den Sessel sprengt. Am beeindruckendsten sind allerdings seine Augen, ein kaltes, durchdringendes Blau, so klar und so bedrohlich, dass ich das Gefühl habe, unter ihrem Blick in meinem Sessel immer kleiner zu werden.
»Was geht hier vor?«, frage ich verzagt. »Wo ist mein Sohn?«
Der Mann beugt sich vor und stellt den Becher auf dem Couchtisch ab. Den Becher, den ich jeden Morgen benutze. Den Zack für mich bemalt hat, zum Geburtstag vor zwei Jahren. Für die beste Mummy, steht darauf, unterschrieben und datiert. Der Becher ist mit gelben Sternen und unregelmäßigen kleinen Herzen bedeckt. Ein Klumpen bildet sich in meiner Kehle.
»Was ich Ihnen jetzt sage, ist sehr wichtig. Ich werde mich nicht wiederholen, also hören Sie gut zu.«
Ich mache den Mund auf, um zu protestieren.
»Ihre Nachbarin ist tot.«
Er sagt das so beiläufig, dass ich die Bedeutung seiner Worte beinahe nicht erfasse. Doch als mir klar wird, was er gesagt hat, trifft es mich wie ein Schlag. Ein hohes, durchdringendes Pfeifen schrillt in meinem Kopf.
»Und wir haben Ihren Sohn.«
4
Anna
Erstarrt sitze ich in dem Sessel den Männern gegenüber.
Für den Bruchteil einer Sekunde hört die Welt auf, sich zu drehen. Mein Hirn ist leer. Mein Herz stockt. Mein Atem bleibt in meiner Lunge stecken. Und dann kommt alles krachend wieder zurück. Ich ringe heiser um Luft, während die Tränen in meinen Augen brennen.
Das ist nicht real … es kann nicht real sein …
»Dr. Jones, bleiben Sie bei mir. Es ist wichtig.«
Ich nicke gehorsam, während eine einzelne Träne still über meine Wange rollt.
»Ihr Sohn ist an einem sicheren Ort, und ihm wird nichts passieren, solange Sie tun, was wir Ihnen sagen. Es gibt Regeln, die Sie befolgen müssen. Wenn Sie dagegen verstoßen, wird Ihr Sohn den Preis dafür bezahlen.«
Dieser Mann, dieser Fremde, setzt meine eigenen Tricks gegen mich ein. Er schlägt denselben Ton an, den ich Angehörigen gegenüber benutze, wenn ich ihnen mitteile, dass mein Patient gestorben ist: mitfühlend, aber dennoch fest. Mein herzliches Beileid.
»Sie müssen nur eine einzige, einfache Aufgabe erledigen, um ihn gesund und munter zurückzubekommen.«
Mein Herz macht einen Sprung, so schnell und gewaltsam, dass der Schmerz durch meine Brust schneidet.
»Eine … eine Aufgabe?«, frage ich mit vor Angst rauer Stimme.
»In zwei Tagen werden Sie Ahmed Shabir auf Ihrem OP-Tisch sterben lassen.«
Mein Magen fühlt sich an, als würde ich fallen. Mir wird übel. Vor meinen Augen verschwimmt alles. Im verzweifelten Bemühen, die Bodenhaftung zurückzugewinnen, umklammere ich die Armlehnen des Sessels und drücke die Fersen in den Teppich.
»Wenn Sie irgendjemandem gegenüber auch nur ein Wort darüber verlieren, stirbt Ihr Sohn. Wenn Sie auffliegen, während Sie Ihre Aufgabe erfüllen, stirbt Ihr Sohn. Wenn es Ihnen nicht gelingt, den Patienten zu töten, stirbt Ihr Sohn an seiner Stelle.«
Die beiden Männer auf dem Sofa beobachten mich so intensiv, dass ihre Blicke auf meiner Haut brennen, aber ich kann die Augen nicht von dem Mann mir gegenüber lassen. Er verlangt Unmögliches von mir. Nicht nur ethisch, sondern auch praktisch. Allein der Gedanke an die Konsequenzen treibt mir frische Tränen in die Augen. Ich möchte ihn fragen, warum, doch er spricht weiter, bevor ich das tun kann.
»Die Schlösser Ihres Hauses wurden ausgetauscht, wir können also jederzeit kommen und gehen. Und die Kameras überwachen rund um die Uhr jede Ihrer Bewegungen. Hier ist das Telefon, mit dem wir Ihnen die nächsten Anweisungen geben werden.«
Ich starrte benommen auf den Tisch. Da liegen ein neuer Schlüsselbund, ein billiges Wegwerfhandy und zwei kleine SIM-Karten.
»Für Ihr privates und für Ihr Diensthandy«, sagt er, als er meinem Blick folgt. »Wir verfolgen Ihre Bewegungen und zeichnen Ihre Gespräche auf.«
Von draußen höre ich Stimmen und drehe mich um. Die Männer, die ich vorhin im Flur gesehen habe, machen sich jetzt an meinem Auto zu schaffen.
»Sie bauen einen GPS-Tracker ein«, erklärt er. »Wenn Sie versuchen, ihn zu entfernen, werden wir das erfahren.«
Das ist nicht real, sage ich mir und merke, dass ich auf dem Sessel sachte vor und zurück schaukele. Ich beiße mir von innen auf die Wange, um etwas anderes zu spüren als den grausamen Schmerz hinter meinen Rippen.
»Wir beobachten jede Ihrer Bewegungen«, sagt er und greift dabei unter seine Jacke. »Und wenn Sie einen Fehler machen, dann kann ich Ihnen versichern: Sie werden es bereuen.«
Er zieht die Hand wieder heraus und legt sanft eine Pistole auf den Glastisch. Es klirrt kaum hörbar, als sie auf das Glas trifft.
»Denken Sie daran, Dr. Jones: eine einzige, einfache Aufgabe, und all das hört auf.«
Äußerlich zeige ich keine Regung, während ich auf die Waffe auf meinem Couchtisch starre. In mir überschlagen sich die Gefühle. Meine Augen füllen sich immer wieder mit Tränen, wenn mir meine Hilflosigkeit klar wird, bevor sie trocknen, wenn die Wut durch mich hindurchschießt. Ich fühle mich schwach und bin gleichzeitig aufs Äußerste gespannt, reagiere auf das leiseste Geräusch. In meinem Gehirn feuern sämtliche Nervenenden haltlos in alle Richtungen.
Und dann, aus dem Nichts heraus, schockiere ich alle im Raum. Ich lache.
Ich lache, bis mir die Tränen übers Gesicht rinnen und das Atmen schmerzt. Ich spüre, wie ich rot anlaufe. Die Männer beobachten mich in steinernem Schweigen.
»Das ist ein Scherz«, sage ich und wische mir die Tränen ab.
Sie starren mich wortlos an.
Mein Lachen erstirbt schlagartig.
»Wo ist er?«, fragte ich panisch. »Wo ist Zack?«
Der Mann mustert mich grimmig schweigend.
»Zack?«, rufe ich zum Eingang, löse meinen Blick langsam von dem Mann im Sessel. »Zack?«
Ich springe auf, renne zur Treppe, nehme immer zwei Stufen auf einmal und gerate oben ins Stolpern. Durch meine Schlafzimmertür lacht mich ein Mann aus. Er steigt von einer Leiter, nachdem er auch dort eine Kamera angebracht hat. In der Hand hält er eine weitere, und ich starre auf die winzige weiße Linse und die Kabel, die hinten herausragen.
»Zack?«
Ich rappele mich wieder auf und renne den Flur entlang zu seinem Zimmer, wo mich ein weiterer Mann erwartet, der gerade eine Kamera in der Ecke des Raumes testet.
»Raus!«
Er zuckt erschrocken zusammen und fährt zu mir herum. Als er meinen Gesichtsausdruck sieht, senkt er den Blick, murmelt etwas in seiner Sprache und schlüpft an mir vorbei nach draußen.
Zacks vertrauter Geruch erfüllt meine Brust. Sein Bett ist gemacht und das Zimmer aufgeräumt, abgesehen von dem Zipfel des Schlafanzugoberteils, das aus dem Wäschekorb ragt. Mich überkommt das plötzliche Verlangen, mein Gesicht darin zu vergraben und seinen Geruch tief in mich aufzusaugen.
Zack ist nicht hier.
Seine Abwesenheit trifft mich augenblicklich wie ein Schlag. Bisher hatte ich es noch nicht wirklich realisiert, doch jetzt, als ich sein Zimmer betrachte, seine Spielsachen, den Schlafanzug, den ich ihm erst heute Morgen ausgezogen habe, trifft es mich. Er ist wirklich fort. Ein verzweifelter Laut hallt in meiner Kehle wider, gefangen zwischen einem Schluchzen und einem Winseln.
Nein. Das kann nicht sein.
Ich knalle die Tür zu und laufe in alle Zimmer, reiße in wilder Panik Türen auf und rufe seinen Namen, zwischen den Männern hindurch, die überall in meinem Haus sind, und ignoriere ihr höhnisches Lachen. Übelkeit überkommt mich in Wellen. Ich renne und bleibe stehen, renne und bleibe wieder stehen. Der Drang, mich zu übergeben, presst mir den Magen zusammen, während Säure in meinem Rachen aufsteigt. Ich stürme die Treppe wieder hinunter und renne in die Küche.
Auf der Abtropffläche sollten Töpfe und Pfannen trocknen, zusammen mit dem Teller und dem Besteck, mit dem Zack zu Abend gegessen hat. Aber die Fläche ist leer, und ich sehe nur ein paar eingetrocknete Spritzer Marmelade neben dem Toaster, wo ich uns heute Morgen in aller Eile Frühstück gemacht habe.
»ZACK?«
Meine Stimme brüllt zu mir zurück. Schwer atmend stehe ich in der Mitte des Raumes.
Nebenan. Er muss nebenan sein.
Ich eile wieder nach draußen, durch den Flur, zur Tür, an dem Mann auf der Leiter vorbei. Er ruft mir irgendetwas nach. Ich hoffe, er fällt herunter und schlägt sich auf seinem eigenen Werkzeug den Schädel ein.
Die kühle Luft trocknet die Tränen auf meinen Wangen. In meinem Auto sitzt ein Mann, er fährt es beiseite, damit die Transporter vom Grundstück herunterkönnen, während ein anderer meine Tasche durchwühlt, die ich auf dem Beifahrersitz habe liegen lassen. Alles passiert viel zu schnell, am liebsten würde ich sie alle anschreien, dass sie langsamer machen, mir einen Augenblick Zeit lassen sollen, damit ich das alles verstehen kann.
Ich sprinte die Zufahrt entlang, Schweiß läuft mir über den Rücken, haste über Paulas Rasen zur Tür und hämmere mit den Fäusten dagegen.
»Zack? Paula?«
Als sich niemand regt, werfe ich eine der Kübelpflanzen neben dem Eingang um. Erde spritzt über meine Schuhe, und ich buddele in dem Topf nach dem Ersatzschlüssel. Mir wird schwindelig, ich stütze mich auf der Türschwelle ab, zittere auf Händen und Knien.
Reiß dich zusammen.
Als ich die Augen wieder öffne, sehe ich den Schlüssel in der Erde glitzern.
Ich schnappe ihn mir und rappele mich auf. Meine Hände sind voller Erde, und meine Knie ebenfalls. Inzwischen zittere ich so heftig, dass es mir schwerfällt, den Schlüssel ins Schlüsselloch zu stecken; dann drehe ich ihn mit solcher Gewalt, dass ich fürchte, er bricht ab.
Die Tür schwingt auf.
»Paula?«
Ich erwarte, dass sie mir antwortet, erwarte, Zack um die Ecke laufen zu sehen, um mich zu begrüßen, während Bär aufgeregt um ihn herumspringt.
Stille erfüllt das Haus.
Ich haste durch den Flur, kontrolliere als Erstes die Küche und sehe dann im Wohnzimmer nach, bevor ich am Kamin stehen bleibe, um wieder zu Atem zu kommen. Es dröhnt in meinen Ohren, die Stille im Haus drängt von allen Seiten auf mich ein.
Sie sind nicht hier, und doch, selbst mit allen Beweisen vor Augen, kann ich es nicht begreifen. Wenn ich weitersuche, wenn ich weiterrenne, dann werde ich sie finden, gesund und munter. Das kann nicht real sein. Mein ganzer Körper zittert, das Atmen schmerzt, das Denken schmerzt, und mit jedem neuen Gedanken, der mein überlastetes Gehirn überfällt, wird es schwieriger, klar zu denken, und es schüttelt mich noch heftiger. Ich bleibe eine ganze Weile in der Mitte des Zimmers stehen und starre ein gerahmtes Foto von Paula und ihrer Tochter auf dem Kaminsims an.
Vielleicht sind sie mit Bär spazieren gegangen, um ihre Ruhe zu haben. Das sähe Paula ähnlich.
Aber hätte sie mich dann nicht angerufen?
Instinktiv taste ich meine Taschen nach dem Handy ab. Mein Herz sinkt, als mir einfällt, dass ich es in der Handtasche gelassen habe. In derselben Handtasche, in der diese fremden Männer eben herumgewühlt haben.
Ich mache auf dem Absatz kehrt, folge der Spur aus Erde, die ich von der Eingangstür hereingetragen habe, und sprinte dann erneut über den Rasen. Es wird allmählich dunkel, und ich muss mich anstrengen, um den Boden unter meinen Füßen zu sehen. Männer kommen einer nach dem anderen aus meiner Haustür. Andere packen ihre Ausrüstung zusammen, Autotüren knallen.
Sie dürfen nicht wegfahren, solange ich nicht weiß, wo er ist.
Ich stürze zurück ins Haus und kippe hintenüber, als mir die Abdeckplane unter den Füßen weggezogen wird. Meine Hüfte schlägt als Erstes auf dem Boden auf; der Schmerz schießt mir den Oberschenkel hinab. Benommen blicke mich um.
Ein Mann steht am anderen Ende des Eingangsbereichs, die Abdeckplane in den Händen, die er offensichtlich gerade für den Transport zusammenrollt. Ein schadenfrohes Grinsen umspielt seine Lippen. Als er lacht, überkommt mich das sofortige Verlangen, dieses Lachen aus ihm herauszuwürgen. Ich rappele mich auf und stolpere ins Wohnzimmer, wo die drei Männer inzwischen aufgestanden sind und mir erwartungsvoll entgegensehen.
»Wo ist mein Sohn?«
Ich werfe mich mit solcher Wucht auf den Mann mit den kalten blauen Augen, dass er rückwärts taumelt, und packe ihn am Kragen.
»Wo ist er?«
Ich hämmere mit den Fäusten gegen seine Brust, schlage wild und verzweifelt auf ihn ein und treffe dabei seine Nase. Blut schießt aus den Nasenlöchern.
Hände packen mich von hinten und reißen mich so heftig zurück, dass sie mich beinahe vom Boden heben, rammen mich mit einem ohrenbetäubenden Krachen gegen die Wand. In meinem Genick knackt etwas. Vor meinen Augen dreht sich alles. Ich kann das Blut aus der Nase des Mannes riechen, den scharfen Atem des anderen, der mich an die Wand drückt.
»Stopft ihr das Maul.«
Eine große Hand in Handschuhen legt sich über meine Lippen.
»LASS DAS!«, höre ich, als ich in die Handfläche des Fremden beiße. Mein Kopf wird noch einmal gegen die Wand geknallt, und heißer, beißender Schmerz fetzt meine Wirbelsäule entlang. Der Raum dreht sich wild. Ich ringe nach Luft und durchfeuchte das Leder des Handschuhs.
Ich krieg keine Luft.
Der blauäuige Mann scrollt durch sein Handy und zieht dabei das Blut in der Nase hoch. Sein Gesicht wird vom Display in ein geisterhaftes weißes Licht getaucht. Als er es mir hinhält, blinzele ich gegen dieses Licht an.
Es ist ein Foto von Paula. Ihre Haut ist grau. Ihre Augen sind offen, die Lippen leicht geöffnet. Auf ihrer Stirn klafft ein dunkles Loch, das bis tief in den Schädel reicht. Es sieht aus, als sei ihr Leichnam in irgendeinem Straßengraben liegen gelassen worden; schwarzes Wasser hat ihre Kleidung durchtränkt.
Ich schreie in die Handfläche des Fremden und schluchze so heftig, dass die beiden Männer mich gegen die Wand drücken müssen, um mich aufrecht zu halten. Und doch kann ich die Augen nicht von dem Bild abwenden. Der Mann steckt sein Handy wieder in die Jackentasche.
»Wenn Sie nicht tun, was Ihnen gesagt wird, wird Ihr Sohn sich zu ihr gesellen. Ich jage ihm die Kugel persönlich in den Kopf, verstanden?«
Die Hand löst sich von meinem Mund. Ich ringe keuchend nach Luft.
»Weshalb sollte ich Ihnen glauben? Woher soll ich wissen, dass er nicht schon längst tot ist?«
Ich brülle, ich schluchze, ich kann mich nicht beherrschen. Er starrt mich mit diesen kalten blauen Augen an und seufzt. Ein Tropfen Blut fällt aus seiner Nase und landet zwischen seinen Füßen. Er holt sein Telefon abermals hervor und hält es sich ans Ohr. Wir warten alle, lauschen dem fernen Klingeln.
»Hol ihn ans Telefon«, sagt er.
Er tritt auf mich zu, und ich weiche zurück. Ich höre ein Rascheln, wie Hosenbeine, die aneinanderreiben, und das Geräusch von Schritten auf einem harten Boden. Eine Tür öffnet sich knarrend. Ich atme schwer, mein Blick jagt zwischen den Männern hin und her.
»Mummy?«
Seine Stimme zu hören, ist wie ein Schlag in den Magen. Ich erstarre mit offenem Mund, während die Tränen über mein Gesicht laufen.
»Baby?«
Zack bricht in Tränen aus, als hätte er die ganze Zeit versucht, tapfer zu sein. Ich habe ihn noch nie so aufgelöst erlebt und sehne mich danach, ihn in die Arme zu schließen, sein Haar zu streicheln und jeden Zentimeter seines Gesichts zu küssen. Bei dem Gedanken an die Entfernung zwischen uns muss ich noch heftiger weinen. Ich beiße mir auf die Lippe, um mich zu fangen, und zwinge die Worte so klar und deutlich heraus, wie nur irgend möglich.
»Baby, hör mir gut zu. Hörst du mir zu? Es wird alles gut. Ich verspreche dir, dass ich dich zurückhole. Hörst du mich?«
»Mu-mu-mummy …«
Jeder Schluchzer ist quälend. Meine Brust steht in Flammen. Die Männer könnten mich jetzt schlagen, sie könnten mich würgen, mir eine ganze Salve Kugeln in den Kopf jagen, nichts davon würde an diesen Schmerz heranreichen.
Der Mann nimmt mir das Telefon vom Ohr.
»Nein! Ich hab ihm noch nicht gesagt, dass ich ihn lieb habe!«
Die Hand in dem Handschuh hebt sich zu meinen Lippen.
»Bitte!«
Sie presst sich auf meinen Mund. Als er das Gespräch beendet, geben meine Beine nach. Die beiden Männer ziehen mich wieder hoch.
»Jetzt wissen Sie, was auf dem Spiel steht, oder?«
Ich nicke heftig hinter der behandschuhten Hand, die inzwischen nass von meinen Tränen ist.
Ich krieg keine Luft. Ich krieg keine Luft. Ich krieg keine Luft.
»Lass sie reden.«
Die Hand löst sich von meinem Mund. Ich hole tief Luft und atme in einem verzweifelten Schluchzen aus.
»Ja!«
Die Männer lassen mich los. Ich breche auf dem Boden zusammen und lande auf dem Steißbein.
Durch den Tränenschleier sehe ich zu, wie die beiden Schläger den Raum verlassen und der Mann, dem ich auf die Nase gehauen habe, etwas aus seiner Tasche holt. Mein Handy. Er nimmt die SIM-Karte heraus, ersetzt sie durch eine vom Tisch und wiederholt das Ganze mit meinem Diensttelefon. Auf der Zufahrt leuchten in rascher Abfolge Scheinwerfer auf und erhellen den Raum so grell, dass ich die Augen zusammenkneifen muss und kaum noch etwas sehen kann. Ich lehne mich gegen die Wand, in meinem Kopf dreht sich alles; ich lausche auf das Brummen der Motoren draußen, die entfernten Schritte, Wortwechsel in einer Sprache, die ich nicht verstehe.
»Eine einfache Aufgabe, Dr. Jones«, sagt der Mann mit den blauen Augen. »Mehr ist es nicht.«
Die Tür schlägt hinter ihm zu, das Geräusch durchzittert das gesamte Haus.
Ich weine eine Weile, sitze an der Wand, die Arme um die Knie geschlungen und wiege mich vor und zurück, Speichelfäden zwischen den Lippen. Als der Schwindel aufhört, öffne ich die Augen.
Es ist dunkel. Das Haus ist still.
Sie sind weg. Einfach so.
5
Margot
Ich bin kein schlechter Mensch. Das sage ich mir immer wieder.
Ich werfe einen verstohlenen Blick über die Schulter und lege den Kopf schief, um zu lauschen. Der Raum ist wie ein Labyrinth, die Spinde formen enge schmale Gänge und bilden zahllose Ecken, in denen sich jemand verstecken könnte. Doch alles, was ich höre, ist das Gurgeln in den Rohren an den Wänden und schwaches Stimmengemurmel vom Flur auf der anderen Seite der Tür.
Als ich sicher bin, dass ich allein bin, nehme ich das Geld aus Karins Geldbörse und stecke es in die Gesäßtasche meiner Jeans, dann schließe ich ihren Spind wieder und lasse das Schloss leise zuschnappen.
Wenn ich ein schlechter Mensch wäre, hätte ich alles genommen. Ich hätte ihr Handy, ihre Kreditkarte und die Designeruhr nehmen können, die sie immer in ihrem linken Schuh versteckt, aber ich habe mich mit zehn mickrigen Pfund zufriedengegeben. Doch ungeachtet der Entschuldigungen, die ich mir ausdenke, weiß ich genau, dass es nicht Freundlichkeit war, weshalb ich ihren Spind nicht komplett ausgeräumt habe, sondern einfach nur eine List, damit sie es nicht so leicht bemerkt.
Schuldbewusstsein flackert in meiner Brust auf. Ich ersticke es schnell.
Ich bin kein schlechter Mensch.
Ich gehe zur Tür und bleibe wie angewurzelt stehen, als ich sehe, dass schon wieder ein Zettel aufgehängt wurde.
Achtung!
In letzter Zeit ist es im Umkleideraum wiederholt zu Diebstählen gekommen. Achten Sie auf Ihre persönlichen Sachen und bewahren Sie nur das Nötigste in Ihrem Spind auf.
Es wird keine Haftung für persönliche Gegenstände übernommen. Wenn Sie Hinweise zu den Diebstählen haben, kontaktieren Sie bitte unverzüglich Ihren Vorgesetzten.
Mein Herzschlag beschleunigt sich. Schnelle, nervöse Schläge gegen meine Rippen.
Es hat Monate gedauert, bis jemand etwas gemerkt hat. Wochen des Abwartens, in denen ich allein zurückblieb, um die Sachen meiner Kollegen zu durchwühlen und mit mir selbst zu debattieren, was ich nehmen sollte und was nicht. Was würden sie am wenigsten vermissen? Was könnten sie am ehesten entbehren? Doch je häufiger ich das tat, desto weniger dachte ich an ihren Verlust. Als die Leute allmählich begriffen, dass etwas nicht stimmte, war ich längst so weit, dass ich auch in ihre Spinde griff, wenn sie mir nur den Rücken zukehrten. Ich fing an, nicht nur zu stehlen, um meine Schulden abzuzahlen, sondern auch aus Spaß, es war wie ein Juckreiz, den ich nie wirklich lindern konnte.
Ich sage mir, dass ich kein schlechter Mensch bin. Eines Tages glaube ich mir vielleicht.
Ich ziehe die Tür auf und zucke zusammen. Der Personalchef steht auf der anderen Seite.
»Da sind Sie ja«, sagt Kelvin. »Ich habe Sie gesucht. Kann ich kurz mit Ihnen reden?«
Kelvin hat mich noch nie leiden können. Aber er ist professionell und lässt es sich nur selten anmerken. Nur hin und wieder ertappe ich ihn dabei, wie er mich ansieht, wenn er glaubt, dass ich es nicht sehe – er versucht, mir auf die Schliche zu kommen.
Vielleicht bin ich auch einfach nur paranoid.
»Hat das bis morgen Zeit? Ich bin in Eile.«
Meine Kehle ist eng vor Nervosität. Wir hören es beide an meiner Stimme.
»Es dauert nicht lange«, antwortet er mit einem verkniffenen Grinsen.
Er weiß Bescheid.
Ich lächele ebenso verkniffen. Mein Herz rast.
»Klar.«
Schweigend geht er voraus zu seinem Büro. Kelvin ist klein und stämmig, mit schütterem mausbraunem Haar und runden, nachdunkelnden Brillengläsern, durch die seine Augen viel zu klein wirken. Wenn wir allein miteinander sind, findet Kelvin sonst immer eine Möglichkeit, mir ein Gespräch aufzudrängen, damit kein peinliches Schweigen entsteht, jetzt jedoch versucht er es nicht einmal.
Er muss nicht mehr so tun, als könnte er mich leiden. Jetzt nicht mehr, wo er mich gleich feuern wird.
Während wir die weitläufigen Flure entlang zu seinem Büro gehen, denke ich an all die verschiedenen Bereiche, in denen mein Leben den Bach hinuntergehen wird, wenn ich entlassen werde. Meine Schulden werde ich nicht mehr zahlen können, und ich werde mit der Miete noch weiter in Rückstand geraten. Es würde mich nicht wundern, wenn Sandy zum Monatsende die Schlösser austauscht. Nick hat heute schon angerufen und eine ganze Reihe aggressiver Nachrichten wegen des Geldes hinterlassen, das ich ihm schulde, und ich frage mich, wie weit ich gehen kann, bevor er gewalttätig wird. Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr gerate ich in Panik, bis ich am ganzen Körper zittere und nicht mehr klar denken kann. Als wir die Tür zu Kelvins Büro erreichen, zermartere ich mir verzweifelt das Hirn nach einer überzeugenden Ausrede.
Er zieht die Tür auf und fordert mich mit einer ausladenden Armbewegung auf einzutreten.
Karin sitzt mit Belinda, einer Kollegin, vor Kelvins Schreibtisch. Sie drehen sich beide zu mir um, als ich hereinkomme, und ihrem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, wissen sie ebenfalls, worum es geht. Karin sieht mich bestürzt an. Ich zucke die Schultern.
»Nehmen Sie Platz«, sagt Kelvin.
Ich setze mich neben Karin; ihr Zehnpfundschein knistert in meiner Hosentasche. Sie wirft mir ein flüchtiges Lächeln zu, und ich zwinge mich, es mit vor Anstrengung zitternden Mundwinkeln zu erwidern.
Kelvin setzt sich hin und sieht uns nacheinander an.
»Danke, dass Sie so spontan gekommen sind.«
»Worum geht es denn?«, fragt Karin mit einem kurzen Blick auf die Uhr.
»Werden wir entlassen?«, fragt Belinda mit unüberhörbarer Panik in der Stimme, die rau ist von den zwanzig Zigaretten täglich. Ich sollte echt aufhören zu rauchen, wenn ich nicht irgendwann aussehen will wie sie. Sogar der Sensenmann würde sich gruseln, bevor er sie holt.
»Nein, nein«, antwortet er und hebt beschwichtigend die Hände. »Ich spreche mit allen wegen der Diebstähle in der Damenumkleide in letzter Zeit.«
Hitze läuft meinen Rücken hinauf. Als er mich ansieht, zuckt mein Augenlid.
»Wieso nur unser Team?«, frage ich. »Wir sind doch nicht die Einzigen, die sich dort umziehen.«
»Natürlich nicht, aber den Daten und Zeiten der Diebstähle nach muss es jedes Mal während Ihres Dienstes passiert sein.«
Daran hatte ich nicht gedacht.
»Also«, sagt Kelvin und legt die Hände aneinander. »Ich möchte gern wissen, ob Ihnen in letzter Zeit irgendein verdächtiges Verhalten aufgefallen ist oder Ihnen irgendetwas weggekommen ist.«
Ich habe von jedem in diesem Zimmer etwas gestohlen: Geld, Zigaretten, Essen aus dem Personalkühlschrank. Ich merke, wie meine Wangen brennen, und beiße die Zähne zusammen, um mich zur Ruhe zu zwingen. Der Körper ist ein elender Verräter, er zeigt einfach alles.
»Mir fehlt Geld«, platze ich heraus. »Nicht viel, nur so fünf oder zehn Pfund, mal hier, mal da. Am Anfang dachte ich noch, ich hätte mich nur verzählt oder vergessen, was ich ausgegeben habe, aber dann hab ich es aufgeschrieben, und es ging nicht auf.«
»Genau«, sagt Kelvin und nickt, während er meine Aussage notiert. »Haben Sie das irgendwem gemeldet?«
»Ich bin selbst erst vor Kurzem darauf gekommen. Wie gesagt, anfangs habe ich noch gedacht, es wäre einfach nur Vergesslichkeit.«
»Ich verstehe.«
Er sieht mich nicht an, also kann ich nicht abschätzen, ob er mir meine Lüge glaubt. Ich halte nach kleinsten Anzeichen Ausschau: einer hochgezogenen Augenbraue, dem Schürzen seiner Lippen. Doch er verrät nichts.
»Bei mir ist es dasselbe«, sagt Karin. »Nie große Summen, als würde jemand hoffen, dass ich nichts merke. Aber ich habe angefangen, mein Geld nach jeder Schicht nachzuzählen, und ein paarmal haben jetzt fünf oder zehn Pfund gefehlt.«
Fünfmal, denke ich. Ich hab dich fünfmal beklaut.
»Mir haben Zigaretten gefehlt«, sagt Belinda.
Kevin sieht sie zweifelnd an. Belinda verschränkt die Arme vor der Brust.
»Es stimmt, Kel. Ich rauche zwanzig am Tag, keine mehr, keine weniger, und nach fast jeder Schicht sind eine oder zwei mehr weg. Das summiert sich.«
»Ja. Zumindest wissen wir dann, dass wir nach einem Raucher suchen.«
Die Selbstgedrehte, die hinter meinem Ohr klemmt, brennt an meiner Schläfe. Sie zeigt direkt auf ihn. Ich streiche mir mit der Hand durchs Haar, um sie zu verstecken, wobei ich aufpassen muss, sie nicht herunterzuwischen.
»Entschuldigen Sie«, sagt Karin und beugt sich vor. »Aber fragen Sie nur Frauen? Die Männer können genauso leicht in unsere Umkleide. Wir wissen doch alle, dass sich der Zugangscode nur in einer Ziffer unterscheidet.«
Ich nicke heftig. »Ein-zwei-drei-vier und Zwei-drei-vier-fünf, nicht gerade schwer zu knacken.«
»Ganz genau«, stimmt Karin mir zu.
Du musst gerade reden, denke ich. Der Code für deinen Spind ist Eins-eins-eins-eins.
Kelvins Wangen laufen rot an.
»Wir lassen die Codes. Und was den Schuldigen angeht, sind wir sicher, dass es sich um eine Frau handelt.«
»Warum?«, fragt Karin.
Er verschränkt die Finger auf dem Tisch, sein goldener Ehering glänzt unter dem Deckenlicht.
»Neben persönlichem Eigentum sind auch Sachen aus dem Lager verschwunden. Sachen, die nur eine Frau brauchen kann.«
O Scheiße.
»Wie zum Beispiel?«, fragt Karin.
Mein Herz fängt schon wieder an zu rasen, und die Träger der Handtasche werden in meinem Griff feucht. Ich hasse dieses Büro. Es ist so klein und stickig. Ich sehe zu dem Fenster hinter Kelvins Kopf hinüber, aber es ist fest verschlossen.
»In den letzten Monaten sind Damenhygieneprodukte aus dem Lager verschwunden, aber erst in allerjüngster Zeit … Schwangerschaftstests.«
Meine Wangen brennen. Ich blicke in meinen Schoß hinunter.
»Ich verstehe«, antwortet Karin. »Na ja, dann wird’s ja nicht lange dauern, bis wir sehen, wer die Diebin ist, oder?«
»Aber nur, wenn die betreffende Person schwanger ist«, antwortet er. »Und der Test nicht negativ …«
»Kelvin«, unterbreche ich ihn. »Ist das nicht ein bisschen übergriffig? Man sollte Mitarbeiterinnen kein schlechtes Gewissen machen, weil sie schwanger werden. Wenn das rauskommt, dann setzen Sie jede schwangere Mitarbeiterin einem Verdacht aus. Das wird hier zu einem Brainstorming, bei dem ich nicht weiß, ob ich dabei sein möchte.«
»Ich auch nicht«, fügt Belinda hastig hinzu, allerdings sehe ich an ihrem hektischen Beinwippen, dass sie kein moralisches Dilemma drängt, sondern ihr Verlangen, rauszugehen und sich eine anzuzünden.
»Sie haben recht«, sagt Kelvin und läuft erneut rot an. »Es tut mir leid. Aber wenn Sie irgendwas sehen oder hören, was mit den Diebstählen in letzter Zeit zu tun haben könnte, dann will ich nur sagen, Sie können sich jederzeit absolut vertraulich an mich wenden.«
In betretenem Schweigen stehen wir drei auf. Außer dem Scharren der zurückgeschobenen Stühle und dem fleischigen Schlagen meines Herzens ist nichts zu hören.
»Schönen Abend noch«, sagt er zu Karin und Belinda. »Margot, kann ich Sie noch kurz sprechen?«
Ich habe mich verraten. Er hat gesehen, wie mir heiß wurde, hat den Schweiß auf meiner Oberlippe und Stirn glitzern sehen.
»Ich wollte nur wissen, wie es Ihnen geht«, sagt er. »Ist zu Hause alles in Ordnung?«
Ich spüre förmlich, wie das abwehrende Gift in meinen Mund sickert. Immer wenn jemand versucht, mich auszuhorchen und sich einzumischen, wird meine Zunge scharf wie ein Skalpell.
»Wie kommen Sie darauf?«
»Na ja …« Er mustert mich von oben bis unten. »Sie haben ziemlich abgenommen in letzter Zeit.«
Ganz im Gegensatz zu Ihnen, liegt es mir auf der Zunge.
»Halten Sie das für angemessen? Den Körper einer weiblichen Angestellten zum Thema zu machen?«
Seine Augen weiten sich ein wenig, sein Rücken streckt sich.
»Ich meine das auf keinen Fall irgendwie übergriffig, ich …« Er gerät ins Stottern und räuspert sich. »Ich habe mir nur Sorgen gemacht.«
»Brauchen Sie nicht. Kann ich jetzt gehen?«
Er blickt mich verwirrt an, als sei er noch damit beschäftigt, zu verstehen, wie seine anteilnehmende Nachfrage so schnell auf Grund laufen konnte, bevor er einen kleinen Seufzer ausstößt.
»Ja, Sie können gehen.«
Ich nicke kurz und verlasse sein Büro, ohne mich umzublicken, während mir das Herz bis zum Halse schlägt.
Wenn ihm aufgefallen ist, dass ich abgenommen habe, dann fragt er sich vielleicht auch, ob ich die Diebin bin. Ich habe dem Mann seinen Lunch geklaut, um Himmels willen.
Ich gehe in Richtung der Lobby und denke daran, was Karin gesagt hat.
Na ja, dann wird’s ja nicht lange dauern, bis wir sehen werden, wer die Diebin ist, oder?
Meine Kehle schnürt sich zu. Ab wann kann man etwas sehen, ab der zwölfte Woche oder so? Wenn das stimmt, dann habe ich nur noch drei Wochen. Mit etwas Glück gehöre ich zu den Frauen, bei denen man kaum etwas sieht, auch später noch nicht. Aber Mama hat immer Witze darüber gemacht, wie sie schon knapp im sechsten Monat unter meinem Gewicht watscheln musste.
Du warst meine gierige Maggot, meine kleine Made, du konntest nie genug kriegen.
Diesen Spitznamen habe ich von Anfang an gehasst. Als mir klar wurde, was maggot bedeutete, war es schon zu spät, da hatte sich der Name bereits festgesetzt: alle kannten mich als Maggot »die Made« Barnes.