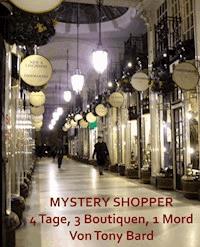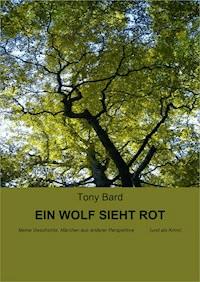Es gibt sie immer und überall. Die, die schon als Kind gerne Geheimnisse gehabt haben. Die, denen man immer "Du bist ein Schatz" sagt. Die, die der Fels in der Brandung sind. Die, die so gut zuhören. Diese Herzigen. Wie passen dann eine tote Schwiegermutter, ein toter Bully und ein toter Lebensgefährte in das Bild? Die Antwort in einem Krimi aus ihrer Perspektive – die der Herzigen natürlich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 148
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tony Bard
DIE HERZIGEN
Ein psychologischer Krimi
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Die Herzigen
Elisabeth
Julia
Monika
Dolores
Impressum neobooks
Die Herzigen
Wir sind die Herzigen. Die aufmunternd nicken. Die interessiert lauschen. Die dasitzen und sich höflich für die langweiligen Familiengeschichten der Gastgeber begeistern. Die tief stapeln. Die Anteilnahme heucheln. Die zur Verfügung stehen zur kostenlosen lebenslangen Lebensberatung. Oder zur Bewunderung oder zum Aufpäppeln oder einfach: zum Zuhören.
So gerne laden sie uns ein. Die Selbstdarsteller. Die Belehrer. Die Besserwisser. Die permanent Ratsuchenden. Am liebsten würden sie uns dauernd sehen. Mindestens einmal in der Woche. „Du bist ein Schatz“ haben wir alle schon einmal gehört. Wie sind ja so niedlich. Wie wir da dasitzen und lauschen.
Die Misstrauischen versuchen manchmal was aus uns heraus zu kitzeln. Aber da bleiben wir hart. Wir speisen sie ab mit gekonnten Floskeln. Wir wissen mehr als sie. Zum Beispiel, dass sie sich ja ohnedies nicht für uns interessieren. Sie wollen nur kein schlechtes Gewissen haben, wenn sie uns mit ihrem Müll zuschütten. Also erzählen wir irgendetwas. Was sie ablenkt. Bevor sie zur nächsten verbalen Entleerung ausholen.
Wir sind so herzig, dass wir nie verdächtig sind. Wir sind so herzig, weil wir unauffällig sind. Wir sind keine Konkurrenz. Wir sind keine Bedrohung. Uns kann man trauen. Uns kann man alles anvertrauen.
Sie glauben uns zu kennen. Sie sagen „ich kenne dich“. Sie glauben wir mögen das gleiche wie sie. Sie glauben wir teilen ihren Geschmack und ihre Ansichten. Wie durschaubar sie sind. Wir schauen verlegen zu Boden, lächeln und beim nächsten Mal haben wir einen Plan. Sie wissen nicht, dass alles an uns abprallt. An uns abfließt.
Wir sind unabhängig von Zeit und Raum. Es gibt uns überall.
Wir brauchen kein Lokalkolorit. Uns interessieren keine Personenbeschreibungen. Wir wissen wer wir sind. Egal ob wir groß, klein, alt, jung, dick, dünn oder sonst etwas sind. Wir sind wir.
Elisabeth
„Ich leide mit Euch,“ schloss die Stimme auf der Mailbox ihren Monolog ab.
„Ich weiß“, dachte sich Elisabeth beim Abhören der Nachricht ihrer Schwiegermutter. „Die Notfallsmutter, die dann aufblüht, wenn es ihren Kindern schlecht geht.“
Die mit der Sehnsucht nach Katastrophen. Immer auf der Suche nach etwas, worüber sie sich aufregen kann. Die, die sich wie eine Cousine der Hausstaubmilbe, nicht von Staub, sondern vom Unglück der anderen ernährt. Die, der man brav „Mißgeschickshäppchen“ apportieren muss. Das brave Kind strebt danach, dass es ihm nie zu gut geht. Denn nur wenn es irgendwo ziept und knackt im Leben, kann es der Mutter liefern, was die sich wirklich wünscht: Dem/der geht es auch nicht besser als mir. Dem/der muss ich helfen.
Überhaupt: diese dauernde Telefoniererei nervte Elisabeth. Vor einem Treffen wurde telefoniert. Nach dem Treffen wurde telefoniert, um das Treffen nach zu besprechen. Wer was gesagt hatte. Wer was nicht gesagt hatte. Wer wie geschaut hatte. Wie alles zu interpretieren war. Ein Telefonat war auch Elisabeths erster Eindruck ihrer zukünftigen Schwiegermutter gewesen. Damals hatte sie ihren Freund und jetzigen Mann zu einem Abendessen bei einem seiner Freunde begleitet. Als dieser für Elisabeth, ihren Freund und dessen Schwestern die Tür öffnete, begrüßte er die Geschwister mit den Worten „Eure Mutter hat gerade angerufen. Ihr habt den Geschirrspüler nicht ausgeräumt.“ Lustig, hatte sich Elisabeth damals gedacht und bemerkenswert, dass die Geschwister, die Mitte 20 waren, gar nicht peinlich berührt wirkten. So als wären sie an eine solche „Nachtelefoniererei“ ihrer Mutter, um sich zu beschweren („Ihr geht weg, um euch zu amüsieren und lässt mich mit dem vollen Geschirrspüler alleine zurück, ihr schlechten Kinder ihr…“), gewohnt.
Im Grunde genommen war in diesem Anruf schon alles enthalten, wofür Elisabeth während der nächsten 30 Jahre immer weniger Nachsicht aufbringen würde: die Hysterie, die Ichbezogenheit, das Unvermögen, die Perspektive ihrer Kinder anzunehmen und vielleicht zu überlegen, ob sie diese nicht mit diesem Anruf vor ihrem Freund blamieren würde, die Vorwürfe, das Erzeugen von schlechtem Gewissen. Ich, ich, ich. Elisabeth hatte dafür ein Wort: Gejeiere. Es wurde ständig gejeiert. Und nun war noch dazu Gefahr im Verzug. Elisabeth war zu dem Schluss gekommen, dass sie handeln musste.
Denn seit etwa zehn Jahren verpulverte die Schwiegermutter das Geld, das sie von ihren Eltern mit Ende fünfzig als Einzelkind geerbt hatte, auf unterschiedlichste Weise. Mal waren es Immobiliengeschäfte in Teneriffa, die schief gingen, mal waren es dubiose Sekten, die sich als non-profit Organisation tarnten. Elisabeth hatte den Eindruck, dass sich die Schwiegermutter auf diese windschiefen Konstruktionen nur einließ, um sich mit ihren Kindern monatelang vorab darüber beraten zu können und um nachher enttäuscht monatelang wieder darüber zu klagen, wie böse sie doch hintergangen worden war und dass man niemanden trauen konnte. Bis zum nächsten Mal.
Diesem Unfug musste Einhalt geboten werden. Für Elisabeth war er nur das Tüpfelchen auf dem I. Die Blacklist der Schwiegermutter war lange genug. Ein Befreiungsschlag war nötig, um nicht nur die Angehörigen, sondern auch die Ressourcen für einen Neustart frei zu setzen.
Elisabeth hatte sich jedenfalls angewöhnt nicht mehr abzuheben. Sie hatte ihrer Schwiegermutter einen Klingelton verpasst und war somit gewarnt, wen sie am anderen Ende war. Ruhe dank Technik. Das Abheben überließ sie ihrem Mann. Er war immer schon das Sorgenpüppchen der Familie gewesen. Der dem die Pleiten-, Pech- und Pannenmomente im Leben seiner Mutter und seiner zwei Schwestern umgehängt wurden. So war es immer schon gewesen und daran würde sich auch nichts ändern.
Es wurde sogar schlimmer. Denn zu den Geschwistern und der Mutter waren über die Jahre auch eine Anzahl an Nichten und Neffen gekommen, die pflichtbewusst die Familientradition der Problemgenerierung fortsetzten. Alle waren sie kränklich oder schlecht in der Schule oder verhaltensauffällig oder alles zusammen. „Immer ist irgendwas!“, sagte Elisabeths Schwiegermutter immer wieder. „Genauso wie du es dir wünscht“, vervollständigte Elisabeth in ihrem Kopf diese Aussage.
Was Elisabeth schon früher verwundert hatte, war die fehlende Nachsicht der Schwiegermutter gegenüber ihren eigenen Kindern. Sie beschwerte sich beim Sohn über die ungeschickten Töchter, bei den Töchtern über den naiven Sohn. Dieses schlecht-über-die-eigenen-Kinder-sprechen zählte für Elisabeth zu den schwersten Vergehen der Schwiegermutter. Dem/der einen erzählen wie dumm der/die andere ist. Elisabeth war selbst nicht gerade von Kindern begeistert - sie konnte mit ihnen nichts anfangen und sie und ihr Mann hatten immer schon gewusst, dass sie selbst keine wollten -, aber trotzdem empfand sie gerade diese Angewohnheit der Schwiegermutter als besonders verwerflich.
Immerhin hatte Elisabeths Mann Martin dazu gelernt. Er hielt sich gegenüber seiner Mutter bedeckt, warf ihr ein paar Pseudoprobleme hin zum Anbeißen. Nichts Ernstes, gerade genug, um sie bei Laune zu halten. Elisabeth beobachtete das mit Genugtuung: Martin ließ sich nicht mehr als Gesprächsstoff instrumentalisieren. Natürlich erwähnte Elisabeth das nie explizit. Sie freute sich im Stillen.
Den Schwägerinnen war es nicht so gut ergangen. Die Töchter waren diese Art von Töchtern, die sich verpflichtet fühlten, täglich mit ihren Müttern zu telefonieren - auch wenn es nicht das Geringste zu erzählen gab. Ein unausgesprochenes Gesetz, dessen Nichteinhaltung nie direkt sanktioniert wurde, aber in diffusem beleidigt-kurzangebunden-sein eben dieser Mütter resultierte. Außerdem war eigenes Gesprächsmaterial bei der Schwiegermutter nicht so wichtig. Sie konnte jeden noch so Schweigsamen mindestens zwanzig Minuten mit ihren eigenen Wehwehchen beschäftigen. Erst Recht die eigenen Kinder. Beide Schwägerinnen waren geschieden bzw. getrennt von den Vätern ihrer Kinder. Elisabeth hatte schon zum Zeitpunkt dieser Trennungen den Verdacht, dass es sich lohnte genauer hin zu sehen, wenn das Schlimmste, was den Töchtern passieren konnte, das Beste für deren Mutter war. Seit damals waren die Töchter wieder voll und ganz auf sie angewiesen. Der Ausflug in die selbständige Lebensführung mit eigener Familie samt eigenen Gesetzen und Spielregeln war beendet. Aufgrund der Prägung und mentalen Konstitution der Schwägerinnen hatte Elisabeths Schwiegermutter inmitten dieser Alleinerzieherinnen-konstellationen wieder die Würfel in der Hand. Sie wurde zum zentralen Element, das essentiell war, um eine halbwegs funktionierende Normalität herzustellen. Denn die Väter der Kinder und deren Familien waren an ihnen nicht besonders interessiert. Der Kontakt zu den Vätern war peu à peu abgebrochen oder so sporadisch, dass er kein Gegengewicht zu der Mutter/Großmutter Achse war. Unter diesen Voraussetzungen wuchs der Machtanspruch der Schwiegermutter. Alle wollten ihren Kindern und Kindeskindern Übel. Zwischen ihren Kindern, Enkelkindern und dem Abgrund stand nur sie.
Also wurden die Enkelkinder zu hoffungslosen Hilfsbedürftigen stilisiert, denen das Leben schon früh auf übelste Art mitgespielt hatte. Sie wurden in Watte gepackt und hatten sich daran gewöhnt, dass man von ihnen nichts verlangen durfte. Elisabeth empfand es nur als logische Konsequenz, dass in dieser Familie sich erbrechen, Nervenzusammenbrüche, Magenbeschwerden, Ohnmachten, Herzrasen, Panikattacken, Migräneanfälle und sonstige diffuse Beschwerden an der Tagesordnung waren. Irgendwer hatte immer irgendwas.
Elisabeth konnte mit ihren Nichten und Neffen wenig anfangen. Es war auch schwer, zu ihnen durchzudringen. Dazu hätte man zuerst die Vereinnahmung durch Mutter und Großmutter durchbrechen müssen und dieser Aufwand war Elisabeth zu mühsam. Außerdem war von Nichten und Neffen kein eigenes Denken zu erwarten. Die großmütterliche Gehirnwäsche funktionierte zu gut.
Die Enkelkinder wurden nun auch mehr von ihr verhätschelt als die eigenen Kinder seinerzeit. Wenn dieses Ungleichgewicht von einem der erwachsenen Kinder auch nur angedeutet wurde, löste das bei Elisabeths Schwiegermutter großes Erstaunen aus. Aber Elisabeth erinnerte sich gut daran, wie geschockt sie gewesen war, als sie einmal mit Martin einige Kinderfotos durchgesehen hatte. Zwischen all den Motiven von Baby Martin verkleidet als Pascha, als Kapitän oder vor dem Weihnachtsmann verdutzt flüchtend, war auch eines, das sie nie vergessen würde. Es zeigte den etwa 10-Jährigen weinend am Esstisch umgeben von Großmutter, Mutter, Onkel und Verwandten. Offensichtlich hatte er nicht aufessen wollen, war gezwungen worden es doch zu tun und daraufhin in Tränen ausgebrochen. Elisabeth fand das ungeheuerlich. Nicht nur, dass das Kind zum Essen gezwungen worden war - eine Kindererziehungspraxis die in den 70er Jahren eigentlich schon in Verruf hätte sein sollen - sondern dass man dann seine Notlage auch noch vor versammelter Familie fotografisch festhielt. Add insult to injury, zur Verletzung auch noch eine Demütigung hinzufügen. Umso unverzeihlicher, dass Martins Mutter heute jeder Stimmung der Enkelkinder wie einem Gebot Gottes folgte. Ihre eigenen Kinder hatte sie hingegen den vorsintflutlichen Erziehungsmaßnahmen ihrer Mutter kampflos zum Fraß vorgeworfen.
Über die Jahre hatte Elisabeth sich in dieses Gefüge eingereiht und es sich in einer völlig passiven Rolle bequem gemacht. Aber: Am Wochenende war der große Tag. Die Älteste Enkelin feierte ihren 17. Geburtstag. Das war der Tag an dem Elisabeth ihren Plan umsetzen würde. Der Befreiungsschlag für alle. Dramatisch aber unabdingbar. Die Schwiegermutter musste eliminiert werden.
Das Familienmodell Katastrophenhilfe sollte zu einem Ende kommen. Nach einer Schockstarre wäre dies für alle Beteiligten das Beste, war Elisabeth überzeugt. Insbesondere, weil dann die Erbschaft anfallen würde. Denn es ging auch um ein beträchtliches Vermögen. Geld, auf das die Kinder bisher keinen Zugriff hatten, da die Schwiegermutter fest daran hielt und kaum darüber gesprochen werden durfte. Elisabeth hatte ihr Urteil schon vor einiger Zeit gefällt. Hatte lange genug gewartet und andere Möglichkeiten abgewogen. Doch sie kam immer wieder zum gleichen Ergebnis: Jetzt zahlte es sich noch aus, noch war es nicht zu spät.
Ihr Mann und sie waren Ende vierzig, Anfang fünfzig, gesund, sahen wesentlich jünger aus. Würde ihr Mann jetzt seinen Erbteil erhalten, könnten sie noch viele Lebenspläne verwirklichen. Das Haus in den Schweizer Alpen zum Beispiel, von dem sie schon oft gesprochen hatten. Was für andere die Villa in der Toskana war für Elisabeth das kleine Chalet in den Bergen. Und es könnte natürlich auch ein großes sein. Groß genug jedenfalls, dass sich ein eigener Fitnessraum darin ausging, dann müsste sie sich nicht mehr zu dem lästigen PowerPlate Training schleppen, das sie regelmäßig absolvierte. Bisher war es finanziell nicht umsetzbar. Ihr Mann verdiente als Marketingexperte nicht genug und auch Elisabeths Gehalt als Empfangsdame in der Schönheitsklinik reichte dafür nicht aus.
Die Schwiegermutter käme nie auf den Gedanken, ihren Kindern auch nur irgendwie finanziell zu helfen. Im Gegenteil. Hörte man sie reden, würde man meinen, man hätte es mit einer Mindestrentnerin zu tun. Auch ihre Wohnung und ihre äußere Erscheinung ließen nicht vermuten, dass sie eigentlich vermögend war. Nicht unermesslich reich, aber doch genug. Genug für Elisabeths weitere Lebensplanung jedenfalls.
Das eindeutige Urteil über das Schicksal ihrer Schwiegermutter hatte Elisabeth nach dem Tod ihres Schwiegervaters gefällt. Seit Martin ein Teenager war, lebte er in einem anderen Land und war außer Telefonaten selten präsent. Die letzten Jahre seines Lebens plagten ihn schwere medizinische Probleme, Transplantation, Dialyse. Aber er beklagte sich nur selten und interessierte sich für Elisabeths Mann und auch für sie. Trotz ihrer Differenzen gelang am Schluss seines Lebens eine Art Aussöhnung mit seinem Sohn.
„Er hat sich nie beschwert und jetzt ist er tot. Wer hingegen hat die letzten 25 Jahre wegen allem gejeiert, war andauernd beleidigt, hat ermahnt, die Kinder gegen einander ausgespielt, immer verlangt, dass sich alles um sie dreht, für alles eine Gegenleistung verlangt und trotzdem immer allen ein schlechtes Gewissen gemacht, dass man sich zu wenig mit ihr und ihren Problemen beschäftigt?“ Elisabeth war verblüfft, dass sie so lange gebraucht hatte, um klar zu sehen, welches Spiel die Schwiegermutter die ganze Zeit betrieben hatte. Sie hatte ihr Leben lang immer nur an sich gedacht und diese Haltung als mütterliche Aufopferung verkauft. Umso harscher war das Strafmaß das Elisabeth verhängte: Es war genug. Elisabeth hatte sich entschlossen, rasch einzugreifen.
Elisabeth hatte lange an ihrem Plan gefeilt. Zuerst jahrelang in Gedanken, dann monatelang die Umsetzung durchgespielt. Die Konsequenzen abgewogen, den Ablauf zusammengestellt. Sie war sich ihrer Sache absolut sicher. Es konnte nichts schiefgehen.
Essentiell war ihre Position als Zuseherin bei diesen Familientreffen. Und diese Stellung war keine gekünstelte einmalige Inszenierung. Diesen Platz als Zuseherin, die kaum wahrgenommen wurden, hatte sie ein Leben lang eingenommen. Daran war nichts gestellt. Das war immer ihre Rolle gewesen. Die Unsichtbare, die ab und zu was Nettes sagt und ansonsten zuhört und lächelt. „Sie hat ja kaum was gesagt“ hieß es dann bei den Nach-Telefonaten.
Was sollte sie auch sagen, wenn die Nichten und Neffen wieder dazu aufgefordert wurden, alle Namen ihrer Klassenkameraden aufzuzählen oder nacheinander ihre Schuhgrößen bekanntzugeben. Sehr interessant, dachte Elisabeth sich dann und schaltete völlig ab. Noch dazu tendierten diese Gespräche dazu, sich bei den Besuchen zu wiederholen. Jede Belanglosigkeit, die die Kinder betraf, wurde zur Sensation erhoben, die man nicht oft genug besprechen und analysieren konnte. Dass die Schwiegermutter mit dieser obsessiven Anteilnahme das seinerzeitige Desinteresse an ihren eigenen Kindern kompensierte, war für Elisabeth nichts Neues. Sie hatte das ja schon fast ein Vierteljahrhundert lang mitgemacht.
Also am kommenden Wochenende. Bis dahin: family business as usual. Die Themen, die die Schwiegermutter auch in dieser Woche auf Trapp hielten, waren nicht weltbewegend. Das waren sie nie gewesen. Sie war einfach mit einem Talent gesegnet, die banalsten Anlässe hoch zu schaukeln. Die meiste Zeit ging es darum, wann sie ihre Kinder sehen konnte. Ob die mit einander telefoniert hatten, um das zu besprechen. Hatte Martin das email der Schwester gelesen? Hatte man schon darauf geantwortet? Warum nicht? War es angekommen? Hatte man die Fotos der Nichten und Neffen angeklickt? Und---? Seit es Enkelkinder gab, ging es die ganze Zeit darum, wann es möglich war die Kinder und die Enkelkinder zu sehen. Am besten alle gemeinsam. Einzeltreffen mit nur einem Kind zählten nicht. Das war nicht erst im Alter so. Seit Elisabeth ihre Schwiegermutter kannte, also seit diese an die 50 war, hatte sich nichts geändert. Ihr Lebensthema war, egal ob im Berufsleben oder in der Rente: wann sehe ich meine Kinder und Enkelkinder? Einen Freundeskreis hatte die Schwiegermutter nie ernsthaft gepflegt. Es war doch viel einfacher, immer an den Kindern zu kleben und bestenfalls die Freunde als Material für Horrorgeschichten zu verwenden(„Stell dir vor, was der Annemarie schon wieder passiert ist…“).
Elisabeth ging auch davon aus, dass die Schwiegermutter im Hintergrund stichelte. Warum hatte man Elisabeth so lange nicht gesehen? Warum redete sie so wenig bei den Treffen? Was machte sie eigentlich genau? Der Sohn würde ihr, der Mutter, schon alles erzählen oder? Aufgrund ihrer inhärenten Bösartigkeit kombiniert mit der Sehnsucht nach Katastrophen wäre es ihr, bewusst oder unbewusst, sicher nicht unrecht, wenn Martin Elisabeth verließe. Wie hatte sie Elisabeth am Tag ihrer Hochzeit so schön gesagt? „Vergiss nicht, dich im Grundbuch als Wohnungsmiteigentümerin eintragen zu lassen, falls Martin sich von dir scheiden lässt!“ Wunschdenken getarnt als fürsorglicher Rat. Einerseits wäre dann der Sohn zu trösten und somit endlich wieder ein Opfer der bösen Welt in der nur auf die Mutter Verlass ist. Anderseits stünde er dann wieder zur Verfügung. Die Einheit Mutter, Kinder und Enkelkinder wäre dann wieder eine geschlossene, ohne Eindringlinge. Die Bienenkönigin hätte wieder die totale Kontrolle.
Die Schwiegermutter war mit dem Micro-management der Kinder auch vor Tag X beschäftigt und erzeugte sich so eine sie auf Trab haltende Dosis von Stress selbst: Wurde der Antrag der Schwestern von Martin schon an die Behörde weitergeleitet, hatte Martin die SMS an die Schwestern schon geschickt, den Anruf schon getätigt, usw. usw. Immer hatte die Schwiegermutter sich mehr mit den verlassenen Töchtern identifiziert und sah ihren Sohn in der Rolle des Unterstützers der Schwestern. So war es auch vorgekommen, dass sie den fast 50-Jährigen gelegentlich am Telefon anschrie, ob er endlich auch wirklich schon dies und das für die Schwestern erledigt hatte. Elisabeth interpretierte diese Ausbrüche als Zeichen, dass die Schwiegermutter am liebsten von ihrem Sohn eine ständige Betreuung ihrer selbst und der Töchter eingefordert hätte.