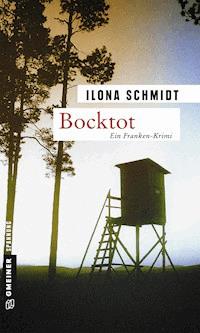Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Elisabeth Bachenschwanz
- Sprache: Deutsch
Während des Dreißigjährigen Krieges fällt das kaiserliche Heer unter Oberst Lamboy in die Stadt Coburg ein, um die Veste den sächsischen Herzögen abzuringen. Die Coburger sind verzweifelt, denn die Besatzer bringen Hunger und Tod mit sich. Inmitten der Wirren versucht die Tochter des Bürgermeisters herauszufinden, warum ihre Mutter vor Jahren auf dem Scheiterhaufen sterben musste. Ausgerechnet in zwei Feinden scheint sie Verbündete gefunden zu haben, doch diese haben anderes im Sinn …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 475
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ilona Schmidt
Die Hexentochter und die Fränkische Krone
Historischer Roman
Zum Buch
Die Veste muss fallen … Franken um1634. Wieder stehen die kaiserlichen Truppen vor Coburg, um endlich die Veste der sächsischen Herzöge für den Kaiser einzunehmen. Während die Bürgermeister vergeblich auf Hilfe von ihrem Herzog hoffen, bereitet sich die Bevölkerung auf Hunger und Tod vor. Inmitten der Wirren lebt die Bürgermeistertochter Elisabeth mit dem Stigma, ein Hexenkind zu sein. Als sie anfängt, den viele Jahre zurückliegenden Flammentod ihrer Mutter zu hinterfragen, soll sie just den Mann heiraten, der ihre Mutter damals angeklagt hatte. In ihrer Not vertraut sie sich ausgerechnet zwei Feinden an, die sie für ihre Verbündeten hält. Doch die haben anderes im Sinn. Hannes Freymann will Rache an dem schwedischen General nehmen, der seine Heimat verwüstet hat, und Freiherr Karl Köckh ist heimlich im Auftrag des bayerischen Kurfürsten unterwegs, der den Kaiserlichen misstraut. Da wird Elisabeths Vater sterbenskrank und sie begreift, dass ihr die Feinde näher sind, als sie glauben kann …
In München geboren, lebte Ilona Schmidt viele Jahre in Nürnberg. Nach dem Studium der Chemie in Erlangen zog sie berufsbedingt nach Coburg. Heute arbeitet sie für einen amerikanischen Konzern und bereist die Welt. Ihre Liebe zum Krimi und für das Abenteuer lebt sie in ihren Romanen aus.
Impressum
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2023 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Bildes von: © Anneka / shutterstock.com und https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coburgprint1small.jpg?uselang=de
ISBN 978-3-8392-7640-2
Prolog Juli 1625
1 Andreas
Es hätte niemals so weit kommen dürfen. Andreas Bachenschwanz schlurfte durchs Steintor, hinter dem Hexenkarren her, wobei ihm die Sommerschwüle Schweißperlen auf die Stirn trieb. Das Hemd klebte an seinem Körper, aber es wäre ungehörig gewesen, die schwarze Jacke auszuziehen. Mit letzter Willenskraft erstieg er die Anhöhe mit dem Galgen darauf. Heute erschien ihm die Hohe Straße staubiger und beschwerlicher zu sein als sonst, und auch die silberne Bürgermeisterkette wog schwerer denn je.
Auf dem mannshoch gemauerten Rund des Schafotts ragte das quadratische Holzgestänge, an dem gleichzeitig vier Verurteilte aufgehängt werden konnten, gen Himmel. Direkt daneben stakte aus einem Stroh- und Reisigwall der rußgeschwärzte Brandpfahl, der die Seele seiner Frau reinigen sollte. Ein Abgeurteilter aus der vergangenen Woche baumelte in der Mittagsglut. Sein von Krähen zerhacktes Gesicht grinste Andreas ekelerregend an. Ein bestialischer Gestank umgab diesen furchtbaren Ort, den Andreas bislang wie die Pest gemieden hatte. Heute jedoch musste er hier sein. Heute musste er diesen Leidensweg gehen, denn vor ihm ratterte das Ochsengespann mit dem Käfig, in dem seine Agnes hockte, einem grauenvollen Ziel entgegen. Begleitet wurde der Zug von Soldaten der Stadtwache, die in ihren gelb-schwarz gestreiften Uniformen und den Piken an riesige Wespen erinnerten.
Die Zunge klebte Andreas trocken am Gaumen, während er sich mit einem Tuch den Schweiß von der Stirn wischte.
Ihm folgten die Bürger Coburgs, deren Schmährufe sich mit dem Quietschen und Knarren des Gefährts vermischten. Andreas warf einen Blick zurück. Er kannte sie alle: die Mitglieder des Schöppenstuhls in ihren schlichten schwarzen Roben, die anderen vier Bürgermeister der Stadt, darunter der derzeit vorsitzende, die Bäcker, die Fleischer, die Handwerker. Einer aus dieser Prozession hatte seine Agnes denunziert.
Das lange Haar zerzaust und verklebt, starrte sie ihn aus blutunterlaufenen Augen an. Er wich ihrem Blick aus. Mit beiden Händen hielt sie die Metallstäbe des Käfigs umklammert. Ihr schmaler Körper steckte in einem zerschlissenen Kleid. Das einst wunderschöne Gesicht war vor Angst verzerrt, die Haut spannte grau über ihre Knochen. Von der Fratze des Teufels konnte er nichts entdecken, aber schon bald würden sie das Böse aus seiner Agnes heraustreiben.
Als sich der Zug der Hinrichtungsstätte näherte, flüchteten einige Drosseln aus der Brombeerhecke, die den Weg säumte, und eine Schar Spatzen flatterte unter lautem Protest von einem Haufen Pferdeäpfel hoch.
Eine schmale Hand schob sich in seine, und er umschloss sie zögerlich. Elisabeth stolperte in ihren neuen Schühchen und fiel auf die Knie. Hastig zog er sie wieder auf die Beine. Ihre rotbraunen Locken steckten unter einer schwarzen Haube, die blassen Wangen schimmerten nass.
»Warum hast du die Kleine mitgenommen?«, sprach ihn sein alter Freund Matthäus Sommer von der Seite an. »Muss sie das unbedingt sehen?«
Andreas zuckte zusammen, denn er hatte ihn bislang nicht bemerkt. »Der Geheimrat meint, es sei das Beste, damit der Teufel nicht auch noch von dem Kind Besitz ergreift«, antwortete er heiser.
Als Beisitzer des Schöppengerichts und Geheimrat des Herzogs hatte Dr. Wolffrum in einer Sitzung auf Elisabeths Teilnahme bestanden, und es hatte keine Gegenstimme gegeben.
»Sie ist erst neun.« Matthäus ließ nicht locker. »Noch nicht einmal eine Frau.«
Unangenehm berührt wandte sich Andreas ab. Elisabeth war das einzige Kind, das Agnes ihm in ihrem Wahn gelassen hatte. Alle anderen lagen auf dem Salvatorfriedhof im Familiengrab. Ermordet von ihrer Hexenmutter, die der Satan zu solch frevelhaftem Tun verführt hatte. So hatte die Anklage gelautet. Nachdem Agnes die Finger mehrmals gebrochen worden waren und das glühende Eisen auf dem einst makellosen Körper gewütet hatte, war ihr Widerstand erstorben und sie hatte alles zugegeben.
»Habt Ihr davon gewusst, Herr Bürgermeister?«, hatte Dr. Wolffrum gerufen, als ihr Geständnis verlesen worden war. Nein, beileibe nicht. Andreas hatte nichts von der Besessenheit seiner Frau bemerkt. Selbst dann nicht, als das Getuschel in seiner Umgebung lauter geworden war. Doch zu diesem Zeitpunkt hatte er alle Verdächtigungen noch als dummen Stadttratsch abgetan.
Fast hätte er deswegen sein Amt verloren, was sein Ruin gewesen wäre. Er, der Bürgermeister und Nachkomme einer alteingesessenen Patrizierfamilie, sollte eine Hexe geheiratet haben? Unmöglich.
Augenblicklich mischte sich Wut ins Durcheinander seiner Gefühle. Agnes hatte Schande über ihn gebracht und ihn den absurdesten Verdächtigungen preisgegeben. Sie hatte ihm geschadet, ebenso ihrer Tochter, der für immer das Stigma des Hexenkindes anhaften würde.
Agnes biss sich in die Faust. Mitleid suchte sein Herz zu erweichen, aber gegen den Teufel war kein Kraut gewachsen, da half nur das Feuer.
Der Karren hielt an. Unter dem Gemurmel der Menge bildete die Stadtwache ein Spalier. Zwei der Soldaten öffneten die Käfigtür und zerrten Agnes an ihren blutverschmierten Händen heraus. Sie schrie auf, an ihren Unterschenkeln rann Urin zu Boden.
Ein schwarzer Talar über einem feisten Wanst schob sich durch die Menge, der Pfarrer baute sich vor ihr auf. »Bereust du deine Sünden, Agnes Bachenschwanz?«, brüllte er, damit es jeder hören konnte.
Ihre Lippen zitterten. »Ich bereue alles. Bitte lasst mich gehen«, flüsterte sie.
Erst jetzt war Andreas fähig, ihr in die Augen sehen, in denen er Angst, Entsetzen und die Frage nach dem Warum las. Sie brach den Blickkontakt zu ihm ab, schwankte, fing sich wieder und hob flehentlich die Hände. »Ich habe nichts von alldem getan. Gütiger Gott im Himmel, du weißt, dass ich die Wahrheit spreche. Warum lässt du das zu?«
»Sogar im Angesicht des Todes verhöhnt diese Teufelshure den Namen des Herrn. Welch ein Frevel!«
Agnes ließ die Arme sinken. »Ich bin keine Hexe!«, schluchzte sie mit überschnappender Stimme.
»Nein, Mutter, das bist du nicht!«, rief Elisabeth. Andreas griff sie an der Schulter und schüttelte sie leicht, um sie zum Schweigen zu bringen.
Agnes drehte ihren Kopf, ein Lächeln blitzte auf, leicht und zart wie ein Schmetterlingsflügel. »Andreas, schick sie heim. Sie soll mich nicht brennen sehen.«
»Schweig, Hexe!«, fuhr sie der Kirchenmann an. »Das Kind soll den Namen des Herrn rufen, wenn der Teufel aus deinem Leib fährt, damit er sich nicht des Körpers des Mädchens bemächtigt. Die Hinrichtung möge beginnen.«
Die Wachen zerrten die wimmernde Agnes zum Scheiterhaufen und banden sie am Pfahl fest.
Andreas schaute wie versteinert zu. Das Herz schmerzte und Magensäure kratzte in seinem Rachen. Seine Tochter, die wie ein Mehlsack an seiner Hand hing, zitterte und würgte ein unterdrücktes Schluchzen hervor.
Hastig hängte der Scharfrichter ein Beutelchen um Agnes’ Hals und tauchte eine zischende Fackel in den mit Schwefel und Schwarzpulver durchsetzten Scheiterhaufen. Die ersten Flammen loderten auf, und der Gestank von Holz, Schwefel und versengtem Haar stach in Andreas’ Nase. Unwillkürlich trat er einen Schritt zurück.
»Was hast du ihr da umgehängt?«, keifte der Pfaffe den Henker an. Zu spät. An dem von Andreas bezahlten Gnadenakt war nichts mehr zu ändern, denn die Flammenwand verhinderte jegliche Annäherung.
Agnes hustete, schrie, sank in sich zusammen und bäumte sich auf. »Gott wird euch strafen … für eure Lügen … eure Verleumdungen … eure Gier. Eure Höfe werden brennen … Hungersnot wird ausbrechen … und die Pest! Der Sensenmann kommt, hält reiche Ernte! Und Krieg wird’s geben – Krieg!«
Neben Andreas sank Elisabeth ohnmächtig in den Staub.
Die schöne Mathilde eilte herbei und hob das Mädchen auf. »Schluss mit dem Unsinn. Ich nehme die Kleine mit zu mir nach Hause.« Ihrer resoluten Stimme wagte niemand zu widersprechen; selbst der Geheime Rat Dr. Wolffrum nicht. Die junge Witwe forderte einen der Umstehenden auf, Elisabeth zu tragen.
Agnes war inzwischen vollkommen von Flammen eingehüllt, ihre Schreie wurden unerträglich. Mit einem lauten Zischen verpuffte das Schwarzpulver in dem Beutel und erlöste sie von ihren Qualen.
Hilflos und erschöpft schleppte sich Andreas hinter der sich auflösenden Menschenmenge her. Die Schöffen und Stadtknechte zogen angeregt plaudernd in Richtung Ratskeller, in dem sie ihre Gerichtsmahlzeit einnehmen würden – ohne ihn, denn ihm war speiübel.
Die Bedrohung Oktober 1632
2 Karl
Mit einem lauten Knall blieb die Kanonenkugel in der Mauer der Festung stecken. Viele Ellen dick widerstand das Bollwerk allen Versuchen, es zum Einsturz zu bringen.
Freiherr Karl Köckh zu Prunn blickte von der Anhöhe Fürwitz zur Veste Coburg hinüber. Fürwahr ein Witz, denn den dreifachen Mauerring zu sprengen war schier unmöglich. Wenn überhaupt, konnten die Verteidiger nur durch Aushungern zur Aufgabe gezwungen werden – und das würde dauern. Manche Dinge waren eben nicht mit Gewalt zu erreichen.
Gedankenverloren strich sich Karl über den roten Kinn- und Oberlippenbart, der in Kontrast zu seinem schwarzen Haupthaar stand, weswegen er oft gehänselt worden war. Insgeheim ärgerte er sich darüber. Was konnte er für die Farbe seines Barts?
Herbstbunte Wälder umrahmten das groteske Schauspiel. In der Tat ein idyllisches Plätzchen, wären da nicht die Kanonen des Generals Wallenstein, deren Feuer speiende Mündungen auf die Festung gerichtet waren. Die Stadt Coburg duckte sich im Tal hinter der Burg, ebenso wie deren Bürger, die sich vor den Besatzern in ihren Häusern versteckten. Sie hatten nur so lange Widerstand geleistet, bis ihrem Herzog die Flucht gelungen war.
General Wallenstein hieß mit vollem Namen Albrecht Wenzel Eusebius von Waldstein. Er war von Ferdinand II., dem Kaiser des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation, erneut zum Oberbefehlshaber von dessen Armeen ernannt worden, die tapfer den katholischen Glauben gegen den Protestantismus verteidigten. In Wahrheit ging es darum allerdings schon lange nicht mehr, sondern um Macht und Land.
Wallenstein wetterte lauthals über die Offiziere neben sich. Dass er keiner der gegeneinander kriegführenden Konfessionen zuzuordnen war, war hinlänglich bekannt, aber auf seine Erfahrungen als Heerführer wollte der Kaiser dennoch nicht verzichten. Wallenstein thronte auf einem eigens für ihn besorgten Stuhl, da ihm längeres Stehen angeblich schwerfiel.
Neben dem Feldherrn standen zwei Lakaien, um ihm bei Bedarf eine Erfrischung zu reichen.
»Der Festungskommandant hatte nichts als Spott für mich übrig«, zischte ein Hauptmann mit hochrotem Gesicht. »Als ich ihn aufforderte, die Burg zu übergeben, und ihm drohte, anzugreifen, gab er zur Antwort, ich solle tun, was ich nicht lassen könne.«
Wallenstein kniff die Lippen zusammen. »Die Festung gilt als uneinnehmbar. Mit diesem Wissen hat der Kerl gut reden.«
»Wie wollen wir sie dann in die Knie zwingen?«
Mit einer List, dachte Karl. Ähnlich der, mit der die Griechen Troja erobert hatten. Doch er verbiss sich seine Meinung, denn das stand ihm nicht zu. Man hatte gefälligst zu tun, was einem die hohen Herren befahlen, und ansonsten das Maul zu halten. Karl hatte früh erfahren müssen, was einem blühte, wenn man zu vorlaut war. Für ihn galt es, seinen Herrn, den bayerischen Kurfürsten Maximilian I., zufriedenzustellen, um die Familiengüter zu behalten – selbst wenn dies mitunter schwerfiel.
Zeit, sich bemerkbar zu machen. Karl räusperte sich. »Herr General«, sagte er und deutete eine Verbeugung an.
»Ah, Leutnant Köckh«, antwortete Wallenstein mit ernster Miene. »Ich denke, der Regent der Bayern schickt mir einen seiner besten Leibgardisten nicht ohne Grund. Welche Botschaft bringt Ihr mir?«
»Der Kurfürst ist zum Aufbruch bereit.«
»Sonst nichts?« Wallenstein wischte imaginären Staub von einem seiner Stulpenstiefel und schickte seine Offiziere und die Lakaien fort. Als sie außer Hörweite waren, winkte er Karl zu sich. »In zwei Tagen rücken wir ebenfalls ab, in eine andere Richtung. Das könnt Ihr Seiner Durchlaucht getrost melden. Zieht er wahrhaftig gegen den Schwedenkönig zu Felde?«
»Wie Euch gewiss bekannt ist, Herr General«, antwortete Karl vorsichtig.
Wallenstein winkte ab. »Der Kurfürst von Bayern mag sich um sein Land kümmern, wir nehmen uns die Sachsen vor.«
»Ihr wollt die Veste und somit den Oberst Taupadel erneut unbehelligt lassen?«
Wallenstein legte den Kopf leicht schief und sah Karl prüfend an. »Meint Ihr, er kommt freiwillig heraus?«
»Ihr hattet ihn bei Neumarkt bereits in Eurer Gewalt und habt ihn dann laufen lassen. Zum Dank ist er in die Oberpfalz eingefallen.«
»Eure Heimat?«
»Ist das Altmühltal.«
»Folglich müsstet auch Ihr ein Interesse an der Einnahme der Veste haben, um seiner habhaft zu werden.«
»Gewiss, aber ich gehorche den Befehlen meines Dienstherrn, und der möchte nach Nürnberg.«
»Einen wie Euch könnte ich gut gebrauchen«, antwortete Wallenstein mit einem feinen Lächeln. »Es würde Euer Schaden nicht sein.«
Ein Wechsel zu ihm käme einem Schlag ins Gesicht des Kurfürsten gleich, der Wallenstein seit der Freilassung des für die Schweden kämpfenden Oberst Georg Taupadel zutiefst misstraute. Zumal dies nicht das erste Mal gewesen war, dass der Feldherr ihm die Hilfe versagt und ihn sogar behindert hatte. »Ich habe einen Eid geleistet, Herr General, und den kann ich nicht brechen.«
»Nun gut, Herr Leutnant.« Wallenstein blickte ihn durchdringend an. »Dann würde ich mich beim Kaiser dafür verwenden, Euch davon zu entbinden.«
»Euer Vertrauen ehrt mich, dennoch muss ich ablehnen.«
»Solltet Ihr es Euch anders überlegen, wisst Ihr, wo ich zu finden bin. Ich schätze Männer, die ihren Verstand nutzen und zu ihrem Wort stehen. Mitunter erfordert es ungewöhnliche Maßnahmen, das Richtige zu tun. Geht nun und berichtet Eurem Herrn über unser Gespräch und auch davon, dass ich weiterziehen werde. Um zu erfahren, wohin ich mich als Nächstes wende, wurdet Ihr doch hergeschickt, nicht wahr?«
Ohne darauf einzugehen, verbeugte sich Karl tief und warf zum Abschied einen Blick auf die trutzige Veste. Sie hatte einst Luther beherbergt, der eine Kirchenspaltung nie beabsichtigt hatte. Der würde sich vermutlich im Grab umdrehen, wenn er erführe, dass seinetwegen ein Krieg entbrannt war.
Karls Ritt in die Stadt hinunter führte durch einen Hohlweg, auf dem ihm eine junge Maid entgegenkam. Ihre Haare leuchteten im Licht der untergehenden Sonne. Er erkannte sie als die Tochter eines der fünf Bürgermeister der Stadt wieder. In der Hand hielt sie einen Topf, den sie fest an sich drückte. Sie war hübsch anzusehen, etwas mager zwar, aber das waren heutzutage alle. Ihre rotbraunen Haare waren zu einem Zopf geflochten, der bei jedem ihrer Schritte mitschwang. Freundlich nickte er ihr zu.
»Edler Herr«, sagte sie zaghaft, »verzeiht, dass ich Euch anspreche.«
»Da gibt’s nichts zu verzeihen. Was steht an?«
»Ihr gehört doch zum Tross des Kurfürsten. Darf ich erfahren, wann er abzieht?«
Fast hätte Karl laut aufgelacht. »Wenn es ihm beliebt.«
Auf ihrer Nasenwurzel erschienen Fältchen. »Schade. Ich dachte, Ihr könntet es mir verraten.«
»Warum wollt Ihr das wissen? Ihr seid die Tochter eines der Bürgermeister, nicht wahr? Ihr werdet es also früh genug erfahren.«
Ihre Hand fuhr zum Mund. »Es ist nur … Ach, nichts.«
Seine Neugier war geweckt. »Kann ich helfen?« Das war ihm herausgerutscht, denn als Lutherische stand sie auf der gegnerischen Seite. Doch etwas an ihr erinnerte ihn an seine Frau Rosemarie, die in München auf seine Rückkehr wartete.
»Euch eilt ein gewisser Ruf voraus«, sagte sie.
»Tatsächlich?«, antwortete er amüsiert. »Hoffentlich ein guter.«
»Man sagt, Ihr hättet einen Mörder seiner gerechten Strafe zugeführt.«
»Das ist nichts Außerordentliches.« Er ahnte, worauf sie anspielte: eine Mordserie in einem der Stadtpaläste Münchens. Als der Kurfürst des Geredes über die Missetaten überdrüssig geworden war, hatte er Karl mit der Aufklärung des Falls betraut. Wie aber war diese Information von München nach Coburg gelangt?
Sie blinzelte, schien verwirrt. »Ihr seid demnach für solche Sachen zuständig, oder?«
»Lediglich wenn ich von Seiner Durchlaucht beauftragt werde.«
»Könntet Ihr eine Ausnahme machen?«
»Das wird kaum möglich sein. Ich befinde mich hier auf feindlichem Boden und habe im Herzogtum Coburg keinerlei Handhabe.«
»Ihr habt uns besiegt, also seid Ihr jetzt verantwortlich.«
Ihn amüsierte ihre Logik, doch ihr ernstes Gesicht verbot ihm, darüber zu lachen. »Geht es um ein Verbrechen?«
»Meine Mutter wurde als Hexe denunziert und verbrannt. Sie war unschuldig.«
Das Mädchen dauerte ihn. Als Kind einer Hexe musste sie mit der Bürde des Aberglaubens ihrer Mitbürger leben. Für ihn selbst existierten weder Hexen noch Zauberer, und selbst bei der Antwort auf die Frage, ob es einen Gott gab, wie ihn die Kirchen darstellten, kam er ins Zaudern. Solche Gedanken behielt er jedoch tunlichst für sich. »Wann war das?«
»Vor zehn Jahren.«
»Da bin ich leider machtlos. Ihr müsst Euch an Euren Herzog wenden.«
»Er war selbst darin verwickelt. Die Beschlagnahme ihres Vermögens kam ihm gerade recht.«
»Es gehört viel Mut dazu, den eigenen Herzog öffentlich anzuklagen.«
»Das sage ich nur Euch, weil Ihr ein Katholischer und dem Herzog zu keinem Gehorsam verpflichtet seid.«
Als er verneinte, ließ sie die Schultern hängen. »Am besten, Ihr kehrt um«, sagte er. »Oben wird noch gekämpft. Aber so Gott will, ist der Spuk bald vorbei.«
»Ich habe keine Angst«, rief sie und warf ihren Kopf in den Nacken. »Wer will schon etwas mit der Tochter einer Hexe zu tun haben?«
Oben an der Burg ertönte ein gewaltiges Donnern. Kanonen wurden abgefeuert. Davon unbeeindruckt wanderte das Mädchen den Topf schwenkend weiter bergauf.
Nachdenklich setzte Karl seinen Weg fort. Die Aufgabe hätte ihn gereizt, aber so schnell würde er nicht nach Coburg zurückkommen – wenn er diesen vermaledeiten Krieg überhaupt überleben sollte.
September 1634
3 Elisabeth
Bunte Fahnen wehten über der Ehrenburg, der Stadtresidenz des Coburger Herzogs, denn heute war ein Festtag. Elisabeth Bachenschwanz packte den Henkel des vollen Wassereimers und schleppte ihn vom Schlossbrunnen zu ihrem schmucken Fachwerkhaus in der Herrngasse, das drei Stockwerke hoch war.
Bürger strebten in Scharen dem Marktplatz zu, denn der Festungskommandant und einige seiner Offiziere würden heute geehrt werden. Sie hatten bei einem vor Kurzem erfolgten Angriff der Kroaten, bei der Verteidigung von Veste und Stadt Standhaftigkeit beweisen.
Vor zwei Jahren war der bayerische Kurfürst zusammen mit Wallenstein in ihre Heimat eingefallen, um Coburg einzunehmen, und kurze Zeit später unverrichteter Dinge wieder abgezogen. Damals hatte Elisabeth ihren Kummer einem Fremden anvertraut, der jedoch mit seinem Heer weitergezogen war. Ein dauerhafter Frieden war dennoch nicht eingetreten, denn immer wieder wurde das Coburger Land von marodierenden Feinden heimgesucht.
Das Wasser war für die Pflanzen im Hinterhof ihres Elternhauses bestimmt, in dem sie mit ihrem Vater, der Stiefmutter Mathilde und deren Tochter Käte aus erster Ehe lebte. Zu dem Haushalt gehörten außerdem eine Küchenmagd sowie ein Knecht, der für die schweren Arbeiten zuständig war. Mehr Gesinde hatten sie nicht, denn die Besatzer hatten die Ruhr-Krankheit mitgebracht, die die Bevölkerung dezimiert hatte.
Als Elisabeth die hölzerne Eingangstür öffnete, schlug ihr aus dem Flur der Geruch von Gemüseeintopf und Gebratenem aus der Küche entgegen. Sie öffnete die Küchentür, rief einen Gruß hinein und erntete dafür ein grantiges: »Raus aus meiner Küch.«
Schmunzelnd trug Elisabeth den schweren Eimer in den geliebten Hinterhofgarten, den ihre Mutter einst angelegt hatte. In ihm blühten Rosen, wuchsen Himbeer- und Johannisbeersträucher, und sogar ein Apfelbäumchen streckte seine mit goldenen Blättern behängten Zweige in die Herbstluft. In einem mit Steinen eingefassten Beet gab es noch etwas Schnittlauch, Petersilie sowie Pfefferminze. Einige Astern leuchteten ihr bunt entgegen. Nachdem Elisabeth mit dem Gießen fertig war, betrachtete sie zufrieden den Garten.
»Elisabeth!«, rief Käte plötzlich aus einem der Fenster im zweiten Stock. »Hast du mich vergessen? Bring mir den dunkelroten Rock und das dazu passende Mieder.«
Elisabeth hatte tatsächlich nicht daran gedacht, doch zugeben würde sie das nicht. »Ich komme gleich!«, antwortete sie, aber Käte war bereits im Innern verschwunden. Elisabeth holte das Gewünschte aus der Kleiderkammer im ersten Stock und betrat Kätes Zimmer im zweiten.
Die Siebzehnjährige trat ihr lachend entgegen, wobei ihre hüftlangen blonden Haare bei jedem ihrer Schritte wippten. Wie so oft erinnerten sie Elisabeth an ein reifes Kornfeld, dessen Halme sich im Wind wiegten. Unter Kätes langem, rüschenbesetztem Leinenhemd schauten nackte Füße hervor. Ihr Vater war kurz vor ihrer Geburt gestorben, und keine drei Monate nach dem Feuertod von Elisabeths Mutter war sie gemeinsam mit ihrer Mutter Mathilde ins Haus des Bürgermeisters Bachenschwanz eingezogen. Damals war Elisabeth neun Jahre alt gewesen, und der Anblick der brennenden Mutter verfolgte sie bis heute.
»Kommst du nach der Ehrung mit in den Festsaal?«, fragte Käte. »Der Rat soll sogar ein Tänzchen erlaubt haben.«
Nachdenklich hielt Elisabeth die dunkelroten Kleidungsstücke hoch. Sie hätte schon gewollt, aber als Kind einer Hexe sollte sie solchen Festivitäten besser fernbleiben. »Mal sehen«, sagte sie deshalb ausweichend. »Ich habe noch zu tun.«
»Das kann warten«, erwiderte Käte und zog ihr am Zopf. »Vielleicht lernst du einen hübschen jungen Mann kennen?«
»In Coburg? Die wissen doch alle, dass ich keine Aussteuer mit in die Ehe bringe.« Elisabeth zog ihr den Seidenrock über. »Ich werde für mein Auskommen selbst sorgen müssen.«
»So darfst du nicht reden. Es ist die Bestimmung einer jeden Frau, einem Mann zu dienen und ihm Kinder zu gebären.«
»Mich will keiner und ich will auch keinen.«
»Mutter findet bestimmt eine gute Partie für dich.«
Gott bewahre, dachte Elisabeth.
Käte blinzelte mit ihren langen Wimpern und drehte sich im Kreis, wobei der Rock wie ein riesengroßer roter Kreisel mitschwang. »Und eine Aussteuer bekommst du bestimmt auch. Meinst du, ich kann so gehen?«
Sie sah wunderschön aus. Elisabeth deutete auf ihre blanken Füße. »Du hast die Schuhe vergessen.«
Kichernd schlüpfte Käte in die roten Seidenschuhe ihrer Mutter.
In zartgelbem Brokat, hochgeschlossen und mit Spitzenhaube kam Mathilde hereingeschwebt. Kritisch ließ sie ihren Blick über Käte schweifen, zupfte hier und dort an ihr herum, bis sie endlich zufrieden nickte. »Steht dir wirklich gut. Unsere Gäste werden entzückt sein.«
»Wenn du auf diesen Wolffrum anspielst – den mag ich nicht.«
Einen Moment lang weiteten sich Mathildes Augen. »Du musst ihn nicht mögen«, sagte sie mit brüchiger Stimme. »Sei nett zu ihm, das genügt. Außerdem ist er kein Freier, sondern ein wichtiger Gast.«
Käte verzog das Gesicht, als würde sie in eine dieser seltenen Früchte aus dem Süden, die sie Zitronen nannten, beißen.
Der aus Eisenach stammende Dr. Peter Wolffrum hatte als Geheimer Rat nicht nur das Ohr des Herzogs, sondern auch großen Einfluss auf die Oberen der Stadt. Ihm gab Elisabeth die Hauptschuld am Tod ihrer Mutter. Beweisen konnte sie das allerdings nicht. Jedes Mal, wenn über ihn gesprochen wurde oder er an ihr vorüberging, erwachten die alten Schreckensbilder zu neuem Leben. Mit zitternden Fingern steckte sie Kätes üppige Haarpracht hoch.
»Hast du die Tischdecke zu Ende gestickt?«, fragte Mathilde in ihr Brüten hinein. »Die würde gut zum heutigen Anlass passen.«
»Ja.« Elisabeth hasste Sticken, aber die Stiefmutter legte großen Wert darauf, dass sie diese hausfraulichen Fähigkeiten beherrschte. »Es wurde alles zu Eurer Zufriedenheit erledigt, Frau Mutter. Wenn Ihr zurück seid, erzählt mir bitte, wie es war.«
»Du gehst nicht mit?« Mathilde legte nun selbst an Kätes Frisur Hand an. »Die Ehrung unserer Helden sollte dir nicht einerlei sein.«
»Welcher Helden? Als die Kroaten kamen, haben sie sich feige in den Weinbergen versteckt, weil der Feind in der Überzahl war. Und als der drohte, die Dörfer niederzubrennen, öffneten die Bürgermeister das Stadtsäckel, damit sie weiterziehen.«
Mathildes Blick ruhte lange auf ihr. »Du bist zu rebellisch, Elisabeth. Eine Frau hat über solche Dinge nicht nachzudenken. Wenn du dich nicht demütig verhältst, wird man das auf den schlechten Einfluss deiner Mutter zurückführen.«
Mathilde verschwand mit ihrer Tochter über die Stiege nach unten ins Erdgeschoss, wo Vaters tiefe Stimme zu hören war. Kurz darauf fiel die Haustür schwer ins Schloss. Stille breitete sich aus. Nicht einmal aus der Küche drangen Geräusche. Nur der Essensgeruch hing noch in der Luft.
Vom Marktplatz her erschollen Fanfaren, und Trommeln schlugen so laut, dass es durch die Herrngasse hallte. Elisabeth öffnete ein Fenster und beugte sich hinaus. Die halbe Stadt war auf den Beinen: die Herren mit weiten Hüten, die verheirateten Frauen mit Hauben. Nachdem sie dem Treiben eine Weile zugeschaut hatte, holte sie die Decke mit der Stickerei aus der Rosenholztruhe und breitete sie auf dem Tisch aus. Viele Stunden mühseliger Arbeit steckten darin.
Lauter Applaus lockte Elisabeth erneut ans Fenster. Die kräftige Stimme des vorsitzenden Bürgermeisters scholl vom Marktplatz zu ihr herüber. Langsam zog sie sich zurück, öffnete die Anrichte und deckte das Fayencen-Geschirr und die Kristallgläser auf.
Als ein Trommelwirbel einsetzte, hielt sie es nicht länger im Haus aus. Kaum war sie auf der Straße, hörte sie Hufgetrappel hinter sich. Erschrocken fuhr sie herum. Ein mächtiges Ross baute sich vor ihr auf. Sie stolperte rückwärts und fiel auf ihr Hinterteil.
Zwei Reiter in blauen Jacken mit geschlitzten Ärmeln sowie Spitzenkragen und breitkrempigen Hüten mit Straußenfedern daran hielten ihre stattlichen Pferde neben ihr an. Einer hatte lockiges blondes Haar, der andere pechschwarzes. Letzterer sah dem Leutnant des Kurfürsten, dem sie vor zwei Jahren ihr Leid geklagt hatte, zum Verwechseln ähnlich. Sie blickte genauer hin, er war es tatsächlich. Was wollte er hier und wer war sein Begleiter? Bedeutete das, dass die Bayern wieder über Coburg herfallen würden?
Schwungvoll sprang der Blonde von seinem Fuchs und bot ihr galant die Hand. »Verzeiht, es lag nicht in meiner Absicht, Euch zu erschrecken oder gar zu verletzen.«
»Glaubt ihm nicht. Das macht er immer so, wenn ihm ein Weibsbild gefällt«, sagte der Leutnant des Kurfürsten. Den Kinnbart hatte er sich abrasiert, den schmal geschnittenen Oberlippenbart hingegen behalten. An seinem Sattel hing eine Muskete, und beide Männer trugen lange Schwerter umgeschnallt.
Feine Herren, vor denen sie im Straßendreck hockte. Sie erfasste die Hand des Blonden und ließ sich von ihm hochziehen.
»Hört nicht auf diesen Sprücheklopfer. Karl will Euch nur in Verlegenheit bringen. Habt Ihr Euch wehgetan?«
Das war die Strafe für ihre Neugierde. Sie hätte im Haus bleiben sollen, denn nun musste sie das Getratsche der Passanten fürchten, weil sie sich mit Fremden unterhielt. »Nein, mein Herr.«
»Von wegen Sprücheklopfer«, brummte Karl, dessen Lachfalten seinen gestrengen Gesichtsausdruck Lügen straften. Er sah vornehmer aus als vor zwei Jahren; vom Straßenstaub, der seinen Kleidern anhaftete, einmal abgesehen. Erinnerte er sich noch an sie? Verschmitzt lächelnd zwinkerte er ihr zu. »Könnt Ihr uns verraten, warum die ganze Stadt aus dem Häuschen ist?«
»Wir ehren heute unseren Festungskommandanten und seine Offiziere, weil sie die Veste so wacker gegen die Kroaten gehalten haben.«
Die Wärme in den Augen des Blonden wich einer Verbissenheit. »Wir haben die Verwüstungen vor den Toren der Stadt gesehen. Wer wird geehrt? Etwa Oberst Taupadel, den die Schweden zum Generalmajor ernannt haben, weil er die Veste so gut gegen Wallenstein verteidigt hat?«
»Der ist längst weitergezogen. Unser neuer Festungskommandant heißt Zehm.«
Die Mundwinkel des Blonden sanken nach unten. »Wir sind umsonst gekommen«, sagte er zu Karl.
»Wir werden sehen. Ich brauche jetzt erst mal ein kühles Bier und tüchtig was zu essen. Da vorne ist ein Gasthof, nicht wahr?«
»Das Goldene Kreuz. Eine gute Herberge.«
»Das Hexenkind!«, schrie eine Magd im Vorbeigehen und hielt sich ihre Zeigefinger überkreuzt vors Gesicht. »Du bist schuld an unserm Unglück. Deine Mutter hat uns alle verhext!«
Dass so etwas passieren würde, hätte Elisabeth sich denken können. Entsetzt rannte sie zurück ins Haus.
4 Karl
Freiherr Karl Köckh zu Prunn hatte das Mädchen mit dem kastanienbraunen Haar auf den ersten Blick wiedererkannt. Er hätte es nie für möglich gehalten, dass sich ihre Wege noch mal kreuzen würden, aber die Spielregeln des Lebens waren mitunter unergründlich. Lange hatte er nicht mehr an das Mädchen gedacht, erst als sein Freund Hannes ihn gebeten hatte, ihn mit nach Coburg zu nehmen, hatte er sich an das Zusammentreffen erinnert. Und nun sah er die junge Frau wie vom Teufel gehetzt in einem der Fachwerkhäuser verschwinden.
»Nanu? Was war das denn?«, fragte sein Freund, Hannes Freymann von Randeck. Hannes und er hatten dieselbe Schule in Eichstätt besucht, gemeinsam Streiche ausgeheckt und die darauffolgenden Strafen zusammen ertragen. Sogar in dieselbe Maid hatten sie sich verliebt, aber bevor sie sich wegen ihr entzweien konnten, hatte ein Dritter erfolgreich um sie geworben.
»Hast doch gehört. Dem Mädchen bin ich während meines letzten Aufenthalts hier in Coburg begegnet. Seine Mutter wurde als Hexe denunziert.«
»Denunziert?« Hannes runzelte die Stirn. »Mitunter fällt es einem schwer, die Wahrheit zu akzeptieren.«
»Manchmal frage ich mich, ob du wirklich der Sohn deines Vaters bist.«
Hannes legte den Kopf schief. »Seine Weigerung, sich an den Hexenverfolgungen zu beteiligen, hat ihm gewaltigen Ärger eingebracht.«
»Und den Segen derer, die dadurch verschont blieben. Schau, da vorne ist das Gasthaus. War beim ersten Mal gar nicht so übel. Ich kann das Bier und das Essen schon riechen.«
»Du warst dort mal zu Gast?«
»Nur zum Essen. Genächtigt habe ich in einem Schlösschen, das der Kurfürst für sich in Anspruch genommen hat – sehr zum Leidwesen des Besitzers.«
Auf dem nahe gelegenen Marktplatz erschollen Rufe, und als Pferdegetrappel einsetzte, brandete Beifall auf. »Du kannst dich noch früh genug auf die faule Haut legen«, erwiderte Hannes. »Hörst du, wie die Bürger applaudieren? Diesen Festungskommandanten Zehm sollten wir uns einmal näher anschauen, meinst du nicht auch?«
Zehm, leider nicht Taupadel, der schwedische General, hinter dem nicht nur Hannes her war, sondern auch alle Kaiserlichen. Den zu fangen würde Ehre und Belohnung bedeuten. Zehm dagegen war im großen Gesamten nur ein kleines Licht.
Taupadel trieb jetzt an einem anderen Ort sein Unwesen und lachte seine Verfolger aus. Wallenstein hatte ihn in seinen Händen gehabt und dann laufen lassen. Deshalb war er in Verdacht geraten, sich den Schweden andienen zu wollen, und war des Hochverrats beim Kaiser angeklagt worden. Weil kein Offizier seines Reichs bereit gewesen war, Wallenstein zu beseitigen, hatten die Schotten herhalten müssen, um ihn und seine Getreuen ins Jenseits zu befördern. Wäre Karl damals mit ihm gezogen, wer wüsste, ob er heute noch am Leben wäre.
An der Eingangstür trat ihnen eine stämmige Frau mit schmalen Lippen entgegen und stemmte ihre gichtknotigen Hände in die Hüften. »Ich bin die Wirtin, alle nennen mich Sonja«, lispelte sie. »Auf welcher Seite steht Ihr, wenn ich fragen darf? Ihr müsst entschuldigen, neuerdings muss man vorsichtig sein, wen man beherbergt.«
»Auf keiner«, antwortete Karl knapp und hoffte, die Frau würde ihn nicht wiedererkennen.
»Des sin’ die Schlimmsten«, war alles, was sie entgegnete. Sie wies einen ihrer Knechte an, die Pferde im Stall des Hinterhofs unterzubringen. Sichtlich stolz zeigte sie ihnen eines der Herbergszimmer im ersten Stock. Darin standen richtige Betten, eine Waschschüssel und sogar ein Nachtgeschirr. »Nicht ausm Fenster schütten, verstanden? Das Wetter is gut, Ihr könnt also aufs Scheißhaus im Hinterhof gehen. Besauft Euch net, denn ich mag’s net, wenn jemand ins Bett kotzt.«
»Ich auch nicht.« Karl drückte prüfend auf der Strohmatratze herum. »Wäre schön, wenn sich der Gast vor uns auch daran gehalten hätte. Hoffentlich ist es nicht verwanzt?«
»Wo denkt Ihr hin? Das Stroh is ganz frisch.«
»Sieht ordentlich aus. Was meinst du, Hannes?«
»Wir nehmen es. Wie viel verlangt Ihr?«
»Einen Schilling die Nacht pro Person und einen halben für die Pferde. Aber im Voraus, wenns beliebt.«
Sie schien ihnen nicht zu trauen, und sie tat gut daran. Karl drückte ihr die geforderten Geldstücke für zwei Nächte in die Hand. »Falls wir länger bleiben, lassen wir es Euch rechtzeitig wissen.«
»Komm schon, ich will die Ehrung nicht verpassen«, drängte Hannes.
Trotz seines Durstes und des Lochs im Bauch gab Karl nach. Hannes marschierte voran Richtung Marktplatz und bahnte sich einen Weg durch die Menschenmenge.
Mehrstöckige Fachwerkhäuser standen sich auf dem weitläufigen Platz gegenüber, die beiden anderen Seiten wurden von zwei großen Gebäuden eingenommen. Eines wurde an den Ecken von doppelstöckigen, reich verzierten Erkern abschlossen, das andere hingegen wies nur einen auf. Auf dessen Dreiecksgiebel befand sich die grün angelaufene Statue eines Männchens mit Wappenschild in der einen und einem erhobenen Marschallstab in der anderen Hand. Links und rechts des Gebäudes plätscherten zwei große Brunnen. Coburg hatte trotz des im ganzen Land wütenden Kriegs nichts von seiner Pracht verloren.
»Reiche Bürgersleute«, stellte Hannes fest. »Offensichtlich sind die Coburger mit einem blauen Auge davongekommen.«
»Wallenstein wollte die Veste und der Kurfürst die Stadt. Wäre der Schwedenkönig nicht in Bayern eingefallen, sähe das Herzogtum Sachsen-Coburg jetzt anders aus.«
Auf einem hölzernen Podest, vor dem etwa zwanzig berittene Dragoner Aufstellung genommen hatten, sprachen die Oberen der Stadt mit einem leicht ergrauten Offizier im glänzenden Brustharnisch.
»Das muss Kommandant Zehm sein«, sagte Hannes leise und stellte sich hinter eine fein gekleidete Dame und ein blondes Fräulein im dunkelroten Kleid. Die beiden Frauen drängten sich in die vorderste Reihe, wobei die Bürger respektvoll zur Seite traten. Karl nutzte die so entstehende Lücke, indem er nachrückte. Lavendelparfüm stieg ihm in die Nase. Das Mädchen drehte sich halb um und strahlte ihn aus himmelblauen Augen an.
»Ihr seid fremd hier, nicht wahr?«, fragte es mit heller Stimme.
»In der Tat, das sind wir. Wollt Ihr uns nicht verraten, wer die anwesenden Herrschaften sind?«
»Gerne«, sagte das Mädchen und deutete auf das Podest. »Das sind die wackeren Verteidiger der Veste. Der da oben in der Rüstung, das ist der Festungshauptmann Zehm, und der daneben ist unser Oberstwachtmeister Görtz.«
Görtz strahlte den Charme einer Daumenschraube aus. »Zwei Befehlshaber in einer Festung – kommt es da nicht zu Reibereien?«, fragte Karl.
Das Mädchen kicherte. »Die zwei können sich auf den Tod nicht ausstehen. Schließlich war der Zehm schon lange vor Görtz da. Der ist einer von uns und dient dem Herzog, während der Görtz dem Generalmajor Taupadel unterstellt ist. Den hat Taupadel hiergelassen, um auf seine Schwester und seinen Sohn aufzupassen.«
»Der Generalmajor hat seine Schwester und seinen Sohn dagelassen?«
»Weil er die Veste als unbezwingbar erachtet.« Das Mädchen hob seine Nase. »Nach Wallenstein wird keiner mehr seine Zeit verschwenden, hat er gesagt.«
Wenn er sich da nicht getäuscht hatte, dachte Karl. Hinter ihm sog Hannes die Luft scharf ein. »Wie viele Landsknechte sind denn oben auf der Veste stationiert?«
»Och, jede Menge. An die sechshundert, glaube ich.«
Die Dame, die das Mädchen begleitete, fuhr herum und zupfte es am Ärmel. »Wirst du wohl schweigen, du dummes Ding?«
Die Ältere hatte ein ebenmäßiges, schmales Gesicht und hielt sich kerzengerade, wobei der exquisite Stoff ihrer Kleidung im Sonnenlicht schimmerte. In ihrer Jugend musste sie eine Schönheit gewesen sein, heute wirkte sie verhärmt. Ein Eindruck, der durch die dünnen Lippen und die Krähenfüße um Mundwinkel und Augen verstärkt wurde.
»Meine Herren, ich weiß nicht, wo Ihr herkommt, doch bei uns in Coburg gilt es als ungehörig, eine Jungfer ohne Erlaubnis ihrer Eltern anzusprechen«, sagte sie spitz.
»Verzeiht«, erwiderte Karl mit einer leichten Verbeugung. »Erstens hat das Fräulein uns zuerst angesprochen, zweitens ist es in Eurer Begleitung und drittens schadet es nicht, oder? Wir wollten gewiss nicht unhöflich sein.«
»So ist es«, bestätigte Hannes. »Wir sind auf der Durchreise und wollten uns nur vergewissern, dass uns keine Gefahr droht. Immerhin leben wir in unsicheren Zeiten. Vor den Toren der Stadt fanden wir etliche Dörfer niedergebrannt und verlassen vor.«
»Das waren die Kroaten. Mögen sie dafür ewig in der Hölle schmoren.« Die Frau musterte sie ausgiebig. »Ihr seht nicht wie dieses Lumpenpack aus.«
»Wo denkt Ihr hin? Wir sind Vertriebene aus Bayern, die eine Anstellung suchen«, sagte Karl und verbeugte sich zuerst vor der Frau und dann vor dem Mädchen. »Ich wünsche Euch und Eurer Tochter einen angenehmen Tag.«
Ihre Augenbrauen zogen sich zusammen. Gleich würde sie die Stadtwache rufen, da war sich Karl sicher. »Habt Ihr Euch beim Kommandanten der Bürgerwehr angemeldet?«
»Mit Verlaub, sonst wären wir nicht hier. Coburg hat mächtige Mauern und gut bewachte Tore. Auf Wiedersehen, meine Dame.«
Außer Hörweite stupste Hannes ihm seinen Ellenbogen in die Seite. »Gut gemacht, Karl. Jetzt wissen wir wenigstens, was uns erwartet. Das Mädchen hätte noch mehr ausgeplaudert, wenn die Mutter nicht dazwischengegangen wäre.«
»Eigentlich nicht viel Neues. Dennoch sollten wir die Angaben überprüfen.«
»Deshalb möchte ich zur Veste hoch, solange die Kommandanten unten auf dem Marktplatz feiern. Die Gelegenheit ist günstig.«
»Nicht günstiger als an jedem anderen Tag. Nur ein Narr würde die Verteidigung einer so wichtigen Burg vernachlässigen. Vor allem dann nicht, wenn der Kommandant die Verantwortung für die Sicherheit der Familie seines Oberen trägt. Das wird kein Kinderspiel, dort hineinzugelangen.« Karl deutete auf ihren Gasthof. »Vielleicht finden wir da drinnen einen, der wie ein Zeisig singt, wenn wir ihm genug Bier und Wein einschenken.«
»Oder wir lösen seine Zunge mit der Peitsche«, knurrte Hannes.
»Mensch, reiß dich zusammen. Die Coburger haben uns freundlich aufgenommen.«
Der Freund schüttelte den Kopf. »Das ist es nicht. Es geht mir weder um Coburg noch um diesen verdammten Krieg. Es geht mir um …«
»Um persönliche Rache«, vervollständigte Karl den Satz. »Du weißt, wie die Mühlsteine der Mächtigen mahlen, und wir sollten aufpassen, dass wir nicht dazwischengeraten.«
5 Elisabeth
Die Sehnsucht, der Enge ihrer Dachkammer zu entrinnen, ließ Elisabeth aus dem kleinen geöffneten Fenster schauen, um das Treiben auf der Herrngasse zu verfolgen. Die kalte Luft störte sie nicht, schien im Gegenteil ihre Sinne zu wecken. Wenn Elisabeth sich vorbeugte, konnte sie einen Blick auf den Markt erhaschen. Stimmengewirr drang zu ihr herauf. Anscheinend war der Festakt zu Ende, denn die zwei Fremden verschwanden im Goldenen Kreuz. Sie erinnerte sich noch gut an den dunkelhaarigen Leibgardisten des Bayernfürsten. Die Hoffnung, er möge sich um ihr Anliegen kümmern, hatte er mit seinem Weggang zerstört. Nun war er zurückgekehrt, jedoch nicht mit einem Heer, sondern mit einem gut aussehenden blonden Begleiter.
Was wollten sie hier? Bestimmt waren sie Spione, denn Vater hatte geäußert, die kaiserlichen Armeen könnten sich bald gen Coburg wenden. Allerdings trugen die beiden keine Uniformen, und wer konnte schon sagen, wem sie jetzt dienten. Dem Wallenstein sagte man nach, er habe sich eines Besseren besonnen und die Fahnen gewechselt, wofür er im Januar mit Absetzung und im Februar mit der Ermordung bestraft worden war.
Nach der Verheerung, die Wallenstein vor zwei Jahren angerichtet hatte, ging es den Coburgern inzwischen wieder einigermaßen gut. Bäckermeister Hohnbaum eilte unter ihrem Fenster vorbei, gefolgt von seinem Gesellen mit einem Huckelkorb halb gefüllt mit Brotlaiben. Kurz darauf winkte Krämersohn Hans Sommer grinsend zu ihr hoch, bevor er um die nächste Ecke verschwand. Aus dem Fenster schauend fühlte sich Elisabeth frei. Niemand bedrohte sie, nicht einmal ein böser Traum.
Ihr Frohsinn verpuffte augenblicklich, als vom Markt kommend zwei Männer in schmucklosen schwarzen Roben und mit dunklen Spitzhüten ihre Schritte auf Elisabeths Elternhaus zu lenkten. Die herzoglichen Geheimräte Dr. Peter Wolffrum und Dr. Bonaventura Gauer wollten ihrem Vater einen Besuch abstatten. Dr. Gauer war der vorsitzende Bürgermeister und der besuchte eigentlich niemanden, denn er und die anderen Bürgermeister trafen sich regelmäßig im Rathaus. Neugier und Angst vor Wolffrum wechselten sich bei Elisabeth ab. Er war Kirchenrat und zugleich Ankläger für allerlei Verbrechen. Ihn wollte keiner gern als Gast haben.
Es war Elisabeths Aufgabe, die Herren hereinzulassen, was sie sogleich tat. Wortlos schritten sie an ihr vorbei in den Flur, wo Elisabeths Vater sie schon erwartete. Er bat sie nach oben in die gute Wohnstube. Steif erwiderten sie seinen Gruß und entblößten dabei ihre kahlen Häupter. Elisabeth folgte ihnen.
»Wie geht es dir, Elisabeth?«, fragte Wolffrum mit scharfer Stimme, als er auf Vaters Stuhl Platz nahm. »Betest du brav jeden Tag?«
»Gewiss, Herr Geheimrat.«
»Einzig durch ständiges Bußetun kannst du der Hölle entrinnen, die dir ansonsten vorbestimmt wäre. Du musst mir sofort mitteilen, wenn der Satan dich zu verführen sucht.«
»Gewiss«, murmelte sie und wünschte sich weit fort.
In diesem Moment betrat Mathilde in einem hochgeschlossenen dunklen Kleid die Stube und winkte Elisabeth, das Mahl zu servieren. Es würde ein langer Abend werden.
Auf die Gemüsesuppe folgte eine Schweinekeule samt brauner Schwarte, dazu gekochter Kohl und Brot. Für die herzoglichen Räte nur das Beste. Wie köstlich das alles duftete. Geschwind verließ Elisabeth die Stube. Sie ließ die Tür halb offen, um zu hören, wenn sie gerufen wurde. Aus dem Zimmer drangen Schlürf- und Schmatzgeräusche, laute Rülpser sowie ein ordentlicher Furz. Elisabeth zog sich nach unten in die Küche zurück.
»Was ist mit dir, Lisbeth?«, fragte Ilse sie dort. Sie war die Regentin der Küche, und nicht einmal Mathilde wagte es, ihr zu widersprechen.
»Dieser Dr. Wolffrum …«
»Hat er dich wieder mal an deine Sünden erinnert? Das macht der mit jedem. Nimm’s net so ernst. Der hält sich für ’nen Stadtheiligen. Wer frei ist von Schuld, der werfe den ersten Stein, müsst der sich selbst den ganzen Tag predigen, anstatt ständig auf andern rumzuhacken.«
»Was willst du damit sagen?«
Ilse zog die Schultern hoch und drehte sich weg. »Nix weiter. Ich mein halt bloß, dass manchmal die besonders Heiligen in Wahrheit die größten Scheinheiligen sind.«
»Du redst dich um Kopf und Kragen.« Der einohrige Lutz zog seinen Kopf aus dem Kamin, den er einmal im Monat reinigen musste. Mit seinem rußgeschwärzten Gesicht sah er aus wie der Schutzpatron auf dem Coburger Stadtwappen. Früher als Kind hatte es ihr Spaß gemacht, sich mit dem Ruß anzuschwärzen, was ihre Mutter lachend quittiert hatte – Vater nicht.
»Pah«, war alles, was Ilse erwiderte.
»Gott zum Gruße!« Archidiakonus Pfürschner betrat die Küche, ließ sich am Tisch nieder und leierte ein Gebet herunter. Kaum war er damit fertig, löffelte er gierig die Suppe in sich hinein.
»Stimmt es, dass die Kaiserlichen sich sammeln?«, fragte Ilse ihn. »Die Schafhirten haben erzählt, dass sich bei Kulmbach was zusammenbraut.«
»Solang’s bei uns noch was zu holen gibt, hauen die net ab«, sagte Lutz und steckte seinen Kopf wieder in den Kamin. Kurz darauf drangen kratzende Geräusche daraus hervor.
»Wirste wohl mit dem Krach aufhören, solang unser Gast isst?«, rief Ilse.
»Ich hab ihn net gerufen.«
»Wir müssen mehr beten«, sagte der Archidiakonus, »dann werden sie uns verschonen.«
»Die brauchen gar net schießen, die bringen auch so Tod und Pestilenz«, drang es aus dem Kamin. Ein Batzen Ruß fiel herunter und schwärzte alles drum herum.
»Oh, du Saubär!«
»Alles liegt in Gottes Hand.« Schmatzend beendete der Pfaffe seine Mahlzeit. »Du bist die beste Köchin von ganz Coburg, Ilse.«
Die schaute verlegen weg. »Trotzdem gibt’s kein’ Nachschlag. Die Suppe muss bis morgen reichen.«
Mit enttäuschter Miene verabschiedete sich der Pfarrer, nicht ohne schnell einen Segen auszusprechen. Elisabeth blickte ihm hinterher. Die Kaiserlichen sammelten sich, und die beiden Neuankömmlinge gehörten bestimmt zu ihnen.
»Du musst wieder hinauf«, sagte Ilse.
Elisabeth nickte und verließ die Küche. In der Wohnstube waren die Teller geleert. Alle saßen stumm und steif auf ihren Stühlen. In der Luft lag eine spürbare Spannung. Sie griff nach dem ersten Teller. Schnell alles abgeräumt und dann weg von hier.
»Es wäre mir eine Ehre, Eure Tochter ehelichen zu dürfen«, sagte da der alte Dr. Gauer mit zittriger Stimme.
Er meinte bestimmt die arme Käte. Wenn Elisabeth mehr erfahren wollte, musste sie bleiben. Sie stellte das Geschirr auf den Boden und wischte eifrig über einen nicht vorhandenen Fleck auf der Türschwelle.
»Sie bekäme eine ordentliche Mitgift«, sagte Mathilde.
»Und welcher Art wäre die?«
»Den Gutshof, der, wie Ihr wisst, an Euren Familienbesitz grenzt.«
Der alte Gauer schwieg. Elisabeth rubbelte langsamer und stellte es schließlich ein. Für eine Weile hörte sie nur ihren eigenen Herzschlag und das Knistern des Kaminfeuers. Sie konnte nicht gemeint sein, denn ihr stand keine Aussteuer zu. Wollte Mathilde die siebzehnjährige Käte diesem alten Zausel überlassen, der vermutlich nicht einmal den nächsten Winter überleben würde? Was bezweckte sie damit?
Endlich brach Wolffrum das Schweigen: »Dort ist kaum noch Gesinde, weil der Pächter am Nervenfieber gestorben ist. Wer verrichtet die anstehende Arbeit?«
»Sagtet Ihr nicht, der Krieg sei bald vorbei?«, bemerkte Vater. »Wenn wir uns alle in Gottgefälligkeit üben, kommen die überlebenden Landsknechte auf ihre Höfe zurück und die Not hat ein Ende.«
»Was ist mit Elisabeth?«, fragte Wolffrum.
Ihr Vater räusperte sich vernehmlich. »Für sie suchen wir ebenfalls einen Freier.«
»Ohne Mitgift wird es schwer werden, einen Heiratswilligen zu finden.« Anscheinend hatte Gauer seine Sprache wiedererlangt.
»Wir werden ihr etwas mitgeben. Sie ist alt genug«, sagte Mathilde.
»Fast zu alt«, erwiderte Wolffrum. »Frauen müssen früh mit dem Gebären beginnen, sonst sterben sie dabei.«
»Es wird sich eine Lösung finden.«
Käte und sie sollten verschachert werden wie Kühe. Elisabeth hatte genug gehört, stellte das Geschirr in der Küche ab und flüchtete in ihre Dachkammer, bevor Ilse sie mit Fragen löchern konnte. Ein Holzgestell als Bett, ein Nachttisch mit dem Nachtgeschirr darin, ein Tischlein, auf dem Stoffstücke für ein Mieder lagen, und ein Stuhl bildeten die Einrichtung. An der kahlen Wand hing ein großes Holzkreuz, und auf dem mit Stroh gefüllten Kissen ruhte ein kleines Holzschaf – das einzige Erinnerungsstück an ihre Mutter.
Erschöpft sank sie auf die Bettkante, ergriff das Schäflein, faltete die Hände wie zum Gebet und grübelte über das Gehörte nach, bis ihr die Augenlider zufielen.
Sie erwachte, als unten die Haustür zugeschlagen wurde. Sofort sprang sie auf, öffnete das Fenster und blickte nach unten. Draußen war es inzwischen dunkel. Die Gäste, Mathilde und der Vater verließen das Haus, überquerten die Gasse und verschwanden im Zeughaus gegenüber, dessen Fenster hell erleuchtet waren. Geigen, Lauten und Blockflöten, dazu ein Cembalo und ein Chor intonierten Allemanden sowie Couranten und forderten so die Gäste zum Zuhören und Tanzen auf. Elisabeth beugte sich vor, um die Tanzenden, die sich der festlichen Umgebung und dem Anlass entsprechend herausgeputzt hatten, besser beobachten zu können. Das sanfte Kerzenlicht der Kronleuchter schmeichelte ihnen, sie sahen alle jünger und schöner aus. Die Coburger feierten ausgelassen, obwohl es gewiss manchem wegen des frivolen Treibens einen Schauer des Entsetzens über den Rücken jagte. Elisabeth entdeckte an diesem Abend jedoch nur fröhliche Gesichter und nichts, was Gott hätte missfallen können.
Oder doch?
War das da unten in der Mauernische nicht Käte? Ein groß gewachsener, schlanker Mann küsste soeben ihren Handrücken. Wenn Elisabeth Kätes begeisterte Beschreibung richtig in Erinnerung hatte, konnte das nur dieser Ludwig von Seckendorff sein, der Festungskommandant der benachbarten Heldburg, die ebenfalls zum Herzogtum Sachsen-Coburg gehörte. Beim ersten Erscheinen des Feindes war er hierhergeflüchtet und hatte seine Frau samt Kindern schmählich im Stich gelassen.
Ein weiterer Handkuss folgte, und als er mit seinen Lippen an Kätes Hals entlangfuhr, schlang sie beide Arme um ihn. Und dann küsste er sie mitten auf den Mund.
Erschrocken fuhr Elisabeth zurück, wollte nicht glauben, was sie da beobachtet hatte. Als sie erneut hinausspähte, waren die beiden verschwunden.
Verwundert stieg sie zur Küche hinab, in der Ilse und Lutz die letzten Aufräumarbeiten vornahmen. Wie jeden Abend saßen sie noch zusammen und Elisabeth hörte dem neuesten Tratsch zu, den die beiden austauschten. Meistens waren sie dann sogar einer Meinung. Elisabeth erzählte nichts von ihrer Beobachtung, das stand ihr nicht zu. Die Kirchturmuhr schlug neunmal und es war schon über der Zeit, sich zurückzuziehen. Lutz würde die Haustüre absperren, aber da der Herr noch unterwegs war, brauchte er es heute nicht zu tun. Elisabeth ging nach oben in ihre Kammer, um dem Treiben etwas zuzusehen.
Die Festlichkeiten schienen sich dem Ende zu nähern, da sich immer mehr fein Gekleidete durch die beiden Ausgänge ins Freie schoben. Unter ihnen auch der Vater und die Stiefmutter. Kurze Zeit später knarrte die Eingangstür, und Käte eilte leichten Fußes die Treppenstiege hoch. Sie stürmte in Elisabeths Kammer, wirbelte einmal um die eigene Achse und ließ sich auf den Stuhl plumpsen. Mit einem theatralischen Seufzer legte sie ihre Hand auf den Halsansatz, streckte die Beine aus und studierte die Decke. »Elisabeth, es war herrlich. Du hättest dabei sein sollen. Tanzen, singen und trinken ohne Ende. Meine Füße brennen wie Feuer.«
»Wer war alles da?«
»Alle. Selbst der Zehm und der griesgrämige Görtz und Ludwig. Und stell dir vor, ich werde heiraten.«
»Ja, den alten Gauer.«
»Aber nein, was redest du da? Ludwig will mich ehelichen.«
»Der von Seckendorff? Der ist doch schon verheiratet.«
»Er wird sich scheiden lassen.« Käte sah sich suchend um. »Ich habe mein Täschchen vergessen. Ausgerechnet das perlenbestickte. Magst du es mir nicht holen?«
»Jetzt?«
»Ach, bitte. Meine Füße schmerzen so sehr«, sagte Käte mit einem treuherzigen Augenaufschlag.
»Na gut. Weißt du wenigstens, wo du es gelassen hast?«
»Im Festsaal, auf einem Tischchen. Gleich wenn du reinkommst in der vorderen rechten Ecke.«
Nur wenige Kerzen und Öllampen erhellten den Saal noch. Bedienstete räumten die Tische ab, und in der Luft hing der Geruch von Wein, Bier und Rauch. Ein Mann lag laut schnarchend auf dem Boden.
Elisabeth eilte zu besagtem Ort und fand das Täschchen auf Anhieb. Inzwischen versperrten drei lallende Zecher den Ausgang, aber zum Glück gab es eine zweite Tür, auf die sie nun zulief.
Aus einer der dunklen Ecken drang merkwürdiges Stöhnen. War da jemand in Not? Elisabeth fasste allen Mut zusammen und näherte sich vorsichtig.
Eine Dame saß mit entblößtem Hinterteil auf dem Schoß eines Mannes, der seine Hände in ihre Gesäßbacken verkrallt hatte. Sie hob und senkte sich, wobei sie keuchende Geräusche von sich gab, während er wie ein Säugling an ihrer Brust nuckelte. Als er seinen Kopf in den Schein einer Öllampe drehte, konnte Elisabeth sein verzerrtes Gesicht sehen – Ludwig von Seckendorff. Die Frau stieß einen spitzen Schrei aus, er stöhnte auf.
Für heute reichte es. Mochten die Kaiserlichen getrost kommen, schlimmer konnte es kaum werden.
6 Hannes
Hannes schreckte aus dem Schlaf hoch. Glasklar stand das grausame Bild vor seinen Augen. Abwehrend riss er die Hand nach oben. Blut, so viel Blut. Er roch es förmlich. Menschen aufgespießt, geschlachtet, verkohlt. Und dort, auf dem Vorplatz der brennenden Kirche, ein schmerzverzerrtes Kindergesicht, Tränenspuren, Blut zwischen den dünnen Beinchen, die rehbraunen Augen leer und starr.
Nur langsam drangen die Stille und die Dunkelheit seiner Umgebung in sein gequältes Bewusstsein vor. Er lag in einem Bett des Goldenen Kreuzes in Coburg, und der altbekannte Albtraum hatte ihn einmal mehr heimgesucht.
»Schlaf weiter«, brummte Karl von der anderen Schlafstatt herüber. »Es ist mitten in der Nacht.«
Der Freund schien Mord und Totschlag besser zu verkraften oder er verbarg seine wahren Gefühle geschickt hinter einer Maske der Gleichgültigkeit. Als Zweitgeborener hatte Karl eine Offizierslaufbahn einschlagen müssen, während Hannes als Drittgeborener einen Beruf hatte erwählen können, der ihm zusagte: den eines Forstmannes. Der Erstgeborene erbte die Güter und den Titel, der Zweitgeborene diente seinem Fürsten als Offizier und dem Drittgeborenen blieb nur, ein Kirchenamt zu bekleiden; außer der Vater hatte ein Einsehen. Doch inzwischen hatte der Krieg Karl zum Erben und Freiherrn gemacht und Hannes zum Soldaten. Dankbar hatte er Karls Angebot angenommen, ihn zu begleiten.
An Schlaf war nicht mehr zu denken. Unter seinen nackten Füßen fühlte Hannes die Unebenheiten der Dielen, deren Wärme und Festigkeit. Das Mädchen von gestern fiel ihm ein. Die Tochter eines der Bürgermeister, hatte ihm Karl erzählt. Das Wechselspiel ihrer Gesichtszüge hatte sich ihm eingeprägt; von beherzt bis zurückhaltend und zuletzt erschrocken.
Er legte sich wieder hin, aber der Schlaf wollte nicht kommen. Vertrieben vom Licht des anbrechenden Tages verlor die Nacht allmählich ihre dunkle Kraft. Stimmen und das Rumpeln von Wagenrädern drangen durch die Fenster herein und kündeten vom Erwachen der Stadt.
Eine Möglichkeit zum Waschen fand er nicht. Ein Bad würde ihm guttun, doch das konnte warten. Behände schlüpfte er in frische Sachen, seine schmutzige Wechselkleidung hatte er der Wirtin zum Reinigen gegeben. Karl schlief währenddessen noch tief und fest, was Hannes dem Freund von Herzen gönnte.
Aus der Küche drang das Klappern von Töpfen. Eine Magd schrubbte mit hochrotem Gesicht die Tische in der Schankstube, als er eintrat. Es roch nach Weinessig und Kernseife.
»Mögt Ihr ein Frühstück?«, fragte die Wirtin.
»Gern, aber erst wenn mein Freund sich aus dem Bett gerollt hat. Sagt, wie komme ich am einfachsten zur Veste hoch?«
»Hier die Herrngasse entlang, dann rechts in die Schlossgasse, an der Ehrenburg vorbei, links Richtung Steintor und dahinter immer den Berg ’nauf. Könnt Ihr gar net verfehlen.«
»Die Ehrenburg?«
»Der Sitz des Herzogs. Wenn er sich denn mal bei uns aufhält. Der jetzige bleibt lieber weg. Wir vermissen unseren Johann Casimir!«
Darauf wusste Hannes nichts zu erwidern. Auf dem Schanktisch stand ein Korb voller rotbackiger Äpfel. Er nahm sich einen und steckte einen zweiten unters Wams. Kauend trat er in die Morgenfrische hinaus. Der Himmel hatte sich eine Wolkendecke übergezogen, und die wenigen Menschen, die zu dieser frühen Stunde unterwegs waren, hielten die Jacken zugeknöpft.
Unentschlossen verharrte er einen Moment. Bis auf zwei Männer, die Pferdeäpfel und sonstigen Unrat wegräumten, lag der Marktplatz verlassen vor ihm. Die Türme der Stadtkirche – einer ordentlich hoch, der andere stummelkurz – ragten hinter den Hausdächern auf. Es sah fast so aus, als wäre der Stadt beim Bauen das Geld für den zweiten ausgegangen. Glockengeläut setzte ein und weckte die Schlafenden. Ein struppiger Hund schnüffelte an Abfällen, und eine Magd schüttete den übel riechenden Inhalt eines Eimers in eine Abflussrinne.
Sein Blick schweifte durch die Herrngasse, die ihren Namen zu Recht trug. Ein stattliches Fachwerkhaus reihte sich ans andere. Gleich an der Ecke befanden sich ein Krämerladen und nur wenige Schritte neben dem Goldenen Kreuz das Zeughaus, in dem der Ball stattgefunden hatte. Und in das Haus schräg gegenüber war das Mädchen mit den lindgrünen Augen geflüchtet. Dessen schwere Eichentür war reich verziert, der Türklopfer schimmerte bronzen, und in den oberen Fenstern hielten Vorhänge neugierige Blicke ab. Der Bürgermeister musste gut situiert sein.
Langsam schritt er daran vorbei.
Als er an der Ecke die Schänke Zum Herrenbeck passierte, rückte die Ehrenburg in sein Blickfeld. Das Steintor, eines der Tore der Stadtmauer, wurde soeben von zwei Stadtwachen geöffnet. Die Straße führte über einen Wassergraben und bald zweigte ein Hohlweg links ab. Es ging stetig bergauf, vorbei an vereinzelt stehenden Häusern und summenden Bienenstöcken. Im Süden breiteten sich Weinberge aus, weiter unten erkannte er auf einer Anhöhe den Stadtgalgen und gleich daneben den Brandpfahl.
Über ihm wuchs die mächtige Festungsanlage in den Himmel. Auf dem kahlen Berghang darunter grasten Schafe und Ziegen, behütet von einem mageren Jungen, der ihm, auf einem Grashalm kauend, entgegenblickte. Die eingefallenen Wangen des Burschen ließen darauf schließen, dass er Hunger litt.
Hannes hielt den zweiten Apfel hoch. »He, Junge, magst ihn haben?«
»Ei freilich.« Der Bursche fing ihn geschickt mit einer Hand, riss seinen Mund auf, als wollte er ihn in einem Stück verschlingen, und schlug seine Zähne hinein. Das »Vielen Dank, der Herr« war kaum zu verstehen.
Als Hannes den Bergkamm erreichte, brach die Sonne durch die Wolkendecke und ließ in der Ferne eine Kirchturmspitze im Morgendunst golden erstrahlen. Dahinter reihten sich bewaldete Bergketten auf, die sich mit dem Horizont vereinten.
Hannes hielt auf die Veste zu. Drei Burgmauern trotzten seinem Blick. Ein dickbauchiger, niedriger Turm, darüber eine hohe Bastei sowie viele Schießscharten und Pechnasen ermöglichten es der Besatzung, jeden Angriff abzuwehren. Nicht weit von hier musste Wallenstein seine Kanonen in Stellung gebracht haben, um auf die Festung zu schießen. Kleinere und größere Kugeln in den Mauern zeugten noch heute davon. An der Südseite überspannte eine Zugbrücke den stinkenden Burggraben. Dahinter fiel das Gelände steil ab. Das würde einen Ansturm von der Stadt aus enorm erschweren, wenn nicht gar unmöglich machen. Karl hatte die Lage treffend eingeschätzt. Ein Eindringen ohne Erlaubnis war aussichtslos. Die meisten Burgen hatten einen geheimen Zugang, aber den zu finden schien unmöglich. Trotzdem musste er um jeden Preis hinein, denn seine Opfer würden nicht freiwillig herauskommen. So einfältig wären sie nicht – oder doch?
Hannes blieb vor dem Tor zur Zugbrücke stehen. Oben auf dem Wehrgang hielten vier Soldaten Wache, und ein Hellebardier schaute misstrauisch aus seinem Wächtertürmchen zu ihm herunter. Zwei Pikeniere traten aus dem Burgeingang, über dem die Spitzen eines Fallgitters bedrohlich nach unten ragten.
»Wohin des Wegs?«, fragte der Hellebardier.
»In die Stadt. Da lang, oder?«
»Schau, dass du dich schleichst, sonst machen wir dir Beine.«
»Ich gehe auf der anderen Seite runter, wenns recht ist. Einen schönen Tag noch.«
An zwei Pulvertürmen im äußeren Mauerring vorbei gelangte Hannes zu einer flache Bastei, die aussah, als streckte die Burg die Zunge heraus. Auf ihr spazierte soeben eine Frau mit einem kleinen Jungen an der Hand. Das mussten Taupadels Schwester und dessen Sohn sein. Wenn es ihm gelänge, die beiden in seine Gewalt zu bringen, würde der General für seine Verbrechen bitter büßen müssen.
Ein Mann trat auf die Dame zu, verbeugte sich ehrerbietig und führte die ihm entgegengestreckte Hand an seinen Mund. Hannes erkannte ihn erst auf den zweiten Blick: Ludwig von Seckendorff. Dieser Weiberheld hatte gestern das blonde Mädchen, das auf dem Marktplatz so auskunftsfreudig gewesen war, hofiert, nur um später eine andere Dame zu begatten. Und heute hatte er schon die Nächste im Visier.