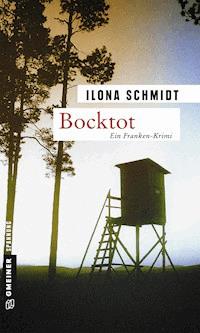4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nürnberg, 2008. Handelt es sich bei den wertvollen Gemälden auf dem Dachboden wirklich um Nazi-Raubkunst? Eine Spur führt Lukas zu Daniela, deren Großtante Maria nach dem Zweiten Weltkrieg ausgewandert ist. Gemeinsam fliegen sie in die USA, um dort weitere Nachforschungen anzustellen. Werden sie in Marias Aufzeichnungen Antworten finden? München, Anfang 1945. Inmitten der zerstörten Stadt riskiert die achtzehnjährige Maria ihr Leben, indem sie eine jüdische Familie mit Lebensmitteln versorgt. Blockwart Mischke hat sie schon lange in Verdacht. Ihm fehlt nur noch der Beweis, um seinen Sohn durch das Aufspüren eines Volksverräters vor dem Fronteinsatz zu retten. Eine ergreifende Familiengeschichte über Menschlichkeit in einer unmenschlichen Zeit
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 411
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Kurzbeschreibung:
Nürnberg, 2008. Handelt es sich bei den wertvollen Gemälden auf dem Dachboden wirklich um Nazi-Raubkunst? Eine Spur führt Lukas zu Daniela, deren Großtante Maria nach dem Zweiten Weltkrieg ausgewandert ist. Gemeinsam fliegen sie in die USA, um dort weitere Nachforschungen anzustellen. Werden sie in Marias Aufzeichnungen Antworten finden? München,
Anfang 1945.Inmitten der zerstörten Stadt riskiert die achtzehnjährige Maria ihr Leben, indem sie eine jüdische Familie mit Lebensmitteln versorgt. Blockwart Mischke hat sie schon lange in Verdacht. Ihm fehlt nur noch der Beweis, um seinen Sohn durch das Aufspüren eines Volksverräters vor dem Fronteinsatz zu retten. Eine ergreifende Familiengeschichte über Menschlichkeit in einer unmenschlichen Zeit
Ilona Schmidt
Marias Geheimnis
Roman
Edel Elements
Edel Elements
Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2019 Edel Germany GmbHNeumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2019 by Ilona Schmidt
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literaturagentur Kossack
Covergestaltung: © Anke Koopmann unter Verwendung von Motiven von shutterstock und © LEE AVISON/arcangel (Frau)
Lektorat: Kanut Kirches
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-96215-267-3
www.facebook.com/EdelElements/
www.edelelements.de/
Gewidmet meiner Mutter
Kapitel 1
2008 – NürnbergLukas
Seit seine Freundin Anika die Gemälde auf dem Speicher seiner Eltern entdeckt hatte, gab es für sie nur noch ein Thema. Ansonsten nicht so kulturbeflissen, wollte sie deshalb heute unbedingt ins Germanische Nationalmuseum, um der Sache auf den Grund zu gehen.
Lukas’ Nacken schmerzte und er startete einen letzten verzweifelten Versuch, sie umzustimmen: „Bei dem schönen Wetter sollten wir lieber zur Burg hinauf gehen – oder zum Dürerplatz.“
Trotz der modernen Glasfassade versprachen die hellen Sandsteinmauern des Museums zumindest eine angenehme Kühle.
Sachte legte sie ihre Hand auf seinen Rücken und schob ihn in Richtung Eingang. „Keine Widerrede. Kunst bildet. Außerdem ist es dort drinnen nicht so heiß.“
„Ein Spaziergang durch die Pegnitzwiesen und anschließend ein frisches Helles wäre keine Alternative, oder?“
„Später vielleicht. Ich muss unbedingt mehr über die Bilder erfahren.“
Die Bemerkung, ob sie eigentlich wüsste, wonach sie suchte, verkniff er sich. Zwar hatte sie kaum Ahnung von Kunst, aber wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, konnte sie nichts und niemand davon abbringen. Die Bilder waren dort am besten aufgehoben, wo sie Zeit seines Lebens gelagert gewesen waren: auf dem Speicher im Haus seines Vaters, mit Decken vor Staub, Licht und Beschädigung geschützt. Er startete einen weiteren halbherzigen Versuch, sie von ihrem Vorhaben abzubringen: „Wäre die Neue Pinakothek in München für deine Recherche nicht besser geeignet? Immerhin beherbergt sie die Staatsgemäldesammlung. Dort könntest du die Malstile vergleichen, um herauszufinden, ob es wirklich ein Cezanne ist.“ Er ruckte sein Kinn in Richtung Museumseingang. „Bei denen hier liegt der Schwerpunkt auf Kulturentwicklung und Kunstgeschichte.“
Um deswegen extra nach München zu fahren, wäre der Zeitaufwand zu groß gewesen, zumal er als Rechtsanwalt und sie als MTA im Schichtdienst selten genug eine Möglichkeit fanden, ihre Freizeit gemeinsam zu verbringen. Aber vielleicht würde Anikas Interesse bis dahin verpufft sein.
„Jetzt sind wir hier, also gehen wir auch rein“, erwiderte sie und baute sich vor ihm auf. Sie war fast so groß wie er und funkelte ihn aus grauen Augen an. „Lukas Mischke, ein bisschen mehr Interesse an Kunst würde dir nicht schaden.“
„Habe ich doch.“
Seine Schultern senkten sich und mit ihnen sein Widerstand. Er liebte die Gemälde, seit er sie als Kind auf dem Dachboden entdeckt hatte. Wunderschöne Bilder, von denen manche Portraits und andere Landschaften zeigten. Motive, die neugierig machten: Wen zeigten die gemalten Personen und wo lagen diese herrlichen Landschaften? Gern hätte er selbst gemalt, aber dieses Talent war ihm nicht vergönnt.
„… einige Fotos ins Internet gestellt und nie eine Antwort erhalten.“ Ihre Stimme drang durch seine Grübeleien. Sie hielt ihr Handy hoch, eine Geste, mit der er nichts anfangen konnte. „Ich möchte mal mit einem Experten sprechen.“
Sie starrte ihn aus schmalen Augen an, während er der Versuchung widerstand, sich den heißen Nacken zu kratzen. „Wenn es dich glücklich macht.“
Anika war nur schwer zufriedenzustellen. Vielleicht mit neuen Klamotten oder dem hundertsten Paar Schuhe – oder einem Verlobungsring, nach dem sie lechzte. Darauf würde sie lange warten können. Eine Beziehung für eine gewisse Zeit – ja, aber gleich heiraten – nein. Dazu waren sie zu verschieden.
Mit zwei Fingern tippte sie ihm auf die Brust. Mein Gott, wie er das hasste. „Wir gehen jetzt da rein und erkundigen uns. Vielleicht ist eines der Bilder wertvoll?“
„Es wäre Sache meines Vaters, das herauszufinden. Schließlich gehören sie ihm.“
Im Grunde fürchtete Lukas, eines der Werke könnte tatsächlich ein Original sein. Vor allem sein Lieblingsbild – eine Orgie aus blauen und sandfarbenen Punkten – das sein Geheimnis erst ab einer gewissen Distanz preisgab, durfte keines sein. Niemand hielt einen echten Cezanne zu Hause versteckt, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben. Wertlose Kopien bekannter Gemälde, wie sie zu tausenden existierten, interessierten niemanden.
Anika zog einen Schmollmund und wedelte mit ihrem Zeigefinger vor seiner Nase herum. „Trotzdem ist das Ganze unheimlich interessant. Wie sind sie eigentlich in euren Besitz gelangt?“
Zu dumm, dass seine Mutter ihr die Bilder gezeigt hatte, denn Anika hatte sofort Blut geleckt. Langsam folgte er ihr durch den Eingang. „Mein Urgroßvater soll sie gemalt haben“, sagte er.
„Alle? Und in verschiedenen Stilrichtungen und Maltechniken? Das glaubst du doch selbst nicht. Die Bilder sehen nicht aus, als kämen sie von einem einzigen Künstler. Wenn dein Uropa so talentiert war, würden seine Werke bestimmt in irgendwelchen Museen oder Galerien hängen.“
„Er hat nur abgemalt.“
„Lass uns herausfinden, ob das stimmt. Ich frage mal, ob einer ihrer Kunstsachverständigen sie prüfen könnte.“
„Vergiss es.“ Lukas rieb sich über den schmerzenden Magen. Eine unbekannte Angst drängte sich aus der hintersten Ecke seines Bewusstseins in den Vordergrund. Er wollte wirklich nichts über die Bilder herausfinden. „Ich habe Hunger.“
Ihr Blick wanderte zur Decke hoch. „Du bist unmöglich“, zischte sie.
„Und du rennst einem Phantom hinterher“, antwortete er schärfer als beabsichtigt.“
„Ja, ja.“ Sie winkte ab. „Das sagen alle, die eine Leiche im Keller liegen haben.“
„Keine Leiche, sondern ein paar edle Tropfen, über die du regelmäßig herfällst.“ Er ließ ein leises Lachen hören und legte seine Hand auf ihre warme Schulter, die das Tank-Top frei ließ. „Ich will keinen Streit, Anika. Bei uns sind weder Millionenwerte auf dem Speicher noch Leichen im Keller. Nur ein paar nette Bildchen. Erinnerungen an meinen Uropa. Weiter nichts.“
„Es könnten auch Fälschungen oder Diebesgut sein. Glaubst du, ich will den Sohn eines Kriminellen heiraten?“
„Den Enkel“, verbesserte er sie. „Mein Vater hat damit nichts zu tun. Die Bilder befanden sich bereits im Familienbesitz, als er noch ein junger Mann war.“
„Auch gut.“ Sie wischte seine Hand von ihrer Schulter. „Geh schon mal voraus in den Kopernikus Biergarten und reserviere einen Tisch. Bis einer frei wird, bin ich bestimmt fertig.“
Damit ließ sie ihn stehen und verschwand in den Hallen des Museums. Anika war die Tochter des ehemaligen dritten Bürgermeisters. Jahrelang war er in sie verknallt gewesen, aber sie hatte sich erst für ihn interessiert, als er sein Jurastudium abgeschlossen hatte und sein alter Herr als Stadtrat nominiert worden war. Anikas Vater war aus parteipolitischen Gründen strikt gegen ihre Verbindung. Ein schaler Geschmack machte sich in seinem Mund breit, den er im Biergarten runterzuspülen gedachte.
Auf der Pegnitzbrücke erhielt er eine SMS von seiner Mutter: „Komm schnell heim, die Kripo ist im Haus.“
Scheiße. Er blieb stehen, hörte sein Blut wie das Wasser der Pegnitz in den Ohren rauschen. Was, zum Teufel, wollte die Polizei bei ihnen?
In ihm wuchs ein ungeheuerlicher Verdacht: Anika hatte die Bilder mit ihrem Handy fotografiert und ins Internet gestellt.
Kapitel 2
2010 – TegernseeDaniela
Gurgelnd arbeitete sich der Wildbach durch sein Bett, umspülte, was sich ihm in den Weg stellte.
Wie im Leben, dachte Daniela. Sie warf einen Grashalm hinein und verfolgte dessen wilden Tanz, bis er ihren Blicken entschwunden war. Anschließend tunkte sie ihre Zehen in das kalte Nass und genoss die prickelnde Frische.
Man muss das Leben nehmen, wie es ist, waren Omas Worte gewesen, als ihr Mann nicht mehr aus der Narkose erwacht war – ein Arzt, der unter dem Skalpell eines Kollegen sein Leben ausgehaucht hatte. Daniela atmete tief durch und zog ihre Füße aus dem Wasser. Nun war auch Oma gegangen, und zurück blieben Erinnerungen sowie das Haus im Hintergrund, von dem aus man einen wunderbaren Blick auf den Tegernsee und die ihn umgebenden Berge hatte. Als Kind war sie oft hier oben gewesen, während des Studiums selten, und jetzt, als Lehramtsanwärterin für die Grundschule, gar nicht mehr.
Sie hatten Oma heute auf dem Dorffriedhof unten im Tal beerdigt. Viele Trauergäste waren nicht gekommen; einige aus dem Ort und ein paar aus München. Wenn man mit achtzig stirbt, hat man die meisten schon hinter sich gelassen, pflegte Vater zu sagen. Nach dem Totenschmaus war er mit ihrer Schwester Nadine wieder nach München zurückgefahren.
Wie mochte Mama sich fühlen, nachdem sie beide Eltern so kurz hintereinander verloren hatte? Daniela erhob sich und schlenderte barfuß durch die feuchtwarme Löwenzahnwiese zum Haus zurück, vor dessen Fenstern Blumenkästen mit roten Geranienblüten hingen.
In einem schwarzen, ärmellosen Trauerkleid, das wie geborgt an ihr hing, kam Mama aus der Haustür getreten. Sie sah blass aus, um ihre rotgeränderten Augen lagen dunkle Schatten wie Trauerflor.
„Wir werden den Hof verkaufen müssen“, sagte sie mit kraftloser Stimme. „Vater meint, der Aufwand, ihn zu erhalten, wäre zu groß.“
Er hasste das Anwesen, aus welchem Grund auch immer. „Das wäre sehr schade.“
„Es gibt keinen Grund, ihn zu behalten. Wir haben selbst ein Haus, und du und deine Schwester lebt euer eignes Leben. Was sollen wir also damit?“
Daniela schaute zu den Bergen, vor denen der Tegernsee mit den Segelbooten darauf wie ein Saphir funkelte. Das Bild von Frieden und Glück mochte täuschen, aber im Moment fühlte sie sich wohl. Dieses Kleinod durfte nicht aufgegeben werden, bloß weil Vater und Schwiegervater sich nicht hatten ausstehen können.
Mama rieb sich die nackten Arme. „Ich lege mich ein bisschen hin. Mir geht’s nicht gut.“
„Soll ich später einen Kaffee machen?“
Sie nickte und zog sich in den dunklen Flur zurück. In der Wohnküche mit dem Herd und der Spüle aus den Fünfzigerjahren roch es leicht nach Petersilie und Schnittlauch, fast so, als kochte Oma ihre leckere Leberknödelsuppe.
Die Kaffeedose enthielt nur Aroma. Oma hatte wohl keine Kraft mehr gehabt, welchen zu besorgen. Wozu auch? Nach Opas Tod war alle Lebensfreude aus ihr gewichen. Und hätte nicht einmal pro Woche eine Haushaltshilfe nach dem Rechten gesehen, wären Haus und Oma vollkommen verwahrlost.
Daniela nahm ihre Handtasche vom Esstisch, die sie am Morgen nach der Beerdigung dort abgestellt hatte und fingerte nach dem Autoschlüssel. Die Platte des Fichtenholztisches zeigte Ringe von Tassen und Gläsern – stumme Zeugen, dass Oma hier gelebt hatte.
Wehmut ist ein schlechter Partner, dachte Daniela. Es war an der Zeit, etwas Neues anzupacken. Entschlossen trat sie hinaus, um beim Bäcker Kaffee zu besorgen.
Autofahren wirkte meist beruhigend auf sie, außer, wenn sie irgendeinem Idioten hinterher bummeln musste. Heute waren aber keine unterwegs und so genoss sie die stille Fahrt am Bergwald entlang und an den Kuhweiden vorbei. Im Ortskern von Tegernsee bevölkerten bereits die ersten Touristen die Bürgersteige. Sie parkte ihr Auto und betrat die Bäckerei, in der es herrlich nach Kaffee und Brot duftete. Anstehen zu müssen, machte ihr nichts aus, das kannte sie aus der Großstadt. Aus der gläsernen Theke lachte ihr ihr Lieblingsgebäck entgegen: ein Schokoladencroissant. Heute war nicht der Tag, um auf die schlanke Linie zu achten.
„Mei’ Beileid“, sagte die Frau hinter der Theke. „Die Helma war a guate Seel.“
„Danke.“ Daniela nannte ihre Wünsche und vergaß auch das Blätterteiggebäck nicht.
„Quarktasch’n und Käskuchen hat’s am liebsten mögen, die Helma“, wusste die Verkäuferin. „Und Schwarzbeerkuchen.“
Wer mochte den nicht? Als Kind hatte sie sich immer gewundert, warum Oma von Schwarzbeeren sprach, während Papa sie als Blaubeeren bezeichnete.
„Darf’s noch was sein?“
Daniela warf einen prüfenden Blick auf die Frau, die Mitte fünfzig sein musste. Zu jung, um etwas von Omas Jugendzeit zu wissen.
„Haben die Lamprechts eigentlich schon immer dort oben gewohnt?“, fragte sie dennoch.
Die Stirn der Frau legte sich in Falten. Wahrscheinlich wunderte sie sich über diese Frage. Wenn das jemand wissen musste, dann sie, die Enkelin. Danielas Ohren wurden heiß.
„Die Lamprechts ham den Hof scho vorm Krieg g‘habt“, antwortete die Frau mit fester Stimme. „Davor war’s der Judenhof.“
„Oh!“
„Sagt ma halt so, weil er Juden g’hört hat.“ Die Verkäuferin grinste. „War lang vor meiner Zeit.“
Die Hitze kroch in Danielas Wangen. In ihrer Familie gab es keine Juden. So mancher Nazi hatte sich nach der Reichskristallnacht am Besitz von Juden bereichert und sie hoffte, dass dies nicht auf ihre Familie zuträfe. „Und wie haben die Lamprechts ihn gekriegt?“, entfuhr es ihr.
„Die wern ihn halt kauft ham. I bin zwar scho alt, aber so alt a wieder net.“
Nachdenklich zahlte Daniela und nahm die Ware in Empfang. Was störte sie an der Bezeichnung Judenhof? Bauernhöfe wurden seit Jahrhunderten nach ihren Besitzern benannt, nach deren Berufen oder anderen Besonderheiten. Ganz früher war es also der Judenhof gewesen, dann der Lamprechtshof und nun hieß er eben Kieslingerhof, weil Mama den Namen ihres Ehemanns angenommen hatte.
Auf der Rückfahrt schob sich hinter einer Kurve der am Waldrand gelegene Hof in ihr Blickfeld: Wohnhaus, Scheune und ein ungenutzter, alter Stall. So viel sie wusste, hatten ihre Großeltern nie Vieh besessen. Opa war bereits im Ruhestand gewesen, als er den Hof übernommen hatte. Aber wer waren die Vorbesitzer gewesen? Vielleicht Bauern oder gar ein Verwandter? Wie wenig sie doch über ihre Urgroßeltern wusste.
Sie wollte diesen Anker im Strom der Zeit, mit all seinen Geheimnissen und Erinnerungen, unbedingt behalten.
***
Schweigend genoss Daniela den Kaffee, und ließ die leicht bittere Schokolade des Croissants auf der Zunge zergehen. In der Ferne grollte Donner, tiefgraue Wolken wälzten sich ins Tegernseer Tal. Wortlos setzte Mama sich zu ihr.
„Wir sollten Omas Post durchsehen“, schlug Daniela vor. Das Leben musste weitergehen.
Mama schwieg dazu, wischte sich verstohlen über die Wangen, erhob sich und verschwand im Haus. Vielleicht war es besser, einen Tag damit zu warten – oder zwei. Solange könnten sie noch bleiben, und etwas Abstand gewinnen.
Daniela schloss die Augen und hielt ihr Gesicht in die wärmenden Sonnenstrahlen. Es donnerte erneut; dieses Mal lauter und näher.
„Das ist ihre Post.“ Mama war mit einem Stapel Briefe in der Hand zurückgekehrt. „Auf das Durchwühlen ihrer Sachen verspüre ich heute keine Lust. Dafür habe ich zu nahe am Wasser gebaut. Mir ist, als wäre sie noch da. Geht dir das auch so?“
Am liebsten hätte Daniela sie umarmt, aber ein Kind umarmte seine Mutter nicht – jedenfalls nicht in ihrer Familie. „Richtig, wir sollten damit bis morgen warten.“
„Gut.“ Mama legte den Stapel auf den Tisch. „Die könnten wir schon mal durchschauen, oder was meinst du?“
Obwohl der Vorschlag dazu von ihr selbst gekommen war, zögerte sie. Es war, als würden sie in Omas Privatsphäre eindringen, wobei der Großteil des Stapels allerdings aus Werbung bestand. Daniela beobachtete Mama von der Seite, während diese den Packen mit stoischem Gesichtsausdruck durchsah.
„Werbung, Werbung, Telekom, Telekom, eine Mahnung …“, sie stockte und hielt eine Ansichtskarte hoch: Meer mit Sonnenuntergang. „Von einer … Regina. Der Name sagt mit nichts.“
Als nächstes lag ein bereits geöffneter Umschlag auf dem kleiner gewordenen Stapel. Daniela griff nach ihm.
„Kanzlei van Utrecht & Mischke in Nürnberg“, las sie vor. „Komisch. Hat Oma in Nürnberg was ausgefressen?“
„Quatsch.“ Mama legte die Ansichtskarte auf dem Tisch ab.
„Der Umschlag ist bereits offen. Oma muss ihn wieder zu den anderen Briefen gelegt haben, weil sie sich vielleicht später damit befassen wollte.“ Daniela zog das Schreiben heraus und überflog es. „Ein Rechtsanwalt Mischke sucht Informationen über jetzt aufgetauchte Bilder, die seit dem Krieg verschollen waren. Der Brief wurde vor einem Jahr geschrieben, als Opa noch lebte. Verstehe ich nicht.“
Mama blickte zum Hirschberg hinüber, dessen Gipfel graue Regenschleier verbargen. „Keine Ahnung, was das mit uns zu tun hat. Soviel ich weiß, wurde uns im Krieg außer Schmuck nichts gestohlen.“
Daniela drehte den Brief um, so dass Mama die Frontseite sehen konnte. „Viel mehr steht nicht drin. Jemand hat „Maria“ darauf geschrieben. Schau, hier.“
Mama kniff die Augen zusammen, als sähe sie schlecht, und begutachtete den Brief ausgiebig „Ja, das ist Omas Handschrift“, sagte sie endlich.
„Gab es denn in unserer Familie eine Maria?“
„Nicht, dass ich wüsste.“ Mama kratzte sich an der Schläfe. „Oder doch. Opas Schwester hat so geheißen. Aber was hat die mit diesen Bildern in Nürnberg zu tun? Opas Familie lebte während des Krieges in München.“
„Warum habe ich nie von ihr gehört?“
„Weil sie gleich nach dem Krieg mit einem Ami in die USA gezogen ist.“
Ein Foto der Ausstellung „Deutschland nach dem Krieg“, auf dem ein deutsches Froilein mit einem GI unter dem Schild NO FRATERNISATION tanzte, drängte sich Daniela auf. „Wie romantisch.“
„Deutsche Frauen hatten damals nichts gegen die Anwesenheit der Besatzer einzuwenden, denn die deutschen Männer waren entweder zu alt, zu jung, gefallen oder in Kriegsgefangenschaft.“
„Was haben ihre Eltern dazu gesagt?“
Mama atmete hörbar aus und lehnte sich zurück. Ihr Zeigefinger fuhr den Rand des Tisches entlang. „Vermutlich nichts Gutes, sonst wären sie in Verbindung geblieben. Ich habe sie nie kennengelernt.“
„Wir sollten sie suchen.“
„Wie stellst du dir das vor? Wir wissen nicht einmal ihren Nachnamen. Und Amerika ist riesengroß.“
„Vielleicht finden wir in Opas Unterlagen etwas über sie heraus.“
„Wäre schön zu erfahren, was aus meiner Tante geworden ist. Und sollte sie noch leben, muss sie vom Tod ihres Bruders erfahren.“
„Wahrscheinlich hat sie unter ihre deutsche Vergangenheit einen Schlussstrich gezogen und keinen Kontakt mehr gewollt.“ Daniela starrte den Brief des Rechtsanwalts an. Die Frage, warum Oma „Maria“ darauf geschrieben hatte, bohrte in ihrem Kopf.
Ein Rechtsanwalt aus Nürnberg? Wieso war der ausgerechnet auf Oma gekommen? Sie sollte ihn anschreiben und um Aufklärung bitten.
Schwere Tropfen fielen vom Himmel, das Gewitter hatte sie erreicht.
Kapitel 3
2010 – NürnbergLukas
Ein kurzes Handzeichen des Liberos, und Lukas sprintete in Richtung Tor. Dieses Mal musste es klappen. Sie hatten nur noch wenige Minuten, um aus dem 1:1 einen Sieg zu machen. Er lief in die freie Gasse, erwartete den Pass. Leicht angeschnitten kam der Ball geflogen, prallte auf dem Rasen auf und sprang flach auf ihn zu.
Sein Herz trommelte, während der linke Verteidiger auf ihn zu gerannt kam. Jetzt kam es drauf an. Mit grimmigem Gesichtsausdruck stellte sich ihm ein anderer Abwehrspieler in den Weg. Lukas zog mit aller Kraft ab, und der Ball zischte am Fuß des Verteidigers vorbei. Der Torwart schnellte sich ab – zu spät. Mit einem lauten Klatschgeräusch prallte das Leder vom Pfosten ab, aufs Spielfeld zurück. Mist.
Aus dem Getümmel vor dem Tor sprang Kai plötzlich hervor, grätschte in den Ball – Tooor.
Freude und Enttäuschung zugleich wirbelten durch Lukas Kopf, zwangen ihn auf die Knie. Endlich die Führung – allerdings nicht durch ihn. Erschöpft blickte er zu dem Torschützen hinüber, der sich von den Mannschaftskameraden feiern ließ.
Schön, wenn im wirklichen Leben mal jemand käme, und einem die eigenen Fehler ausbügelte.
Die wenigen Zuschauer applaudierten johlend, hatten sie doch nicht nur ihren Erzrivalen bezwungen, sondern – sollten sie das Ergebnis bis zum Schlusspfiff halten können – auch den Klassenerhalt geschafft.
Langsam erhob er sich. Viel Zeit zum Ausgleich blieb dem Gegner nicht mehr. Lukas und sein Team mussten nun alles daransetzen, den Sieg zu sichern. Er rannte, bis ihm die Lunge zum Hals heraushing, kämpfte um jeden Ball. Erst der Abpfiff des Schiedsrichters erlöste ihn. Nichts wie hin zur Seitenaus-Linie, um sich mit kaltem Wasser zu erfrischen.
„Du bleibst noch auf ein Bier oder zwei?“, fragte Kai, die Wangen rot von der Anstrengung.
Das Angebot klang verlockend, trotzdem zögerte Lukas. Seit Jahren scheute er die Fragen, die seine Anwesenheit unweigerlich nach sich ziehen würden. „Eigentlich müsste ich arbeiten.“
Mit einem Grinsen schlug Kai ihm auf die Schulter. „Ohne deine Vorlage wäre ich nicht zum Schuss gekommen.“
„Na ja, als Vorlage kann man das nicht gerade bezeichnen.“
„Nennen wir’s halt Vorlage mit Bande. Komm schon, gib dir einen Ruck. Wir haben selten genug Grund zum Feiern.“
Eine innere Stimme sagte ihm, dass er sich schon zu lange gedrückt hatte. „Am Montag sind Gerichtstermine, für die ich mich vorbereiten muss.“
Schwaches Argument, denn morgen war Sonntag. „Also gut.“ Vielleicht würden sich die Jungs beherrschen.
Das Bier war herrlich erfrischend und ließ ihn, trotz der unbequemen Sitzbank, den schmerzenden Oberschenkel vergessen. Langsam stellte sich Entspannung ein. Um ihn herum war eine laute Diskussion über den Spielverlauf entbrannt. Neugierige Blicke wurden ihm zugeworfen, aber vielleicht bildete er sich das auch nur ein. Auf jeden Fall war es richtig gewesen, hier zu bleiben.
Seit Vater die Kandidatur für einen Sitz im Stadtrat zurückgezogen hatte, verließ seine Mutter selten das Haus, vor allem, nachdem die Medien das Sommerloch mit Berichten über seine Familie gefüllt hatten.
An dem ganzen Tohuwabohu waren nur die Bilder schuld gewesen. Nein, eigentlich sein Urgroßvater. Von wem, verdammt nochmal, hatte er sie bekommen? Tatsächlich waren Originale darunter, und deshalb war die Story zu interessant, um sie unter den Tisch fallen zu lassen. Ein gefundenes Fressen für die Medien und den politischen Gegner.
„Lukas? Bist du noch bei uns?“, fragte Kai.
„Sorry. Was war?“
„Huni will wissen, ob du schon was Neues über die Herkunft der Bilder rausgefunden hast.“
Das war der Grund, warum er nicht hatte mitfeiern wollen. Sollte er überhaupt darauf eingehen? Die Mitspieler schauten ihn erwartungsvoll an. Irgendwie war er ihnen eine Antwort schuldig. „Nein. Solange keiner einen Anspruch auf sie erhebt, bleiben sie in unserem Besitz. Und selbst wenn, ist die Sache vermutlich längst verjährt. Laut BGB Paragraph soundso.“
Kai hob sein Glas, um mit ihm anzustoßen. Die Kripo hatte er abwimmeln können, den Shitstorm im Internet musste er ertragen. Ob sein Vater für die Neo-Nazis kandidieren würde, hatte ihn der Journalist einer Zeitung gefragt.
„Alles Paletti, nur keine Panik“, sagte Huni. „Da gibt’s noch mehr Leut’, die Dreck am Stecken haben, oder besser g’sagt, Nazi-Raubkunst im Keller.“
Lukas holte tief Luft. „Die Sachen könnten auch rechtmäßig erworben worden sein, wie wäre das denn? Warum immer gleich das Schlechte annehmen und dann darauf herumreiten? Nicht jedes Kunstwerk, das während des Kriegs verschwunden ist, wurde geklaut. Manche wurden zum Beispiel gegen Nahrungsmittel oder ein Dach über dem Kopf eingetauscht.“
Er hatte sich in Rage geredet. Kai legte beschwichtigend die Hand auf seinen Arm. Der Außenstürmer hatte recht, dies hier war ein Kampf gegen Windmühlen. Vermutlich würde nicht einmal ein Beweis, dass sie die Bilder rechtmäßig erworben hätten, etwas bewirken. Nichts hielt sich hartnäckiger als Gerüchte. Warum musste auch ausgerechnet ein millionenschwerer Cezanne – hinter dem nicht nur Museen her waren – darunter sein? Wenn er könnte, hätte er das Ding längst verkauft. Aus den Augen, aus dem Sinn.
„Ein für alle Mal. Ich dulde keine Verleumdungen meiner Familie, kapiert?“ Das Bier schmeckte plötzlich schal, und am liebsten hätte er es diesem Huni über die Glatze gegossen.
„Scho’ gut“, sagte der. „Reg dich ab. Ich hab’s net so g’meint.“
Damit nahm er Lukas den Wind aus den Segeln. Sein Ärger verebbte und machte einer Leere Platz, die er mehr fürchtete als seinen Zorn.
„Mir reicht’s für heute.“ Kai trank aus. „Kannst du mich heimfahren? Dann könnten wir noch einiges bereden.“
Nach reden war Lukas nicht zu Mute, aber heimfahren hörte sich gut an. Seit dem unheilvollen Tag vor zwei Jahren hatte er sich verändert. Bislang hatte er sich für eine Kämpfernatur gehalten, aber die fast tägliche Konfrontation mit diesem Thema, zehrte an den Nerven, zumal nicht absehbar war, wie er aus dem Schlamassel wieder herauskommen könnte.
Im Wagen bliebt Kai schweigsam, wartete wohl darauf, dass Lukas den Anfang machte. Endlich sagte Kai: „Wie geht’s Anika? Hast du was von ihr gehört?“
„Zu eins: keine Ahnung, zu zwei: nein.“ Lukas kniff die Lippen zusammen und schlug mit der Faust aufs Lenkrad. „Sag mal, hast du keine besseren Fragen?“
„Ich möchte doch nur, dass du aus deiner Totenstarre aufwachst. So kenne ich dich gar nicht.“
„Ich arbeite wie ein Ochse, spiele Fußball und muss mich um jeden Scheiß kümmern. Was sollte ich denn deiner Ansicht nach sonst noch tun?“
„Leben. Du spielst Fußball, als wärest du auf einem Schlachtfeld. Mensch Lukas, lass es einfach mal etwas ruhiger angehen. Was vor siebzig Jahren passiert ist … Dafür bist du nicht verantwortlich.“
„Stimmt genau. Nichts, dessen ich mich schämen müsste. Anikas Vater hat die Geschichte nur benutzt, um meinen Vater von der Stadtratsliste zu schießen. Und die dumme Nuss hat ihm die Munition dafür geliefert.“
„Wer? Anika?“
„Freilich.“
Kai schwieg.
Der Ausdruck „dumme Nuss“ war unfair, denn sie hatte das bestimmt nicht gewollt, aber er hatte ein Ventil gebraucht, um seinem Ärger Luft zu machen. „Als Rechtsanwalt kann ich mir keine Negativschlagzeilen leisten.“
„Ist doch alles legal, oder?“
Schwang in seinen Worten eine gewisse Ironie mit? Offenbar ahnte Kai, wie es in ihm aussah, und hatte deshalb seine Zweifel dezent umschrieben. „Vom heutigen Standpunkt aus gesehen – ja. Wo kein Kläger, da kein Richter.“ Er sprach nicht weiter. Der Cezanne sollte vor dem Krieg einem Ableger der weitverzweigten Rothschild Familie gehört haben, und hing nun im Schlafzimmer seines Vaters. Es war zum Haare ausraufen.
***
Lustlos arbeitete Lukas sich in seinem Zweizimmerapartment durch die Unterlagen des Falls, der ihn morgen vor Gericht erwarten würde. Keine medienwirksame Verhandlung, eher eine Routinesache, die er und sein Mandant gewinnen sollten. Er hatte seine Hausaufgaben gemacht und könnte sich jetzt eigentlich entspannt zurücklehnen.
Immer wieder glitt sein Blick von den Prozessunterlagen zu dem Foto, das er von dem Cezanne-Gemälde im Schlafzimmer seiner Eltern geschossen hatte, um es mit den Aufnahmen im Art Loss Register zu vergleichen. Den ursprünglichen Eigentümer der Kunstwerke hatte er schnell herausgefunden, aber wie sie dann von der Familie Rothschild in den Besitz seines Urgroßvaters gelangt waren, blieb schleierhaft.
Neben dem Foto lag die Post vom Freitag, die er sich zum Durchsehen bereitgelegt hatte. Seit Anika aus seinem Leben verschwunden war, arbeitete er am liebsten in einem Stück durch – außer er spielte Fußball oder joggte seine zehn Kilometer um den Wöhrder See. Er rieb sich die Augen, während von draußen gedämpftes Kinderlachen in die Stille seiner Wohnung drang. Ein schönes Geräusch. Gegen Kinder hatte er nichts einzuwenden.
Er betrachtete den Absender des obersten Briefs. Die Buchstaben verschwammen vor seinen Augen, gleich würden ihm die Lider zufallen. Eine Pause einlegen, sich eine Tasse Kaffee gönnen, oder einfach hinausgehen und das Leben genießen, wäre eine gute Idee. Zumindest könnte er die Balkontür öffnen, um frische Luft und das Kinderlachen hereinzulassen.
Vom Balkon aus konnte man den See und den ihn umgebenden Park überblicken, den Hunden beim Gassigehen und den Kindern beim Spielen zuschauen. Eine leichte Brise kräuselte die Wasseroberfläche, auf der die Strahlen der untergehenden Sonne lebhaftes Glitzern erzeugten. Ein wunderschönes Motiv für einen Maler. Mit seinen Fingern formte er einen Rahmen und suchte den besten Bildausschnitt.
Von unten sah ein Mann zu ihm hoch, den er auf den ersten Blick wiedererkannte. Mit dem Kriminalhauptkommissar hatte er beruflich öfters zu tun gehabt, aber mittlerweile war der im Ruhestand. Was wollte er hier?
Instinktiv wich Lukas in den Schatten zurück, lachte dann über sich selbst. Nein, unter Verfolgungswahn litt er nicht. Als er wieder an die Brüstung trat, war der alte Herr verschwunden.
Das Telefon klingelte. Er eilte hinein und sah auf das Display: Mutter. Auch das noch. Sollte er das Gespräch annehmen? Die Fragen, die auf ihn einprasseln würden, kannte er auswendig. Also gut.
„Hast du die Post schon durchgesehen“, fragte sie ohne Umschweife.
„Bin gerade dabei.“
„Hoffentlich hat sich der Kunstsachverständige endlich gemeldet. Warum er das Ergebnis zu dir schickt, ist mir allerdings …“
„Weil ich eure Interessen vertrete.“
Schweigen. Im Hintergrund bellte Zeus, sein Hund, den er aus Zeitmangel bei den Eltern einquartiert hatte. „Wie geht’s Zeus?“
„Er wird alt.“
„Zwölf ist doch kein Alter für einen Husky.“
„Dreizehn. Rufe bitte sofort zurück, wenn der Brief eintrifft, ja?“
Er versprach es, legte auf und hakte seine Daumen in die Gürtelschlaufen der Jeans ein. Was, wenn das Urteil des Sachverständigen nicht seinen Erwartungen entspräche?
Mit einem Seufzer unterdrückte er den Impuls, einfach einen Spaziergang um den See zu machen. Langsam näherte er sich seinem Schreibtisch mit dem Briefstapel darauf und fächerte sie so weit auf, dass er die Absender lesen konnte. Die meisten Umschläge waren mit gedruckten Adressangaben versehen, Geschäftsbriefe eben. Von dem Kunstexperten war keiner darunter. Prima, darauf konnte er heute gut verzichten.
Der letzte Brief fiel durch die handschriftliche Adresse auf: Daniela Kiesling, München.
Nachdenklich zog er ihn unter den anderen hervor und betrachtete ihn von allen Seiten. Im Verlauf seiner Recherche hatte er einige Personen angeschrieben, die in der Nachbarschaft seines Urgroßvaters gewohnt hatten, immer in der Hoffnung, jemanden zu finden, der den legalen Erwerb der Bilder bestätigen konnte. Auf seine Anfragen hatte kaum jemand geantwortet und wenn, dann immer mit negativem Bescheid. Klar, denn die meisten Zeitzeugen waren entweder gestorben oder unbekannt verzogen. Und jetzt …? Konnte es wirklich sein?
Mit dem Brieföffner schlitzte er den Umschlag auf, entnahm das Schreiben und las im Stehen.
Sehr geehrter Herr Dr. Mischke,
die Fragen in Ihrem Schreiben kann ich Ihnen leider nicht beantworten, aber ich kenne jemanden, der es eventuell könnte. Dazu müsste ich allerdings wissen, um was es sich im Detail handelt und was meine Familie damit zu tun hat. Ich schlage deshalb ein Treffen hier in München vor.
Mit freundlichen Grüßen
In kleinen aber schwungvollen Buchstaben folgte eine gut lesbare Unterschrift: Daniela Kiesling. Lukas ließ die Hand sinken. Der Name war nicht unter denen gewesen, die er angeschrieben hatte, und große Mühe, weitere Nachbarn seines Urgroßvaters ausfindig zu machen, hatte er sich nicht gegeben. Eigentlich hatte er die Vergangenheit ruhen lassen wollen, doch jetzt schien es, als hätte sie ihn eingeholt.
Kapitel 4
2010 – MünchenDaniela
„Wollten Sie nicht los, Frau Kiesling?“, fragte Frau Mechthold im Schulsekretariat.
Verflixt. Ein Blick auf die Uhr bestätigte, dass sie nur noch eine Viertelstunde Zeit hatte. Das würde knapp werden. Sie biss sich auf die Unterlippe. Für sie wäre das Café um die Ecke optimal gewesen, aber nein, der Herr Rechtsanwalt aus Nürnberg hatte unbedingt in die Nähe des Bahnhofs gewollt, und deshalb musste sie sich jetzt abhetzen. Vermutlich würde bei dem Treffen sowieso nichts herauskommen. Wie auch? Er wusste bestimmt keine Details, dazu war seine Anfrage viel zu allgemein gewesen, und ihre eigenen Informationen beschränkten sich auf den Namen Maria, den Oma auf den Brief geschrieben hatte. Dabei war nicht einmal klar, wer damit gemeint war. Bei der Häufigkeit dieses Namens könnte es Gott weiß wer sein.
Ein Blick durchs Fenster zeigte, dass auch das Wetter sich gegen sie verschworen hatte: Schnürlregen überzog die Stadt mit nassem Grau. Hier, im hell erleuchteten Schulsekretariat des modern ausgestatteten Altbaus, merkte man davon nichts. Sie langte nach ihrer Handtasche und sah sich nach ihrem Regenschirm um. Mist, der lag im Auto. Frau Mechthold hielt ihr ihren eigenen entgegen.
„Sie sind ein Schatz“, rief Daniela beim Hinausstürmen.
„Ich weiß.“
Sie rannte die Treppen hinunter, erwischte gerade noch die Straßenbahn und fand sogar einen freien Sitzplatz. Ihr gegenüber saß ein älterer Herr, der sie neugierig musterte. Genau so stellte sie sich den Rechtsanwalt Mischke aus Nürnberg vor: ergraut, etwas beleibt, aber mit dem wachen Blick eines Strafverteidigers, der stets eine Lücke in der Argumentationskette des Gegners suchte.
Endlich hielt die Straßenbahn in der Nähe des vereinbarten Cafés. Verdammt, fünf Minuten zu spät. Sie stürmte hinein, nahm kurz den Geruch von Kaffee wahr und schaute sich um. Es war nur mäßig besucht und der einzige in Frage kommende war ein einzelner Herr im Anzug an einem Fenstertisch.
Von wegen ergraut: sportlich, braune, kurzgelockte Haare, Dreitagebart. Von dem konnte sich der Freund und Rechtsanwalt ihres Vaters eine Scheibe abschneiden. Sie setzte ein förmliches Lächeln auf, denn dies war schließlich kein Rendezvous, sondern ein geschäftliches Treffen.
Er sah erst auf, als sie bereits am Tisch stand. Seine grauen Augen weiteten sich kurz. Anscheinend war er genauso überrascht wie sie, hatte vermutlich ein altes Mütterchen erwartet.
„Entschuldigung. Herr Dr. Mischke?“, fragte sie.
Er sprang auf. „Freut mich, Sie kennenzulernen, Frau Kiesling“, begrüßte er sie lächelnd.
Eine leichte Röte machte sich auf seinem Gesicht breit, als er ihr die Hand entgegenstreckte: lange, schmale Finger, fester Griff, den sie forsch erwiderte. Die blau-braun gestreifte Krawatte passte hervorragend zum hellgrauen Anzug. Jedenfalls schien er Geschmack zu besitzen – oder seine Frau. Sie würde ihre Vorstellung über Rechtsanwälte, die das Aufspüren von NS-Raubkunst betrieben, revidieren müssen. Er nahm ihr den Regenschirm ab und stellte ihn in den dafür vorgesehenen Ständer an der Garderobe.
Sie entschied sich für einen Latte Macchiato, während er sich einen Cappuccino bestellte. Eine Weile ergingen sie sich im Small Talk über seine Anreise und das grausige Wetter. „München ist bei weiß-blauem Himmel besonders reizvoll“, sagte sie.
„Nämberch auch“, konterte er, wobei die Aussprache seine fränkische Herkunft verriet. Nachdem ihre Bestellung serviert worden war, nippte Daniela vorsichtig daran. Cremiger Milchschaum auf einem Espresso erinnerte sie an den letzten Rom-Urlaub mit Ferdi, den sie schon lange ad acta gelegt hatte. Ihre Gedanken kehrten zu Dr. Mischke zurück.
„Worum geht es?“, fragte sie.
Er zog einen iPad aus einer flachen Mappe, flippte ihn auf und drehte ihn zu ihr. „Um dieses Bild.“
Von Gemälden verstand sie nur wenig, ihre Leidenschaft galt der Musik, aber dass es im Stil des Pointilismus gemalt worden war, erkannte sie auf Anhieb. „Ein echter …?“
„Cezanne.“ Er nickte bedächtig. „Außer diesem wurden auf dem Dachboden … äh, noch Werke anderer Meister gefunden, aber das hier dürfte das wertvollste sein.“
Warum zögerte er? Wollte er seinen Mandanten schützen? Es war noch nichts bewiesen, und solange kein Museum einen Anspruch erhob, bestand kein Zwang, die Bilder zurückzugeben. Sie räusperte sich. „Und wie sind Sie darauf gekommen, dass es sich um NS-Raubkunst handelt?“
„Ich … äh.“
Wieder dieses Zögern, dazu wich er permanent ihrem Blick aus und auf seiner Oberlippe bildeten sich winzige Schweißperlen. „Mein Mandant wurde nach einer Veröffentlichung im Internet darauf aufmerksam.“
Er redete von sich selbst. Es sind seine Bilder, oder die eines nahen Verwandten. Ihr Jagdinstinkt war geweckt. „Wurde denn ein Eigentumsanspruch angemeldet oder gar Klage erhoben?“
„Weder noch.“ Er streckte sich ein bisschen. „Mein Mandant hat sich jedenfalls nicht strafbar gemacht.“
Sie legte den Kopf ein wenig zur Seite. „Würden Sie mir bitte erklären, was passiert ist?“
Zum ersten Mal blickte er ihr tief in die Augen, als wollte er ihre Gedanken lesen. „Die Bilder lagerten seit dem zweiten Weltkrieg auf einem Dachboden. Der Besitzer hatte sie seinem Enkelsohn vermacht.“
„Warum nicht seinem direkten Nachkommen?“ Das wäre naheliegend, oder?
„Der ist im Krieg gefallen.“
„Aha. Und weiter?“
„Wird das ein Verhör?“, fragte er und verzog spöttisch den Mund.
„Nein, nein.“ Sie wedelte mit ihren Händen. „Sie lassen sich nur jedes Wort aus der Nase ziehen.“
Ein trockenes Lachen folgte, seine Augenbrauen zuckten nach oben. „Die Sache hat eine persönliche Note. Deshalb.“
„Dachte ich mir“, entfuhr es ihr. „Entschuldigung, ich wollte nicht vorlaut sein.“
„Schon gut. Mein Mandant …“
„Lassen Sie mich raten. Ihr Vater?“
Er nickte. „Mein Vater hat die Bilder bei der Haushaltsauflösung seines Großvaters, also meines Urgroßvaters …“ Wieder sah er sie voll an. „Warum erzähle ich Ihnen das alles? Eigentlich tut es gar nichts zur Sache.“
Ob er darin verwickelt war, ging sie nichts an, schließlich waren sie nicht vor Gericht. „Es geht also um die Herkunft der Bilder.“
„Sie sind im Art Loss Registry verzeichnet. Darin wurden sie von einem entfernten Verwandten einer im Krieg ermordeten Familie eingetragen. Daraus ergibt sich die Frage, die ich beantwortet haben möchte.“
„Wie sind die Bilder in den Besitz ihres Urgroßvaters gelangt?“
Er öffnete beide Hände und drehte die Handflächen nach oben. „Genau.“
„Nach all den Jahren werden sie kaum noch etwas herausfinden.“
„Stimmt, und die Chancen werden mit jedem Jahr geringer.“ Ein Lächeln umspielte seine Lippen. „Deshalb die Anfrage an alle ehemaligen Nachbarn meines Urgroßvaters. Wie erwartet erhielt ich keine verwertbaren Antworten.“
Oder wie erhofft? Sie studierte sein Gesicht. Wie würde sich die Geschichte auf seine Karriere auswirken?
„Aber einen Versuch war es wert. Raubkunst – sofern es sich darum handelt – wurde oft an Sammler oder Kunsthändler verkauft. Was danach damit geschah weiß der Himmel.“
„Sogar ein Cezanne also. Ihr Urgroßvater muss ziemlich reich gewesen sein, wenn er ihn von einem Kunsthändler gekauft hat. Sammler geben ihre Objekte eher selten wieder aus der Hand.“
Er beugte sich ein wenig vor. „Oder er besaß etwas, auf das der Verkäufer scharf war.“
„Schwarzmarkt? Also Tausch von Nahrungsmitteln, Wertsachen oder mein Schweigen gegen deines?“, zählte sie auf.
„Zum Beispiel.“
„Hat sich außer mir sonst jemand gemeldet?“
„Nein. Wie gesagt, das war vorhersehbar. Inzwischen ist viel Zeit verstrichen. Haben Sie noch eine Frage?“
Betont langsam lehnte sie sich zurück. „Nein. Oder doch. Was war mit der ermordeten Familie?“
„Mir ist nur bekannt, dass sie während der Naziherrschaft irgendwo in München untergetaucht war und nach Kriegsende nicht mehr lebte.“
„Gibt es keine Zeitzeugen mehr, die man fragen könnte? Ehemalige Nachbarn oder Verwandte, die vor dem Krieg ins Ausland geflohen sind?“
Er hob seine Hände und ließ sie auf den Tisch fallen. „Möglich. Aber die sind schwer ausfindig zu machen und die wenigen, die ich aufspüren konnte und kontaktiert habe, rührten sich nicht. Alles, was ich weiß ist, dass ein Verwandter der getöteten Familie die Bilder vor etwa zwanzig Jahren in London in der Art Loss Registry als verschollen listen ließ. Mehr Hinweise liegen mir nicht vor – außer dem illustren Nachnamen der damaligen Eigentümer: Rothschild. Eine Frage hätte ich noch.“
„Nur zu.“
„Ich hatte niemanden mit dem Namen Kiesling angeschrieben. Wie sind Sie an meinen Brief gelangt?“
Daniela zog ihn aus ihrer Handtasche hervor und entfaltete ihn. „Er war an meinen Großvater, Dr. Heinz Lamprecht, gerichtet. Adressiert war er an seinen alten Münchener Wohnsitz in Harlaching, an dem er während des Krieges mit seinen Eltern gelebt hatte. Seine letzten Jahre verbrachte er am Tegernsee. Offensichtlich wurde ihm die Post dorthin nachgeschickt.“
„Wer wohnt jetzt in dem Harlachinger Haus?“
„Keine Ahnung. Es wurde verkauft. Wir fanden den Brief erst vor wenigen Tagen, nach dem Tod meiner Großmutter, im Tegernseer Haus.“
„Mein Beileid“, sagte er höflich.
„Danke.“ Sie nickte ihm zu.
„Ihre Mutter ist also die Tochter des Herrn Dr. Lamprecht?“
„Richtig, und sie war das einzige Kind. Seltsam ist, dass Oma offenbar nicht nur Ihren Brief aufbewahrte, sondern auch einen Namen darauf vermerkte.“
„Aber zu einer Antwort konnte sie sich nicht aufraffen.“
„Vielleicht wollte Opa nichts mit den alten Geschichten zu tun haben.“ Die Frage ist nur, warum, fügte sie in Gedanken hinzu.
Er beugte sich vor, während sie auf den hingekritzelten Namen am Briefrand deutete.
„Wer ist diese Maria?“, fragte er.
„Ehrlich gesagt ist sich in meiner Familie keiner sicher. Es gab oder gibt eine Verwandte dieses Namens: die Schwester meines Opas. Das ist aber auch schon alles.“
Eine Falte zeigte sich zwischen seinen Augenbrauen. „Nachname? Wohnort?“, fragte er.
„Fehlanzeige. Meine Mutter meinte, Maria wäre gleich nach dem Krieg in die USA ausgewandert und hätte dort wahrscheinlich einen Amerikaner geheiratet.“
„Aha“, machte er. „Ziemlich weit weg.“
„Offenbar zu weit, um mit der Familie Verbindung zu halten.“
„Gab es dafür einen Grund?“
„Nicht, dass ich wüsste. Vielleicht warf man ihr vor, sich mit einem Besatzer eingelassen zu haben. Sie müssen wissen, wir sind eine ziemlich merkwürdige Familie. Väterlicherseits kenne ich die ganze Sippschaft, aber auf Mutters Seite ist ein großes Loch.“
„Eigentlich schade, nicht wahr?“
„Wie man’s nimmt. Als wir Kinder waren, ist das meiner Schwester und mir nie aufgefallen, weil ständig irgendwelche Verwandte um uns herum waren.“ Sie trank ihren Latte Macchiato aus. „Und Ihr Urgroßvater wohnte also in der Nachbarschaft meiner Urgroßeltern.“
„Ja, genau“, sagte er leise und sah zum Fenster hinaus. „Mein Urgroßvater hieß Hermann Mischke, und war der zuständige Blockwart.“
Kapitel 5
1945 – MünchenHermann Mischke
Alles Blut sackte in Hermann Mischkes Beine ab, machte sie bleischwer und seinen Kopf federleicht, während sein Mut wie ein zerbombtes Haus in sich zusammenstürzte. Was hatte er soeben gesagt? Er hätte diesen Versuch niemals wagen dürfen, aber es ging doch um das Leben seines einzigen Sohnes. Mischke holte tief Luft. Der Geruch von kaltem Rauch und abgestandenem Bier ekelte ihn auf einmal an.
Das Gemurmel der etwa dreißig Parteigenossen trat in den Hintergrund. Schwarz-weiß-rote Hakenkreuzfahnen bedeckten die Wände im Festsaal des Münchener Wirtshauses und von einem überlebensgroßen Bild über dem Podium starrte ihm sein geliebter Führer grimmig entgegen.
NSDAP-Kreisleiter Buntler straffte sich in seiner goldbraunen Uniform zu seiner ganzen Größe. „Blockwart Mischke, Sie wollen also allen Ernstes, dass ich mich dafür verwende, dass Ihr Sohn, der Ihren eigenen Worten nach ein tapferer, deutscher Soldat sein soll, zur Polizei versetzt wird? Ist wohl ein Drückeberger?“
„Aber nein, ganz und gar nicht. Er will in unserer Stadt denen, die den Glauben an den Endsieg verloren haben, ordentlich Feuer unterm Hintern machen.“
Buntler zog die Oberlippe hoch. „Ich denke, Ihr Viertel ist sauber? Sie wollen damit doch nicht sagen, dass Ihr Sohn das beenden soll, wozu Sie selbst nicht in der Lage sind?“
Mischkes Wangen wurden heiß. Sein Bezirk war sauber, aber dennoch vermutete er, dass diese hochnäsigen Lamprechts Dreck am Stecken hatten. „Ich tue, was ich kann, Herr Kreisleiter.“
„Wirklich? Die Zahl derer, die bei ihnen für den Volkssturm rekrutiert werden, könnte höher sein. Und haben sie wirklich alle Volksverräter gemeldet oder nur die, die wir sowieso schon identifiziert haben? Mischke?“ Buntlers Stimme wurde lauter. „Tun Sie endlich Ihre Pflicht für Führer, Volk und Vaterland!“
„Da … Da sind keine mehr übrig. Alle, die ich gemeldet hab, wurden abgeholt.“ Schweiß brach auf Mischkes Stirn aus. Er hatte zwei Familien ins KZ geschickt. Himmel, Arsch und Zwirn, was sollte er denn noch tun? „Bei mir herrscht Ordnung“, fügte er hastig hinzu.
Buntler machte eine wegwerfende Handbewegung. „Die Waffen-SS braucht jetzt jeden Mann. Ich kann Ihnen da nicht helfen.“
„Bruno hat viel geleistet – viel mehr als manch anderer. Er ist Träger des EK1. Erst kürzlich hat er sogar einen Freund aus unserer Nachbarschaft wegen Feigheit vor dem Feind gemeldet, der daraufhin exekutiert wurde.“
Seine letzten Worte hingen schwer in der Luft. Er hätte nicht Freund, sondern Kameraden sagen sollen, schoss es ihm durch den Kopf.
„Ein richtiger Schlächter also?“ Buntler schien sich diese Frage förmlich auf der Zunge zergehen zu lassen. „So was lob ich mir.“
Mischke suchte an der Stuhllehne hinter sich Halt. Das Blut rauschte in seinen Ohren. Sein Sohn war kein Schlächter, sondern ein wackerer Soldat, der seine Pflicht erfüllte. „Er hat Befehlen gehorcht.“
Buntlers Mund zuckte, als wollte er eine weitere Gemeinheit hinzufügen, aber unruhiges Gedränge vor der Tür am anderen Ende des Saals zog die Aufmerksamkeit aller Anwesenden auf sich. Stühle schrammten laut über den Parkettboden, Stiefelhacken knallten zusammen, ausgestreckte Arme wurden hochgerissen. Ein vielstimmiges „Sieg Heil!“ donnerte durch den Raum. Gauleiter Giesler war eingetroffen, grinste wie ein Filmstar und strahlte absolute Kompromisslosigkeit aus. Er unterstand direkt dem Führer, und da dieser sich nicht sonderlich für Lokalpolitik interessierte, war der Gauleiter uneingeschränkter Herrscher über das gesamte südliche Reich.
Mischke fühlte sich angesichts dieses Mannes unendlich klein. Automatisch klatschen seine Hände bei dem nun losbrechenden Applaus mit. Er wollte in die frenetischen Rufe seiner Parteigenossen einstimmen, aber Buntlers Gesichtsausdruck verschloss ihm den Mund.
„Hören Sie“, zischte Buntler, „ich gebe Ihnen vierzehn Tage und nicht eine Stunde länger, um mir zu beweisen, wie gut Sie ihren Laden im Griff haben. Bringen Sie mir zehn Mann für den Volkssturm – und einen Volksverräter. Wenn’s ein Jude ist, umso besser. Ich werde dann sehen, was ich für Sie und ihren Sohn tun kann. Vierzehn Tage – verstanden?“
In vier Tagen endet Brunos Heimaturlaub, und dann könnte es zu spät sein, wollte Mischke einwenden, brachte aber keinen Ton heraus. An Buntlers Bedingungen war nichts zu ändern.
Woher einen Juden nehmen, nachdem alle schon deportiert worden waren? Er konnte sich doch keinen aus dem Ärmel schütteln. Angeblich sollten noch einige im Untergrund leben, aber an die war nur schwer ranzukommen. Mischke lockerte die Krawatte, während Buntler kerzengerade an ihm vorbeistolzierte, quer durch den Saal, den Arm zum Deutschen Gruß gestreckt. „Heil Hitler!“, brüllte er.
„Heil Hitler!“, schrie die Menge.
Verzweifelt blickte Mischke zu einem befreundeten Polizisten, der mit einem Lächeln antwortete. Was wusste der schon von den Sorgen eines Vaters. Der hatte keinen Sohn an der Front.
Mischke sank auf seinen Stuhl. Vierzehn Tage, um die Aufgabe zu bewältigen. Vierzehn Tage, um das Leben seines Sohnes zu retten. Vierzehn Tage … Er durfte keine Minute verlieren, musste sofort etwas unternehmen. Und er wusste auch schon, wen er ans Messer liefern würde.
Kapitel 6
2010 – MünchenDaniela
Eine Woche später war Daniela vom Lehrerzimmer zum Klassenraum der Ersten unterwegs, als ihr Handy die Star-Wars-Melodie spielte, die sie sich als Erkennungszeichen für Familienmitglieder heruntergeladen hatte. Ihre Kinder, wie sie die Abc-Schützen nannte, liebten diese Melodie, wodurch sie ihnen vermutlich sympathischer erschien, obwohl sie fand, dass die Star-Wars-Filme für diese Altersgruppe weniger geeignet waren. Aber das zu entscheiden, war Sache der Eltern.
Ein Blick aufs Display zeigte, dass Mutter sie zu sprechen wünschte. Daniela seufzte innerlich, denn Mama schaffte es, immer dann anzurufen, wenn es ihr nicht in den Kram passte. „Ich ruf dich zurück“, sagte sie deshalb kurz angebunden.
„Ist aber wichtig, Kleines.“
In den Augen ihrer Mutter würde sie immer nur deren Kleines bleiben. Manchmal musste sie darüber schmunzeln, aber meistens nervte es nur. Sie öffnete die Tür zum Klassenzimmer, in dem es wie immer laut zuging. Augenblicklich verstummte das bunte Sprachengewirr aus aller Herren Länder. In diesem Alter verhielten sich die Youngster noch umgänglich. Ausgrenzungen, Mobbing und Aggressionen gegen die Lehrkraft fanden erst in den oberen Klassen statt. Sie liebte den Umgang mit den Kindern, ein Grund, warum sie diesen Beruf ergriffen hatte.
Heute war sie allerdings unkonzentriert, da ihr die Geschichte des Rechtsanwalts, sowie er selbst, nicht aus dem Kopf gingen. Lukas Mischkes stiller Vorwurf, ihre Ahnen hätten sich an Juden bereichert, war unterschwellig herauszuhören gewesen.
Obwohl dafür – falls überhaupt – ihre Großeltern oder sogar die Urgroßeltern verantwortlich wären, fühlte sie sich irgendwie mitschuldig.
Auch Mama hatte betroffen geschaut. Nur Danielas Schwester Nadine ging das alles am Arsch vorbei, wie sie sich ausgedrückt hatte. „Wir Deutsche sollten endlich einen Schlussstrich unter die alten Geschichten ziehen, und uns nicht ständig die Schuld unserer Vorfahren unter die Nase reiben lassen“, hatte sie weiterhin gesagt, und damit war die Sache für sie erledigt gewesen.
Auch Vater ließ keinen Zweifel daran aufkommen, dass er weder am Bauernhof von Danielas Großeltern noch an deren Vorgeschichte interessiert war. Die Ehe ihrer Eltern war schon seit Langem in Schieflage geraten, aber das mussten die beiden unter sich ausmachen.
Da Mama nur selten etwas als wichtig erachtete, sehnte Daniela das Ende der Unterrichtsstunde herbei. Kaum verkündete der Gong deren Ende, stürmten die Kleinen aus dem Zimmer Richtung Pausenhof. Als der Letzte draußen war, rief sie zu Hause an.
„Was gibt’s?“, fragte Daniela vorsichtig.
„Ich habe einen Anhaltspunkt gefunden, wo sich Tante Maria aufhalten könnte.“
„Und wo wäre das?“ Plötzlich bekam sie Angst vor der eigenen Courage, denn wer konnte schon sagen, ob sich da nicht eine böse Überraschung anbahnte.
„Das ist eine lange Geschichte. Hast du so viel Zeit?“
„Leg los und spann mich nicht länger auf die Folter.“
„Die Schwester deiner Urgroßmutter lebte vermutlich seit Ende des Krieges in den USA. Als sie im Sterben lag, hat sie mit Oma Kontakt aufgenommen. Ich habe den Brief in einem ihrer Ordner gefunden.“
„Hast du sie angerufen?“
„Wen? Die Urgroßmutter? Ich habe doch gerade gesagt, dass sie schon lange tot ist.“
Daniela rollte die Augen, obwohl Mama dies nicht sehen konnte. „Ich meinte ihre Familie, oder den, der Oma angeschrieben hat.“
„Natürlich.“
„Und?“
„Ich habe die in dem Brief angegebene Telefonnummer in den USA angerufen und tatsächlich jemanden erreicht.“
„Jetzt red’ endlich und lass dir nicht alles aus der Nase ziehen.“
„Ihren Sohn.“ Moms Stimme klang freudig erregt. „Der sprach sogar ein paar Brocken Deutsch.“
„Der muss schon uralt sein.“
„An die siebzig. Das ist heutzutage kein Alter.“
Das kam auf die Perspektive an. Mama war Anfang fünfzig. „Und was hat er so erzählt?“
„Dass er in Florida lebe, irgendwo in der Nähe von Fort Lauderdale. Er sagte, er würde Maria kennen und dass sie eine Verwandte von ihm sei.“
„Die muss jetzt aber auch schon um die siebzig sein.“
„Um die achtzig.“
„Wenn wir von der noch etwas erfahren wollen, bevor sie das Zeitliche segnet, sollten wir uns beeilen.“
„Stimmt. Er nannte mir eine Telefonnummer und eine Adresse, aber das Telefon sei stillgelegt. Er habe schon seit einigen Jahren nichts mehr von ihr gehört.“
„Mist.“
„Wieso so pessimistisch? Ist nicht gesagt, dass sie gestorben ist. Amerikaner ziehen bekanntlich öfter um.“
„Deshalb kann man trotzdem Kontakt zu seinen Verwandten halten. Wie sollen wir sie jetzt finden?“
„Indem du hinfliegst und nach ihr suchst.“
Daniela klappte der Mund auf und zu. „So wie in der Fernsehsendung: Bitte melde dich? Das wird schwierig werden.“
„Am besten, du beginnst deine Suche in Florida.“
Typisch Mama. Wenn sie eine Lösung gefunden hatte, war die Sache für sie abgehakt. „Das wird leider nichts, wegen der Schule.“
„Dann flieg eben in den Ferien. Uns treibt doch nichts?“
„Mal sehen. Ich rufe später wieder an. Die Pause ist zu Ende.“