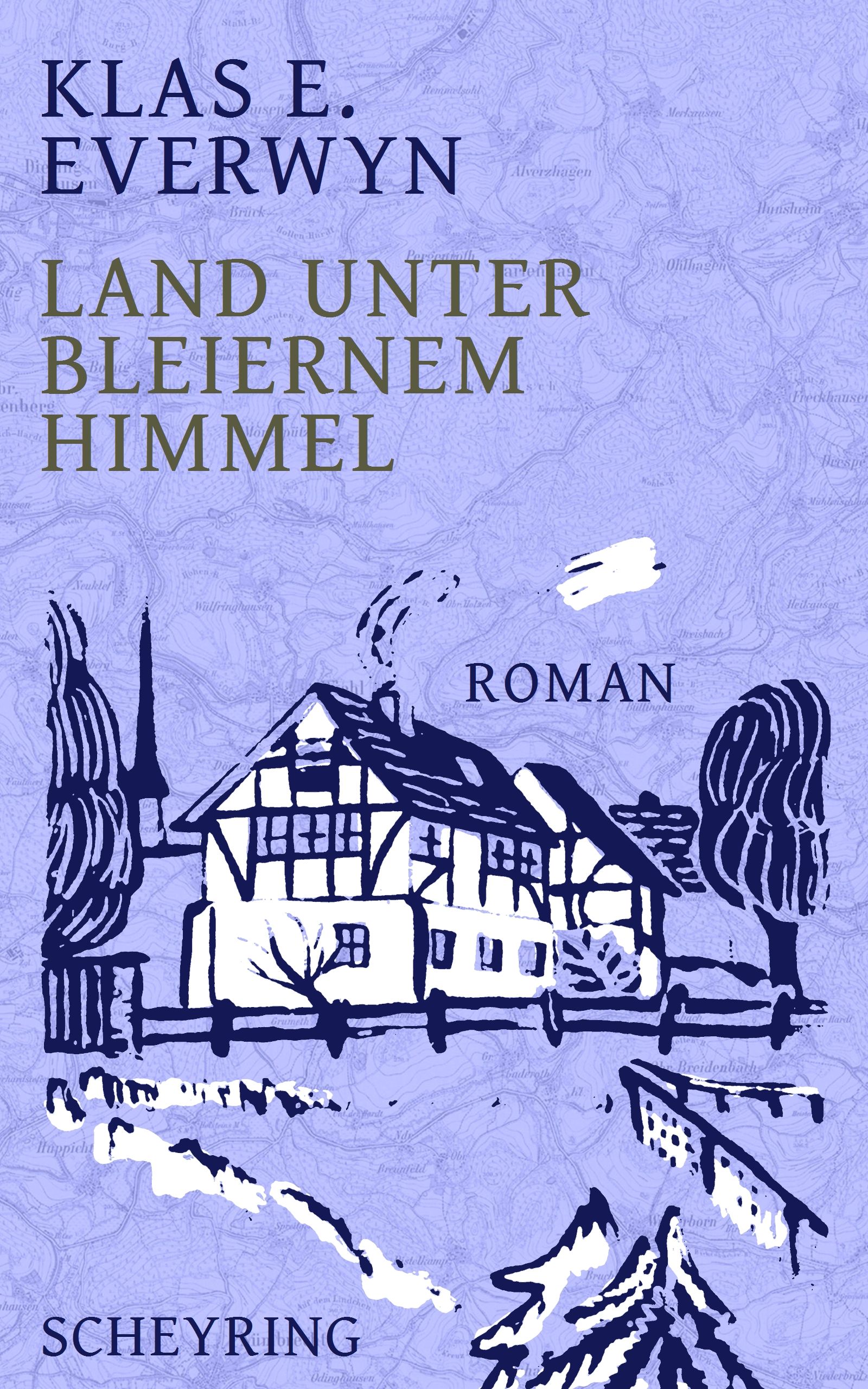2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Scheyring Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Veränderte Landschaft
- Sprache: Deutsch
Das Bergische Land in den 50er Jahren: Sie sind die Hinterlassenschaft des Krieges. Sie tun ihr Bestes, ihr Leben wieder in geordnete Bahnen zu lenken. Ohne Eltern, ohne Mann, ohne Söhne, ohne Bein.
Franz, 16 Jahre, Kriegswaise, hat bei Onkel und Tante Unterkommen gefunden, die ihm jedoch nicht viel mehr als ein Bett und regelmäßige Mahlzeiten bieten können. Als ersten Schritt ins Erwachsenenleben versammelt er eine Musikband um sich, die erfolgreich über die Dörfer tingelt. Da tritt die lebenshungrige junge Kriegerwitwe Frau Simon auf den Plan und setzt eine verhängnisvolle Kettenreaktion in Gang … (VLB-713)
Pressestimmen
»Die Handlung ist von jener Simplizität und Strenge, die es dem Autor erlaubt, seine Helden so differenziert wie nötig anzulegen, und er tut es mit Treffsicherheit und bitterer Distanziertheit.«Sybil Gräfin Schönfeldt in der ZEIT NR. 37/1963
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 421
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
KLAS E. EVERWYN
Die Hinterlassenschaft
ROMAN
SCHEYRING VERLAGNEUSS
IMPRESSUM
Vollständige E-Book Ausgabe
© Scheyring Verlag, Neuss 2020
© Marion von Schröder Verlag, Hamburg 1962
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Sämtliche, auch auszugsweise Verwertungen
bleiben vorbehalten.
Covermotiv: G. Schmachtenberg
Autorenfoto: Ina-Maria von Ettingshausen
ISBN 978-3-944977-71-3
www.scheyring.de
INHALTSVERZEICHNIS
EINS
Die Schreie waren im ganzen Dorf zu hören: schrille, schmerzerfüllte tierische Schreie, und für den, der sie kannte, waren sie der Beweis für die Stümperhaftigkeit, mit der irgend jemand dort zu Werke gegangen war: die Axt geschwungen und deren stumpfes Ende auf den flachstirnigen Schädel eines Schweines geschmettert hatte, ohne über die erforderliche Sicherheit des Armes und des Auges zu verfügen, so daß er statt der Stirn den Rüssel traf oder das Ohr, und der Streich war vertan. Jeder im Dorf würde nun wissen, daß es ein Stümper war, der ihn vollführte.
Aber es war nicht Fip; es beruhigte, zu wissen, daß Fip es nicht gewesen sein konnte. Anderenfalls hätte ich nämlich nicht hier in unserer Wohnung stehen und mit ansehen können, wie Tante Fina die Hände gegen die Ohren preßte, ehe sie ausrief: »O Gott, dieser Rohling!«; ich wäre dann dabeigewesen, als er den mißglückten Streich tat, denn in diesen Dingen war ich seine rechte Hand. Das alles wußte auch Tante Fina, so daß es gar nicht hätte geschehen dürfen, daß sie fortfuhr auszurufen: »Natürlich Hauser! Hört er denn gar nicht auf, das Tier zu quälen?«
Und doch war es nicht die Inkonsequenz, die mich an ihrem Ausruf ärgerte, sondern eher die Ungerechtigkeit, mit der sie Fip bedachte, indem sie ihn einen Rohling genannt hatte; denn Fip war kein Rohling, ebensowenig wie Onkel Joe (wie sie es schrieb; Jö: wie sie es sprach) einer war, und das, was Fip veranlaßte, Schweine zu schlachten, war eben sein Beruf (›Halt!‹ würde Fip jetzt gesagt haben: ›Nun mal langsam!‹), also nicht sein Beruf, sondern eine Beschäftigung, der er im Spätherbst oder wintertags nachging und die etwas Geld abwarf. Eine Verdienstmöglichkeit, nichts anderes; wie Schuhe besohlen und Dächer decken oder elektrische Leitungen reparieren (was er alles zu anderen Jahreszeiten besorgte). Jedenfalls eine Beschäftigung, um die man ihn bat und die zu tun man ihn drängte, weil er im Umkreis als der beste Schlachter bekannt war.
In diesem Moment sagte Onkel Joe: »Schrecklich!«, und es war dies eigentlich nichts weiter als eine Bestätigung, die er für die Meinung seiner Frau immer dann bereit hatte, wenn sie ihrer bedurfte. Selbst in meinen Ohren waren das inzwischen abgedroschene Redensarten, die nichts über seine tatsächliche Meinung aussagten, auf die es sowieso nicht ankam und auf die er in dem Augenblick verzichtet hatte, als er sie heiratete oder schlimmer: weit früher noch, als sie sich kennenlernten und er zum ersten Mal in ihrer Gegenwart den Mund öffnete, um ihr dieses oder jenes klarzumachen, seine Vorstellung über gewisse Dinge kundzutun, unmißverständlich, wie er sich vorgenommen hatte, und sie ihm das Wort abschnitt, indem sie sagte: »Aber Sie müssen doch zugeben, daß ich recht habe«, und er immer noch nicht begriffen hatte, wohin ihn dieser Satz führte oder zu führen imstande war, denn er setzte erneut an. Doch es war diesmal nur ein Wort, das er hervorbrachte, höchstens ein Wort, vielleicht aber auch nur eine einzige Silbe des Wortes, das Bestandteil eines Satzes war, den er vorgehabt hatte, um jeden Preis vor ihr loszuwerden; dazu ließ sie es nicht mehr kommen, sie sagte nur: »Herr Busch!«, und er stockte augenblicklich, sah sie an, und sie sagte es noch einmal, nun leiser, aber um so bestimmter: »Herr Busch!«, und er hatte es überstanden.
Ich hätte demnach gar nicht darauf einzugehen brauchen, ich hätte es übergehen können und statt dessen hinausgehen sollen, um allem aus dem Wege zu gehen, aber was Fip betraf, verstand ich keinen Spaß, denn es betraf auch mich, und ich sagte: »Was soll denn daran so schrecklich sein?«
Als er jetzt von der Zeitung aufschaute, über die auf die Nasenspitze gerutschte Brille hinweg mich anstarrte, erkannte ich auch schon, daß er nicht einmal meine Frage verstanden hatte. Denn er selbst sagte es mir: »Wieso?«, immer noch die großflächigen Zeitungsbogen vor sich ausgebreitet wie einen Schirm, einen Schild, hinter dem er sich vorkommen mußte wie in das uneinnehmbare Gefüge einer Festung einbezogen, wo er vor den Blicken seiner Frau sicher und geborgen war. Das war ein Trick, wobei ihm seine Meinungslosigkeit noch zustatten kam dadurch, daß, obwohl er gar nicht darauf achtete, was seine Frau sagte, er es nur mit einem Wort zu bestätigen brauchte, um sie zufriedenzustellen. In der Wahl der Bestätigungswörter konnte er sich ganz auf sein durchtrainiertes Gehör verlassen, das ihm genau anzeigte, wann es an der Zeit war, etwas zu verneinen oder zu bejahen, zu bedauern oder zu verurteilen. Im Laufe der Jahre hatte er sich einen bestimmten Vorrat solcher Wörter zugelegt, über deren Verwendbarkeit nicht einmal er selbst entschied, sondern Tante Finas Stimme. Ihr Organ löste in ihm einen Mechanismus aus, der das zutreffende Wort aus seinem Wörterschatz herausklaubte und es über seinen Mund hinausbeförderte, und es war gesagt.
»Du hast ›schrecklich‹ gesagt«, sagte ich.
»So, hab ich das?« Seine Augen verschwanden schon wieder hinter den herabgesenkten Lidern, unter deren Rändern hervor sie nun über die Zeilen der Zeitungsspalten huschten, während ich sagte: »Natürlich hast du das.«
Die Schreie waren verstummt, das hatte ich gewiß vergessen, denn nun würde Tante Fina ihre ganze ungeteilte Aufmerksamkeit uns und unserem Disput widmen können, würde ihm und seinem Ausmaß eine Zeitlang lauernd gefolgt sein, wie um sich davon zu überzeugen, in wessen Waagschale sie das Gewicht ihrer Meinung und damit gleichsam das Gewicht des Rechts schlechthin würde werfen können, ohne sich ihres Rufs als Richter zu begeben, wozu es dann aber immer noch einer klärenden Frage bedurfte: »Er hat was gesagt?«
»›Schrecklich‹ hat er gesagt.«
»Na und, sind sie denn nicht auch entsetzlich?«
»Du meintest aber doch Fip«, sagte ich, als wüßte ich nicht genau, daß die Würfel bereits gefallen waren, sie ihre Entscheidung längst getroffen hatte, und das machte sie mir dann auch deutlich: »Das ist doch dasselbe.«
»Nein, es ist eben nicht dasselbe, es ist nämlich nicht Fip. Es wird Matthes sein oder Hänschen, irgendwelche Stümper, die Fip das Wasser nicht reichen können.«
»Sieh mal einer an«, sagte sie und drehte ihren Kopf vom Fenster weg, heftete ihre Blicke auf mich, »das Wasser nicht reichen können. Daran erkennt man mal wieder, wie sehr du unter seinen Einfluß geraten bist und wie sehr es an der Zeit ist, daß es damit ein Ende hat. Du gehörst auf eine Lehrstelle. So ein Junge wie du gehört einfach auf eine Lehrstelle, wo er sich mit seiner Arbeit abplagen muß, wo ihm die Flausen vergehen, wo man ihm die Zicken aus dem Kopf nimmt. Joe«, wandte sie sich nun an ihn, der sich immer noch hinter seinem Festungswall aus Zeitungspapier sicher wähnte und der auch jetzt nicht aufschaute, nicht einmal die Zeitung so sehr senkte, daß man wenigstens den Bruchteil seines Gesichts hätte sehen können. Es war nur ein »Nun?«, das ihm sein Mechanismus vermittelte, und das genügte in diesem Falle nicht, das reichte einfach nicht aus angesichts eines Problems, mit dem sie sich nun schon seit zwei Jahren herumschlugen und bei dem es um nichts anderes ging, als für mich eine geeignete Lehrstelle zu finden.
Für mich war das längst erledigt, zumindest seit einem Monat, dem Tage nämlich, da wir die Alten Kameraden gründeten und ich der Furcht enthoben war, jemals eine Lehrstelle antreten zu müssen. Auch vorher schon war nur in gewissen Zeitabständen im Kreise der Familie von einer Lehrstelle die Rede gewesen, dann nämlich, wenn das Geld, das ich von den Bauern für die Feldarbeit erhielt, nicht ausreichte, Tante Fina davon zu überzeugen, wie wenig ich eine Lehrstelle benötigte, um Geld mit nach Hause zu bringen. Und wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich auch darauf verzichtet, mir hätte genügt, mit zehn oder elf Jahren auf das Gymnasium geschickt worden zu sein oder mit vierzehn auf die Handelsschule. Aber davon hatten sie nichts wissen wollen. Vielmehr sollte ich es sein, der Geld verdiente, und das auf eine andere Art als die von Onkel Joe praktizierte:
Er hatte aufgehört, sich Sorgen über den Broterwerb zu machen, seit ihm monatlich die zweihundertundetwas Mark Rente ins Haus gebracht wurden, die er für sein abbes Bein erhielt. Sein abbes Bein oder einfach der Fuß, wie er es nannte, war es denn auch, das ihn daran hinderte, weiteres Geld hinzuzuverdienen; wenigstens gab er das vor, und seltsamerweise brachte Tante Fina hierfür sogar Verständnis auf. Wahrscheinlich waren sie übereingekommen, daß er genügend für den Unterhalt seiner Familie durch die Hergabe eines Dreiviertel-Beines getan hatte und daß es an mir sei, sollte Geld benötigt werden, dafür zu sorgen. Denn sie hatten mich aufgezogen und würden auf eine Begleichung der angelaufenen Rechnung nicht verzichten wollen, zumal es elf Jahre waren, die es mich in dieser Familie gab.
Im Anfang mußten es zwei Familien gewesen sein, wenigstens nahm ich das an, wenn auch Tante Fina sagte, es seien im günstigsten Falle anderthalb gewesen: denn mein Vater war nie bis in den Kreis unserer Familie oder besser in die Kreise unserer Familien vorgedrungen:
Ein Soldat auf dem Weg von Polen zum Westen, Ende 1939, den meine Mutter wahrscheinlich auf irgendeinem Tanzvergnügen kennenlernte. Und schon war er wieder unterwegs, und er war gerade in Frankreich eingetroffen, Mai 1940, als sie ihm von mir schrieb, und er schrieb zurück, er könne es nicht ändern, und sie: aber sie wolle geheiratet werden, ich brauche einen Namen, und zwar nicht den ihren, sondern den seinen, darauf er: er könne nicht weg zum Heiraten, er habe in Frankreich alle Hände voll zu tun, worauf sie das Briefeschreiben unterließ und sich an den Pastor wandte, der es dann für sie besorgte. Es dauerte allerdings eine ganze Weile, ehe auch er, der Pastor, alles in die Wege geleitet hatte, und es gab mich schon fast ein ganzes Jahr, und der Mann, der Soldat, befand sich schon wieder an einem anderen Ende der Welt, ohne die Drehscheibe benutzt zu haben, die er auf seiner ersten Wanderung in Anspruch genommen hatte, und jetzt war er wirklich unabkömmlich (schrieb sein Regimentskommandeur dem Pastor, der es meiner Mutter sagte), so daß sich der Pastor zum letzten entschloß. Inzwischen hatte nämlich der Staat, oder wer auch immer, eine neue Erfindung gemacht, was den Zusammenschluß heiratswilliger Paare anging, eine Erfindung, die das Zusammen-vor-den-Altar-Treten nicht mehr erforderlich machte. »Ferntrauung«, erklärte mir Onkel Joe, und von ihm hatte ich dann das Zeremoniell erfahren:
Da stand dann der Soldat irgendwo in Rußland vor seinem Regimentskommandeur und die Frau vor dem Pastor ihrer Gemeinde, sogar die Uhrzeit war vorher abgesprochen zwischen Pfarrei und Regiment, und die Frau hatte einen polierten Stahlhelm neben sich auf rotem Samt liegen und der Soldat einen Blumenstrauß, und beide sagten ihr »Ja« im selben Augenblick Tausende Kilometer voneinander entfernt, und vielleicht, überlegte ich mir, nahm hernach jeder den Statthalter des anderen mit ins Bett, sie den Stahlhelm, er den Blumenstrauß, und sie hatten eine angenehme Hochzeitsnacht. Ich wußte zwar nicht, was an einer Hochzeitsnacht so seltsam war, immerhin aber wußte ich so viel, daß es sie gab und daß sie das Wichtigste an der ganzen Heiraterei sein sollte: sagte Aloys, der war zwar nicht verheiratet, dafür aber Soldat gewesen.
Ich bekam also seinen Namen, und meine Mutter war, scheint’s, zufrieden. Zwei Monate später, kaum daß die notwendigen Dokumente aus Rußland beim Standesamt eingetroffen waren, kam abermals ein Brief von dem Regiment des nunmehr als verheiratet geltenden Soldaten, der seiner nunmehrigen Ehefrau mitteilte, ihre ganze Mühe sei umsonst gewesen, ihr Mann sei gefallen, und das Standesamt erhielt den Auftrag (Buchstabe A–K), ein neues Dokument zu fertigen, auf Grund dessen meine Mutter eine Rente beanspruchen konnte. Also wenigstens das. Und wenn es eine Erinnerung an diesen Mann, der mein Vater war, gab, so die monatliche Überweisung meiner Waisenrente, die jetzt, nach Mutters Tod, Onkel Joe zugeschickt bekam, denn er war mein Vormund.
Anders war das mit meiner Mutter. Ich war fünf, als sie mich zu Tante Fina brachte, die damals schon in Schmalkotten wohnte, das entschieden weiter von der Bedrohung, die der Krieg heraufbeschwor, entfernt war als die Großstadt, aus der wir allesamt (mit Ausnahme des Soldaten) stammten. So sah ich denn meine Mutter als eine große, stattliche Frau mit flatterndem dunkelblondem Allerweltshaar, eingehüllt in ein graues Schneiderkostüm und mit einem gänzlich weißen Gesicht. Oder anders: sie besaß für mich überhaupt kein Gesicht; denn dort, wo es hätte sein müssen, befand sich ein runder, form- und konturenloser Fleck, ähnlich jener weißen Flecke, die Landkarten dort aufweisen, wo man das Gebiet noch nicht so weit erforscht hatte, daß man es auf den Landkarten mit Konturen hätte versehen können, mit Höhen und Tiefen, Bächen und Flüssen, Urwald oder Steppe. Tante Fina verwahrte zwar eine Fotografie von meiner Mutter, und sie hatte sie mir nicht einmal vorenthalten, als ich sie eines Tages danach fragte, aber das änderte nichts an meiner Erinnerung und an dem weißen Fleck an Stelle ihres Gesichts, aus dem heraus sie auf mich einredete, wenn sie mich bei der Hand faßte, mir in den Zug half und wieder heraus und mich den Berg hinaufleitete und dann wieder hinab ins Tal, auf dessen Sohle es ein Dorf gab, von dem ich später erfuhr, es heiße Schmalkotten und in dem Tante Fina, Onkel Joe und Vetter Josef wohnten. Mehr nicht, und doch viel in Anbetracht der Umstände, denn meine Mutter sah ich seither nicht mehr. Sie blieb einfach aus, und niemand sprach von ihr, und ich hatte sie vergessen. Das, was mich wieder auf sie aufmerksam machte, war das Erfordernis, Tante Fina als Tante Fina und Onkel Joe als Onkel Joe anzureden, während meine Schulkameraden diejenigen, die das gleiche für sie taten wie Tante Fina und Onkel Joe für mich, mit Mama und Papa anreden durften. So stieß ich wieder auf sie, und als man mir (mit aller Schonung) eröffnete, sie sei im Himmel, gab ich mich damit vorerst zufrieden. Eine Weile mochte ich sie mir als eine Art Engel vorgestellt haben, bis ich den Begriff »tot« lernte und meinte, sie müsse auf dem Friedhof liegen unter einem Blumenbeet und einem Grabstein, und da ich schon zu lesen oder vielmehr Buchstaben zu entziffern verstand, ging ich hin und sah nach, aber es gab dort keinen Grabstein, der ihren Namen trug. Tante Fina erläuterte mir auch das: Es sei der letzte Bombenangriff der Terrorflieger auf jene Großstadt gewesen, deren Namen ich zur Bezeichnung meines Geburtsortes in der Schule anzugeben hatte und in der sie einer anscheinend wichtigen Aufgabe wegen bleiben mußte, wo ihr Einsatz erforderlich war aus irgendwelchen Gründen, und bei diesem Bombenangriff sei sie gestorben, nicht getötet worden durch eine dieser Bomben, oder doch: gestorben an der Bombe, die so nahe bei dem Haus herabfiel und explodierte, in dem sie sich aufhielt, daß es ihr das Herz stillstehen ließ. Vielleicht hatte es vorgehabt, hernach weiterzuschlagen, wollte nur eben den Schrecken überbrücken, den das Getöse und Gebebe in ihm auslöste, doch dann hatte es wahrscheinlich zu lange gewartet, und es blieb still. Tante Fina sagte, man habe sie, obwohl sie gar nicht verletzt gewesen wäre, der Eilbedürftigkeit wegen in einem Massengrab beigesetzt, so daß es für sie keine Grabinschrift und kein besonderes Blumenbeet geben würde. Ich wußte es nicht. Vielleicht doch. Ich wünschte es ihr jedenfalls.
Nicht daß ich sie vermißt hätte, dazu kannte ich sie, als ich mit Denken anfing, zu wenig, darüber hinaus hatte ich Tante Fina und Onkel Joe und außerdem Josef, ihren Sohn und meinen Vetter, und sie alle waren nicht anders zu mir, als die Mütter und Väter und Brüder zu ihren Kindern und Brüdern waren. Nur daß sie eine andere Bezeichnung trugen. Das ergab in meinen Augen jedoch keinen großen Unterschied.
Und Schmalkotten, das Dorf, nicht zu vergessen. Schmalkotten war wichtig für mich. Eigenartig fand ich nur, daß ich nicht hergehörte, nach Tante Finas Meinung. Wir gehörten alle, sagte sie, in die Großstadt, mit ihr seien wir verwurzelt, und sie ließ keine Gelegenheit aus, es mir, was sage ich, es uns allen klarzumachen. Und dazu ergab sich oft genug Gelegenheit. Denn unsere ganze Misere (wie sie es ausdrückte) hatte ihre Ursache in dem, was sie die Enge nannte. Bald schon verstand ich sie besser: es waren die beiden Zimmer, die sie als die Enge bezeichnete und die wir bewohnten, zwei Zimmer auf Fuhrmanns Hof, das eine (sogenannte Wohnzimmer) zur Hauptstraße hin gelegen, das andere (tatsächliche Schlafzimmer) der Stallseite zugekehrt, und beide etwa gleich groß und vollgepfropft mit ihren Möbeln aus der Großstadt, eingekauft nach den Maßen großstädtischer Zimmer (deren dann aber drei oder gar vier), so daß die zweifellos vorhandene Enge sich allein schon aus dem Vorhandensein der herumstehenden Möbel ergab. Wahrscheinlich hatten sie das in der Anfangszeit auch eingesehen, denn nach und nach verschwand das eine oder andere Möbel, die ich dann in den Zimmern der Bauern und dort völlig fehl am Platze wiederfand, auch den Teppich und das Radio. Komplett blieb, bis auf den Frisiertisch, das Schlafzimmer, das dann auch als einziges seine Bezeichnung zu Recht trug. Das andere (sogenannte Wohnzimmer) diente nur zum Teil seinem eigentlichen Zweck: denn es erfüllte den Zweck einer Küche ebenso wie den einer Schlafkammer oder natürlich auch den eines Wohnzimmers, und in ihm spielte sich in der Hauptsache das ab, was man als Familienleben bezeichnet: Kochen, Essen, Zeitunglesen, Schulaufgabenmachen, Herumsitzen, Streiten, Nasenbohren, Aus- und Ankleiden, Waschen, Spülen, Wäschetrocknen und was es derlei Dinge mehr gibt.
Im Winter stand aber auch das Schlafzimmer anderen Zwecken zur Verfügung, dann nämlich, wenn es nach Tante Finas Auffassung Wahnsinn war, sich zu nächtlicher Stunde auf den Abort zu begeben: ein Gehäuse ohne Dach, an der Rückfront des Stalltraktes zwischen Holzschuppen und Wohnhaus gelegen, in das nicht nur der Wind aus allen Himmelsrichtungen und darüber hinaus auch von oben und unten eindrang, sondern mehr noch: wenn Schnee gefallen war, so hatte auch er Einlaß gefunden und sich um die holzverkleidete Öffnung drapiert, auf die man notwendigerweise angewiesen war. Ich nahm an, daß es nicht der Gewohnheit der Bauern entsprach oder auch nur der der Familie Fuhrmann, nachts den Abort aufzusuchen, denn sonst hätte man ihn zumindest längst mit einem Dach versehen müssen. Tagsüber war das nicht so schlimm, man sah wenigstens, wohin man sich setzte, aber nachts blieb einem nichts anderes als der marternde Schrecken. Und den wollte Tante Fina, wollten wir alle nicht auf uns nehmen. Ein halbwegs mit Wasser gefüllter Eimer in der Mitte des Schlafzimmers zwischen den beiden Betten war ein annehmbarer Ersatz, auf jeden Fall ersparten wir uns den Schrecken. Ich brauchte nachts sowieso nicht oft raus, und so durfte ich das Hörspiel, das mir die anderen boten, meist ungeteilt genießen. Sie warteten natürlich, bis ich eingeschlafen war oder sie es vermuteten, und in der Mehrzahl der Fälle werden sie es auch schon so eingerichtet haben, aber andererseits hatte ich Gelegenheit genug, den Kopf unters Deckbett zu stecken und mich vor Lachen zu schütteln.
Daß sie sich, im wahrsten Sinne des Wortes, vor mir bloßstellten, wußten sie natürlich, und es war daher für Tante Fina ein Grund mehr, die Misere zu beklagen. Und doch war es das nicht allein. Viel lag auch einfach an Onkel Joe oder an dem mangelnden Verständnis, das er ihrer Misere entgegenbrachte, es lag daran, daß er sich mit einer Meinungslosigkeit begnügt hatte und nun glaubte, damit habe er alles in seiner Macht Stehende getan, um sie bei guter Laune zu halten. Vielleicht, überlegte ich mir, hing das auch damit zusammen, daß sie nicht in einem Raum zusammen schliefen, nicht die Nacht in einem Zimmer gemeinsam verbrachten, wie es für andere Eheleute einfach unumgänglich ist. Aber auch hierfür hatte sie einen ganz plausiblen Grund, den sie mir nannte, ohne daß ich danach gefragt hätte, so als bedürfe ich seiner, und der nichts anderes besagte, als daß sie den Stallgeruch, der in dem Schlafzimmer besonders intensiv zu bemerken war, nun einmal nicht ausstehen könnte, wenn sie es auch so präzise nicht ausdrückte; sie sagte: »Dieser Geruch macht mich verrückt«, zum Beispiel, oder sie erwähnte, wenn sie die Betten gemacht hatte, ihre Kopfschmerzen, die sie auf den Geruch zurückführte; jedenfalls dokumentierte sie durch ihr ständiges Wehklagen über den Geruch ihre Abneigung gegen die Schlafkammer, so daß es mir hätte einleuchten müssen (wie sie annahm), wie wenig sie bereit sein könnte, dort auch noch zu schlafen. Sie schlief im Wohnzimmer auf einem zusammengezimmerten Bettgestell, nahm vorlieb mit einem Bretterboden, roh zusammengetrimmten Brettern auf vier Holzstelzen, auf das drei Seegrasmatratzen gepackt waren. Onkel Joe und mir konnte der Geruch nichts anhaben, auch Josef nicht, als er noch lebte, denn er teilte mit mir dasselbe Bett, während Onkel Joe den Vorzug genoß, alleine schlafen zu können.
Jetzt auch ich. Es war damals ein eigenartiges Gefühl, in einem Bett alleine schlafen zu dürfen, ein wohliges Behagen, gekoppelt mit einer Art schlechtes Gewissen, da ich diesen Vorzug nur auf Kosten Josefs hatte in Anspruch nehmen können. Mir hatte es nichts ausgemacht, mit ihm das Bett zu teilen, denn ich war es nicht anders gewohnt. Zwar wurden wir beide mit der Zeit breiter und größer, und manchmal waren wir uns schon sehr lästig, besonders dann, wenn Josef seiner Gewohnheit nachging und im Traum den Kopf hin und her bewegte. Onkel Joe, der auch davon erwachte, sagte mir, das habe er schon als Kleinkind im Kinderwagen getan: ein absonderliches Herumrollen des Kopfes, dem auch mit Rufen und Knüffen nicht beizukommen oder abzuhelfen war; es schien tatsächlich nur seine träumerische Phantasie noch zu beflügeln, und mir fiel dabei immer Helmut Blach ein, ein Schüler aus der Dorfschule, der dann und wann Anfälle bekam und bei denen es genauso herging, wie wenn Josef träumte. Helmut kam dann in eine Anstalt, weil diese Anfälle immer heftiger und in immer kürzer werdenden Abständen auftraten. Josef kam indes nicht in eine Anstalt, ihn mußte ich austoben lassen, das war auch gar keine Krankheit. Die trat erst auf, als er plötzlich seine nächtlichen Vorführungen aufgab, was mir aber erst auffiel, nachdem er damit eine volle Woche geknausert hatte, und etliche Tage später brachte man ihn ins Krankenhaus. Eine Zeitlang glaubte ich wirklich, ihm sei die Aufgabe seiner Bewegungen, um die ich ihn oftmals schon gebeten hatte, nicht bekommen, und ich machte ihm Vorwürfe, machte auch mir Vorwürfe, denn ich hätte ihn nicht darum bitten sollen. Denn so schlimm war das nun auch wieder nicht gewesen. Er sollte von mir aus ruhig damit weitermachen und dafür gesund bleiben. Als man aber auch mich ins Krankenhaus steckte, obwohl ich diese Angewohnheit nicht hatte, ging mir auf, daß es im Gegenteil die Krankheit gewesen war, die ihm seine Gewohnheit ausgetrieben hatte. Typhus hieß sie; ich wußte gar nicht, was daran so schrecklich sein sollte, denn ich fühlte mich ganz wohl dabei. Aber ich blieb nur ein paar Tage im Krankenhaus, bis man festgestellt hatte, daß ich an dieser Krankheit überhaupt nicht litt. Als ich nach Hause kam, erfuhr ich, daß es eine Epidemie sei, und das sei weit schlimmer als Typhus, und es läge am Wasser, erzählten sich die Leute, und es kamen Fremde ins Dorf, die Lodenmäntel trugen und seltsame Glasbehälter mit sich herumschleppten, deren Inhalt sie ins Wasserbassin in der Reutherkuhle gossen. Onkel Joe sagte mir, es sei Chlor, aber das half Josef nicht mehr auf die Beine. Er starb am selben Tag, an dem die Lodenmantelmänner ins Dorf kamen.
Das war ein schlimmer Tag, und auch die folgenden wurden schlimme Tage, und ich vergesse den Abend nicht, als mir Tante Fina mitteilte, ich könnte von nun an allein im Bett schlafen, für immer allein. Ich freute mich darüber, denn das hatte ich mir oft gewünscht, aber dann bekam meine Freude doch ein schlechtes Gewissen, und ich hörte auf, mich zu freuen. Ich begann, wie die anderen, zu weinen, und Tante Fina drückte mich ganz fest an sich, und Onkel Joe legte mir seine Hand auf den Kopf, und Tante Fina sagte: »Jetzt bist du unser Junge.«
»Aber«, antwortete ich, »das bin ich doch immer gewesen.«
»Natürlich«, sagte sie, und sie drückte mich noch fester an sich, und sogar einen Kuß gab sie mir irgendwohin ins Gesicht, was sie, so ich mich erinnerte, noch nie getan hatte. Und Onkel Joe sagte: »Wir sind eine sterbende Familie.«
»Hör auf, hör auf!« schluchzte Tante Fina, und er hörte auf, nahm seine Hand von meinem Kopf, seufzte einmal ganz tief und schlimm auf und setzte sich in den Sessel, um die Zeitung zu lesen.
Seit seinem Tod waren nun fünf Jahre vergangen, und von Josef wurde nicht mehr viel gesprochen. Unser Familienleben zu dritt hatte sich eingefahren, und alles, was Josef einmal gehört hatte, war seinerzeit verbrannt worden, sogar seine Kleider, obwohl ich sie gern aufgetragen hätte. Wir waren von gleicher Größe gewesen, so daß sie sich eine Menge Geld hätten sparen können, das sie nun für die Anschaffung neuer Kleidungsstücke ausgeben mußten. Das schien mir seltsam, wo sie doch ständig über Mangel an Geld klagten und keine Gelegenheit ausließen, mir zu verstehen zu geben, wie schwer sie es hätten, durchzukommen. Aber mir das zu bedeuten besorgte meist Tante Fina, Onkel Joes Sorgen waren das nicht, sie lagen auf einem anderen Gebiet, wenn es auch nicht seine ausschließlichen Sorgen waren; sie gehörten ihnen beiden zu gleichen Teilen und betrafen sein abbes Bein.
Wenn die Sprache darauf kam, schlug er mit dem Knöchel seines Zeigefingers gegen den Holzschaft, den er unter seiner Hose verbarg, und sagte: »Es ist ein Kreuz mit so einem Fuß.« Diese Bezeichnung irritierte mich in der ersten Zeit, und ich überlegte, ob er uns nicht doch etwas vorgekohlt haben konnte, daß er vielleicht wie ein Magier oder ein Zauberer aus dem Zirkus mit seinem Bein umsprang, das er verschwinden und wieder auftauchen lassen konnte, wie es die Zauberer mit Kaninchen und Taschentüchern und Geldstücken vermögen. Denn daß das Bein ab war, bewies er uns jeden Tag, wenn er sich auszog, und es war eigentlich komisch anzusehen, wenn er mit seiner Unterhose, die ein langes und ein kurzes Bein hatte, durch das Zimmer hüpfte und das Holzbein in die dafür vorgesehene Zimmerecke stellte, sich auf sein Bett niederließ, um den verbliebenen Stumpf (ein über und über mit Pickeln und Abschürfungen besäter, sonst aber unnatürlich weißfleischiger Stumpf mit einer tiefroten wulstigen Narbe an seinem unteren Ende) zu reiben und zu kneten und dabei zu sagen: »Mensch, hab ich wieder Schmerzen im Fuß. Es wird wohl anderes Wetter geben.«
Wenn er so weit war, verließ Tante Fina fluchtartig das Schlafzimmer, falls sie nicht vorgezogen hatte, es überhaupt nicht erst zu betreten. Im Winter kam es aber oft vor, daß wir uns im Wohnzimmer entkleideten. Tante Fina hatte dann unsere Schlafanzüge oder Nachthemden über den Ofen gehängt, um sie anzuwärmen. Denn in der Schlafkammer war es in dieser Jahreszeit lausig kalt. Und wenn sich dann Onkel Joe daranmachte, erst die Hose auszuziehen, um sich dann des mit Riemen und Schnallen an dem Leib befestigten Holzbeines zu entledigen, verschwand Tante Fina entweder ins Schlafzimmer, oder sie hatte etwas in Fuhrmanns Küche zu besorgen. Hinterher konnte es vorkommen, daß sie Stellung nahm, daß sie sich entschuldigte, aber diese Entschuldigung gleich mit einer Klage verband, der Klage über die Misere und die Enge, denen wir ausgesetzt seien. »Warum«, so sagte sie, »haben wir kein Badezimmer, wie wir eins in der Großstadt hatten, wo es niemanden stört, wenn Onkel Joe sein Bein auszieht? Warum haben wir nicht wenigstens ein geheiztes Schlafzimmer? Wenn ich mir das alles überlege, fühle ich wieder, wie mir die Decke auf den Kopf fällt. Das ist doch kein Zustand so was!«
Um diesem Zustand zu entrinnen, fuhr sie dann und wann in die Großstadt, um die Freunde und Freundinnen vergangener Tage aufzusuchen, und wenn sie dann, nach einer Woche, zurückkehrte, war sie für einen Tag glücklich über das in der Stadt Erlebte, um tags darauf in eine Art Katzenjammer zu verfallen, wenn sie die Enge und die Misere erneut zu spüren bekommen hatte. Deshalb freuten Onkel Joe und ich uns zwar auf ihre Reise, da wir während dieser Zeit endlich einmal tun und lassen durften, was uns gefiel, sahen aber ängstlich dem Tage ihrer Rückkehr entgegen.
Ich meinte immer, es könnte anders sein, wenn sich jeder von uns zufriedengäbe. Daran, daß wir in die Stadt zurückkehren würden, glaubte ohnehin niemand von uns ernstlich. Auch Tante Fina nicht. Onkel Joe drückte das so aus: »Sie muß ab und zu mal hin, sie muß sich wieder mal ihren Akku aufladen, sie braucht das wie das tägliche Brot.« Aber das sagte er auch nur, wenn sie nicht zugegen war; wir wagten nicht einmal einen Versuch, ihr diese Besuche, sosehr sie auch ins Geld schossen, auszureden. Das Zufriedengeben betraf deshalb in der Hauptsache sie, und Onkel Joe hätte der Mann sein müssen, es ihr zu vermitteln. Hierzu fühlte er sich jedoch anscheinend nicht imstande. Sie waren nun beide in den Vierzigern, und er hätte Mittel und Wege finden müssen, seine offensichtliche Zufriedenheit auf sie zu übertragen, vielleicht mittels eines geheimnisvollen Vorganges, von dem Aloys oftmals sprach. »Was denkt ihr«, sagte er, »was das die Weiber zufrieden macht. Ich kannte mal eine, die war mir direkt dankbar dafür.« Aber als ich näher in ihn eindrang, lachte er nur: »Nun guckt mal diesen kleinen Scheißer! Auf den Trichter wirst du noch früh genug kommen, wenn’s an der Zeit ist, verlaß dich drauf. Es soll aber keiner kommen und sagen, ich hätt’ dir die Laus in den Kopf gesetzt.«
Also gab es doch so etwas, und mir leuchtete nicht ein, warum Onkel Joe keinen Gebrauch davon machte. Der Stallgeruch war natürlich eine Ausrede, die man selbst mir nicht aufbinden konnte, eher bewirkte es schon der häßliche Stumpf, das abbe Bein oder der Fuß, dessen Anblick sie ohnehin flüchten ließ, und vielleicht war es überhaupt der Verzicht auf ihre Zufriedenheit, mit der er sich sein gewisses Eigenleben eingehandelt hatte; daß sie sich zu einem Entschluß durchrangen, nachdem sie zu ihm gesagt hatte: »Du kannst machen, was du willst, und du kannst es machen, wo und wie du willst, aber ich bitte dich, hör zu, Joe, ich bitte dich wirklich, es nicht mehr mit mir zu machen«, worauf er nur gegrunzt haben würde, unzufrieden mit dem Ausgang des Monologs zwar, aber unfähig, seinen Protest zu äußern, und so hatten sie’s in der Folgezeit gehalten.
Oft schon hatte ich vorgehabt, es ihnen zu sagen, zumindest von ihnen zu verlangen, in einem Raum zu schlafen und mir das Bettgestell zu überlassen. Um ihr die Zufriedenheit wiederzugeben, hätte ich gern auf mein Bett verzichtet. Aber die Geleise, in denen sich ihr Leben bewegte, waren zu sehr eingefahren. Er gab sich mit dem Nichtstun zufrieden, was ihm wohl schon immer vorgeschwebt haben mochte: Geld zu erhalten, für das er nicht mehr zu arbeiten brauchte, Zeitung zu lesen, ein Leben, wie er es sich beim Militär vorgenommen hatte, zu leben (»Wenn ich nach Hause komme, schiebe ich ’ne ruhige Kugel, und das wird die Wahrheit sein«), nachdem man ihn dort tüchtig zwischengenommen hatte (wie er es darstellte: »Da wird man zwischengenommen, kann ich dir verraten, und das nicht zu knapp.«). Und das, was eigentlich seine Aufgabe gewesen wäre, die Familie nämlich mit Geld zu versorgen, fiel damit mir zu.
Aber während der Zeit, da ich dem Alter nach eine Lehrstelle hätte innehaben können, würde ich sowieso nur verhältnismäßig wenig Geld mit nach Hause gebracht haben, bestimmt weit weniger, als ich im Monat von den Bauern erhielt, sowohl an Bargeld als auch an Lebensmitteln. Allein was ich an Kartoffeln anschleppte, die ich zentnerweise in die Kreisstadt verkaufte, und die Wurst und das Fleisch, das mir Fip bei den Schlachtungen dafür zu verdienen gab, daß ich das Tier bei den Ohren hielt, während er zuschlug, übertraf bei weitem den Lohn eines Lehrlings in jedwedem Handwerksbetrieb und in jedwedem Lehrjahr. Und doch hatte sie mir jetzt bewiesen, daß ich mich vor dem Problem noch längst nicht sicher wähnen durfte.
Aber Onkel Joe auch nicht, das hatte sie ihm deutlich genug zu verstehen gegeben, auch wenn das nur ein so dahingesagtes »Joe« gewesen war, auf das er sich gar nicht einzugehen bemühte, es nur eines »Nun?« für wert befand, und das war zu wenig. Damit war das Thema denn auch abgeschlossen und beendet, und er war es selbst gewesen, der es zur Bedeutungslosigkeit degradierte gegenüber einem anderen Problem, und das betraf allein ihn.
»Joe«, wiederholte sie, und als er immer noch nicht von seiner Lektüre ablassen wollte, fügte sie ein nochmaliges »Joe« hinzu, das aber spitzer, und als er jetzt endlich aufblickte, war gar nicht abzusehen, wann er seine Lektüre würde fortsetzen können; er konnte die Zeitung aus der Hand legen, es war unnötig, sie auch jetzt noch weiter in beiden Händen zu halten, als sie sagte: »Ich möchte, daß du mir zuhörst, Joe.«
»Aber Fina«, antwortete er, »das hab ich aber doch.«
»Nein, das hast du nicht, und wenn ich dich jetzt fragen würde, um was es sich gehandelt hat, könntest du es mir nicht einmal sagen. Aber ich frag dich erst gar nicht.«
Mit der rechten Hand ließ er das Zeitungsblatt los, um sich an die Brille zu greifen, nicht etwa, um sie abzunehmen, sondern um sie auf dem Nasenrücken höher zu schieben, aber er würde sie noch abnehmen müssen, daran kam er nicht vorbei, auch wenn er immer noch abstritt, nicht zugehört zu haben: »Ich hab bestimmt genau hingehört.«
»Hingehört«, sagte sie, »hingehört. Du solltest mir zuhören.«
»Aber ja, natürlich, hab ich auch. Ich weiß genau, daß du von dem Schwein gesprochen hast, und ich habe dir auch darauf geantwortet. Daß es nämlich schrecklich ist, dieses Quieken, und es ist tatsächlich schrecklich. Ich kann es genausowenig ertragen wie du.«
»Na bitte, ist das nicht der Beweis dafür, daß du überhaupt nicht zugehört hast? Gib es doch wenigstens zu. Sag doch einfach: Ich hab nicht zugehört. Aber selbst damit sagtest du mir nichts Neues. Du hörst ja nie zu, wenn ich was sage. Sitzt da und liest die Zeitung, hast …«
»Nun, nun, Fina«, grunzte er, und es war der Zeitpunkt gekommen, die Brille abzunehmen und einen der Ohrenbügel zwischen die Lippen zu klemmen, während er weitersprach: »Das dürfte doch etwas übertrieben sein. Selbstverständlich interessiere ich mich dafür, was du sagst. Nein, du kannst mir wirklich nicht vorwerfen, ich hätte kein Ohr für deine Probleme und Sorgen. Was das betrifft, habe ich ein gutes Gewissen.«
»Ja«, sagte sie, »so ein Gewissen möchte ich auch haben. Du kannst es drehen und wenden, wie du willst, es bleibt immer ein gutes Gewissen.« Dann erinnerte sie sich jedoch, daß es auch noch mich gab in dem Raum, ein Kind in ihren Augen und in dessen Gegenwart sie sich nicht gern über das Gewissen ihres Mannes auslassen wollte, denn es konnte geschehen, daß im Eifer von Rede und Widerrede auch das ihre zur Sprache kommen würde, und sie wandte sich mir zu, als habe sie mich erst jetzt entdeckt: »Ach, Fränzchen, du könntest gut das Holz kleinmachen. Sieh mal im Schuppen nach.«
Und dem hatte ich nichts entgegenzusetzen und nichts hinzuzufügen, denn so war es immer, wenn sie zu streiten anfingen: irgendwann erreichte das Gespräch einen Punkt, an dem es ihr geraten schien, mich unter Zuhilfenahme eines Vorwandes, der in der Hauptsache in der Ausführung irgendeines Arbeitsauftrages bestand, zu entfernen, und so sagte ich auch jetzt nur: »Ist gut, kann ich machen«, war sogar ein wenig froh darüber, nicht mehr Gegenstand ihres Streitgesprächs zu sein, obwohl ich gern Zeuge gewesen wäre, wenn sie ihn mal wieder in die Zwickmühle nahm.
Ich ging hinaus auf den Hinterhof. Der Hauklotz war ein riesiger Wurzelblock, der unter dem Schuppen in unmittelbarer Nähe des Abortes stand und auf dem ich fast Tag für Tag dafür sorgte, daß, wie Tante Fina sagte, der Kamin rauchte. Aber ich sah schon von weitem, als ich noch unter der Hintertür des Hauses einen Blick hinunter auf Hinterhof, Schuppen und Scheune warf, daß ich sie würde enttäuschen müssen, und ich erinnerte mich sofort, daß es bereits einige Tage her war, seit ich das letzte Knüppelholz aus dem Wald geholt hatte. Wir besaßen einen kleinen Handkarren, mit dem ich jede Woche einmal in den Wald hinaufzog, um Knüppelholz daraufzuladen. So oder so würde ich also bald wieder in den Wald hinauf müssen, aber für heute hätte ich Frau Fuhrmann wegen etwas Brennholz fragen können, damit ich wenigstens heute von dem Waldgang befreit wäre.
Deshalb ging ich zurück in unser Zimmer, um Tante Fina zu sagen, das Holz sei alle, aber sie brauche sich keine Sorgen zu machen, ich würde Emma um etwas angehen. Als ich das Zimmer betrat, sah ich sie mit hochroten Köpfen einander gegenübersitzen, der Disput hatte also seinen Fortgang genommen; doch nun schwiegen beide, sahen mir mit einer Art Erwartung entgegen, als hinge es von mir ab, welche Wendung das Gespräch von nun an nehmen würde. Was Onkel Joe anging, so würde er seine ganze Hoffnung auf mich setzen, und sie würde gewiß nicht trügen, denn in jedem Falle brachte ich von meinem Gang zum Hinterhof ein neues Thema mit ins Haus, was immer es auch sein mochte, und wie ich – und natürlich auch er – Tante Fina kannte, würde sie schon darauf brennen, sich auf das neue Thema stürzen zu können. Das nicht etwa, um dem alten zu entrinnen, denn sie behielt bei der Erörterung eines jeden Themas die Oberhand, sondern weil sie sich für alles zuständig fühlte, weil sie die Geschicke der Familie leitete und, wie sie selbst es verstand: weil sie alles zu deichseln hatte.
»Was«, sagte sie, von Onkel Joe ablassend, »kein Holz mehr da?«
»Nein«, antwortete ich, »aber das ist ja nicht so schlimm.«
»Wieso ist das nicht schlimm? Natürlich ist das schlimm«, und jetzt schon hatte ich Onkel Joe errettet, ich hörte ihn glückhaft aufstöhnen und sah ihn wieder nach der Zeitung greifen, die er vor sich auf den Knien liegen gehabt hatte. Und während er sich auch wieder die Brille aufsetzte und sich in seine Lektüre zu vertiefen begann, hatte das neue Thema mich ereilt: »Sehr schlimm ist das sogar. Du willst doch nicht, daß wir hier frieren.«
»Klar will ich das nicht, aber …«
»Na also. Du hättest schon gestern gehen sollen, denn du bist dafür zuständig, das ist dein Ressort, du hast dich darum zu kümmern, ob das vorhandene Holz für die Woche ausreichen wird. Das hast du mal wieder vergessen.«
»Wieder?« fragte ich. »Wieder vergessen? Ich hab noch immer dafür gesorgt. Du hast selbst gesagt, ich sorgte schon dafür, daß der Kamin rauchte. Und das tu ich auch. Ich will ja auch morgen gehn, aber …«
»Warum morgen? Gleich jetzt wirst du gehn!«
»Aber ich könnte doch auch Emma danach fragen, sie hilft uns bestimmt damit aus.«
»Du sollst nicht immer Emma sagen. Frau Fuhrmann heißt das. Sind wir schon so weit, daß du dir die Gewohnheiten der anderen Bauernlümmels aneignest? Nein, Franz, so weit sind wir nun doch noch nicht. Wir wissen immer noch, was Anstand bedeutet. Und du wirst sie nicht fragen, du wirst sofort mit dem Wagen hinaufgehen und neues holen.«
»Mensch«, sagte ich, »immer das verflixte Holzholen. Was denkst du, wie schwer das ist, den schweren und vollgepackten Wagen den Berg herunterzukriegen auf diesen Wegen hier.«
»Hab ich die Wege gemacht?« rief sie, und ich merkte, wie das Gespräch in eine neue Richtung umschlug, eine Richtung, in die ich es nicht gedrängt sehen wollte, denn das hatte wenig Sinn; ich hatte heute einfach keine Lust, in den Wald zu gehen, es war schon über Mittag, es war überdies kalt und ungemütlich, und ich wäre viel lieber zu Hause geblieben, bis ich am Abend mit Fip und Aloys zusammentreffen würde. Ich hatte gar nichts gegen das Holzholen, auch nichts gegen die Wege, aber ich hatte etwas dagegen, ausgerechnet heute Holz holen zu müssen.
Ich sagte: »Auf jeden Fall ist es eine elende Plackerei, und alles muß ich alleine machen.«
Ich bemerkte, wie jetzt auch Onkel Joe von seiner Zeitung aufsah, er schien hellhörig geworden zu sein, ihm behagte anscheinend der in das Gespräch geratene Ton nicht, und er ahnte gar, ähnlich wie ich, wie es enden würde, wie es bisher noch niemals geendet hatte, aber das besagte ja nicht, daß es nicht einmal so weit kommen könnte. Auch Tante Finas Blicke wurden um einige Grade intensiver, spitzer und schärfer, während sie mich anfuhr: »Was soll denn das heißen? Alleine machen! Wer soll es denn sonst tun? Etwa ich? Verlangst du vielleicht, ich sollte auch noch das Holz aus dem Walde schleppen? Wo alles schon auf mir lastet! Hab ich nicht genug und übergenug zu tun, damit ihr was zu essen kriegt?«
»Das hab ich ja auch gar nicht gemeint«, sagte ich, »aber vielleicht könnte Onkel Joe mir mal dabei helfen.«
Jetzt war es heraus, und ich fühlte mich leichter, aber nicht sehr lange, denn nicht nur, daß Onkel Joe die Zeitung vollends fallen gelassen hatte und mich nicht so sehr feindselig als vielmehr in einer Art verblüffter Verwunderung musterte: es lag hauptsächlich an Tante Finas Gesichtsausdruck, der ihre völlige Fassungslosigkeit offenbarte, daß mir sehr schnell klar wurde, wie wenig leichter ich mich fühlen durfte.
Dann hatte sie auch schon ihre Fassung wiedererlangt, obwohl ihre Stimme immer noch voller Staunen war, als sie fragte: »Was sagst du da? Du verlangst tatsächlich, daß sich dein armer alter Onkel dafür hergibt, nur damit du es bequemer hast?«
»Aber«, sagte ich, »er hat doch sowieso nichts zu tun.«
»Aha!« rief sie. »Aha. Das also willst du damit sagen, darauf willst du hinaus. Pfui Teufel, das hätte ich nicht von dir erwartet. Du weißt wohl überhaupt nicht, was Dankbarkeit bedeutet. Wer hat dich denn aufgezogen, wer hat denn für dich gesorgt? Dein Vater etwa, dieser hergelaufene Strauchdieb? Nein, der nicht, er hat nicht einmal meine Schwester heiraten wollen, so ein feiner Herr war das. Und ich sehe schon, daß du ihm nachzuschlagen beginnst. Mach so weiter, mach nur so weiter, und du wirst sehen, wo du landest. Du bist auf dem besten Wege, du mit deinem Fip. Auch Frau Fuhrmann hat mich vor ihm gewarnt. Weißt du eigentlich, was das für ein Bursche ist, sag, weißt du das? Ein Nichtstuer und Faulenzer, der unserem Herrgott den Tag stiehlt, Schweine umbringt und sonst nichts tut. Mit dem treibst du dich herum, statt dich an Hänschen zu halten, der ein ordentlicher Kerl ist. Ich möchte bloß wissen, was für einen Narren du an dem gefressen hast, an diesem Tunichtgut!«
»Was hat das denn mit Onkel Joe zu tun?« fragte ich. »Ich möchte doch nur …«
»Halte deinen Mund!« rief sie. »Halt um Gottes willen deinen Mund!«, und bei diesen Worten erhob sie sich von ihrem Stuhl, auf dem sie bis dahin gehockt hatte, schob ihn mit den Kniekehlen hinter sich zurück und war mit einem Schritt bei mir. Und ich hielt den Mund, bis zum Äußersten wollte ich es nicht kommen lassen. Tante Fina hatte mich bislang noch nie geschlagen, mich auch noch nie zu schlagen brauchen, viel weniger denn Onkel Joe, ich hatte mich ihnen und ihren Anordnungen immer gefügt. Das wollte aber nicht heißen, daß ich auch immer mit ihnen einverstanden war. Und wenn ich abends im Bett lag, stellte ich mir schon mal vor, wie es zuginge, wenn ich ihnen oder besser ihr widerspräche und es dabei nicht bewenden ließe, sondern schon zum Gegenangriff überginge, denn so wie Onkel Joe wollte ich mich dabei unter keinen Umständen aufführen. Ich würde mit ihr Fraktur reden, wie es Tante Fina selbst bezeichnete, wenn sie mit Onkel Joe zankte. Und immer, wenn ich davon träumte, trug ich den Sieg über sie davon, ich machte sie mundtot, ich ließ sie überhaupt nicht mehr zu Worte kommen, so daß sie mich händeringend bat, von ihr abzulassen. Statt dessen hielt ich jetzt den Mund, wie sie es von mir verlangt hatte, denn ich fühlte, wie mir die Tränen aufstiegen, nicht über die Schelte, ach Gott, die konnte ich schon ertragen, sondern über die nicht zu verzeihende Ungerechtigkeit, die aus ihren Worten sprach. Ich würde kein Wort mehr herausbringen, denn schon das nächste würde unweigerlich die Tränen mit hervorbrechen lassen. Ich dachte dann daran, um wie vieles leichter es die Jungen meines Alters hatten, die von Natur aus härter veranlagt waren. Ihnen fiel das Hart-Sein gar nicht schwer, denn sie waren es schon, als sie zur Welt kamen, ich dagegen mußte darum kämpfen.
»Joe«, sagte sie jetzt, und Onkel Joe war ganz Ohr, ganz Aufmerksamkeit, als wenn er ahnte, daß ihn ein falsches Wort unrettbar mit in den Strudel ziehen würde, und so hatte er die Zeitung zusammengefaltet und auf den Tisch zurückgelegt, die Brille mit gekreuzten Bügeln dazu, um bei seinem Stichwort sofort auf den Plan treten zu können.
»Ja, Fina?« fragte er.
»Ich hoffe, du hast auch noch einiges dazu zu sagen. In der Hauptsache betrifft es ja dich.«
»Ach, Fina«, sagte er. Denn das war ihm noch weniger recht, als von ihr gescholten zu werden, nunmehr auch noch Partei zu ergreifen, viel mehr, als nur Partei zu ergreifen: auch noch Standgericht zu sein.
»Was heißt hier: Ach, Fina? Du solltest ihn lieber gehörig zwischennehmen. Damit hättest du viel früher beginnen müssen, dann wäre es nie so weit gekommen.«
»Fina, hör mal …«
»Joe!«
»Was ist das nur für ein Leben!« seufzte er und erhob sich mühsam aus dem Sessel, und noch im Aufrichten wandte er sich an mich: »Hör mal, Fränzchen …«
»Ach!« rief ich und hatte die Tränen überwunden. »Laß das doch«, machte auf dem Absatz kehrt und ging hinaus.
Nun aber, da er einmal aufgestanden war, war er so leicht nicht mehr abzuschütteln, denn auch er hatte einen Auftrag erhalten, und ich wußte, daß er ihn ausführen würde, nicht heute, wahrscheinlich auch nicht morgen, aber irgendwann einmal – vermutlich wenn wir unter uns waren – würde er darauf zurückkommen, um hernach Tante Fina gegenüberzutreten und zu sagen: »Befehl ausgeführt«, oder so ähnlich. Daß er sich sofort und unmittelbar an meine Fersen heften würde, hätte ich nie vermutet, gar nicht vermuten können nach allem, wie er sich bisher in den elf Jahren aufgeführt hatte; doch als ich mit der Handkarre, vom Hinterhof kommend, auf die Straße einbog, sah ich ihn unter der Haustür stehen in Joppe und Hut, sogar Handschuhe hatte er an den Händen, die dampfende Pfeife steckte ihm im Mund, und ich war einfach sprachlos. Ich war dann auf der Höhe des Hauseinganges, als er, ohne die Pfeife aus dem Mund zu nehmen, rief: »Wart, Franz, ich begleite dich ein Stück«, aber ich hielt nicht an, ich setzte meinen Weg die Hauptstraße entlang fort, so daß er sich beeilen mußte, um mir noch Gesellschaft leisten zu können und seinen Auftrag loszuwerden. Und ich hörte ihn hinter mir her humpeln, wobei seine Prothese eigenartige Laute ausstieß, knarrte und quietschte, bis er endlich an meiner Seite anlangte und sagte: »Du hast aber ’nen ordentlichen Zahn drauf.«
Nicht genug damit, daß er mich begleitete, sogar bis oben hinauf auf die Haen, er half mir auch noch dabei, das Knüppelholz zu suchen und den Wagen zu beladen, ohne daß ich ihn dazu aufgefordert hätte; aber das hatte ich ja schon zu Hause getan, und vielleicht, so sagte ich mir, hatte der Streit doch sein Gutes gehabt, vielleicht besinnt er sich darauf, ein Vorbild und nicht nur ein Vormund zu sein, der sich damit begnügt, Empfänger, Verantwortlicher meiner Waisenrente zu sein.
Erst als wir den Wagen bepackt hatten und ich schon an der Deichsel stand, um das Gefährt bergab zu leiten, entsann er sich seines mutmaßlichen Auftrages, oder er hatte alles genau voraus berechnet, hatte sich gesagt: erst mal den Wagen beladen, den eigenen guten Willen zeigen, dann wird sich das Weitere ergeben, und er tat es, indem er vom Wagen wegtrat, sich auf einen Baumstumpf setzte und umständlich seine Pfeife neu zu stopfen begann. Er rauchte das billigste Kraut, das Puschels Marie in ihrem Laden führte, und das auch nur, weil Onkel Joe danach verlangt hatte. Es verursachte einen entsetzlichen Gestank, der mich schon oft wundern ließ, warum wohl Tante Fina etwas gegen den Stallgeruch hatte, wenn der Gestank seiner Pfeife oder des Krautes, das er in ihr verpaffte, weit stärker war.
»Hier ist noch Platz«, sagte Onkel Joe und rückte ein wenig zur Seite, während er sein abbes Bein weit von sich streckte und das gesunde bis fast an die Kinnspitze anzog, und ich ließ die Deichsel fahren, ging zu ihm hin und setzte mich seitlich neben ihn, so daß wir fast Rücken an Rücken saßen und uns nicht ins Gesicht zu sehen brauchten. Der Gestank des Tabaks verbreitete sich rasch, ich hörte das Zischen und Knistern des Tabaksaftes und rümpfte die Nase und sagte: »Ich kann nichts dafür, aber das Zeug stinkt erbärmlich.«
»Du rauchst doch auch schon, was?« fragte er, und es klang eigentlich so müde und uninteressiert, daß es schon fast harmlos erschien; aber mit Harmlosigkeit allein würde er sich wohl kaum begnügen wollen.
»Manchmal«, sagte ich.
»Im Steinbruch mit den anderen Jungens, wie? Bei mir fing es in einer Regentonne an, aber der Rauch verriet mich, und ich bekam Prügel von meinem Vater.«
Wir lachten. Onkel Joe konnte schon ganz prima sein.
»Wirst du es Tante Fina sagen?«
»Daß du rauchst? Aber so was tut man doch nicht, das wäre ja Verrat.«
»Mensch, Onkel«, rief ich, »warum bist du nicht immer so?«
»Soll das ein Kompliment sein? Ich habe erst sehr wenige bekommen.«
»Von Tante Fina, was?« – Wir lachten beide.
»Auch du bist schon ganz in Ordnung, Junge«, sagte er, und ich schämte mich ein wenig. »Aber, sag mal«, fuhr er fort, »wie bist du eigentlich darauf gekommen?«
»Worauf?« fragte ich und war gespannt auf das, was nun folgte.
»Na, du weißt schon: das mit dem Helfen und daß ich sowieso nichts zu tun hätte.«
»Ach das, das hab ich nur so dahergeredet. Laß man, ich mach schon meine Arbeit.«
»Jetzt bist du aber ein bißchen feige. Du kannst mir das ruhig sagen. Ich trage dir nichts nach.«
Jetzt lachte ich nicht mehr, auch schämte ich mich nicht mehr, denn er hatte mich daran erinnert, warum wir hier saßen; weil er einfach nicht der Kerl dazu war, sich mit einem sechzehnjährigen Jungen über Allerweltsfragen zu unterhalten. Das waren alles Finten, auch das Holz-holen-Helfen, das alles gehörte mit zu seinem Angriffsplan, der nicht einmal sein eigener war, sondern vermutlich der seiner Frau, denn von ihr hatte er den Auftrag, und ich war schon drauf und dran gewesen, das alles außer acht zu lassen.