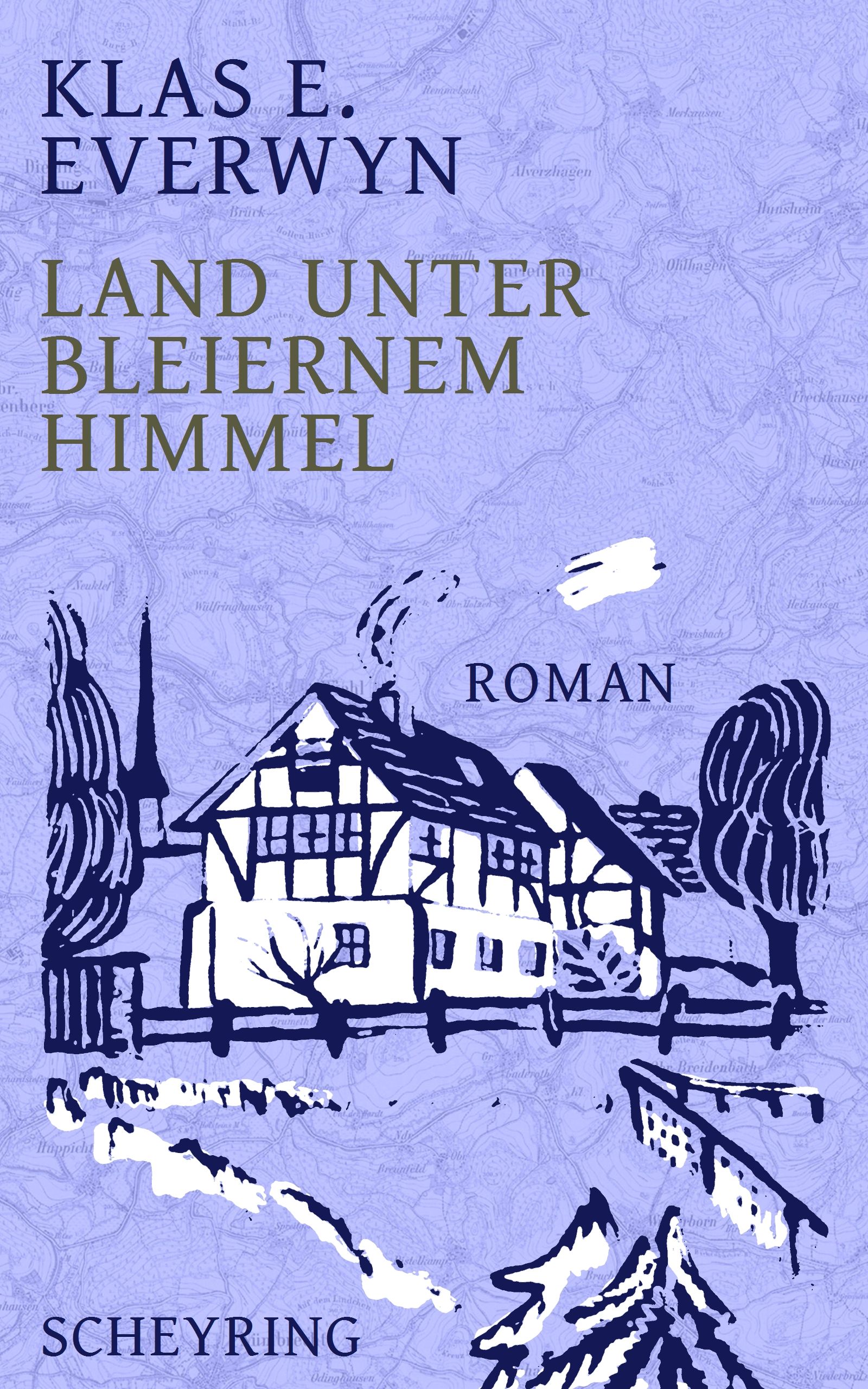
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Scheyring Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Veränderte Landschaft
- Sprache: Deutsch
Dies ist der Roman einer Familie, die aufbricht, um Macht zu gewinnen über ein Dorf.
Der abgelegene Hof in der Haen wirft wenig ab. Die Kinder des Hauses, Leo und seine Schwester Sanne, von den Leuten im Dorf ob ihrer innigen Beziehung mißtrauisch beäugt, haben nicht vor, das arbeits- und entbehrungsreiche Leben ihrer Eltern fortzuführen. Doch der vermeintliche Weg nach oben erweist sich als selbstzerstörerisch … (VLB-720)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 251
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
KLAS E. EVERWYN
Landunter bleiernemHimmel
ROMAN
SCHEYRING VERLAGNEUSS
IMPRESSUM
Vollständige E-Book Ausgabe
© Scheyring Verlag, Neuss 2020
© Benziger Verlag, Zürich 1983
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Sämtliche, auch auszugsweise Verwertungen
bleiben vorbehalten.
Covermotiv: G. Schmachtenberg
Autorenfoto: Ina-Maria von Ettingshausen
ISBN 978-3-944977-72-0
www.scheyring.de
INHALTSVERZEICHNIS
DIE GRUFT
EINS
Plötzlich, von einem Tag auf den nächsten, war alles anders.
Sanne hatte in der Nacht Schüsse gehört und war beruhigt mit dem Gedanken wieder eingeschlafen, daß sie spätestens am Wochenende die Schuhe besitzen würde, die sie sich so sehr gewünscht hatte. Leo hatte sie dann aber nicht heimkommen hören. Sie war, wie gewöhnlich, gegen vier aufgestanden, hatte sich, wegen der Kälte ein wenig zögerlicher als sonst, gewaschen und war in Kittel, Kopftuch und dicken Wollsocken hinuntergegangen, um in die Gummistiefel zu steigen und die Melkmaschine in den Stall zu tragen. Dabei hatte sie den strengen Geruch wahrgenommen, der aus der tiefgelegenen Waschküche drang, und sie hatte einen Blick auf die beiden Kadaver geworfen, die von der Waschküchendecke, an Stricken baumelnd, herabhingen und ihr Blut längst vergossen hatten. Es stand, zu einem dunklen Rinnsal erstarrt, in der Ablaufrinne.
Sie hatte den Kühen die Melkstutzen angelegt, die Maschine angestellt und war zwischendurch mehrmals in die Küche gegangen. Sie hatte das Radio eingeschaltet und das Frühstück vorbereitet, das sie später zusammen mit Leo schweigend eingenommen hatte. Danach hatte er die gefüllten Milchkannen auf den Lieferwagen geladen und war nach Schmalkotten gefahren. Während Leo unterwegs war, trieb sie die Kühe aus dem Stall auf die Weide, wusch die Melkmaschine aus, säuberte den Stall und streute frisches Häcksel.
Nachdem Leo von Schmalkotten zurückgekommen war, begann er mit dem Jauchefahren. Inzwischen waren die beiden Alten erwacht, und sie hatte ihnen in der Küche das Frühstück zurechtgestellt. Sie hatte den Schlagermelodien aus dem Radio gelauscht und eine Weile damit zugebracht, sich auf einem Tanzboden vorzustellen. Sie konnte nicht tanzen, aber in ihrer Vorstellung gelang es ihr spielend. So lange jedenfalls, bis eine Männerstimme anfing, ihr etwas über Ostverträge zu erzählen. Da war sie hinausgegangen und hatte sich um das Futter für die Hühner und Katzen gekümmert.
Schließlich war sie in die Waschküche gestiegen, um das Blut aufzuwischen. Dabei stieß sie wiederholt mit den baumelnden Kadavern zusammen. Es waren zwei Ricken. Leo würde sie verkaufen und ihr ein Paar Schuhe mit nach Hause bringen. Und am Sonntag, wenn sie nach Schmalkotten zum Gottesdienst ins Gemeindehaus führen, würde sie sie zum ersten Mal anziehen.
Es war ein Tag wie jeder andere in der Einsamkeit der Haen, jenem öden, bewaldeten Höhenzug zwischen dem Wengertbach im Norden und der Gies im Süden, in dessen Mitte das Gehöft der Pampus-Familie lag, umgeben von ein paar dem Wald abgetrotzten Feldern und Weiden, nicht mehr als sechs bis sieben Hektar Land, das nur auf Feldwegen zu erreichen war. Und daß Leo wilderte und das geschossene Wild an den Viehhändler Pietsch aus Heiligsmühl verkaufte, gehörte genauso zur Gleichförmigkeit ihres Lebens wie die übrige Arbeit, die Sanne und Leo sich teilten.
Die Leute von der Haen hatten sich stets ein Zubrot verdienen müssen, um hier leben und bestehen zu können während der mehr als zweihundert Jahre, die es sie auf dem Hof gab. Gewildert hatten sie immer, ob mit Netzen, Schlingen, Fallen oder mit der Büchse. Später war dann die Nutzung der Wildschäden als Erwerbsquelle hinzugekommen; sie brauchten bloß die Früchte in der Nähe des Waldrandes anzubauen, auf die es die Wildschweine besonders abgesehen hatten, Kartoffeln und Hafer. Dafür kassierten sie dann die Versicherungssummen, für die der ferne Jagdpächter aus Wuppertal hatte aufkommen müssen. Früher noch hatten sie auch aus Korn oder Kartoffeln Schnaps gebrannt; das war damals gewesen, als eine Flasche ihre fünfzig Reichsmark wert war und zudem als Tauschobjekt für andere Güter diente. Aber seit es den Grünen Plan gab mit seinen Steuer- und Darlehenserleichterungen, der ihnen Traktor und Mähmaschine und andere Geräte bescherte, hätte man auch auf der Haen knapp sein Auskommen finden können. Aber das war es natürlich nicht, was Sanne und Leo, die beiden Geschwister, sich vom Leben erhofften.
Dennoch schienen die Aufregungen längst hinter ihnen allen zu liegen. Seit der Geburt der Tochter im Jahr fünfundvierzig, als die Mutter einen schweren Schock erlitt, weil die Hebamme auf sich warten ließ und ihr Mann vor den schrillen Schreien und dem Blut davongerannt war, das bereits das Bett tränkte, seit dieser Zeit war Gertrud Pampus nicht mehr richtig im Kopf und dämmerte in debiler Freundlichkeit lächelnd vor sich hin, ohne sich um mehr als die Blumen vor dem Fenster zu kümmern.
Aber ihr Zustand war für Sanne und Leo ebenso selbstverständlich und unabänderlich wie des Vaters zwanghafte Dengelsucht, die ihn Tag für Tag unters Schuppendach trieb, wo ein mit Zement gefüllter Zinkeimer mit einer Art Miniaturamboß stand, auf dem er die Blätter der Sensen mit dem scharfkantigen Dengelhammer bearbeitete oder die Messer der Mähmaschine. Das aufreizende Klingen des Dengelhammers begleitete Sannes und Leos Leben. Nur die Mutter lauschte ihm mit Andacht, als erinnere es sie an eine weit zurückliegende und glückliche Zeit: »Hört mal, wie Papa dengelt.«
Damit hatte er begonnen, nachdem er die beiden Geschwister bei einem gemeinsamen Bad erwischt hatte; vielmehr war es Sanne, die in der Zinkwanne auf dem Dachboden, dem Ohler, saß, während Leo davorhockte und ihr den Rücken einseifte. Mehr hatte der Vater nicht gesehen, aber es genügte, um ihn wortlos auf der Treppe umkehren und in die Küche zurückgehen zu lassen, wo er die aus drei Lederriemen geflochtene Peitsche vom Haken nahm, die Leo schon kannte. Damit erschien er wieder auf dem Ohler, aber Leo erwartete ihn bereits, nahm ihm die Peitsche einfach weg, wie man einem Kind ein Spielzeug wegnimmt, noch ehe der Vater einen Fuß auf den Ohlerboden gesetzt hatte, und warf sie in eine Ecke, wo sie wahrscheinlich immer noch lag. Der Alte war danach in die Küche gestiefelt und hatte die Ungeheuerlichkeit seiner Frau berichten wollen. »Laß die Kinder spielen«, hatte sie geantwortet und die Schürze über ihrem Schoß glattgestrichen. Da wußte er, daß ihm die Macht über seine Kinder genommen war, und er gab es auf, sich auf dem Hof nützlich zu machen. Dafür begann er mit dem Dengeln, das keinem nützte. Jetzt wußte er, was allsonntäglich auf dem Ohler geschah, wenn Leo, kaum dem Bett entstiegen, in der Waschküche unter dem Waschkessel Feuer machte und später das heiße Wasser eimerweise über drei Treppen bis auf den Ohler schleppte, von wo bald das laute Lachen der Geschwister erklang, bis sich das Schmutzwasser aus dem Ohlerfenster in die Brennesselwildnis hinterm Haus ergoß und er hörte, wie die leere Wanne an die Ohlerwand gerückt wurde.
Vielleicht erinnerte er sich dann der Gedanken, die ihn als Jungen beim Anblick seiner Schwester Margarethe bestürmt hatten. Aber er hatte noch eben rechtzeitig Gertrud Sutter aus Sierspe kennengelernt, sie mit auf die Haen geschleppt und geheiratet, vier Monate bevor Leo geboren wurde. Seine Schwester Margarethe verkuppelte er erfolgreich an den Postboten Palmen aus Zieghain, der einmal im Monat mit seinem Fahrrad auf der Haen erschien, um den Beitrag für die Feuerversicherung einzuziehen. Er sah sie ebensowenig wieder wie seine Brüder Wilhelm und Heinrich. Wilhelm fiel im Ersten Weltkrieg an der Somme, Heinrich blieb als Maurer in Remscheid. Wer die Haen verließ, kehrte nicht zurück.
Als Gertrud auf den Hof kam, war sein Vater längst an Schwindsucht gestorben. Aber seine Mutter lebte noch, Pampus’ Settchen. Blind, schwergewichtig und mit von Wasser aufgequollenen Beinen lag sie in ihrem Bett in der Dachkammer, stieß, wann immer es ihr paßte, ihren Krückstock auf die Fußbodendielen und drangsalierte die Familie bis zu ihrem Tod.
Da war Leo drei, und seine Häßlichkeit zeichnete sich schon ab. Das lag nicht nur an seiner gedrungenen Gestalt und seinem breiten, teigigen Gesicht, sondern mehr noch an seiner absonderlichen Blondheit, die ihm fast das Aussehen eines Albinos gab. Sein Haar, die Wimpern und Augenbrauen waren beinah farblos, sein Körper war wie mit Mehl bestäubt, so daß sich jeder Pickel auf ihm ausnahm wie ein Brandmal. Sanne, seine um fünf Jahre jüngere Schwester, wirkte gegen ihn wie eine Schönheit. Sie hatte die ebenmäßigen Züge ihrer Mutter, und ihr Haar war nicht so hell wie das ihres Bruders, aber es sah dennoch so aus, als verwende sie dafür ein Bleichmittel. Das lag in der Familie und machte sie, verglichen mit den übrigen Bewohnern des Landstrichs, zu etwas Besonderem.
Doch sie kamen ja kaum aus der Haen heraus; sie lebten dort wie in einer himmelsüberspannten Gruft schon zu Lebzeiten, ohne Fernsehen, wenn auch mit Telefon und einem Radio ausgestattet, das sie mit Nachrichten versorgte und den beiden Alten sonntags den Gottesdienst übertrug, abgekapselt vom übrigen Leben, beschickt lediglich mit den katalogisierten Segnungen der Häuser Quelle und Neckermann, aus denen sich allein Sanne bedienen durfte. Sichtbar für die anderen wurden sie an den Sonntagen, wenn Sanne und Leo nach Schmalkotten kamen, um den protestantischen Gottesdienst im Gemeindehaus zu besuchen.
Dort saßen sie nebeneinander wie Mann und Frau in ihrer auffallenden Blondheit: Leo breit, wuchtig und pickelgesichtig, in knappsitzender Sonntagskleidung; Sanne herausgeputzt wie für den Besuch einer Cocktailparty, behängt mit allem, was Quelle und Neckermann an modischen Neuheiten zu bieten hatten, das blonde Haar toupiert und frisiert wie von Zauberhand, was sie indes neben ihrer eigenen Fertigkeit in diesen Dingen der Frisierhaube verdankte, die Leo ihr zum Geburtstag geschenkt hatte. So saßen sie dort und machten den Mund nicht auf für ein Gebet oder Lied.
Schmalkotten, wenn auch drei Kilometer entfernt und durch den Galgenberg von ihnen getrennt, war für die Haener, selbst jetzt, zu Beginn der siebziger Jahre, immer noch der letzte Außenposten einer fernen, fremden Welt. Dort gab es den Lebensmittelladen der Witwe Schnier und Schilds Bullenstation, Marenbachs Bäckerei und die Volksschule, Otto Romünders Dreschmaschine und das Haus des Försters Schurichkeit; außerdem Hausers Kneipe. Aber in sie setzten sie nie einen Fuß, obwohl doch Philipp Hauser, der Gastwirtssohn, der einzige gewesen war, den man einmal einen Freund der Familie hätte nennen können, solange er regelmäßig auf der Haen erschien, um zu schlachten und zu wursten. Außerdem war er es gewesen, der Leo nicht nur die achtkalibrige Steyr-Mannlicher, sondern auch die Verbindung zu Pietsch beschafft hatte. Doch das war vorbei.
Es hatte aufgehört, nachdem Leo dahintergekommen war, daß Fip Hauser seiner Schwester nachstellte, ihr an der Tränke auflauerte. Leo hatte sich das eine Zeitlang angesehen, eines Tages hatte er das Gewehr aus dem Versteck auf dem Abtritt geholt und war gleichzeitig mit Fip am Treffpunkt aufgetaucht. Dann hatte er nur noch ein Wort zu sagen brauchen, um den Kampf für sich zu entscheiden. Für Fip war es der Beweis, daß die Gerüchte stimmten, die über Sanne und Leo in Umlauf waren. Danach dauerte es nicht lange, bis er Lis Schnier, die kurzsichtige und von Diabetes aufgedunsene Tochter der Lebensmittelhändlerin, heiratete. Mit ihr hatte er inzwischen zwei Kinder. Neben der Gastwirtschaft hatte er nun auch eine Gärtnerei aufgemacht. In zwei Gewächshäusern in der sumpfigen Bachniederung hinter dem Kneipenanbau zog er Topfblumen, Alpenveilchen hauptsächlich, die er auf den Märkten der Umgebung anbot. Mit der Gastwirtschaft hatte er nicht viel im Sinn; er verkaufte den wenigen Bauern, die seine Schänke besuchten, Bier und Schnaps mit der gleichen Lustlosigkeit, die schon seinen Vater berühmt gemacht hatte; vorausgesetzt, er war überhaupt da und die Kneipe war geöffnet.
Mit Sanne und Leo war das passiert, als sie eben siebzehn geworden war: ein warmer Sommersonntagmorgen, als sie sich beide anschickten, zum Gottesdienst nach Schmalkotten zu fahren und sie noch vor dem Spiegel in ihrer Kammer stand, um ihren nackten Körper zu betrachten. Da war er hinter sie getreten und hatte seine Hände auf ihre Brüste gelegt, und sie hatte zu lachen angefangen. Sie hatten dann trotzdem noch den Gottesdienst besucht, wie später auch, wenn sie ihr Baderitual feierten. Sämtliche Versuche des Vaters, Leo für eine andere Frau zu interessieren, schlugen fehl. Wahrscheinlich schon allein deshalb, weil es Leo einfach lächerlich erschien, sich länger als unbedingt notwendig in Schmalkotten oder wo auch immer aufzuhalten, nur um dabei vielleicht eine Frau kennenzulernen, die ihn hätte heiraten mögen. Er kannte sie ja alle, die der Heiratsmarkt der Gegend für ihn noch bereithielt, und verglichen mit Sanne hatten sie überhaupt keine Chance.
Aber diese Aufregungen lagen hinter ihnen, als Leo am Abend jenes Tages im September die beiden Ricken auf die Ladefläche seines Lieferwagens schmiß und über die kaum benutzte Alte Straße nach Heiligsmühl hinunterfuhr, um in Kurt Ziemes’ Kneipe Pietsch zu treffen.
Der unterhielt in dem alten Fachwerkbau mit steiler Außentreppe und einem kleinen Saalanbau, in dem mitunter die Tanzveranstaltungen der Dorfjugend stattfanden, eine Art Hauptquartier, von wo aus er die Fäden für seine undurchsichtigen Geschäfte zog, und das schon seit den Schwarzmarktzeiten vor nunmehr dreiundzwanzig Jahren. Er war jetzt fünfundfünfzig und bewohnte immer noch jenes Dachzimmer in Ziemes’ Schänke mit nicht mehr an Mobiliar als Bett, Tisch, Schrank und zwei Stühlen, auf das er sich zurückzog, wann immer ihn Müdigkeit befiel oder eine andere Art von Ruhebedürfnis.
Pietsch saß wie üblich um diese Tageszeit an seinem Tisch: einem runden Tisch, wie ihn sich Stammtischfreunde aussuchen oder Skatrunden. Er hatte die Zigarre zwischen seine Lippen geklemmt, so daß sie sich nach außen stülpten und ihm einen leisen Anflug von Sinnlichkeit gaben. Ansonsten nämlich waren sie schmal und verkniffen, wie alles an ihm schmal und verkniffen erschien: die schmalrückige Nase und die von halbgesenkten Lidern beschatteten grauen Augen, der fast kahle schmale Schädel: der Typ eines Halbweltganoven aus einem drittklassigen Film, nicht eben der eines Vieh- und Futtermittelhändlers, als der er sich ausgab.
Und ihm saß Leo Pampus gegenüber, Bless, wie er seiner Blondheit wegen gerufen wurde von Leuten, die ihn kannten (nicht aber von Sanne oder den beiden Alten), saß ihm gegenüber in seiner ausgebeulten, schmutzstarrenden Hose, den verkrusteten Gummistiefeln, dem schwitzig-verfilzten Pullover und mit der speckigen alten Militärmütze auf dem Kopf: ein unbeholfener Hinterwäldler.
So wurde er auch eingeschätzt. Nicht von Pietsch, der wußte, was er an ihm hatte, aber von all den anderen Typen, die in der Kneipe herumlümmelten und auf ein Stichwort von Pietsch warteten: Das konnte ebenso der Ruf nach einem frischen Glas Bier oder nach einer Zigarre sein wie der Befehl, das Moped zu nehmen und irgendwohin zu fahren, um dort etwas abzuholen, entgegenzunehmen, das keine Bezahlung verlangte und wofür sie dann ein anerkennendes Wort aus dem Mund des Meisters erwarten durften oder ein Glas Bier oder eine Zigarre oder auch einen Hunderter, wenn der Auftrag entsprechend gewesen war.
»Hallo, Bless«, hatte Pietsch gesagt, »komm, setz dich her!« Und dort saß er nun zwischen ihnen wie auf Besuch bei der Tante in der Großstadt, und niemand hätte zu sagen gewußt, ob er den Stuhl tatsächlich berührte oder nicht.
»Du kommst bestimmt wegen ’nem Auftrag«, sagte Pietsch, und Leo nickte. »Is’ aber nix mehr drin für dich«, fuhr Pietsch ungerührt fort. »Is’ zu Ende mit dem Geschäft. Gibt zu viele, die jetzt ganz legal die Viecher abknallen un’ anbieten bei der Kundschaft. Keine Preise mehr zu machen. Verstehste?«
»Nee«, sagte Leo.
»Dann eben nich’«, und Leo war entlassen und war sein Zubrot los, und alles begann sich von diesem Zeitpunkt an zu verändern.
Diesmal benutzte er den kürzeren Weg über Schmalkotten und war in weniger als einer halben Stunde auf der Haen. Sanne, die eben die Tiere von der Weide geholt und im Stall angekettet hatte, stand unter der Tür des Wohnhauses und sah ihn kommen, wie er den Karrenweg mit dem Lieferwagen heruntergebraust kam, als sei jemand hinter ihm her. Die Reifen knirschten und schlingerten im Morast, als er in den Wirtschaftshof einbog.
Er stieg aus und warf die Wagentür zu. Sanne war sofort bei ihm, hängte sich an seinen wildschlenkernden Arm, so daß er zur Ruhe kam. »Was is’?«
»Mach den Deckel auf!« sagte er und löste ihre Hand von seinem Arm. »Den Deckel von was?« fragte sie. Sie standen sich gegenüber wie Kämpfer, und sie nahm den Geruch wahr, der seinen Kleidern entströmte: ein Gemisch von Schweiß, Holz, Jauche und Nässe, ein schlimmer Geruch, aber sie kannte ihn seit fünfundzwanzig Jahren.
»Vom Brühloch, von was denn sonst«, hatte er geantwortet und war auf die Mistemauer zugegangen, um sich schwer atmend dagegenzulehnen. Sanne nahm den Buchenstecken und schob ihn durch den Eisenring des Betondeckels, der die Jauchegrube verschloß. Ein Ruck, und der Deckel wuchtete hoch und polterte zu Boden. Ein Gestank wie direkt aus der Hölle fuhr sie an, und sie trat einen Schritt zurück, lehnte sich nun auch an die Mistemauer, ein Bein angewinkelt gegen die Mauer gestemmt, die Hände unter der blaubunten Schürze verschränkt. Es war nicht mehr sehr warm. September und neblig, und den ganzen Tag über hatte es genieselt, während Leo Jauche aufs obere Feld gefahren hatte.
Leo stieß sich von der Mauer ab und bewegte sich mit unsicheren Schritten auf den Lieferwagen zu. Sanne beobachtete ihn unausgesetzt, wie er die Plane löste, sie über die Aufbauten schmiß und sich tief in den Laderaum hineinbeugte. Als er wieder zum Vorschein kam, trug er das Reh bei den vier Beinen. Der spitze Kopf mit der weit heraushängenden Zunge baumelte überm schlammigen Hofboden. Der Hund gebärdete sich wie wild, und Leo mußte nach ihm treten. Der kannte den Geruch und war verrückt danach; ein Rüde, der sogar auf Wildschweine ging, ein Säushund also. Leo nahm ihn häufig mit, wenn er im Wald zu tun hatte. Falls er nicht aufpaßte und den Hund nicht kurz an der Leine hielt, jagte er davon, angelockt von der Witterung. Leo hatte den Kadaver in die Grube geworfen und danach die zweite Ricke geholt. Hinterher wuchtete er den Betondeckel herum und schob ihn mit dem Fuß in die Lagerung zurück, wo er liegenblieb und den Gestank dämmte.
Sie sah ihn an. »Ein Paar Schuh zum Teufel. Un’ jetzt?«
»Schluß«, sagte er. »Aus un’ vorbei. Von Pietsch gibt’s keinen Heller mehr.«
»Un’ was wird nun aus den Schuhen, die du mir versprochen hast?«
»Morgen«, sagte er. »Wart bis morgen!« Er war schon wieder auf dem Weg zum Wagen; die hereinbrechende Dunkelheit verschluckte ihn fast.
»Noch mal weg?« rief sie hinter ihm her.
»Muß Hausers Fip sprechen«, antwortete er.
Das verschlug ihr die Sprache, und sie unterließ es, weitere Fragen zu stellen. Statt dessen sah sie zu, wie er in den Wagen stieg, ihn wendete und mit aufgeblendeten Scheinwerfern davonfuhr.
Die Idee mußte ihm unterwegs gekommen sein. Fip war tatsächlich der einzige, der ihm vielleicht helfen würde.
Und so betrat er etwas später Hausers Kneipe erstmals seit Jahren und sah sich Fip gegenüber. Dessen Überraschung währte nicht länger als einen Flügelschlag. »’n Bier?« fragte er. Leo nickte und schaute sich um: Auf dem Ausschank thronte immer noch der Landsknecht mit angesetzter Trompete, die Dielenbreiter knarrten wie früher bei jedem Schritt, und von der niedrigen Decke hing einer dieser altmodischen Fliegenfänger. Als Schüler der einklassigen Schmalkottener Volksschule war Leo oft hier gewesen, hatte eine Limonade getrunken, bevor er sich auf den einstündigen Fußmarsch zur Haen hinauf machte; später dann nicht mehr.
Für Bier mochte er kein Geld ausgeben. Das trug er lieber in Schniers Malchens Laden, um ein Mitbringsel für Sanne zu erstehen, Modeschmuck oder ähnlichen Krimskrams, über den sie sich freute. Wenn bei Pietsch Zahltag war, mußte er hin und wieder notgedrungen ein Bier in Kurt Ziemes’ Kneipe bestellen, aber mehr als eines hatte er noch nie auf eigene Rechnung getrunken, mehr würde er auch heute nicht trinken.
Das Bier stand inzwischen tropfend auf der Chromplatte der Theke; Fip hatte seine biernassen Hände teilnahmslos auf den Thekenwulst gelegt und sah mit ausdruckslosem Gesicht an Leo vorbei, der ihn zu fixieren versuchte. An Fips Gesicht fielen lediglich die abstehenden Ohren auf, sie wirkten, als habe man sie zunächst vergessen und erst nachträglich an den Kopf gepappt, dabei aber versehentlich die falschen erwischt.
»Schon mit dem Brühfahren angefangen?« fragte Fip schließlich, denn Leos Geruch würde auch ihm zusetzen. Er grinste mit einem Mund, wie ihn Kinder einem Mondgesicht zeichnen. Da grinste Leo zurück und nickte. Aber sein Grinsen hatte nichts von einem Kindermond. Es sah aus, als habe er vergessen, wie man’s macht.
»War eben bei Pietsch«, sagte er rasch.
Fips Gesicht erstarrte. »Damit will ich nichts mehr zu schaffen haben«, sagte er heftig. Er deutete mit der Hand nach dem Fenster in seinem Rücken, in dem nun die Nacht hing, beleuchtet vom Widerschein der Kugellampe über der Theke. »Kannste das sehen?«
Leo kniff die Augen zusammen, aber er sah nichts außer der spiegelglatten Glasfläche. Und doch wußte er, was Fip meinte, denn wie alle Welt wußte auch er, daß Fip sich von Pietsch und dessen Geschäften zurückgezogen hatte, seit er mit Lis verheiratet war und die beiden Gewächshäuser hinters Haus gesetzt hatte.
»Ich weiß«, sagte Leo.
»Weshalb also bist du hier?« fragte Fip.
»Weil nix mehr läuft.«
Fip grinste abermals. »Ist die Jagd zu Ende?«
»Richtig«, sagte Leo. »Un’ da dacht ich, du hättst ’ne Idee. So was wie das da draußen«, und er wies nun auch auf das Fenster und meinte das andere, was dahinter unsichtbar errichtet stand und so etwas wie Unabhängigkeit verkörperte. »Natürlich keine Alpenveilchen«, fügte er hinzu.
»Natürlich nich’«, sagte Fip, und nach einer Pause: »Was macht Sanne?«
»Gut«, sagte Leo. Von seinem Gesicht war keine Regung abzulesen.
»Naja, man interessiert sich schließlich, wie’s weitergeht mit euch. Ihr werdet ja wissen, was auf euch zukommt.«
»Nee«, sagte Leo, und man sah, daß er aufhorchte.
»Bundeswehr. Sag bloß, ihr wißt von nichts.« Fip wies auf Leos Glas. »Das Bier wird schal.«
Leo hob das Glas an den Mund; sein Adamsapfel an dem weißen pickligen Hals hüpfte auf und nieder, während er trank. Als er das Glas absetzte, blieb an seiner Oberlippe ein Schaumrest zurück. Er schüttelte den Kopf. »Wenn ich’s dir sage«, sagte er.
»Ihr liegt doch mit eurem Land gleich hinterm Staatsforst?« Leo nickte. »Wär’ das denn nichts?«
»Verkaufen?« fragte Leo. Jetzt nickte Fip.
ZWEI
Es dauerte allerdings bis Dezember, ehe sich zeigte, was Leo Monate zuvor in der Kreisstadt erledigt hatte. Es war kalt, die Erde gefroren, Raubreif lag auf den Ackerschollen und den Feldern mit der Wintersaat. Das Vieh war schon im Stall, in den nackten Bäumen am Waldrand hockten die Krähen und zerhackten die Stille mit ihrem Gekrächz. Das waren schlimme Tage auf der Haen, wenn dort das Leben stillzustehen schien, die Mutter mit leerem Blick auf dem Holzkasten saß und ihren verworrenen Gedanken nachhing, der Alte auch aufs Dengeln keine Lust hatte und das Radio ausgeschaltet bleiben mußte, weil die Mutter das Gedudel nicht ertrug. Dann war Sanne allein mit dem Wunsch, weit fort zu sein und endlich unbelacht all die Kleider tragen zu dürfen, die aus den Katalogen der Versandhäuser den Weg in ihren Schrank gefunden hatten.
Es war einer dieser Tage auf der Haen, wo rein gar nichts passierte. Sanne stand am Herd und rührte in der Zoppe aus eingelegten grünen Bohnen, Kartoffeln und gepökeltem Schweinefleisch, die sie dann später aus ihren Tellern schlürfen würden, die Arme auf dem Tisch aufgestützt, nachdem sie Komm, Herr Jesus, und sei unser Gast heruntergebetet hatten.
Die Mutter war es, die den Wagen als erste sah. »Da kommt ein Auto«, sagte sie plötzlich in die Stille hinein. Sanne legte den Holzlöffel auf den Topfrand und trat ans Fenster; aber da war der Wagen schon hinter der Scheune verschwunden. Sie mußte warten, bis er am anderen Ende wieder auftauchte, winzig klein noch, und sich langsam auf dem Feldweg oben am Waldrand vorwärtsschob, über Geröll, Gestein und aufgeworfenen und zu Klumpen gefrorenen Boden. Dann bog der Wagen in den Weg ein, der von oben schnurstracks auf den Hof zuführte. Sie sah das Auto größer werden und Form annehmen: ein Mercedes, in dem vier Leute saßen.
In dem Moment platzte auch der Alte mit der Nachricht herein, und Sanne sagte über die Schulter: »Wissen wir schon.« Da hielt der Wagen bereits auf dem Wirtschaftshof. Sie sah Leo hinzutreten. Der Hund hatte schon zu blochen angefangen und sprang um Leo, herum. Als der ihm einen Klaps auf die Schnauze gab, hörte er damit auf. An dem Kennzeichen erkannte Sanne, daß es ein fremder Wagen war.
»Sieht aus wie vom Amt«, sagte der Alte. Sie standen alle am Fenster und lugten hinaus, wie nicht nur sie es sich angewöhnt hatte, wenn es draußen etwas zu sehen gab, zu dem sie nicht ausdrücklich hinzugebeten worden war.
»Sitzt da nicht ein Soldat drin?« fragte die Mutter und überraschte Sanne ein weiteres Mal, da die Mutter doch sonst kaum noch etwas von dem begriff, was um sie her geschah. Denn es war tatsächlich ein Soldat, der im Wagen sitzen blieb, während die drei Zivilisten ausstiegen und mit Leo zu reden anfingen. In ihren Händen trugen sie schwarz glänzende Köfferchen. Der Hund schlich von einem zum anderen und beschnupperte ihre Hosenbeine, bis Leo »Aff!« rief. Da setzte er sich auf die Hinterbeine und ließ sie nicht aus den Augen. Als die Vierergruppe in Richtung Stall ging, trottete er langsam hinterher.
Dann stand nur noch das Auto da, und drinnen saß der Soldat. Er hatte eine olivfarbene Uniform an und ein Schiffchen auf dem Kopf. Sanne sah, daß er dunkelhaarig war und ein kleines Bärtchen auf der Oberlippe hatte. Das Wagenfenster hatte er trotz der Kälte heruntergekurbelt; er rauchte eine Zigarette und schnippte ab und zu die Asche aus dem Fenster. Nach einer Weile lehnte er den Kopf gegen die Kopfstütze und schloß die Augen. Die Zigarette behielt er im Mund, sein Schiffchen war ihm auf die Nasenwurzel gerutscht.
»Paßt mal auf die Zoppe auf«, sagte Sanne, ging zum Kleiderreck, nahm das große Wolltuch, schlang es sich um Kopf und Rücken und ging nach draußen. Sie hatte Gummistiefel an den Füßen, vielleicht hörte er deshalb ihre Schritte nicht; denn auch als sie schon sehr nahe heran war, hielt er die Augen geschlossen.
Er war weit jünger als sie, achtzehn vielleicht. Sie schniefte laut, und er öffnete die Augen. »Hallo«, sagte er, ohne die Zigarette aus dem Mund zu nehmen. Er richtete sich auf, seine Hand schob das Schiffchen über die Augenbrauen zurück.
»Tag«, antwortete sie.
»Was machen Sie denn hier?« fragte er. »Wohnen Sie etwa hier?« Sie nickte.
»So weit weg?«
»Weit weg von was?« fragte sie und bemühte sich, ein wenig wie ihre Mutter zu reden, die sich seit ihrem Schock eine etwas affektierte Sprechweise angewöhnt hatte. Der Junge war nicht von hier, wie Sanne heraushörte.
»Nun ja, da haben Sie nicht ganz unrecht. Es kommt immer drauf an, ob man was vermißt. Ist es nicht so?«
»Sicher«, sagte sie und stemmte einen Gummistiefel gegen die Radkappe.
»Und Sie haben wohl alles, was Sie hier brauchen, kann ich mir denken.«
»So’n Mercedes wie Ihrer, der würd’ mir noch fehlen.«
Er lachte kurz auf, nahm die Zigarette aus dem Mund und warf sie durchs Fenster zu Boden. Dort blieb sie eine Weile qualmend liegen, ehe sie aufzischte und verlosch. »Ist ja auch nicht meiner«, sagte er. »Gehört dem Bund. Wollen Sie ihn mal von innen sehen?«
»Sicher«, sagte sie.
Er öffnete den Wagenschlag, rutschte auf den Mitfahrersitz und ließ sie hinters Lenkrad. »Bitte«, sagte er, griff über Sanne hinweg nach der Tür, zog sie zu und kurbelte das Fenster hoch. »Lausig kalt draußen.« Sie lächelten sich an. Das Tuch war ihr vom Kopf gerutscht, und das Haar lag ihr hell auf den Schultern. Mit beiden Händen packte sie das Lenkrad. Ihre Gummistiefelfüße standen platt auf dem Bodenbelag.
»Mit dem Lenken würde es schon klappen«, meinte er.
»Was woll’n eigentlich all die Leut’ von uns?« fragte sie und machte eine deutende Kopfbewegung, während sie wie starr durch die Windschutzscheibe schaute. Vor ihr lag die breite Öffnung zwischen Wohnhaus und Scheune mit dem jetzt kahlen Walnußbaum in der Mitte, dahinter die bereiften Felder und der Wald, der sich dunkelgrün den Ommerberg hinaufschob. Weiter weg konnte sie die Umrisse des Hohen Tännchens erkennen, der höchsten Erhebung in der Haen, fast vierhundert Meter hoch. Oben gab es einen Aussichtsturm; mit der Schule war sie einmal dort gewesen, und der Lehrer hatte ihnen ihre Heimat gezeigt. Viel war es nicht, was sie zu sehen bekamen; Sanne kannte das alles schon zur Genüge: Wald und Berge, Wege, ganz vereinzelt ein paar zusammengeschobene Hausdächer, das waren die wenigen Dörfer, die es hier gab. Eine einsame Gegend, die Haen. Von dort oben sah man es deutlich, wenn man es nicht schon vorher wußte.
»Ich weiß auch nichts Genaues«, sagte der Soldat. »Irgendwas wollen sie hier besichtigen. Es kommt ja bald eine Einheit hierher. Raketen, habe ich gehört. Vielleicht will der Bund das alles kaufen.«
»Unsern Hoff?« entfuhr es ihr. Sie nahm die Hände vom Lenkrad und sah ihn an: ein junges, immer noch lächelndes Gesicht mit dem Bärtchen und zwei seltsam hellbraunen Augen. Jetzt wußte sie endlich, was Leo vorhatte.
»Warum nich’?« sagte der Soldat.
»Richtig«, sie blickte von ihm weg, »warum eigentlich nich’?« Die Hände hob sie wieder aufs Lenkrad. »Wär’ nich’ schade drum.«
In dem Auto roch es angenehm nach Leder und ein wenig auch nach Sprit. Den Spritgeruch mochte sie, Leos Klapperkiste stank stark danach; sie mochte ihn beinahe ebenso gern wie den Teergeruch, der zu ihnen herabwehte, wenn der Schotterweg nach Eibach ausgebessert wurde.
»Was is’ das da eigentlich?« fragte sie und tastete mit den Füßen über die Pedale.
Er sah kurz hin. »Ach, das? Wissen Sie’s nicht? Können Sie etwa nicht Auto fahren?« Sie schüttelte den Kopf, ihr Haar löste sich allmählich aus den Spangen. »Das sind Gas, Bremse und Kupplung. Braucht man alles, um das Ding von der Stelle zu kriegen, verstehen Sie?«
»Sind aber drei. Un’ ich hab’ nur zwei Füße.«





























