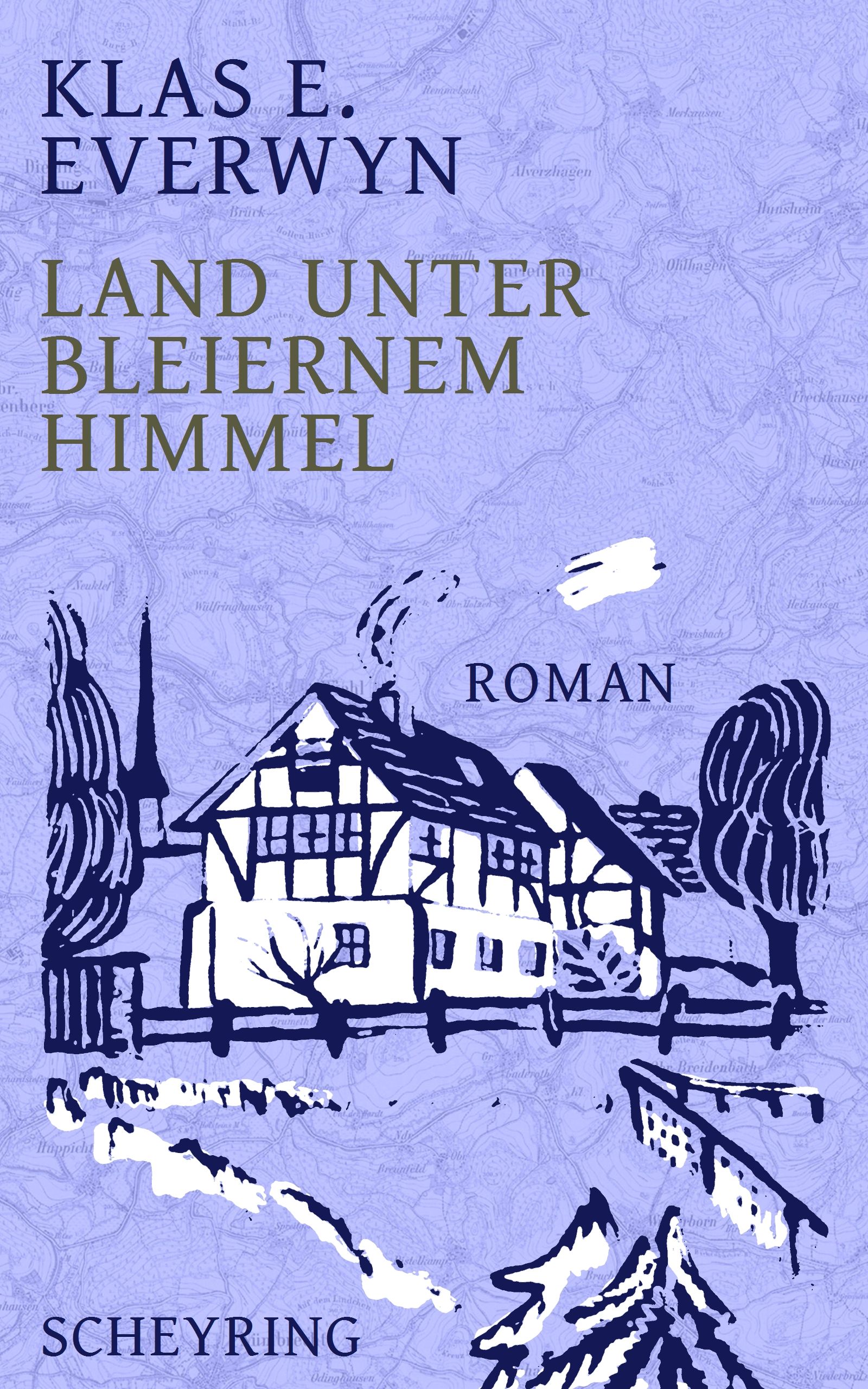2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Scheyring Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
40 Jahre »Störfall«. Was Ende 1979 als Auftragsarbeit für den Literaturpreis der Stadt Dormagen begann, mündete letztlich 1983 in einen kleinen bundesweiten Aufreger.
Ein Störfall in der Chemiefabrik gerät mehr und mehr außer Kontrolle. Während die Bevölkerung in alle Richtungen flieht, nehmen die Rentner Jüsten und Gehrmann den Kampf gegen die drohende Katastrophe auf. (VLB-126)
Diese Ausgabe des »Störfall« entspricht der nach einem gerichtlichen Vergleich genehmigten Druckfassung vom April 1983 und enthält als Anhang eine zeitgenössische Nachbetrachtung des Autors mit vielen Hintergrundinformationen zur Entstehungsgeschichte des Werkes.
Pressestimmen
»Horror-Szenario«
Der Spiegel 14/83
»ätzende Prosa«
Die Welt
»Die Angst der Bayer AG vor der Macht des Orakels. Der Chemiekonzern und die Sprengkraft des Rentners Jüsten: Ein literarischer Störfall …«
Frankfurter Rundschau
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 162
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Vergleich
1. Der Antragsgegner bringt auf der inneren Titelseite oder dem Frontblatt des Druckwerks „Der Dormagener Störfall 1996“ folgende Erklärung an:
„Mit diesem Buch habe ich mein Unbehagen gegenüber der Chemie ausdrücken wollen. Da es sich um ein Auftragswerk der Stadt Dormagen handelt, war es für mich zwingend, das dort ansässige große Chemiewerk für meine Legende heranzuholen. Ich will weder das Werk noch seine Menschen diffamieren.
Die Wiedergabe von Vorgängen aus der Vergangenheit erhebt keinen Anspruch auf Richtigkeit und dokumentarische Genauigkeit und soll insbesondere nicht bedeuten, daß die angenommenen Störfälle von 1984 und 1996 sich zwangsläufig aus dem gegenwärtigen Stand der Produktionsabläufe entwickeln müssen.
Ich habe nach Erscheinen der ersten Auflage des Buches erkennen müssen, daß ich ohne Absicht Empfindlichkeiten der Werksangehörigen getroffen habe. Aus diesem Grund ist es mir nicht schwer gefallen, in den weiteren Auflagen den Namen „Bayer“ durch den Begriff „das Werk“ zu ersetzen.“
Auszug aus dem am 20.4.1983 vor dem Landgericht Düsseldorf zwischen der Bayer AG, Bayerwerk, 5090 Leverkusen (Antragstellerin) und dem Schriftsteller Klas Ewert Everwyn, Konkordiastr. 38a, 4000 Düsseldorf (Antragsgegner) geschlossenen Vergleich.
KLAS E. EVERWYN
DER DORMAGENERSTÖRFALL VON 1996
Eine Legende
SCHEYRING VERLAGNEUSS
Impressum
Vollständige E-Book Ausgabe
© Scheyring Verlag, Neuss 2020
© Klas E. Everwyn 1983
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Sämtliche, auch auszugsweise Verwertungen
bleiben vorbehalten.
Coverfoto: Jürgen Jester,
„G&H Raffinerie Speyer - panoramio“,
Wikimedia Commons, lizenziert unter
CreativeCommons-Lizenz by-sa-3.0-de.
Autorenfoto: Ina-Maria von Ettingshausen
ISBN 978-3-944977-12-6
www.scheyring.de
Rund um die Chemiefabrik
klagen Kaminkehrer über
Atembeschwerden, werden Schweine
mit zwei Köpfen geboren, sind
vierblättrige Kleeblätter
die Regel.
Man kann von Glück sagen,
wenn man keins findet.
Dieter Höss
Inhaltsverzeichnis
PROLOG
Unweit des Dorfes Dormagen, einer Ansammlung kleiner, sich duckender, zumeist rostrot-dunkler Häuser an der Straße, die links des Rheins auf Köln zuführt, liegt, für den Wanderer, der nur Augen für die Schönheiten der Natur hat, kaum sichtbar, die verwitternde, von Unkraut und wildem Baumbestand umwucherte Ruine einer einstigen Fabrikanlage, „das Werk“ geheißen. Dieses Werk besaß in früheren Zeiten eine Machtfülle und Bedeutung, die sich heute, zweihundert Jahre nach den Ereignissen, nur noch in seinen sichtbaren Ausmaßen zu erkennen gibt. Die Anlagen reichten einst vom Dorf Dormagen bis nach Worringen und gewannen nach Westen hin eine Ausdehnung von annähernd dreißig Quadratkilometern, berührten die Dörfer Delhoven, Straberg und Nievenheim und erfaßten das Dorf Horrem von Norden her: glanzvolles Denkmal einer Epoche und Zeugnis gewaltigen Reichtums, kaufmännischen Strebens und segensreichen, lebenserleichternden Ingenieurgeistes.
Heute hingegen ein Ort Trübsal vermittelnder Öde und Wildnis und seit einiger Zeit gegen eine geringe Gebühr zu besichtigen, die ein alter, stoppelbärtiger Mann schwielenhändig kassiert und wofür er nichts anderes unternimmt als ein windschiefes Gatter zu öffnen, durch das der Gast das gespenstisch anmutende Gelände betreten kann.
Wilde Brombeersträucher behindern den Weg des Besuchers, meterhoch, und nur hier und da gibt die üppige Flora Blicke frei auf bizarre, von gigantischen Rohrleitungen geformte Konstruktionen, verbogene Eisenteile, in den Himmel strebende Ziegeltürme, Betonwandungen, unbetretbar. Ein winziges, von Wind und Wetter zernagtes Holzhaus gleich neben dem Eingang beherbergt die wenigen Überreste einstigen Forschersinnes. Seine Besichtigung ist im Eintrittsgeld eingeschlossen, lohnt sich aber kaum. Wenn der Alte guter Laune ist, begleitet er den Gast und zeigt ihm das erhaltene Foto an der Wand des armseligen Raumes, auf dem die Fabrikanlage im Jahr 1980 abgebildet ist, sechzehn Jahre vor ihrer Zerstörung also, oder er weist auf den schmierigen Behälter, der ein paar Liter jener Flüssigkeit enthält, auf deren Basis der Betrieb überhaupt erst funktionierte: Öl. Gegen ein Trinkgeld öffnet der Alte auch den Verschluß, läßt den Gast eine schmutzig-grüne, zähflüssige Substanz sehen, die einen eigentümlichen Duft verströmt und ungenießbar ist. Weiter erhalten geblieben sind ein ölverschmierter blaufarbener Arbeitsanzug und ein verbeulter gelblicher Schutzhelm sowie Restbestände einiger weniger hier hergestellter Produkte des damaligen täglichen Bedarfs: ein Klodeckel aus sogenanntem Kunststoff und eine Handvoll Schreibgeräte, früher Kugelschreiber genannt, wie sie damals milliardenfach in aller Welt in Gebrauch waren.
Gelände und „Museum“ werden vom „Verein zur Erhaltung der Werks-Ruine“ verwaltet, einem Verein, der von Spenden lebt und der auch den schwielenhändigen Alten angestellt hat, um Neugierigen den Zutritt zum Gelände zu ermöglichen. Weit kommt man ohnehin nicht. Keine hundert Schritte weit bleibt der einstige Asphaltbelag der Straße sichtbar, wenn auch an vielen Stellen aufgeplatzt und überwuchert, bis die Straße übergeht in eine Art Trampelpfad, der geradewegs zu dem Krater führt, den jene verhängnisvolle Explosion vor annähernd zweihundert Jahren riß und die den Zustand herbeiführte, der heute zu besichtigen ist. Lange Zeit hat die Zerstörung als das Werk islamischer Terroristenkommandos gegolten. Der Islam, der eben angefangen hatte, Europa zu erobern und die Fackel des Aufruhrs auch in unsere Heimat zu tragen, schien allein über die revolutionäre Kraft und die Mittel zu verfügen, eine solche Tat zu initiieren. Nach Meinung der Experten bedurfte es dazu eines gewissen Fanatismus oder einer Art heiligen Wahns. Jedenfalls verfügte die islamische Welt seinerzeit fast ausschließlich noch über genügend Öl, um die westlichen Industrienationen mit dem Stoff zu versorgen, auf dem ihre gesamte wirtschaftliche Existenz aufgebaut zu sein schien. Die Verbindungen zwischen einheimischer Wirtschaft und dem arabisch-islamischen Raum waren daher vielfältig, und der Hinweis darauf, daß sich das Werk einst geweigert hatte, seine Belegschaft geschlossen der islamischen Glaubensgemeinschaft zuzuführen, mußte schon beachtet werden bei der Suche nach den Verantwortlichen für diese Tat. Das alles mußte für die damaligen Kenner der Szenerie mit hoher Politik zu tun haben, denn auf die Idee, in der Explosion die Tat eines Einzelnen zu sehen, wäre damals niemand gekommen. Letztlich verdankte die Stadt Dormagen ihre Existenz und ihren Reichtum ausschließlich diesem Werk. Und es war nicht irgendein Werk: sein Name allein bürgte für Verbindungen in alle Welt, und es ist nicht übertrieben, wenn gesagt wird, in Dormagen habe sich seinerzeit die Weltwirtschaft ein Stelldichein gegeben.
Das ist für uns Heutige nur schwer vorstellbar, wenn wir das Gelände betrachten, auf dem sich vor zweihundert Jahren Geschichte vollzogen haben soll, wo chromglänzende Blechkarossen die bedeutendsten Wirtschaftslenker ihrer Zeit über ebenmäßigen Asphalt bewegten, wo in von klaren Linien bestimmten, vollklimatisierten Räumen, erhellt von unzähligen Leuchtröhren, Konferenzen stattfanden, die den Lauf der Welt bewegten, wo in den Labors der technische Fortschritt und der Erfindergeist Triumphe feierten und in riesenhaften Werkshallen die Arbeiter nicht nur Arbeit und Brot fanden, sondern auch berufliche Zufriedenheit. Heute, da es hier aussieht, als sei genau dies der Punkt, wo sich die Erde in die Unterwelt öffnet angesichts eines sich nach Quadratmeilen bemessenden Kraters, angefüllt mit hochtemperiertem Wasser, auf dessen Grund Anlagen und Gebäude ruhen mögen; abgesehen von den im Unkraut versinkenden Resten, die aus dem von abgestandenen trüben Gewässern durchzogenen Boden hervorlugen, wenige übriggebliebene zinnenartige Erhebungen, denen man nicht mehr ansieht, daß von dort aus die Sirene einer nach Tausenden zählenden Arbeiterschaft die Mittagszeit und den Feierabend verkündete.
Alles gehört nun der Vergangenheit an, auf sich selbst zurückgeworfen und zurückgekehrt in die Erde, aus der das Werk einst emporstieg wie eine Verheißung. Es war auf allen Märkten der Welt zu finden gewesen, seine Leistungen auf dem Gebiet der Chemie hatten schon Geschichte gemacht, als es noch in den Anfängen steckte. Man redete von ihm als von einer Institution, die an einen Wohlstand für alle dachte, wo Arbeiter zu anerkannten Mitarbeitern wurden, das den größten Jubilar-Verein der Welt besaß, dessen Lager, Werkstätten und Ausbildungsmaßnahmen als großzügig und vorbildlich galten, dessen Produktionsbetriebe in Grün eingebettet lagen, über werkseigene Kaianlagen verfügte und bei dem das Schiff durch die Nähe des Rheins als Verkehrsträger an erster Stelle stand. Allein das Rohrbrückensystem, über das die verschiedenen Produktionsbetriebe mit Gasen oder Flüssigkeiten, Kälte, Wärme, Preßluft, Wasser, Roh- und Hilfsstoffen versorgt wurden, war 30 km lang; das Werk verfügte über eigene Kraftwerke, auf seinem Gelände befanden sich mehr als fünfhundert Gebäude. Imponierende Zahlen spiegeln die damalige Bedeutung des Werkes wider: 50 km Werksstraßen, 45 km Gleisanlagen, 74 km Kanäle, Abstellplätze für 5500 Kraftfahrzeuge, 3900 Werkswohnungen und 1300 Betten in Wohnheimen, 12000 Beschäftigte arbeiteten in 75 verschiedenen Berufen. Das Werk förderte Vereine und soziale Einrichtungen im kulturellen und im Bereich anderer Freizeitbeschäftigungen. Es gab eine Werksbücherei mit 12000 Bänden, ein Sportpark stand zur Verfügung. In gewaltigen sogenannten Krackanlagen wurden Moleküle gespalten, um Erdöl in die gewünschten Ausgangsstoffe für die chemische Industrie umzuwandeln. Salz wurde vom Niederrhein herbeigeschafft, Flüssigschwefel aus Norddeutschland, Baumwoll-Linters aus den USA. Achthundert verschiedene Rohstoffe wurden hier verarbeitet. Hergestellt wurden Insektizide, Herbizide, Fungizide, anorganische Grundchemikalien, synthetischer Kautschuk, Elektro-Isolierfolien und Chemie-Werkstoffe: Cellidor, Novodur, Levapren, Desmodur, Desmophen: Ausgangsprodukte der Polyurethan-Chemie: Endlosbänder aus Dralon, Ausgangsstoffe für Hart-, Weich- und Integralschaumstoffe, Schwefelsäure im Doppelkontaktverfahren, Teppichgarne. Die Tank- und Kesselwagen des Werks befuhren Straßen und Schienen. In einer Verbrennungsanlage wurde beladene Abluft verbrannt und nach einem Abkühlprozeß über einen 130 m hohen Kamin abgeleitet. Es gab eine Deponie für feste Abfallstoffe mit einer Müll-Lagerfläche von 320.000 qm (das waren 44 Fußballfelder). In einer „Dortmund-Brunnen“ genannten Kläranlage wurden Abwässer vollbiologisch gereinigt. Es gab kaum einen Superlativ, der nicht auf das Werk zutraf.
Übriggeblieben davon sind von Efeuranken und Kletterpflanzen überwucherte Trümmer, Dickicht aus Weißdorn und wilden Brombeeren. Orchideenartige Gewächse, dickfleischig üppige Pflanzen mit zum Teil riesenhaften, zehnfingrigen Blättern und traubenartigen Blüten vermitteln den Eindruck subtropischer Vegetation, in der es von Kriechtieren, Lurchen, Käfern wimmelt. Seerosenteiche haben sich gebildet, Tümpel mit Stechmücken und Salamandern, buntfiedrige, papageienähnliche Vögel nisten im Gesträuch, das nur mit Hilfe scharfer Haumesser zu durchdringen ist, falls man vom vorgezeichneten Weg abweicht.
Eine Apokalypse, ein Inferno: als die bei der Explosion erzeugte Druckwelle die Stadt Dormagen vernichtete, Mauern umlegte, Dämme und Deiche öffnete und Wassermassen ins Land schwemmte, als Eisen schmolz und Beton barst. Das Dorf war zu jener Zeit längst verlassen und aufgegeben, längst war den Bewohnern der Aufenthalt unerträglich geworden, es gab keine Hand mehr, die die Maschinen und Geräte des Werks hätte bedienen können. Danach gab es für lange Zeit nur noch Trümmer und einen von sprudelnden Wasserläufen durchzogenen Boden. Eine weite Wasserniederung war entstanden, die bis Neuss und Longerich reichte, und aus der nur hier und da Reste von Stallungen und Häusern ragten: der Jussenhof war verschont geblieben und das Gebäude des Bahnhofs.
Heute, mehr als zweihundert Jahre nach dem Ereignis, wissen wir mehr darüber, wissen wir, wie es zu jenem „unendlichen Störfall“ und seiner Legende gekommen ist. Dies verdanken wir der Umsicht und Aufmerksamkeit derjenigen, die hundert Jahre nach der Katastrophe als erste ihren Fuß wieder in das Dorf Dormagen setzten und dort auf die Beweise stießen. Beim Enttrümmern des Jussenhofes fanden sie nicht nur die Überreste einer männlichen Leiche (was für sich schon eine Überraschung bedeutete, da Dormagen doch als völlig geräumt gegolten hatte), sondern auch ein in einer Mauernische verwahrtes Bündel von handschriftlichen Aufzeichnungen, die es uns ermöglichen, die Geschehnisse des Jahres 1996 lückenlos zu rekonstruieren.
1
Der Mann hieß Bernhard Jüsten und war, als die Ereignisse ihren Höhepunkt erfuhren, zweiundsiebzig Jahre alt und seit mehr als zehn Jahren Rentner. Seine Frau Hermine war Jahre zuvor an einem Krebsleiden gestorben, und er bewohnte ein Reihenhaus auf dem Nicolaweg in der Nähe des Werks. Er hatte zwei Töchter, die zu jener Zeit aber bereits in anderen deutschen Gegenden lebten, verheiratet waren und Kinder hatten und mit ihrem Vater nur noch in brieflichem Kontakt standen.
Bevor Jüsten in Rente gegangen war, war er in der Verwaltung des Werks beschäftigt gewesen; zu seinen Aufgaben gehörten Lohnfestsetzungen und -auszahlungen, Tätigkeiten, die sich darin erschöpften, Eingabebelege für eine Datenverarbeitungsanlage mit entsprechenden Zeichen zu versehen. Man vermag sich heute kaum mehr vorzustellen, wie sich ein erwachsener Mensch mit einer derart nichtssagenden, unpersönlichen und monotonen Beschäftigung hat zufrieden geben können, bei denen Ergebnisse erzielt wurden, die er nicht mehr einsehen konnte. Ihm war jegliche Sicht auf das aus seiner Arbeit entstandene Produkt verwehrt.
Damals befand sich die Menschheit ohnehin in einer Art Zwischenkulturstufe, wie wir heute wissen. Das industrielle Zeitalter war dabei, seinen Geist aufzugeben. Es verlor zusehends an Sinn, immer bessere und wertvollere Produkte zu erzeugen, für die schon lange kein Bedarf mehr bestand; man produzierte nur noch um des Produzierens willen, um Wachstum zu erzielen und um Arbeitsplätze zu erhalten, als sei Arbeit an sich bereits das Maß aller Dinge.
Das Atom war gerade seiner friedlichen Nutzung zugeführt worden, aber es machte den Leuten Angst, weil sie nichts mehr von dem begriffen, was da überhaupt vorging. Ein Atom, eine Atomspaltung, was eigentlich sollte das sein für den Einzelnen, wenn die Spaltung eine Explosion unvorstellbaren Ausmaßes im Gefolge hat und Energien freisetzt, die dann wiederum zum Wohle der Menschheit eingesetzt werden sollen? Was fand da eigentlich statt? In Seveso, Lengerich, Stolberg, Dormagen, Leverkusen, Emmerich, Harrisburg, Goslar, Toronto und hinter dem Ural: mal ein chemisches Werk, mal ein Tanklastzug, mal ein ganzes Kernenergiezentrum, mal eine Müllverbrennungsanlage, mal ein einfacher Mischer, die in die Luft flogen; mal Blei, mal Radioaktivität, mal Gusathion. Kinder kamen mit Schäden zur Welt, die es vordem nicht gegeben hatte, Menschen liefen mit Blei und Quecksilber im Blut herum, Tiere krepierten auf den Weiden, brachen einfach zusammen und ließen ellenlange Zungen aus ihren toten Mäulern hängen. In der Toskana starben die Zypressen, im Schwarzwald die Fichten, in Skandinavien die Wälder schlechthin.
Und die Menschen begannen ihren Kampf gegen Windmühlenflügel. Wehrten sich mit Mistgabeln gegen Atommeiler, versuchten es mit Biochemie, gewannen Energie aus Komposthaufen, aus dem Stalldung, gar aus Heu und Stroh, bauten Windmühlen gigantischen Ausmaßes, Solarzellen setzten sie sich auf und neben ihre Häuser, Parabolspiegel, zogen aus in die Natur und weigerten sich, ihre Umwelt zu erkennen wie die Straußenvögel, wenn sie den Kopf in den Sand stecken, bauten naturgedüngte Gemüsesorten an, als wenn nicht sämtliche Luft erfüllt gewesen wäre von dem, was die Fichten im Schwarzwald sterben ließ, die Zypressen in der Toskana, die Wälder in Skandinavien. Ein Kreislauf setzte ein: die Stahlwerke in Lothringen taten’s den Schwarzwälder Fichten an, die deutschen Stahlwerke gaben’s weiter nach Skandinavien, alles mit Hilfe des Windes, der auch in Dormagen bestimmte, wohin eine Giftwolke trieb oder nicht, wer verschont blieb oder davon betroffen wurde.
Hilflosigkeit machte sich breit angesichts schwindender Ölvorkommen, angesichts eines sich verändernden Klimas, einer sich ändernden Umwelt; die Menschen reagierten mit psychischen Ausfällen, mit Aussteigen, Ausflippen auf jenes unmenschliche Computerdenken, das andere Menschen ihnen aufbürdeten; eine Art Expertokratie ergriff die Macht, es begann die Herrschaft der Experten; Abhängigkeit und Entfremdung nahmen unter den Menschen zu.
Hilflos stiegen sie ein in Tunix-Bewegungen, Alternativ-Gruppen, stellten sich um auf Müsli und Makrobiotik, als helfe ihnen das noch darüber hinweg. Manche entwarfen ein „Recht auf Faulheit“, beriefen sich dabei sogar auf Lafargue, einen Mann, der hundert Jahre zuvor ähnliches entworfen hatte, während die Gewerkschaften noch blind das „Recht auf Arbeit“ postulierten, entwarfen Banner mit der Aufschrift „Lieber krankfeiern als gesund schuften“, protestierten mit einem „Freien Wendland“ gegen die Macht eines an sich ohnmächtigen und vor den Industriemultis kapitulierenden Staates, der immer noch auf Wachstum setzte denn auf Leben, ohne darauf zu achten, daß der Mensch bereits begonnen hatte, Widerstand zu leisten und sich einer Kulturstufe näherte, die andere Verhaltensweisen erforderte als bislang üblich, Beschaulichkeit vielleicht, wie sie im Mittelalter schon einmal als hohe Tugend gegolten hatte. Man kramte den Report von Wissenschaftlern hervor, der eine Industriegesellschaft ohne Wachstum pries und im übrigen nachweisen konnte, daß Änderungen in den Verhaltensweisen in den kritischen Epochen der Menschheitsgeschichte immer ein prägendes Merkmal kultureller Entwicklung waren.
Die Arbeit, sagte man, sei krank und sie stecke in einer Krise. Das führte schließlich zu den Arbeitsverweigerungen in den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts, über deren Ursachen lange gerätselt worden ist, und die um sich griffen wie ein Buschbrand. Die Zahl der sogenannten Aussteiger nahm in beängstigender Weise zu, gleichzeitig förderte dieser Trend die weitere Automatisierung der Wirtschaft und der Bürokratie, führte zu weiterer Detailbesessenheit in der Gesetzgebung, als müsse für jedes Individuum ein eigenes Gesetz, eine eigene Verordnung geschaffen werden, weil die Gerechtigkeit auf der einen, neue Ungerechtigkeiten auf der anderen Seite ergab. Großtechnologie und Spezialistentum erbrachten zwar eine Steigerung der Wirtschaftlichkeit, eine bessere Ausnutzung der gegebenen Möglichkeiten bei der Bewältigung von Problemen, erstickten andererseits aber Engagement und Kreativität des Einzelnen.
Die Politiker begannen lauthals zu beklagen, sie vermöchten mit ihren Programmen keinen Hund mehr hinter dem Ofen hervorzulocken, die jungen Menschen verweigerten sich zusehends mehr dem Zugriff der „Macher“, reagierten mit Wegtauchen, Absacken, ließen die „Macher“ nicht mehr an sich heran. Aber es gab immer wieder Situationen, in denen auch die Spezialisten versagten, wo sie plötzlich vor „Rätseln“ standen, wo von ihnen sogar von „Wundern“ gesprochen wurde, Vokabeln sämtlich, die ihnen vorher als suspekt erschienen waren, als unakademisch. „Keiner kennt die Ursache“, schrieb eine Zeitung über eine Explosion in der Leverkusener Müllverbrennungsanlage und zitierte eine professorale Koryphäe mit dem Ausspruch: „Irgend etwas stimmte mit der Anlage nicht. Irgendwo muß eine Lücke im System der Sicherungsvorkehrungen sein.“ Unverständnis also durchaus auch bei Experten, wo dem Laien nichts anderes als seine Angst blieb.
Auch Bernhard Jüsten war „ausgestiegen“, ohne daß er den Vorgang je so dramatisch, wie es das Wort will, empfunden hätte. Er sah lediglich, daß er mit seiner Arbeit nicht mehr zurechtkam, mit den sich täglich verändernden Änderungsdiensten und Belegeingaben, mit Fehlerstreifen, Stripp-Listen, Schlüsselverzeichnissen, Kennzahlenübersichten, die ihm über Kopf und Hände wuchsen. Er glaubte, in einem Meer von Papier zu versinken; denn das einzige, was es uneingeschränkt zu geben schien, war Papier, auf dem sich dann jene inhumane Anordnungsflut abspielte, der er nicht mehr weiter folgen wollte und konnte: Gesetze, Tarife, Vereinbarungen, Anweisungen, Denkschriften, Protokolle, was alles Jüsten schon gar nicht mehr las, sondern was er zu all den anderen gesammelten Ungeheuerlichkeiten legte, die das Innere seines Schreibtisches bis zum Bersten füllten, die er sich zu ordnen weigerte, weil jede Ordnung verloren gegangen war durch immer neue Ordnungen. Ein EDV-Programm war nicht genug, es mußten neue her, die alles noch effizienter machten, also noch weniger überschaubar für die Menschen. Da legte Jüsten eines Tages den Kugelschreiber weg, mit dem er eben dabei gewesen war, die kleinen grünen Kästchen irgendeines obskuren Eingabebeleges auszufüllen, stand auf, schob den Stuhl zurück und verließ das Büro. Eine Kriegsbeschädigung aus dem letzten Krieg verhalf ihm zu einem Attest und schließlich auch zur Begründung eines Rentenantrages, und mit fünfundfünfzig Jahren trat er in den „Ruhestand“.
Da lebte Hermine, seine Frau, noch. Beide hatten sich etwas von einem gemeinsamen Lebensabend versprochen, der ihnen jetzt bevorstand: Urlaub im Schwarzwald oder in Südtirol, wo sie immer gern hingefahren waren, wo sie sich auskannten und heimisch waren bei den Leuten. Im übrigen hatten sie ihr Haus auf dem Nicolaweg, einen Garten, und in Haus und Garten hatten beide genug zu tun. Aber dann kam ein Abend im November 1979, kurz nachdem er seine erste Rentenzahlung hatte in Empfang nehmen können: