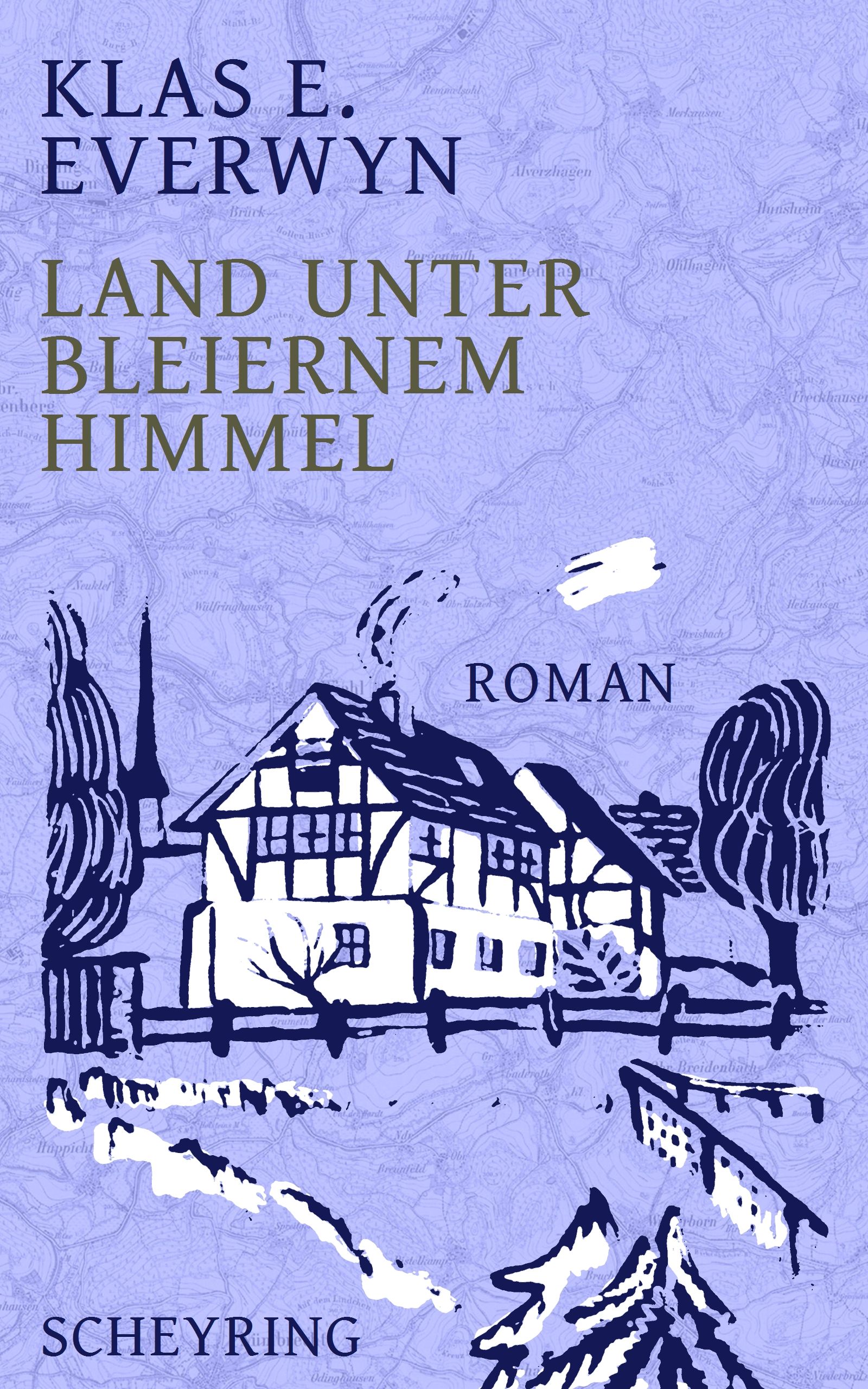2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Scheyring Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Veränderte Landschaft
- Sprache: Deutsch
Der junge Will Scherff nimmt sich fest vor, das Leben in der Barackensiedlung hinter sich zu lassen. – Debutroman von Klas E. Everwyn!
In unser unmittelbaren Nachbarschaft gibt es eine Gruppe von Menschen, die ihr Eigendasein führt: mit Schlägereien, Trinkgelagen, Hemmungslosigkeit im Austoben der Stimmungen und Bedürfnisse, mit körperlicher und seelischer Brutalität, die aber selbstbewußt und stolz ihre Gemeinschaft nach außen mit allen Mitteln zu verteidigen bereit ist. Dabei lebt auch in denKralernder Hunger nach Zärtlichkeit, die Freude am Witz, die Sehnsucht nach Komfort, sei es nur in Form eines Fernsehapparates oder einer Waschmaschine.
In realistischer, mit deftigem Humor gewürzter Darstellung bringt Everwyn köstliche, mit Liebe gezeichnete Charaktere, die sich um den jungen Will Scherff versammeln. Will, für den Glücklichsein mit dem Besitz einer eleganten Wohnung und viel Geld verbunden ist, versucht auszubrechen aus der lähmenden Umgebung und die Bande zu zerreißen, mit denen ihn die Familie und das Mädchen Maria eisern festhalten wollen. Bei seinen Zusammenstößen mit dem Vater und den Kameraden gehört ihm unsere wachsenden Anteilnahme. Ob aber schließlich die Liebe zu Maria oder alle anderen Wünsche die Oberhand behalten, beantwortet erst die letzte Szene …
Grußwort des Autors (1961)
Ich begann zu schreiben, weil mich Brauchtum, Geschichte und das Leben der Menschen um mich herum interessieren, und die Zeitungen druckten meine Aufsätze gern, denn sie fanden, ich hätte die richtige Art, den Menschen das Selbsterkennen leicht zu machen. Der Roman, Die Leute vom Kral entstand unter dem Einfluß von Faulkner, der mich begeisterte, weil seine Art meinem Wollen entgegenkam. Ich kann beteuern, daß den Personen meines Buches meine ganze Liebe gehört.
Pressestimmen
»… eine ereignisreiche Erzählung, die das drastische Talent des Autors erkennen läßt.«Sybil Gräfin Schönfeldt in der ZEIT NR. 42/1962
»Eine sehr erfreuliche Debutantenleistung. Everwyn ging es um die pralle Schilderung, und die ist ihm inklusive herber Erotizismen durchaus gelungen. In seinem flüssig und sprachlich beweglich geschriebenen Roman gefallen vor allem die milieuechten Dialoge.«Die Welt
»Der Roman spricht an durch seine Ehrlichkeit. Er ist präzis geschrieben, hart realistisch. Fast wurde hier eine Gerhard Hauptmannsche Gestalt erneuert.«Bayerischer Rundfunk
(VLB-706)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 338
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
KLAS E. EVERWYN
Die Leute vom Kral
ROMAN
SCHEYRING VERLAGNEUSS
IMPRESSUM
Vollständige E-Book Ausgabe
© Scheyring Verlag, Neuss 2020
© Marion von Schröder Verlag, Hamburg 1961
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Sämtliche, auch auszugsweise Verwertungen
bleiben vorbehalten.
Covermotiv: G. Schmachtenberg
Autorenfoto: Ina-Maria von Ettingshausen
ISBN 978-3-944977-70-6
www.scheyring.de
Für H. H. D. Everwyn, meinen Vater
INHALTSVERZEICHNIS
EINS
Auf alles hätten die Windhunde verzichten können, nur nicht auf Großvater. Nicht weil er, wie es andere Großväter zuweilen tun, ihnen Süßigkeiten zusteckte, sondern weil er ihr Spielzeug war. Gott hätte sie gar nicht schlimmer strafen können als dadurch, daß er ihnen Großvater nahm. Vielleicht war es allein darauf zurückzuführen, daß er nicht schon längst gestorben war, daß er immer noch als freundliche Zugabe aus vergangener Zeit unter uns weilte, Relikt und Ladenhüter, aber für sie (die Windhunde) ein ewig neues Spielzeug, so daß es gar nicht erforderlich gewesen wäre, ihnen zu Weihnachten eine hölzerne Eisenbahn zu schenken, denn sie fand höchstens an den ersten beiden Tagen Beachtung; es hätte weit mehr Spaß gemacht und weniger Kosten verursacht, ihnen Großvater unter den Weihnachtsbaum zu legen.
Es war dann ein Tag für Tag sich mehrmals wiederholender Vorgang, wie der Teil eines Zirkusprogramms, das keine festen Spielzeiten besaß, sondern immer nur dann einsetzte, wenn es notwendig wurde; aber mit einer Präzision im Ablauf, die auf ein langjähriges, intensives Training hindeutete, ein Training (oder besser: Proben), wie es (oder sie) jeder gute Schauspieler absolviert, um in Form zu bleiben.
Großvater war wirklich ein blendender Schauspieler, einer, der seine Rolle genau studiert hatte, keinen Souffleur benötigte und immer eine gleichbleibend gute Figur abgab: wenn er (wie es jetzt geschah, da ich von der Arbeitsstelle heimkehrte und das Moped gegen den brüchigen, vermodernden Gartenzaun lehnte) aus der Tür der Baracke trat, mit der einen Hand einen Gruß in die Luft zeichnete, der zweifellos mir galt, während sich seine andere Hand in den Hosenbund krampfte, um der Hose einen notdürftigen Halt zu verschaffen. Dann entfernte er sich auf dem Trampelpfad zwischen Baracke und Gartenwildnis, und die baumelnden, tanzenden Hosenträgerenden schlugen im wilden Rhythmus gegen seine schlurfenden Hacken: eine alles in allem schlotternde, abgewrackte Gestalt, grau und nebelhaft wie ein ausgewrungenes Spültuch; schon halb gestorben, wie er da einherzockelte in einem eilfertigen Altmännertrab, um das grüngestrichene Gehäuse an der Rückfront der Baracke zu erreichen, ehe ihn die Katastrophe ereilte. Die Katastrophe, das konnten die Windhunde ebensogut sein wie der Umstand, der ihn aus dem Sessel aufgetrieben hatte,
nachdem ihm der Schweiß auf die zerfurchte, schlaffe Stirn getreten war und nun in Bächen die unrasierten Wangen entlangrann, so daß Mutter ihn kritisch betrachtete, ehe sie ausrief: »Jetzt wird es aber Zeit für dich, du altes Stinktier!«, worauf er sich ächzend erhob, die Hosenträger losknöpfte und eilig davontrottete, um wenigstens einen gewissen Vorsprung vor den Windhunden herauszuholen.
Ich vernahm sie auch schon: ihre trippelnden, kurzen, flinken Kinderschritte und das Geheul, das sie ausstießen, und dann waren sie heran und an mir vorbei. Aber diesmal war ihnen Großvater entwischt.
Es war ein ewiger Wettlauf zwischen ihm und den Windhunden (Hansi und Werner), den er meist infolge seiner Vorgabe für sich entscheiden konnte; doch war es schon vorgekommen, daß sie ihn erwischten und sich an die wippenden Enden seiner Hosenträger klammerten, mittels deren sie ihn und sein Tempo zu zügeln versuchten, und während sich dann die beiden vor Lachen überschlugen, stieß Großvater die gröbsten Schimpfwörter aus, die ihm zu Gebote standen, bis sie die Hosenträger fahrenließen und Großvater einen Satz nach vorn machte, der ihn einmal sogar von den Beinen gerissen hatte, so daß das Unvermeidliche eintrat.
Das alles gehörte so unverbrüchlich zum Kral wie sein Ruf, wie Vlissers Schleiereule, wie Hähnscheids Ernst oder Vater, Originale oder Bestandteile dessen, dem ich tagtäglich entgegenzustreben gezwungen war, sobald ich die Arbeit auf der Baustelle beendet hatte.
Wenn ich dann den Varner Weg erreichte, waren es noch fünfhundert Meter – mit dem Moped anderthalb Minuten – bis zu dem Punkt der Landstraße, von dem aus ich den Kral würde sehen können: dort nämlich, wo die geteerte Landstraße auf dem Weg zur Kreisstadt eine weite, ausladende Rechtskurve beschreibt, wo der mit Buschwerk und Gesträuch bestandene Abhang zurückspringt, sich in einer sanften Schwingung zurückzieht und den Blick öffnet auf das tiefgelegene, bis dahin unsichtbare Tal, durch das sich der Wengertbach windet: ein bleigraues, unansehnliches, von Abwässern blindes Gewässer, eine dunkle Kerbe im Grün der Wiese, aus der die klingenspitzen Schwerter des Sumpfgrases emporschießen; kein Tal eigentlich, eine Niederung mehr, sumpfig, naßschwer und strotzend vor blendender Frische.
Vom Varner Weg aus sieht man aber vorerst nur die schwarzbraune, rußige Kuppe des Schornsteins, Wahrzeichen jenes Fabrikgebäudes, das seit drei oder mehr Jahren leerstand und in dem bis dahin aus den Abfällen der Gerberei Seife hergestellt worden war, eine Art Kernseife, der nicht mehr der Geruch der Abfallbottiche anhaftete, die in den Boden des Fabrikvorhofes einzementiert sind. An ihnen vorbei zieht sich der schmale, unebne Feldweg dahin, der am Scheitelpunkt der Landstraßenkurve abzweigt und in die Niederung hinabführt, einen Bogen um das (nun verlassene, verkommende, mit abbröckelnder Tünche überzogene) Fabrikgebäude schlägt, sich an den Bottichen vorbeischlängelt, eine Bohlenbrücke mit Stahlrohrgeländer passiert und dem Lauf des Baches, der Kerbe, folgt, bis er es erreicht: jenes in dieser Jahreszeit (Ende Mai) in der üppigen Fülle paradiesischer Buntscheckigkeit und Farbenpracht ertrinkende, sich in weißer und roter und grüner Blüten- und Blätterpracht wälzende und schmatzend sich ergehende Gebilde: den Kral.
Während ich dann in den Feldweg einbog und mit eingekuppeltem Motor den geschwungenen Abhang hinabfuhr, entzog er sich für kurze Momente meinem Blick, verbarg sich für eine geraume Zeit hinter der niederträchtigen Fassade des Fabrikgebäudes und schoß erst wieder in meinen Blickkreis, wenn ich Bohlenbrücke und Bach passiert hatte, so daß er nun etwas oberhalb jenes Weges auftauchte, der sich nach Überwindung des Baches grau und zerfurcht aus der Niederung herauszuwinden versucht und, je näher er dem Kral kommt, sich stetig verbreitert, um sich schließlich in eine spitzsteinige, mit Schlaglöchern übersäte Schotterstraße zu verwandeln. Hinter der Brücke aber beginnt die Buschhecke, die dem Lauf des Weges folgt und sich, ebenfalls breiter und breiter werdend, so daß sie bei Erreichen des Krals die Ausmaße eines Waldstreifens annimmt, zwischen Schotterstraße und Bachniederung schiebt; wahrscheinlich als Schutzwall gedacht gegen das aus der Sumpfwiese aufsteigende, sich verbreitende, tausendfach vermehrende Geschmeiß, gegen das sie aber weniger Schutzwall ist, seit die Bewohner der grüngestrichenen Baracken (die Kraler also) dazu übergegangen waren, ihren Kehricht und Unrat und vielfach auch die Notdurft der Kinder und Kranken, die es versäumten oder denen es nicht möglich war, den Abort hinter der Baracke aufzusuchen, dem Buschwerk zu übergeben. Mehr noch: Das Geschmeiß hatte längst den Sumpf, die Brutstätte seiner Urahnen verlassen und war in die Gefilde übergewechselt, aus denen es seine Nahrung bezog, seinen Unterhalt bestritt. Aber immer noch befuhr der städtische Müllwagen wöchentlich zweimal die zerpflügte Schotterstraße entlang den grünen Baracken und entlang den sich bereits türmenden braunroten Aschenhaufen, die übersät waren mit Konservendosen jeglicher Art und Farbe, mit abgenagten Knochen und undefinierbarem Geschling, Haufen von Müll und Geröll, aus denen dann und wann starke Eisenpfähle aufragten, an deren oberen Enden gelbe Schilder angebracht waren, die sämtlich die Aufschrift: Schutt abladen verboten! trugen oder wenigstens getragen hatten, bis sie von Wind und Wetter, von Luftgewehrschüssen und Messern unkenntlich gemacht waren. Aber die Müllmänner taten nicht mehr als ihre Pflicht, denn es war ihnen aufgegeben, sämtliche Straßen nach einem genauen, von der Stadtverwaltung herausgegebenen Plan zu befahren, ob da nun Müllkübel standen oder nicht. Wir hatten nie einen solchen Kübel besessen; ich hätte mir auch nicht vorstellen können, daß Vater oder Mutter oder eins der vier Gören, von Großvater ganz zu schweigen, ihn gefüllt auf die Straße schleppen würde, um ihn später leer wieder hineinzutragen.
Heute aber war Freitag, nicht nur Lohntag, sondern auch Fischtag, ein Tag, der mir mehr als alle anderen Tage der Woche das Heimkehren verleidete. Ich hatte den Geruch bereits empfunden, als ich mit dem Moped die kurze Anhöhe erreichte, auf der dann der Weg fast waagerecht auf den Kral zuläuft: den Geruch in der Pfanne brutzelnder Fischleiber und verdampfender Kartoffeln, einen Geruch, der wie eine träge Wolke über der Landschaft lag, zäh und langlebig wie alle Gerüche, die man haßt, und der nicht eher aus den Baracken, aus den Sträuchern, aus der ganzen Gegend weichen würde, bis ihm ein neuer, intensiverer Geruch folgte, ihn zerstreute und auflöste, und der dann immer noch für eine Weile, einen Tag vielleicht, in unseren Kleidern würde haftenbleiben, um sich auf Baustellen und Büros und überall dort, wo Menschen zusammenkamen, bemerkbar zu machen.
Lene und Alex (die beiden anderen Gören: zehn und vierzehn Jahre alt) würden vor dem Fernsehapparat hocken, um die Kinderstunde zu sehen, was Hansi und Werner bis jetzt ebenfalls getan haben mochten, worauf zurückzuführen war, daß Großvater die Vorgabe erhielt, die es ihm ermöglichte, das mit einem Guckloch ausgestattete Gehäuse hinter der Baracke unbehelligt zu erreichen. Aber die Jagd war noch nicht beendet, denn als ich die Diele betrat, hörte ich sie vor dem Abort herumlärmen, während der Alte sie von innen her mit Schimpfwörtern bedachte, die sie jedesmal mit lautem Geheul quittierten.
»Du liebe Zeit«, sagte ich, nachdem ich die Küchentür aufgestoßen hatte, »die beiden hetzen den Alten noch zu Tode. Kann sie denn niemand davon abhalten …«
»Still!« zischte Lene; und da sah ich sie auch schon im Dämmerlicht, das die vorgezogenen Vorhänge bewirkte, auf den Stühlen sitzen, mit angezogenen Knien und vorgeschobenen Gesichtern, gebannt auf die flimmernde Scheibe starrend, auf der ein Kinderfilm abrollte: Lene, grobknochig und spitznasig, mit wippendem Pferdeschwanz, dünnen, hohen Beinen und etwas zu langen Füßen für ein Mädchen von zehn; daneben Alex, breiter, robuster als sie, älter, nicht nur an Jahren, sondern eher an Gewohnheiten.
Mutter stand am Herd, auf dem in einer Pfanne Fisch briet. Dann und wann wendete sie ihn mittels eines Löffels um, was jedesmal ein stark zischendes Geräusch verursachte, das Lene veranlaßte, sich mißbilligend vom Fernsehschirm abzukehren und eine tadelnde Miene aufzusetzen; aber das würde Mutter des herrschenden Dämmerlichts wegen nicht sehen können, und selbst wenn, hätte sie es wohl kaum beachtet, weil auch sie auf die Scheibe starrte: ein breiter, wuchtiger Schatten von monumentalen Ausmaßen, unbeweglich und starr, als sei kein Leben in ihm, bis sie den Arm senkte, um das Fischfilet zu wenden.
Es war Tag für Tag das gleiche Bild: Dämmerlicht und flimmernde Scheibe, der Schatten des Monuments vor dem Herd, die kleinen, drahtigen Schemen auf dem Boden. Was sich änderte, war allenfalls der Essensdunst; das Bild aber änderte sich nie, seit der bräunliche Kasten in der Zimmerecke stand, es würde sich auch nie wieder ändern; es sei denn, die Radiohandlung würde genug davon haben, die Raten von Monat zu Monat zu stunden, und den Kasten mitsamt der auf dem Dach befindlichen Antenne aus der Baracke entfernen.
Ich schloß die Tür hinter mir, tastete mich an Tisch und Stühlen vorbei, war nun schon bei den kleinen Schemen, und als ich die Hand ausstreckte, sagte Alex: »Das treiben wir dir auch noch aus«, aber da hatte ich den Apparat ausgeschaltet, und ich sah, wie sich das eben noch vorhanden gewesene Bild mit rasender Schnelligkeit perspektivisch genau in das Gehäuse zu verkriechen schien; und dann endlich war die Scheibe schwarz, wie poliert, und auch die Stimme war verschwunden, war nur mehr ein kurz anhaltender brummender Ton, bis auch er verstummte.
»Immer dasselbe, wenn er heimkommt«, sagte Lene und rutschte von dem Stuhl herunter.
»Ich sage ja: auch das werden wir ihm noch austreiben.«
»Quatsch nicht«, sagte ich und faßte ihn beim Arm. »Öffne lieber die Vorhänge, öffne lieber gleich das Fenster, ehe ich hier ersticke!«
Alex riß sich los. »Von dir lasse ich mir das nicht mehr länger gefallen. Du kannst …«
»Streitet ihr schon wieder?« fragte Mutter mit müder Stimme aus der Dunkelheit. »Immer müßt ihr aber auch streiten.«
»Wenn der nicht aufhören kann …«
»Willst du wohl endlich die Vorhänge aufziehen?« rief ich.
»Du kannst mir mit deinen verdammten Vorhängen gestohlen bleiben.«
»Richtig so!« sagte Lene. »Jeden Tag muß er uns die Kinderstunde vermasseln.«
»Gott, Kinder, laßt das doch sein. Gleich kommt Vater heim, und wenn er dann den Spektakel hört, wird er ungemütlich. Ich kenne doch Vater.«
»Papa ist prima«, sagte Lene, »der vermasselt einem nie die Kinderstunde.«
Da öffnete sich die Tür, und Hansi und Werner kamen herein.
»Was?« rief Werner. »Keine Kinderstunde mehr?«
»Merkt ihr denn nicht, wer da ist?« fragte Alex.
»Hört mal, ihr zwei«, sagte ich. »Ihr solltet den Alten in Frieden lassen. Eben habe ich wieder gesehn, wie ihr ihn ums Haus gehetzt habt.«
»Aber das macht doch Spaß«, sagte Hansi. »Du kannst dir gar nicht vorstellen, welchen Spaß das macht. Wir haben ihn gar nicht gekriegt, er war schon drin, als wir hinkamen, und nun kommt er nicht mehr runter.«
»Will hat recht«, sagte die Mutter und zog einen der Vorhänge auf, so daß es in der Küche merklich heller wurde und ich die Gegenstände und Gestalten besser zu erkennen vermochte. »Das wird ihn noch umbringen.«
»Ich glaub eher, daß ihm das selber Spaß macht«, sagte Werner. »Ihr hättet mal hören sollen, was der gedonnerkeilt hat. Bestimmt, Will, das macht ihm Spaß.«
Ich setzte mich auf einen Stuhl und fragte: »Gibt’s nun bald was zu essen?«
»Lene, hole Will mal ’nen Teller«, sagte Mutter.
»Wo der uns ewig die Kinderstunde vermasselt?«
»Du sollst ihm ’nen Teller holen, hab’ ich dir gesagt!«
»Laß ihn sich doch den Teller selber kriegen«, mischte sich Alex ein.
»’nen Teller sollst du holen!« schrie Mutter, ohne sich vom Herd wegzurühren, ohne sich überhaupt merklich dabei zu bewegen.
»Nun hol doch schon ’nen Teller«, sagte Hansi.
»Immer vermasselt der einem die Kinderstunde«, schluchzte Lene auf.
»Da habt ihr den Salat«, sagte Alex. »Nun heult sie auch noch. Und warum das alles: wegen ihm, alles nur immer wegen ihm. Ich sagte ja, lange laß ich mir das …«
»Hoffentlich scherst du dich bald nach draußen!« rief ich und langte nach ihm, aber er entwischte mir, und er blieb auf der anderen Seite des Tisches stehen und sah mich feindselig an: »Du wirst’s noch früh genug merken, mit wem du es zu tun hast.«
»Ach, Kleiner«, sagte ich, »nicht mal ’n Halbstarker bist du, nie wirst du einer werden.«
»Verlaß dich drauf!« rief er und stolzierte hinaus.
»So«, sagte ich, »nun mal her mit dem Teller, Lene. Aber ein bißchen fix!«
Dann aber rief Hansi: »Da hat die Tür geknarrt!«, und wieder stoben sie davon und Großvater entgegen, und schließlich führten sie ihr Spielzeug an den Hosenträgern herein, während er, Verwünschungen sabbelnd, vorwärts stolperte. Endlich ließen sie von ihm ab, und er blieb, ausdruckslos in die Küche starrend, vor dem Tisch stehen: »Was denn, was denn? Kein Fernsehn mehr? Hat’s Will wieder ausgedreht? He, Will! Hast du’s wieder ausgedreht?«
»Nun verkrümel dich schon«, rief Mutter. »Du hältst ja mal wieder Volksreden. Mach dir lieber die Hosen zu. Es ist ja ’ne einzige Schande, wie du hier rumläufst. Wenn Scherff gleich kommt, und er sieht, daß du die Hosen offen hast, gibt’s ein Donnerwetter.«
»Verdammt, verdammt«, nuschelte der Alte und schlurfte zum Holzkasten, wohin ihm die Windhunde folgten.
Lene hatte den Teller gebracht, und Mutter kam mit dem Fisch. Ich begann zu essen, während sich in der Herdecke Großvater mit den Burschen balgte, die an seine Hosenträger zu kommen versuchten. Es war Hansi, der kleinere von beiden, der sie endlich eroberte, die Enden langzog und schnellen ließ, so daß sie gegen Großvaters mageren Körper schlugen. Als er aufheulte, war Mutter flinker, als man von ihr erwarten konnte, bei ihnen und drosch mit dem Fischlöffel auf sie ein.
Mitten im allgemeinen Gejammer und Gewühl tat sich abermals die Tür auf, und ein breiter Lichtschein schoß ins Zimmer und traf die Kämpfenden, so daß sie auseinanderfuhren und zu blinzeln begannen, weil sie genau wußten, daß es Vater war, der nun dort stand und ihnen zusah, wie sie sich bemühten, harmlos und friedfertig auszusehen.
Er betrachtete sie mit einem Ausdruck voller Hohn, Überheblichkeit und Gleichmut, einem Ausdruck, den er immer aufsetzte, wenn er Zeuge von Streitigkeiten wurde, an denen er nicht beteiligt war. Denn Vater war gefürchtet, und er wußte das, er nutzte es aus, er weidete sich daran, wie sie sich unter seinem Blick duckten, wie sie ihn bereits mit ihren Augen um Verzeihung baten, obwohl er noch kein Wort der Anklage gesprochen hatte, er überhaupt noch nicht Stellung genommen hatte. Sein Erscheinen und seine Erscheinung allein genügten, sie gefügig zu machen; und wie sehr er es liebte, dreinzuschlagen und zu sehen, wie sie, von seinen Schlägen getroffen, fielen, wie er sie niederwarf, so sehr verachtete er die Streitigkeiten anderer, auch die innerhalb seiner Familie, wohl allein deshalb, weil alle diese Streitigkeiten nicht die Qualität besaßen, die er seinen eigenen Schlägereien verlieh.
Als Vater die Tür schloß und im selben Augenblick der Lichtschein versiegte, waren die Körper entwirrt, das Gejammer eingestellt, und Mutter befand sich wieder an ihrem Platz am Herd, breit, wuchtig und wie leblos, als habe sie sich nicht vom Fleck gerührt, und Großvater versuchte mit zittrigen Fingern (vergeblich), die Hosenträger anzuknöpfen, und die Windhunde kauerten zu seinen Füßen. Ich wußte, was kommen würde.
»Ich verstehe nicht«, sagte Vater, und man merkte seiner Stimme an, daß er getrunken hatte (es war ja Lohntag), sie klang rauh und tief, und er war (nicht nur in diesem Augenblick) ein echter Kraler, »daß du so etwas zuläßt.« Er warf seine Tasche in irgendeine Ecke des Zimmers. »He!« rief er. »Dich meine ich!«
»Ich weiß«, sagte ich.
»Du weißt es mal wieder. Wie immer, weiß er es. Es ist zum Lachen, was er nicht alles weiß. Eigenartig nur, daß du nicht weißt, wie man so etwas verhindert.«
»Das überlaß ich dir, du kannst das besser.«
»So?« fragte er. »Ich kann es besser? Das ist, glaube ich, das einzige, was du mir zubilligst, besser zu können als du. Mauern kannst du ja auch besser als ich, hab’ ich mir sagen lassen. Aber immerhin, er billigt mir zu, etwas besser zu können als er. Und warum!« schrie er.
»Sohn, Sohn, Sohn!« jammerte Großvater in seiner Ecke und war immer noch damit beschäftigt, die Hosenträger anzuknöpfen.
Aber er ließ sich nicht beirren, es war aussichtslos, ihn davon abhalten zu wollen, das zu sagen, was ihm auf der Zunge lag, ihn daran zu hindern, andere in Angst und Schrecken zu versetzen, so daß sie in der Nachbarschaft nun wieder sagen würden: ›Seid mal still, ich glaub’, Scherffs Toni macht die Seinen mal wieder fertig.‹
Aber das war es ja gar nicht, das Schreien und Toben hatte er gar nicht nötig, um seine Familie zur Räson zu bringen, das benötigte er nur, um mir zu beweisen, daß er auch mir gegenüber der Herr des Hauses und der Chef der Familie war; denn er wußte genau, daß ich ihn nicht einmal haßte, daß ich überhaupt nichts für ihn empfand, weder Achtung noch Liebe, nicht einmal Furcht oder Ekel, und das nun schon seit einundzwanzig Jahren. Sieben Jahre lang hatte es so ausgesehen, als würde ich sein Einziger bleiben, aber nach sieben Jahren, während deren er bereits herausgefunden hatte, daß er mir nicht beikam, mir nie würde beikommen können, weil er wahrscheinlich den Zeitpunkt verpaßt hatte, an dem er mich hätte impfen müssen, an dem er die Furcht oder die Achtung, die Liebe oder den Ekel vor ihm mir hätte injizieren müssen, da kam Alex. Und das entschädigte ihn dafür, daß ich in seinen Händen unformbar geblieben war.
Vielleicht rührte das aber auch daher, daß ich erlebt hatte, wie leer, wie einsam und trostlos es hinter seinem Kraftmeiertum aussah, daß ich Zeuge war, als Mut und Tatkraft von ihm wichen und nichts mehr von ihm blieb als ein Bündel voller Verzweiflung und Schrecken:
Ich war damals sechs, von Alex sprach noch niemand, und es bestanden keinerlei Anzeichen dafür, daß es jemals einen Bruder namens Alex geben würde. Darum ging es an jenem Tage vor fünfzehn Jahren auch nicht. Es war, und das steht fest, einzig und allein die Schuld Onkel Wilhelms, denn von ihm hatte Vater die Jagdflinte geerbt (eine alte, fettige, Rost ansetzende Schrotflinte). Er durfte sogar noch von Glück sprechen, daß er die Flinte erhielt, genausogut hätte er das Geweih erben können, das Tante Gertrud bekam, obwohl ihn das Geweih nie in die Verlegenheit hätte bringen können, in die ihn das Gewehr brachte. Doch das konnten weder er noch gar Onkel Wilhelm ahnen, so daß Vater eine Weile stolz und glücklich darüber war; und er erklärte sich diesen Glücksumstand damit, daß er vielleicht doch bei Onkel Wilhelm, der ein Vetter von Großvater war, einen Stein im Brett hatte. Dieser Glücksumstand währte indes nicht lange, genau gesagt dauerte er bis zum Nachmittag des Tages, an dem er die Flinte von dem Testamentsvollstrecker zugeschickt erhielt.
Als Onkel Wilhelm starb (er wurde neunzig Jahre alt und war zeit seines Lebens ein Jäger gewesen; ein wilder Jäger freilich, aber einer, der mit der Büchse und mit dem Geld, das er auf irgendeine geheimnisvolle Art verdiente, umzugehen verstand), glaubten beide (Vater und Tante Gertrud), für den Rest ihrer Tage versorgt zu sein; denn Onkel Wilhelm galt als wohlhabend. Die Familie hatte auf nichts sehnlicher gewartet als auf seinen Tod, und Vater und seine Schwester gaben ihrer unverkennbaren Freude dadurch Ausdruck, daß sie zu seinem Begräbnis in einen weit entfernten Ort fuhren, nachdem die Todesanzeige eingetroffen war, um nur ja nicht den Gedanken (etwa bei mißgünstigen Bekannten oder Verwandten) aufkommen zu lassen, sie seien nicht einmal für ein ansehnliches Erbe zu einem Opfer bereit. Aber es war alles umsonst gewesen, und das erklärte ihnen der Brief, der zusammen mit der Flinte und dem Geweih durch die Post zugestellt wurde, und der von einem Anwalt aus jenem Ort stammte, den sie anläßlich des Begräbnisses aufgesucht hatten: weil nämlich von Onkel Wilhelms hinterlassenem Geld ein Fonds zur Ausbildung von Jungjägern gegründet und sein Jagdhaus zu einer Jungjägerschule ausgebaut werden sollte.
Vater saß dann in der Küche und betrachtete die auf seinen Knien liegende, noch von Packpapier und Bindfäden unordentlich umwickelte Flinte, von der ein eigentümlicher Geruch ausging, ein Geruch von Wald und nassem Holz und Laub und Schweiß, so daß ich voller Begeisterung ausrief: »Das find’ ich aber nett von Onkel Wilhelm, daß er uns die Flinte schickt.« Davon aber hatte Vater eine andere Meinung, und das hing damit zusammen, daß er seit Onkel Wilhelms Tod seine Arbeitsstelle bei der Baufirma nicht mehr aufgesucht und statt dessen ein umfangreiches Fest arrangiert hatte. Aber er begann nicht einmal zu toben, wie es seine Art war, um Enttäuschungen zu verwinden, nur seine Nasenspitze nahm eine eigentümlich farblose Glätte an, die Mutter damals in Erschrecken versetzte; aber auch die verflog, und sich auf den Schenkel schlagend, während er mit der anderen die Flinte hielt, erhob er sich und sagte: »Na denn, recht hat er, der Onkel, verdammt noch mal.« Ich wußte damals noch nicht, warum er recht gehabt haben sollte, denn ich hatte den Brief des Anwalts nicht lesen können. »Aber immerhin seine Flinte«, sagte Vater. »Es würd’ mich interessieren, was Gertrud bekommen hat.«
Tante Gertrud bewohnte zu jener Zeit noch zusammen mit Onkel Adalbert (ihrem Mann) und Großvater dessen Baracke am anderen Ende der Schotterstraße, denn ihre Ehe mit Onkel Adalbert war kinderlos geblieben, und anfangs vertrugen sich die drei recht gut mit Ausnahme der Stunden, da Onkel Adalbert betrunken nach Hause kam. Vater war in Hansens Baracke gezogen, als er Mutter heiratete, denn Mutter war Hansens einziges Kind gewesen, doch als die beiden alten Hansen kurz nacheinander starben, kamen die Geschwister überein, daß Großvater nun mit zu Vater ziehen sollte, wohl wegen der Luftveränderung oder weil Mutter weniger empfindlich war, Großvaters Hosen zu waschen.
So machte sich Vater an jenem Tage auf, um seine Schwester zu besuchen, und als er dann kurz nach Mittag zurückkehrte, war er zufrieden. »Stellt euch vor«, sagte er, »was sie bekommen hat.« Aber weder Mutter noch gar ich konnten es uns vorstellen, so daß er es selbst sagen mußte: »Ein Geweih, irgend so ein Geweih von einem Hirschen oder was es gewesen war«, und bog sich vor Lachen.
Er war deshalb ganz ruhig, als er sich am Nachmittag die Flinte griff und hinausging und, sich unter der Tür nochmals umwendend, sagte: »Mal sehn, ob das Ding wenigstens in der Lage ist, mir die Spatzen vom Leibe zu halten.« Und während er sich durch die aufgestellten Bohnenstangen wand, stahl ich mich hinter ihm her, war plötzlich neben ihm, als er die Holzbank unter dem Apfelbaum erreichte und sich darauf niederließ.
»Willst du Spatzen schießen?« fragte ich atemlos vor Spannung, aber er beachtete mich schon gar nicht mehr, beobachtete nur die Bohnenstangen und Erbsenreiser und die Luft darüber, und ich tat es ihm nach, sah auch die beiden Vögel, die vom Haus her kamen und in die Bohnen einfielen, zwitschernd und zankend, worauf ich Vater anstieß: »Da«, sagte ich, »zwei Stück.« Aber er hatte sie längst gesehen, denn er hob schon den Kolben an die Wange, doch ehe er abdrücken konnte, flogen sie schreiend wieder auf und torkelten davon.
»Hast du denn geladen?« fragte ich, diesmal ohne ihn anzusehen, denn ich beobachtete weiter, und er antwortete auch nicht einmal darauf, hielt die Flinte einfach weiter im Anschlag, so als ob er darauf wartete, daß sie zurückkämen, um dann sogleich den Schuß lösen zu können.
Und dann geschah es: Es waren nun drei oder sogar mehr Spatzen, die sich in die Bohnenranken verkrochen, und als Vater schoß, gab es einen lauten, alle anderen Geräusche übertönenden, betäubenden Knall, und wir vernahmen beide einen kurzen, spitzen Schrei, so daß wir im ersten Augenblick glaubten, einer der Vögel habe ihn in seiner Todesangst ausgestoßen; und ich lief schon, um ihn unter den Ranken zu suchen, als mich plötzlich andere Geräusche veranlaßten, stehenzubleiben und zu Vlissers Baracke hinüberzublicken, denn von dort her klangen undeutliche Laute, aufgeregte Stimmen, bis ich heraushörte, daß es Vlisser selbst war, der da fluchte und wetterte; und dazwischen das undeutliche, schrille Gewimmer einer Frau; und das konnte nur Frau Vlisser sein.
»Vater!« rief ich, aber da stand er schon neben mir und sah ebenfalls hin. Er hatte die Flinte gesenkt, schritt an mir vorüber, durch die Erdbeerstauden hindurch, ohne achtzugeben, was er zertrat, geradewegs auf den dünnen Maschendrahtzaun zu, der unsere Grundstücke voneinander trennte. »Hallo!« hörte ich ihn rufen. »Karl! He, Karl! Ist da am Ende, verdammt noch mal, was passiert?« Als dann Vlisser seine Frau ans Fenster führte und er Vater vorwies, was geschehen war, hatte ich Vater eingeholt und sah nun ebenfalls, wo die Schrotladung getroffen hatte: ihr Gesicht war wie mit Himbeersirup bekleckert, in stürzenden Bächen rann es zwischen den Händen hindurch und verfärbte Kleid und Fensterbank und Vlissers Hemd. Ich schaute dann zu Vater auf und erkannte ihn nicht mehr: so blutleer und schlaff und tot war sein Gesicht, und aus seinen Augen, seinen trotzigen, gewalttätigen Augen unter den schwarzen Haarbüscheln der Brauen glotzten nichts weiter als Angst und Schrecken.
Frau Vlissers Auge war nicht mehr zu retten gewesen, und zwei Tage lang trank Vater, um es loszuwerden, aber auch das half ihm nicht, denn er bekam wegen Körperverletzung einen Monat Gefängnis, und als er zurückkam und wieder zu arbeiten anfing, mußte er einen Teil seines Lohnes an Vlisser abführen. Eine Weile tat er es wirklich, Woche für Woche ging er hinüber und lieferte es ab, und es hatte den Anschein, als habe ihm das Gefängnis gut getan. Aber dann hatte er eines Abends wieder getrunken, erheblich mehr getrunken, als er bis dahin jemals getrunken hatte, und er schlug Mutter und mich und Großvater, und dann ging er hinüber und begann, in Vlissers Küche herumzutoben, und von der Zeit an zahlte er nichts mehr. Er wechselte danach oft die Arbeitsstelle, damit man ihm den Lohn nicht pfänden konnte, bis es Vlisser aufgab, hinter dem Geld herzujagen; aber Vater wechselte trotzdem noch einige Male seinen Arbeitsplatz, ehe er es einmal vergaß und plötzlich merkte, daß der Pfändungsbefehl ausblieb, und er blieb bei der Firma; er war noch heute dort.
Nun war es wieder soweit. Und während die anderen alle mit ihrer Angst beschäftigt waren (Mutter regungslos am Herd, den Fischlöffel geschultert; Großvater dabei, die Hosenträger zu befestigen; die beiden Windhunde vor dem Holzkasten, Figuren in den Staub zeichnend; Lene am Schrank, die Unterlippe zwischen den Zähnen), kaute ich an meinem Essen und ließ ihn mich anschreien: »Und warum läßt er mich das machen? Weil er einfach kein Scherff ist, wenigstens keiner von der Sorte, die ich kenne oder die ich gekannt habe. Weiß der Teufel, aus welcher Ecke er plötzlich in unser Haus geweht ist, er Mutter unter den Rock gekrochen ist! Das kann doch unmöglich ich besorgt haben! Schau dir Alex an! Das ist ein Kerl! Was denkt ihr, was der mit euch allen macht, wenn er sein Alter hat!«
»Hör mal, Vater!« wandte Mutter ein, aber mit einer weitausholenden Armbewegung wischte er die Bemerkung fort, zog sich einen Stuhl heran und setzte sich.
»Was zu essen«, sagte er und stützte den Kopf in den Handteller. »Verdammt noch mal, ist denn nie was auf dem Tisch, wenn ich heimkomme? Und warum ist das Fernsehn nicht eingeschaltet? Ich will schließlich was von dem Kasten haben für mein Geld, verdammt noch mal!«
Lene ging hin und schaltete ihn ein. Ich sah, wie er den Kopf erwartungsvoll hob und seinen Blick auf die noch schwarze Scheibe heftete, als erwarte er von ihr das Heil und die ewige Seligkeit oder zumindest die Therapie zur Verkürzung seiner offensichtlichen Leiden. Dann kam der Ton: ein pfeifendes, piepsendes, schrilles Geräusch, das, je länger es anhielt, lauter und lauter wurde, und ich bemerkte, während ich weiteraß, wie sich sein erwartungsvolles Gesicht verdüsterte, umwölkte, er die Stirn in Falten legte, den Kopf aus der Handstütze hob und sagte: »Nicht mal das, zum Henker, nicht mal das! He, alter Affe, schalt’s schon aus!«
Aber Großvater verstand ihn nicht, denn er war immer noch mit seinen Hosenträgern beschäftigt, so daß Hansi aufstehen und den Schalter betätigen mußte, und jetzt erst schien es Vater zu bemerken: wie die alten, dürren Finger flogen und wieder und wieder den Knopf verfehlten, während sie weit wichtigere Dinge unbeachtet ließen, obwohl Mutter es ihm doch deutlich genug gemacht hatte, auf was Vater achten würde. »Kannst du mir mal sagen«, fragte er, und es klang ganz ruhig, so wie er es sagte, aber der Unterton war unverkennbar, doch Großvater zu alt und vermutlich zu schwerhörig, ihn zu vernehmen, und er mußte es über sich ergehen lassen: »Kannst du mir mal sagen, was das bedeuten soll? Willst du den Kindern Sachen beibringen, für die sie sich noch nicht zu interessieren haben, oder warum trägst du deinen Latz mal wieder offen? Vielleicht glaubst du, es bestünde Grußpflicht oder weiß der Teufel, was du annimmst. Aber du bist gar nichts weiter als ein Schwein, nicht wahr, Alter, ein einfältiges Schwein.«
Ich schob den Teller in die Tischmitte und stand auf: »Es wäre besser, wenn du den beiden Burschen Bescheid sagen würdest. Der ganze Ärger kommt nur daher, daß sie ihn zum Abtritt hetzen. Das muß ihn ja durcheinanderbringen.«
»Ach«, sagte Vater und wandte sich mir zu, »sieh mal einer an, wie klug er redet. Nein, hört nur, wie gescheit. Mein Gott, wie konnte es mir nur passieren, dich in die Welt zu setzen. Da ist doch irgendwas faul bei der Sache, oberfaul.«
»Leg mal ’ne andere Platte auf«, sagte ich, und er ließ mich an sich vorbeigehen und die Schlafzimmertür erreichen, ehe er in meinen Rücken hinein sagte: »Das kommt nur daher, daß du kein Scherff bist. Deswegen hab’ ich dich auch nie recht schlagen können. Aber ich hab’ so im Gefühl, als wäre der Tag nicht mehr fern, an dem ich es doch noch schaffen werde, und dann gnade dir Gott!«
Ich öffnete die Tür und schloß sie hinter mir, ging an den elterlichen Betten vorbei, vorbei an dem Gestell, auf dem Hansi und Werner ihr Lager hatten, und betrat die letzte Kammer, in der Großvater, Alex und ich schliefen und die an Mobiliar nicht mehr aufwies als einen weißlackierten, alten Kleiderschrank und drei Betten.
Es war drückend warm in der Holzbaracke. Durch das offene Fenster strömte der Duft der Blüten, ein Duft von tauigem Gras, süß-saurem Unkraut, ein unbeschreiblicher Duft, der sich mit dem stickigen Geruch warmen Holzes mischte, ein schwerer, ermüdender Geruch, und ich warf mich aufs Bett, verschränkte die Arme unter dem Nacken und schaute hinauf zu den Balken und Bohlen, die die Decke bildeten:
rohes, unbearbeitetes Holz, das man einbaute, so wie es von der Sägemühle gekommen war. Denn man hatte keine Zeit, war in Eile, als man den Kral baute, ohne jedoch zu wissen, daß es einmal der Kral würde; man war tatsächlich der Meinung, ein soziales Werk zu tun. Damals befanden sich die Sozialisten im Rathaus, ärmelaufkrempelnde Reformer, Weltbeglücker, und sie bauten das Barackendorf draußen vor den Toren der Kreisstadt. Es sollte ein Behelf sein, ein Behelf für kurze Zeit, bis sich die Zeitläufe änderten, die zu ändern die neuen Männer versprochen hatten. Und sie holten die Arbeitslosen aus ihren Keller- und Mansardenzimmern und verpflanzten sie ins Grüne, in die Helligkeit des Wengerttales, dem einzigen Grund und Boden, den niemand haben wollte und der für diesen Zweck gerade das richtige war. Dann aber, zwei Jahre später, gewannen die Bürgerlichen die Wahl zum Stadtrat, weil sie den Bürgern versprochen hatten, den Kral, der da schon zum Kral geworden war, wieder zu entfernen, den Schandfleck der Kreisstadt auszumerzen und den Kralern menschenwürdige Wohnungen zu bauen. Aber sie bauten keine Wohnungen für die Kraler, weil es ihnen einfach an Zeit fehlte, denn plötzlich gab es überhaupt keine Bürgerlichen mehr und keine Sozialisten, es war alles gleichgeschaltet; sogar die Kraler waren keine Kraler mehr, sondern Volksgenossen, deshalb versprach man ihnen, sobald es eben möglich sein würde, neue Wohnungen zu bauen, damit sie sich auch als Volksgenossen unter Volksgenossen fühlten. Aber ehe man recht zupacken konnte, ehe man recht warm geworden war im Nest der Macht, kam der Krieg, und, ob sie nun Volksgenossen unter Volksgenossen waren oder nicht, man holte die Kraler aus ihren Baracken, nicht um ihnen neue Wohnungen zu geben, sondern um sie zu Soldaten zu machen oder sie notdienstzuverpflichten. Auch das ging vorüber. Die Sozialisten und die Bürgerlichen kehrten zurück, nicht zu vergessen die neue Institution – die Besatzungsmacht –, und alle legten sie mit Versprechungen los, und die, welche am besten zu versprechen vermochten, gewannen die erste Wahl. Aber die Zeit war schlecht, es gab überall keine Wohnungen, erst recht keine neuen für die Kraler, und vier Jahre später, als die nächste Wahl anstand und die Besatzungsmacht aus dem Kreis der Versprecher ausgeschieden war, sagte man den Leuten, wie schlecht die Zeit sei, und das leuchtete den Leuten, den Wählern, auch ein, und sie wählten sie wieder. In der Tat, nun begannen sie wirklich Wohnungen zu bauen. Aber dann kamen die Flüchtlinge aus den Ostgebieten, und wieder redete man den Leuten gut zu, man müsse doch einsehen, daß denen zuerst geholfen werden sollte, deren Not am größten sei, und siehe da, die Leute sahen auch das ein. Also zogen die Flüchtlinge in die neuen Häuser; man baute immer mehr davon, die Kreisstadt vergrößerte sich, und immer neue Transporte von Flüchtlingen kamen, und auch sie erhielten Wohnungen, und als die Zeit reif war für eine neue Wahl, gewann sie die regierende Partei mit den Flüchtlingsstimmen. Aber das Versprechen, den Kral zu entfernen, hatte man nicht vergessen, obwohl die Leute davon abgekommen waren, die Versprechen zu zählen; niemand kümmerte sich mehr darum, was die Partei versprach, denn sie gewann jede Wahl, auch ohne ihre Versprechen zu halten. Und als dann tatsächlich jemand von der Stadtverwaltung in den Kral kam und festzustellen versuchte, wer von den Kralern denn nun bereit war, den Kral zu verlassen, hörte man ihm nicht einmal mehr zu; denn inzwischen hatte man nicht nur vergessen, auf die Versprechen zu achten, sondern es waren Generationen neuer Kraler herangewachsen, Leute, die schon im Kral geboren waren. Die Mieten waren niedrig, während sie in den neuen Wohnungen unvergleichbar höher sein sollten, und man stellte andere Ansprüche an das Leben. Da waren die Raten für das Motorrad, für den Kleinwagen, für den Fernsehempfänger, die Mixmaschine und die elektrische Kaffeemaschine, den Strickapparat, und niemand wollte darauf verzichten. An den Kral aber, an die fehlende Kanalisation, an das Wasserstandrohr vor dem Haus, an die Mücken aus dem Sumpf und den Abfall vor der Tür, an die verwilderten Gärten und die unter der Sommersonne erglühenden, unter der Kälte des Winters berstenden Holzbaracken hatte man sich längst gewöhnt, dieses Bild hatte seinen Schrecken verloren. Es kamen dann sogar Rathausbeamte, die die Kraler zu überreden versuchten, im Guten wie im Bösen (man kündigte sogar die Mietverträge), aber schließlich blieb doch alles, wie es war, und die wenigen, die hinauswollten, wurden gehalten, weil sie entweder zu jung oder zu schwach waren oder beides zusammen, oder aber, was wahrscheinlicher war, der Kral sie nicht mehr ließ, und früher oder später würden auch sie resignieren und sogar bleiben wollen.
Als ich später die Küche wieder betrat, hatte Vater gegessen, Mutter spülte das Geschirr, und während aus dem Fernsehgerät die Stimme eines Sprechers plärrte, der ein antikes Kunstwerk erklärte, das man bei einer Ausgrabung entdeckt hatte, klapperten Schüssel und Teller und Löffel und Gabeln in dem Bottich, wurden hart auf das Ablaufbrett gestellt oder gelegt, wo Lene sie aufnahm, um sie abzutrocknen. Die Windhunde hockten immer noch auf dem Fußboden, glotzten zum hellen Schirm auf, und wenn der Nacken zu schmerzen begann, schauten sie hinunter, stießen sich an und stritten sich, wer von ihnen Großvaters Pantoffeln entwenden durfte.
Vater saß im Sessel, hatte den Ellbogen auf die Lehne und den Kopf in die Hand gestützt und verfolgte mit schläfrigen Blicken die erklärende Hand des Mannes auf dem Bildschirm, die über Figuren auf Töpfen und Schalen fuhr, und Großvater auf dem Holzkasten röchelte leise: ein Anzeichen dafür, daß er dabei war, den auftretenden Hustenreiz zu unterdrücken. Ich wußte, daß schon dieses Röcheln allein die Familie in Aufregung versetzte, denn so oder so würde der Hustenanfall doch einsetzen, und da sagte es auch schon Vater, sagte es in der müden Art, die Betrunkene an sich haben, wenn sie halbwegs zufrieden sind: »Nun fang schon an zu husten, Mensch!«
Das ließ sich Großvater nicht zweimal sagen, und in seinem grollenden, aufreizenden Hustenanfall gingen die Worte des Sprechers unter, so daß Mutter sagte, es rief: »Mein Gott und Vater, der spuckt noch mal seine Lunge aus!« Das war aber nur der Anfang; denn zuerst kamen die Anfälle alle Viertelstunde, dann jede zehn Minuten, die Abstände zwischen ihnen wurden von Mal zu Mal kürzer, bis es schließlich nur einzelne Atemzüge, von Röcheln begleitete Atemzüge waren, die das Husten kurz unterbrachen, und dann wurde es für ihn Zeit, den Raum zu verlassen und freiwillig das Bett aufzusuchen.
In der ersten Zeit war das noch anders, da gehörte es noch zu Mutters Obliegenheiten, ihn aus dem Sessel oder von dem Holzkasten aufzuzerren und, begleitet von Vaters Schimpfkanonaden, aus dem Zimmer zu bugsieren. Denn auch er wollte das Schauspiel miterleben, das ihm das neue Gerät, das Vater eines Tages hatte hertransportieren und aufstellen lassen, verhieß. Aber immer dann, wenn es (in der Anfangszeit) in der Handlung eines Films oder während eines Quizturniers spannend zu werden begann und Großvaters Hustenanfälle kaum noch Unterbrechungen erfuhren, dann hielten es die Familie und die Verwandten und Bekannten, die mit Stühlen und Bierflaschen beladen den Weg zu uns und zu dem Gerät gefunden hatten, nicht mehr länger aus, denn dann war es genau wie zu Stummfilmzeiten, wenn der Filmerklärer einen schlimmen Husten hatte, und dann sagte Vater: »Hör entweder sofort mit der Kotzerei auf oder verschwinde!«, und er hörte tatsächlich für eine Sekunde auf, wohl weil er den Atem anhielt, aber als er es nicht mehr vermochte, begann er erneut zu röcheln und gleich darauf zu husten, und Vater schrie: »Schafft mir den Kerl vom Hals!«, und Mutter hatte sich längst erhoben, war zu ihm hingegangen, hob seine schlaffe Hand auf und zerrte ihn hoch. Anfangs wehrte er sich dagegen mit einer Bockbeinigkeit und einem Widerstand, der zwar nicht so heftig war, daß er von Mutter nicht doch noch gebrochen werden konnte, der aber immerhin Zeugnis davon ablegte, wie widerwillig er dem Befehl seines Sohnes folgte, bis ein weiteres »Raus!« eben dieses Sohnes sein Schicksal besiegelte und er sich nicht mehr länger widersetzte und ging, ohne indes zu verfehlen, seinen sabbelnden Protest, auf den niemand hörte, der Versammlung kundzutun.