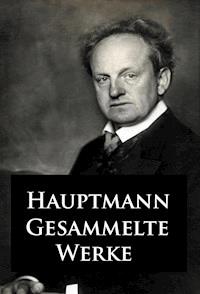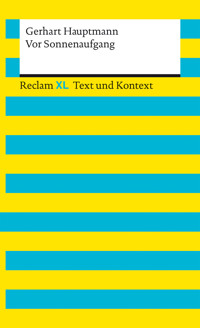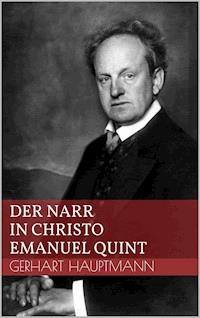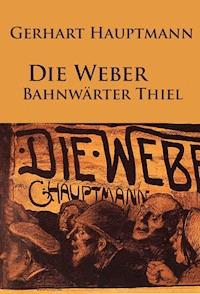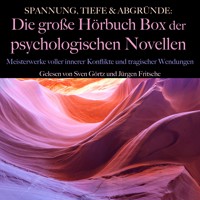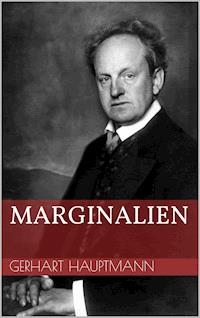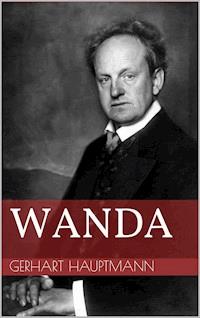Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Diese stimmungsvolle Novelle, die Ende des 19. Jahrhunderts spielt, erzählt von der Studienzeit, von der Findungsphase danach, von Liebe und von Freundschaft.Den Erzähler und seine Weggefährten Haspel und Dietrich verbindet eine tiefe Freundschaft. Zwei von ihnen sind bereits glücklich vergeben. Doch als auch Dietrich sein Glück findet, wird die Freundschaft auf eine harte Probe gestellt.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 88
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gerhart Hauptmann
Die Hochzeit auf Buchenhorst
Saga
Die Hochzeit auf Buchenhorst
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1932, 2021 SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788726956603
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
Dieses Werk ist als historisches Dokument neu veröffentlicht worden. Die Sprache des Werkes entspricht der Zeit seiner Entstehung.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - ein Teil von Egmont, www.egmont.com
Als ich Kühnelle kennenlernte, war ich achtzehn und er etwa zweiundzwanzig. Er kam nach Jena, Gott weiss wozu, und ich war in Jena, um Gott weiss was zu studieren. Er schloss sich unserem studentischen Kreise an, der aus meinem Bruder und mir, einem schwerhörigen Geschichtsprofessor und einigen anderen Freunden bestand.
Kühnelle war ein stattlicher junger Mann von runden Gesichtsformen. Nicht nur die Herzen der Weiber flogen ihm zu. Wir sahen sofort, wir hatten es mit keinem gewöhnlichen Menschen zu tun. Natürlich hatte er sein Abiturium hinter sich und belegte Kollegs, wie wir anderen, wodurch er aber nicht irgendeinem studentischen Typus ähnlicher ward. Bevor wir ihn näher kennenlernten — wenn man bei ihm von einem Näherkennenlernen überhaupt sprechen kann — wussten wir nicht, was wir aus ihm machen sollten. Eines Tages erfuhr ich, und zwar von ihm selbst, er habe früher eine grosse Kraft in seinen Händen gehabt, leider aber den rechten Arm überspielt: Kurz: er hatte einer Pianistenlaufbahn entsagt.
Kühnelles Familie war in Leipzig und Dresden ansässig. Sie hatte italienisches Blut.
In seinem Äusseren unterschied sich Dietrich Kühnelle von uns durch Salonfähigkeit. Stattlicher, breitschulteriger, kurzum männlicher als wir, trug er am Tage einen schwarzen, an den Rändern mit Borte versehenen Cutaway, einen schwarzen, grossen, weichen Hut, den Sommerpaletot überm Arm, ein paar helle Handschuhe in der Hand.
Er hatte blondes, dichtes, gekräuseltes Haar. Allein diesen blonden, oft etwas, faden Typ widerlegten sogleich zwei dunkle, feurige Augen, widerlegte die ihn erfüllende, in den ersten Wochen unserer Bekanntschaft nicht zutage tretende, leidenschaftliche Innerlichkeit. Wenn sie sich äusserte, war es etwa, als wenn ein Gefäss, von dem man glaubte, es sei mit Milch gefüllt, sich voll feurigen Weins erwiese.
Kühnelle blickte auf uns herab. Er gestand mir später, warum er sich in den ersten Wochen unserer Bekanntschaft still verhalten hatte. Mein Bruder und ich, so sagte er, hätten ihn angezogen. Was wir aber bei Tisch und des Abends auf der Kneipe gesagt, getan und getrieben und wie wir das alles gesagt, getan und getrieben hätten, das kam ihm auf eine peinliche Weise. enttäuschend und auf verletzende Weise unreif vor. Es habe ihn geradezu abgestossen. Sein Gedanke war, plötzlich und ohne Abschied von Jena überhaupt zu verschwinden, da er sich bereits zu tief mit uns eingelassen habe, um, wenn er am Orte bliebe, ohne offenen Bruch von uns loszukommen.
Was ihn schliesslich festhielt, war seine Neigung zu mir.
Solche Bekenntnisse machte er mir nach Monaten. Meine Ansichten brachten mich in der Tat seltener mit ihm, als mit meinem Bruder und mit meinen anderen Freunden in Gegensatz. Auf, was ich hinauswollte, das war die Kunst, nicht die Wissenschaft. Die Frage war: sollte ich Bildhauer werden oder sollte ich gar auf etwas hinarbeiten, was man eigentlich entweder ist oder nicht, aber nie werden kann? Die sogenannten Meininger, die ich als Knabe im Stadttheater zu Breslau sah, hatten mir eine Leidenschaft zum Theater eingeflösst und den brennenden Ehrgeiz, Dramen zu schreiben. Ich tat es auch, und so konnte es denn nicht ausbleiben: ich las vorhandene Versuche und Fragmente eines Tages Kühnelle vor. Bei solchen Gelegenheiten geriet mein Bruder in Begeisterung. Auch meine übrigen Freunde liessen sich hinreissen. Bei Kühnelle war das nicht zu erreichen. Man spürte auch hier seine unbestechliche Überlegenheit. Er sagte zu dem, was er hörte, nicht nein. Allein sein Begriff von schöpferischer Dichterkraft war mit einer so unechörten Begnadung gleichbedeutend, dass er in meinen vorgelegten Proben die Anwartschaft auf dergleichen Begnadung nicht sehen konnte. Er selbst, von dessen musikalischen Fähigkeiten ich damals, weil er nicht vorspielte, keinen Begriff haben konnte, versagte sich jedem Versuch zur Komposition. Das wahrhaft Grosse zu leisten, sei unter Millionen kaum einem beschieden, sagte er. Er schliesse sich nicht dem ungeheuren Zuge dünkelhafter Narren an, in dem er, wie jeder von ihnen, glaube, er sei der Eine.
Er drückte das übrigens nicht so aus. Seine Proteste waren niemals heftig oder feierlich, sondern eher in Form von Fragen gehalten, wobei er einen scharf wie durch Brillengläser — er trug keine Brille — ins Auge fasste.
In einem gewissen Sinne, durchaus ohne zu verletzen, hielt er sich bei unseren Zusammenkünften wie jemand, der sich anschliesst, ohne eigentlich zugehörig zu sein.
Weshalb der Vereinsamte alte Junggeselle und Professor der Geschichte sich zu uns gefunden hatte, weiss ich heute nicht mehr zu sagen. Mein Bruder und Pfaff, der fünfte im Bunde, studierten Naturwissenschaft. Der sechste, Haalhaus, war trotz seiner Jugend bereits eine Leuchte auf dem Gebiete der vergleichenden Sprachwissenschaft. Es lag auf der Hand, dass er in sehr jungen Jahren sein Ziel, eine Professur, erreichen würde, da er schon jetzt alle Merkmale des Gelehrten an sich trug, und zwar bereits im Zustand der Verknöcherung. Gespräche ausserhalb des Gebietes seiner Wissenschaft kannte er nicht. Es war noch ein Herr von Gabler, ein Balte, da und ein Pole, dessen Name mir nicht mehr gegenwärtig ist. So war ja überhaupt unser Kreis ein bisschen zusammengewürfelt, und wenn er eine Weile beisammen blieb, so lag das nicht an einer Idee, die uns etwa gemeinsam gewesen wäre und uns gebunden hätte, sondern daran, dass Persönlichkeiten einander anzogen, dass sie Gefallen aneinander gefunden hatten, ohne recht zu wissen warum. Trotzdem, wie gesagt, schien Kühnelle sich noch auf besonders ausgesprochene Weise als von uns allen abgesondert zu betrachten, im einzelnen und im ganzen gleichsam nur unser Gast zu sein.
Von meinem Bruder war er, wie er mir sagte, enttäuscht worden. Vielleicht habe das daran gelegen, meinte er, dass er, nachdem er ihn lange im Kolleg, in den Gasthäusern und auf der Strasse beobachtet hätte, von seiner Persönlichkeit derartig hingenommen gewesen sei, dass er seine Bekanntschaft mit allzu brennender Spannung gesucht habe. Worauf die Enttäuschung beruhte, hat er mir mehrmals unter vier Augen dargelegt. Aber es ist mir leider entfallen. Konrad, mein Bruder, lebte damals in einem idealistischen Rausch, einem doppelten Rausch, da er sich nicht nur an Darwin, Büchner, Haeckel, Spinoza und anderen berauschte, sondern am meisten an sich selbst. Das drängende Gären seines allbelebenden; höchst lebendigen Geistes liess ihm für die echten Schicksale anderer keine Zeit. Gerade dies aber mochte es sein, was der junge Kühnelle erhofft hatte.
Es dauerte nämlich nicht sehr lange, bis man es, oder besser, bis ich es im Wesen dieses scheinbar kerngesunden, allezeit heiteren jungen Mannes wetterleuchten sah. Es traten seltsame Äusserungen zutage, die auf geheimnisvolle Dinge hindeuteten, mit denen sein Dasein belastet schien. Dies berührte mich um so sonderbarer, als mein neuer Freund einen kraftstrotzenden, dabei aber auch wohlgenährten Eindruck machte, und auf seinem schönen, heiteren Gesicht nicht die allerkleinste Sorgenfalte erkennbar war. Sah man von der Einmaligkeit seiner Erscheinung ab, so fand man in ihm den wohlerzogenen, reichen Bürgersohn, der immer einen gedeckten Tisch, ein gutes Bett, eine warme Stube und alle und jede Bequemlichkeit des Daseins genossen, Mangel und Sorge nicht kennengelernt hatte.
Die Enthüllungen des gelegentlichen Wetterleuchtens liessen jedoch einen inneren Kampfplatz und darauf ein keineswegs leichtes Kampfleben, natürlich nur flüchtig, sichtbar werden. Es handelte sich dabei um Streitigkeiten, die Kühnelle in sich selbst, mit sich selbst und gegen sich selbst auszutragen hatte. Rings um den jungen Menschen aber tauchten, hastig umrissen, Mitglieder einer Familie auf, die, durch unversöhnliche Gegensätze getrennt, unter einem schweren Verhängnis zu stehen schienen.
Auch in meiner Familie waren Meinungsverschiedenheiten, Streitereien, Entzweiungen aller Art keine Seltenheit, aber sie hatten doch nicht, wie hier, den Charakter des Unversöhnlichen. Auch ich beklagte eine Schulerziehung, die mir, wie ich glaubte, mein Selbstbewusstsein geraubt und mich gleichsam am Rückgrat, lädiert hatte. Er dagegen verwarf, ja, verfluchte seine ganze Jugendzeit, hasste seine Erzieher, Vater, Mutter und Lehrer, ohne Ausnahme und in einem Geiste, dem jeder Gedanke an Verstehen, an Entschuldigung oder gar Verzeihung nicht entfernt in Betracht kommen in konnte.
In langem, unermüdlich zähem Ringen habe er sich, wie er sagte, durchgeschlagen und frei gemacht. Es sei seinen Unterdrückern, seinen Peinigern, seinen stupiden und tückischen Verfolgern, diesem durch Gesetze geschützten Verbrecherkonsortium, das mit sadistischer Lust und niederträchtig-satanischer Entschlossenheit, seinen Leib zu schänden, seine Seele zu töten gesucht habe, weder das eine noch das andere gelungen. Ihre Minen wären nicht tief genug, er habe die seinigen tiefer gegraben. Das habe er aber nur darum erreicht, weil er früh das wahre Gesicht aller derer, die ein so unerbetenes und unverschämtes Interesse an ihm nähmen, entlarvt habe. Von da ab habe ihn keine Form von sogenanntem Zuspruch, von Belehrung oder Ermahnung, keine Form von süsslicher Heuchelei mehr getäuscht. Sie habe in ihm den jederzeit entschlossenen Gegner gefunden, der sich mit allen nur immer denkbaren Mitteln gegen sie wappnete und wehrte. Jede Waffe schien ihm erlaubt. Als er nun einmal auf unzweideutige Art und Weise zur Erkenntnis des niederträchtigen Verrates, den man Jugenderziehung nenne, gekommen sei, hätte er sich alle und jede Mittel zugebilligt. Denn was anders sei es, auf was diese sogenannte Erziehung hinauskomme, als das, was man anwende, wenn man einen gefangenen Raubvogel am Fliegen verhindern wolle: man mache seine Schwingen unbrauchbar: Nicht so in die Augen fallend freilich, sondern tückisch, schlau und geheim, aber darum auch um so vollständiger sei die menschliche Verstümmelung. Dem Knaben werde zuerst der Gebrauch feiner Kräfte verboten und dann überhaupt das Bewusstsein seiner Kraft geraubt. Vom Recht dagegen sei nie die Rede. Die Empfindung absoluter Rechtlosigkeit werde dem Gemüte des Menschen mit glühendem Stempel eingeprägt. Man benutze, sobald dies geschehen sei, die Wunde zu Zwecken der Lähmung und Demütigung, wie man es mit dem Stiere tue, den man an einem durch seine Nasenscheidewand gezogenen Ringe führt.