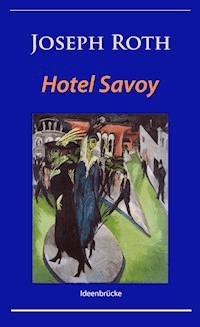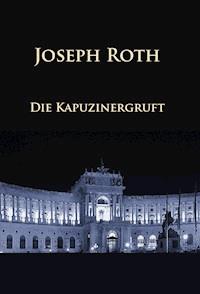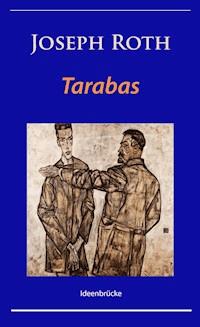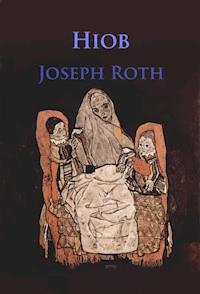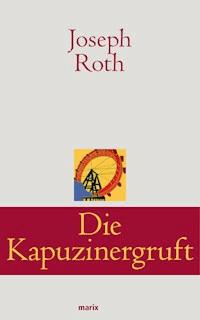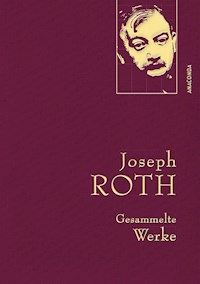Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In Joseph Roths Werk 'Die hundert Tage' taucht der Leser ein in die politische und gesellschaftliche Landschaft des Habsburgerreichs während der Zeit der französischen Besetzung. Der Roman erzählt die Geschichte des jungen Offiziers Franz Weyring, der zwischen Loyalität zum Kaiser und seinem Gewissen hin- und hergerissen ist. Roth nutzt eine eindringliche Erzählweise, die geprägt ist von ironischer Distanz und poetischer Sprache. Durch die Darstellung von Weyrings moralischem Konflikt offenbart der Autor die Zerrissenheit und Verworrenheit einer Epoche im Umbruch. 'Die hundert Tage' ist ein bedeutendes Werk der österreichischen Literatur, das Roth als Meister des psychologischen Realismus etabliert.Der Autor Joseph Roth, selbst gebürtiger Österreicher und Zeuge des Untergangs der Habsburger Monarchie, schöpft aus seiner eigenen Erfahrung, um die historischen Ereignisse des Romans lebendig werden zu lassen. Sein tiefes Verständnis für die Komplexität der Charaktere und die Ambivalenz der politischen Situation machen sein Werk zu einer fesselnden Lektüre.'Die hundert Tage' ist ein Muss für alle Leser, die sich für historische Romane mit tiefgründigen Charakterstudien interessieren. Roth fängt nicht nur die Atmosphäre einer vergangenen Ära ein, sondern wirft auch einen schonungslosen Blick auf die moralischen Dilemmata, mit denen seine Figuren konfrontiert sind.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die hundert Tage
Books
Inhaltsverzeichnis
Erstes Buch
Die Heimkehr Des Grossen Kaisers
I
Die Sonne tauchte blutrot, winzig und vergrämt aus den Nebeln. Bald verschwand sie wieder im kalten Grau dieses Morgens. Ein mißmutiger Tag brach an. Es war der zwanzigste März, also ein Tag vor dem Anfang des Frühlings. Man spürte ihn noch nirgends. Es regnete und stürmte im ganzen Lande, und die Menschen froren.
Es hatte noch gestern nacht in Paris gestürmt und geregnet. Heute verstummten die Vögel jäh, nach einem kurzen, morgendlichen Jubel. In dünnen, gehässigen und kalt schwelenden Fäden stieg der Nebel aus den Ritzen zwischen dem Pflaster empor, näßte die Steine aufs neue, die der Morgenwind soeben getrocknet hatte, schwebte um die Weiden und Kastanien in den Parks und an den Rändern der Alleen, ließ die fürwitzigen Knöspchen der Bäume erzittern, jagte deutlich sichtbare Schauder über die feuchten Rücken der geduldigen Fiakergäule und drückte den Rauch, der hier und dort aus morgenfleißigen Kaminen aufzusteigen versuchte, gegen die Erde. Es roch nach Brand, Nebel, Regen, feuchten Kleidern, lauernden Schneewolken und vorderhand verhindertem Hagel, nach unfreundlichem Wind, durchnäßtem Lederzeug und nach häßlich dünstenden Kanälen.
Dennoch hielt es die Einwohner der Stadt Paris nicht in ihren Häusern. Zu früher Stunde schon drängten sich die Menschen in den Straßen. Sie versammelten sich vor den Wänden, an denen Zeitungs blätter klebten. Diese Zeitungen enthielten die Abschiedsworte des Königs von Frankreich. Es waren kaum leserliche, geradezu verweinte Zeitungen, denn der nächtliche Regen hatte ihre frischen Lettern verwischt und hie und da auch den Leim gelöst, mit dem sie an den Stein geklebt waren. Von Zeit zu Zeit riß ein stürmischer Windstoß ein Blatt vollends von der Mauer und schleuderte es in den schwarzen Kot der Straße. Also wurden die Abschiedsworte des Königs von Frankreich schmählich vernichtet, im Kot der Straße, unter den Rädern der Wagen, unter den Hufen der Pferde, unter den achtlosen Tritten der Fußgänger.
Manche, die dem König treu geblieben waren, sahen diesen Blättern wehmütig und ergeben nach. Der Himmel selbst schien ihm ungünstig gesinnt. Sturm und Regen ließen es sich angelegen sein, seine Abschiedsworte zu vernichten. In Wind und Regen hatte er gestern abend sein Schloß und seine Residenz verlassen. »Macht mir das Herz nicht schwer, Kinder!« sagte er, als sie ihn auf den Knien baten zu bleiben. Er konnte nicht bleiben, der Himmel war gegen ihn ... man sah es.
Er war ein guter König. Wenige liebten ihn, aber viele im Lande hatten ihn gern. Er hatte kein gutes Herz, aber es war ein königliches. Er war alt, wohlbeleibt, schwerfällig, friedfertig und stolz. Er kannte das Unglück der Heimatlosigkeit, denn er war in der Verbannung alt geworden. Er traute den Menschen nicht, wie jeder Unglückliche. Er liebte das Maß, die Ruhe und den Frieden. Einsam war er und den Menschen fremd – denn die wahren Könige sind fremd und einsam. Er war arm und alt, wohlbeleibt und schwerfällig, würdig, bedächtig und unglücklich. Wenige liebten ihn, aber viele hatten ihn gern im Lande.
Der alte König floh vor einem großen Schatten, dem Schatten des gewaltsamen Kaisers Napoleon, der sich seit zwanzig Tagen der Hauptstadt des Landes näherte. Der Kaiser warf seinen Schatten voraus, und es war ein schwerer Schatten. Er wuchtete auf dem Lande und fast auf der ganzen Welt. Man kannte ihn gut im Lande und überall auf Erden. Seine Würde war eine andere als die der geborenen Könige: Er besaß die Würde der Gewalt. Seine Krone hatte er erworben und erobert und nicht geerbt. Er stammte aus einem unbekannten Geschlecht. Und selbst seinen namenlosen Vorfahren verlieh er noch Ruhm. Er schenkte Glanz seinen Ahnen, statt ihn von ihnen zu empfangen wie die geborenen Kaiser und Könige. Also ward er allen Namenlosen ebenso verwandt wie den Trägern altererbter Würden. Indem er sich selbst erhob, adelte, krönte, erhob er alle Namenlosen im gemeinen Volk, und also liebte es ihn. Erschreckt, besiegt und im Zaum gehalten hatte er eine geraume Zeit die Großen dieser Erde, und deshalb hielten ihn die Kleinen für ihren Rächer und anerkannten ihn als ihren Herrn. Sie liebten ihn, weil er ihresgleichen zu sein schien – und weil er dennoch größer war als sie. Ihnen gab er ein Beispiel; eine Aufmunterung war er ihnen.
Überall in der Welt kannte man den Namen des Kaisers – aber wenige wußten von ihm. Denn wie ein wahrer König war auch er einsam. Er wurde geliebt und gehaßt, gefürchtet und verehrt und selten erkannt. Man konnte ihn nur hassen, lieben, fürchten, anbeten, als wäre er ein Gott. Und er war ein Mensch.
Er selbst haßte, liebte, fürchtete und verehrte. Er war stark und schwach, verwegen und mutlos, treu und verräterisch, leidenschaftlich und gleichgültig, hochmütig und einfach, stolz und niedrig, gewaltig und armselig, treuherzig und mißtrauisch.
Er verhieß den Menschen Freiheit und Würde – aber wer in seine Dienste trat, verlor die Freiheit und ergab sich ihm vollends. Er schätzte das Volk und die Völker gering, und er buhlte um die Gunst des Volkes. Er verachtete die geborenen Könige, und wollte ihre Freundschaft und ihre Anerkennung. Er glaubte an Gott, und er fürchtete ihn wenig. Vertraut war ihm der Tod, und er wollte nicht sterben. Er achtete das Leben gering, und er wollte es genießen. Er schätzte die Liebe nicht, und er wollte die Frauen besitzen. Er glaubte nicht an die Treue und an die Freundschaft, und er suchte unermüdlich, Freunde zu gewinnen. Er schätzte diese Welt wenig, und er wollte sie erobern. Er traute den Menschen nicht, bevor sie nicht bereit waren, für ihn zu sterben: also machte er aus ihnen Soldaten. Damit er ihrer Liebe sicher sei, lehrte er sie, ihm zu gehorchen. Damit er ihrer sicher sei, mußten sie sterben. Beglücken wollte er die Welt, und er verschaffte ihr Plage. Ach, und man liebte ihn noch seiner Schwäche wegen. Denn wo er sich schwach erwies, sahen die Menschen, daß er ihresgleichen sei, und sie liebten ihn, weil sie sich ihm verwandt fühlten. Und wenn er sich stark zeigte, liebten sie ihn gerade deswegen und weil er nicht ihresgleichen zu sein schien. Und wer ihn nicht liebte, haßte ihn oder fürchtete ihn. Er war stark und wankelmütig, treu und verräterisch, mutig und furchtsam, erhaben und gering.
Jetzt stand er vor den Toren der Stadt Paris.
Aus Furcht warfen die einen und andere aus Freude die Abzeichen weg, die der König eingeführt hatte.
Die Farbe des Königs und seines Hauses war die weiße gewesen. Die sich zu ihm bekannt hatten, trugen weiße Schleifen am Rock.
Heute aber verloren Hunderte, wie durch einen Zufall, ihre weißen Schleifen. Nun lagen sie, geschändete, verleugnete Schmetterlinge, im schwarzen Kot der Straße.
Die Blume des Königs und seines Hauses war die unnahbare, jungfräuliche Lilie gewesen. Jetzt lagen Hunderte weggeworfene, verleugnete, geschändete Lilien aus Stoff und Seide im schwarzen Kot der Straße. Die Farben des herannahenden Kaisers aber waren: Blau und Weiß und Rot: blau wie der Himmel und die Ferne; weiß wie der Schnee und der Tod; rot wie das Blut und die Freiheit.
Auf einmal sah man in der Stadt Tausende von Menschen mit blauweiß-roten Schleifen an den Röcken und an den Hüten.
Und statt der keuschen, stolzen Lilie trugen sie die bescheidenste aller Blumen: das Veilchen.
Es ist eine demütige und eine tapfere Blume. Sie hat die Tugenden des namenlosen Volkes. Kaum erkannt blüht sie im Schatten der großen Bäume, und mit einer bescheidenen und würdigen Tollkühnheit begrüßt sie als erste aller Blumen den Frühling. Und ihr dunkelblauer Schimmer erinnert ebenso an den morgendlichen Dunst vor dem Aufgang der Sonne wie an den abendlichen vor dem Anbruch der Nacht. Es war die Blume des Kaisers. Man nannte ihn den »Vater des Veilchens«.
Nun sah man Tausende aus dem Volk, aus den Vorstädten von Paris gegen den Mittelpunkt der Stadt, gegen das Schloß heranziehen, alle mit Veilchen geschmückt. Es war ein Tag vor dem Anfang des Frühlings, ein unfreundlicher Tag, ein mißmutiger Frühling. Aber das Veilchen, die mutigste aller Blumen, blühte schon vor den Toren der Stadt, in den Wäldern. Und es war, als trüge das Volk aus den Vorstädten den lebendigen Frühling in die steinerne Stadt, vor das steinerne Schloß. Die frischgepflückten Veilchensträuße blauten an den Spitzen der erhobenen Stöcke der Männer, zwischen den warmen und schwellenden Brüsten der Frauen, an den hochgeschwenkten Hüten und Mützen, in den grüßenden Händen der Arbeiter und Handwerker, an den Degen der Offiziere, an den Trommeln der alten Tamboure und an den silbernen Trompeten der alten Trompeter. An der Spitze mancher Gruppen marschierten die Taboure der alten kaiserlichen Armee. Sie trommelten die alten Schlachtenmelodien auf die alten Kalbfelle, ließen die beschwingten Schlegel in der Luft wirbeln und fingen sie, die heimkehrenden schlanken Vögelchen, in den väterlich geöffneten Händen wieder auf. An der Spitze anderer Gruppen, oder auch in ihrer Mitte, marschierten die alten Trompeter der alten Armee, und von Zeit zu Zeit setzten sie ihre Hörner an die Lippen und bliesen die alten Schlachtrufe des Kaisers, die wehmütigen und einfachen Rufe des Todes und des Sieges, von denen jeder jeden Soldaten an seinen Schwur erinnerte, für den Kaiser zu sterben, und auch an den letzten Seufzer der geliebten Frau, bevor man sie verließ, um für den Kaiser zu sterben. Mitten zwischen vielen Menschen und rittlings auf Schultern sah man die alten Offiziere des Kaisers. Sie schwankten, ja, sie wurden geschwenkt über den wogenden Köpfen der Menge wie lebendige, menschliche Fahnen. Sie hatten ihre Degen gezogen. An deren Spitzen flatterten ihre Hüte wie kleine, schwarze Fahnen, geschmückt mit den dreifarbigen Kokarden des Kaisers und des Volkes von Frankreich. Und von Zeit zu Zeit und als bedrückte der nicht oft genug ausgestoßene Schrei immer noch die Herzen der Frauen und Männer, riefen sie: »Es lebe Frankreich! Es lebe der Kaiser! Es lebe das Volk! Es lebe der Vater des Veilchens! Es lebe die Freiheit! Es lebe der Kaiser!« Und noch einmal: »Es lebe der Kaiser!« – Manchmal auch, mitten in einer Gruppe, begann ein Begeisterter zu singen. Er sang die alten Lieder der alten Soldaten, aus alten Schlachten, die Lieder, die den Abschied der Menschen vom Leben besingen, ihr Gebet vor dem Tod, die gesungene Beichte des Soldaten, der keine Zeit hat zur letzten Absolution, seine Liebe zum Leben und seine Liebe zum Sterben, die Lieder, die den Tritt der Regimenter enthalten und das Knattern der Gewehre. Plötzlich stimmte einer das längst nicht mehr gehörte Lied, die Marseillaise, an – und alle Tausende fielen ein in diesen Gesang. Es war das Lied des Volkes von Frankreich. Es war das Lied der Freiheit und des Gehorsams. Es war das Lied des Vaterlandes und der ganzen Welt. Es war das Lied des Kaisers, wie das Veilchen seine Blume war, wie der Adler sein Vogel war, wie die Farben Blau, Weiß, Rot seine Farben waren. Es adelte den Sieg und überglänzte auch noch die verlorenen Schlachten. Es enthielt den Triumph und seinen Bruder, den Tod. Es enthielt die Verzweiflung und die Zuversicht. Jeder einzelne, der die Marseillaise vor sich hinsingt, wird der mächtige Genosse und Freund der vielen, deren Lied sie ist. Und wer sie gemeinsam mit vielen anstimmt, fühlt seine ewige Einsamkeit, obwohl er mitten unter vielen ist. Denn die Marseillaise verkündet den Triumph und den Untergang, die Gemeinschaft mit der Welt und die Verlassenheit jedes einzelnen, die trügerische Macht des Menschen und seine sichere Ohnmacht, es ist das singende Leben und der singende Tod. Es ist das Lied des Volkes von Frankreich.
Man sang es an dem Tage, an dem der Kaiser Napoleon heimkehrte.
II
Manche seiner alten Freunde eilten ihm entgegen, um ihn noch unterwegs einzuholen. Andere machten sich bereit, ihn erst in der Stadt zu empfangen. Schon war die weiße Fahne des Königs vom Turm des Rathauses verschwunden, schon flatterte an ihm die blau-weiß-rote des Kaisers. Und an den Mauern, an denen heute morgen noch die Abschiedsworte des Königs geklebt hatten, hafteten jetzt neue, nicht mehr verweinte, vom Regen verwüstete, sondern klare, leserliche, saubere und trockene Blätter. Über ihnen schwebte in mächtiger Beharrlichkeit der kaiserliche Adler, als beschützten seine starken, schwarzen Schwingen die schwarzen, sauberen Schriftzeichen und als hätte er sie selbst, Zeichen um Zeichen, aus seinem gefährlichen und beredten Schnabel fallen gelassen. Es war das Manifest des Kaisers. Und wieder versammelten sich die Leute vor den gleichen Mauern, und in jeder Gruppe las einer mit lauter Stimme die Worte des Kaisers vor. Das war ein anderer Klang als der wehmütige Abschied des Königs. Die Worte des Kaisers waren blank und stark, in ihnen schwang das Rattern der Trommeln, der harte Ruf der Trompeten und die anstürmende Stimme der Marseillaise. Und es war, als verwandelte sich die Stimme eines jeden, der die Worte des Kaisers vorlas, in die Stimme des Kaisers selbst, und es war, als spräche er, noch nicht angekommen, bereits aus zehntausend vorausgesandten Boten zum Volk von Paris. Ja, bald war es, als sprächen die Zeitungen selbst von den Wänden. Die gedruckten Worte verlauteten sich selbst, die Lettern riefen, und über ihnen schien der mächtig und geruhsam schwebende Adler seine Schwingen zu rühren. Der Kaiser kam. Schon hallte seine Stimme von allen Wänden.
Die alten Freunde, die alten Würdenträger und ihre Frauen eilten zum Schloß. Die Generäle und Minister zogen ihre alten Uniformen an, legten ihre kaiserlichen Auszeichnungen um, und nun, da sie sich im Spiegel besahen, bevor sie ihr Haus verließen, war es ihnen, als hätten sie seit der Abwesenheit des Kaisers gar nicht gelebt, sondern einen tauben Schlaf getan und wären erst heute zum Leben erwacht. Glücklicher noch waren die Damen des kaiserlichen Hofes, als sie ihre alten Kleider wieder anzogen. Schon hatten sie gedacht, ihre Jugend sei verloren, ihre Schönheit verwelkt, ihr Glanz erloschen. Nun aber, da sie ihre Kleider anlegten, die Zeugen ihrer Jugend und ihrer seligen Triumphe, glaubten sie zu sehen, daß die Zeit stillgestanden sei seit der Abfahrt des Kaisers. Ja, die Zeit, die Feindin der Frauen, hatte gelähmt innegehalten, ein wüster Traum waren die rollenden Stunden gewesen, die schleichenden Wochen, die langweiligen und langsam mordenden Monate. Die Spiegel trogen nicht mehr. Sie gaben die wirklichen Bilder der Jugend wieder. Und mit triumphierenden Schritten, auf seliger beschwingten Füßen, als es jugendliche sein können – denn es waren verjüngte und zur Jugend wiedererwachte Füße–, bestiegen die Damen ihre Wagen und fuhren zum Schloß, umjubelt vom nachdrängenden und vom wartenden Volk.
In den Gärten vor dem Schloß wartete es, vor den Toren stieß es sich. In jedem ankommenden Minister und General sah es einen neuen Boten des Kaisers. Es kamen auch die niederen Bedienten, die alten Köche und Kutscher und Bäcker und Wäscherinnen des Kaisers, die Stallmeister und die Pferdeknechte, die Schneider und die Schuster, die Maurer und die Tapezierer, die Lakaien und die Dienstmägde. Und man begann, das Schloß für den Kaiser herzurichten, damit er es wiederfinde, wie er es verlassen hatte, und damit ihn nichts mehr an den geflohenen König erinnere. In dieser Arbeit vereinigten sich die hohen Damen und Herren mit den niederen Bedienten. Ja, eifriger als diese begannen die Damen des kaiserlichen Hofes, ohngeachtet ihrer Würde, ihrer leicht zu verderbenden Kleider und ihrer behüteten Fingernägel, die Tapeten, die weißen Lilien des Königs, von den Wänden zu schälen, zu reißen, zu kratzen, mit Rachsucht, Wut, Ungeduld und Begeisterung. Unter den Tapeten des Königs erschienen wieder die alten, wohlbekannten Zeichen des Kaisers, unzählige goldfarbene Bienen mit gläsernen, zart geäderten, gespreizten Flügelchen und schwarzgestreiftem Hinterteil, kaiserliche Insekten, die emsigen Bereiter der Süße. Soldaten der alten Armee brachten die kaiserlichen Adler aus golden glänzendem Messing und stellten sie an allen vier Ecken auf, damit der Kaiser in dem Augenblick seiner Ankunft wisse, daß die Soldaten ihn erwarteten – auch jene, die ihn nicht bei seinem Einzug begleiten konnten.
Inzwischen brach die frühe Dämmerung herein – und der Kaiser war noch immer nicht gekommen. Die Laternen vor dem Schloß entzündeten sich. Die Windlichter flammten an den Rändern der Straßen auf. Sie kämpften gegen Nebel, Feuchtigkeit und Wind.
Man wartete, man wartete. Endlich hörte man das regelmäßige Getrappel militärischer Pferdehufe. Man wußte: Es waren die Dreizehner-Dragoner. Ihnen voran ritt der Oberst, sein Säbel glänzte, ein silberner, schmaler Blitz, in der trüben Finsternis – und der Oberst rief: »Platz für den Kaiser!« Hochragend auf seinem braunen Roß, das im Dunkel kaum sichtbar wurde, das weiße, breite Angesicht mit dem großen, schwarzen Schnurrbart über den Köpfen der herandrängenden Menschen, die blanke Waffe in erhobener Hand, von Zeit zu Zeit seinen Ruf: »Platz dem Kaiser!« wiederholend, von Zeit zu Zeit gelblich umschimmert von den flackernden Windlichtern und schnell wieder aus ihrem Leuchtkreis verschwindend, erinnerte er das Volk an den leibhaftigen, kriegerischen, ja grausamen Schutzengel, dessen sich der Kaiser versichert haben mochte. Denn es war dem Volk, als befähle der Kaiser sogar seinen Schutzengeln in dieser Stunde ...
Und da kam auch, begleitet von den Dragonern, schon sein Wagen, auf hurtigen Rädern, deren Rollen erstarb unter dem Getrappel der Hufe.
Man hielt vor dem Schloß.
Als der Kaiser aus dem Wagen stieg, streckten sich ihm viele weiße, offene Hände entgegen. In diesem Augenblick, gebannt von den beschwörenden Händen, verlor er Willen und Bewußtsein. Diese liebenden, weißen Hände, die sich ihm entgegenstreckten, schienen ihm furchtbarer als feindliche und bewaffnete. Jede einzelne Hand war wie ein weißes, liebevolles und sehnsüchtiges Angesicht. Die Liebe der ausgestreckten, blanken Hände strömte dem Kaiser entgegen, eine heftige und gefährliche Beschwörung. Was verlangten diese Hände? Was alles wollten sie von ihm? Diese Hände beteten, forderten und befahlen zugleich: Hände, die man Göttern entgegenstreckt.
Er schloß die Augen und fühlte schon, wie ihn die Hände hoben und wie er auf unbekannten Schultern dahinzuschwanken begann, die Treppe zum Schloß empor, und er hörte noch die wohlbekannte Stimme seines Freundes, des Generals Lavalette: »Sie sind es! Sie sind's! Sie sind's – mein Kaiser!« Er erkannte an der Stimme und am Atem, die ihm zugewandt waren, daß sein Freund rücklings vor ihm die Treppe hinanstieg. Der Kaiser öffnete die Augen – nd er sah die ausgebreiteten Arme seines Freundes Lavalette und die weiße Fläche seines Gesichts.
Er erschrak und schloß wieder die Augen. Einem Schlafenden und Ohnmächtigen ähnlich, erreichte er, getragen, geführt und gestützt, sein altes Zimmer. Schrecken und Glück, also ein schreckliches Glück im Herzen, setzte er sich an den Schreibtisch.
Er sah wie durch einen Nebel einige seiner Freunde im Zimmer. Von der Straße her, hinter den geschlossenen Fenstern, hörte er die lärmenden Rufe des Volkes, das Wiehern der Pferde, das Klirren der Waffen, das helle Klingeln der Sporen, und aus dem Vorzimmer, hinter der hohen, weißen Tür, der gegenüber er saß, Gemurmel und Geflüster vieler Stimmen, und von Zeit zu Zeit war es ihm, als erkenne er diese und jene. Alles nahm er wahr, deutlich und verschwommen, ferne und nah zugleich, und alles beglückte und alles schauderte ihn zu gleicher Zeit. Es war ihm, als sei er endlich heimgekehrt und zugleich weit von irgendeinem Sturm davongetragen worden. Allmählich zwang er sich achtzugeben, befahl er seinen Augen zu beobachten, seinen Ohren zu horchen. Er saß reglos vor dem Schreibtisch. Ihm allein galten die Rufe draußen vor den Fenstern. Seinetwegen standen die Freunde hier im Zimmer und warteten. Seinetwegen murmelten und flüsterten die vielen Stimmen hinter der geschlossenen Tür im Vorzimmer. Auf einmal war es ihm, als sähe er im ganzen großen Lande Frankreich alle, viele Tausende Freunde stehen und warten. Im ganzen Lande riefen Millionen wie hier die Hunderte: »Es lebe der Kaiser!« In allen Zimmern flüsterte, murmelte und sprach man von ihm. Er hätte sich gerne noch ein wenig Muße gegönnt, um über sich so nachzudenken, als wäre er ein Fremder. Da hörte er hinter seinem Rücken auf dem Kamin das regelmäßige und unbarmherzige Ticken der Standuhr. Die Zeit lief – auf einmal begann die Uhr mit ihrer dünnen, wehmütigen Glocke zu schlagen. Es war elf Uhr, eine Stunde vor Mitternacht. Der Kaiser erhob sich.
Er trat zum Fenster. Von allen Türmen der Stadt verkündeten die Glocken die elfte Stunde. Er liebte die Glocken. Seit seiner Kindheit hatte er sie geliebt. Er schätzte die Kirchen gering, er stand ratlos und manchmal sogar furchtsam vor dem Kreuz, aber die Glocken liebte er. Sein Herz antwortete ihnen. Ihre Stimmen machten ihn feierlich. Ihm schien es, daß sie mehr verkündeten als nur die Stunden und die Gottesdienste. Sie waren die Zungen des Himmels. Welcher Irdische verstand ihre goldene Sprache? Jede Stunde schlugen sie fromm, sie allein mochten wissen, welche die entscheidende war. Er blieb am Fenster und genoß ihren mählich verklingenden Nachhall. Dann wandte er sich um. Er ging zur Tür und riß sie auf. Er blieb an der Schwelle stehn und überflog die Gesichter der Versammelten. Da waren sie alle, er erkannte sie, er hatte sie nie vergessen, denn er hatte sie ja selbst geschaffen: der Herzog von Bassano und Cambaceres, die Herzöge von Padua, von Rovigo, von Gaete, die Thibeaudeau, die Decres und Daru und Davout. Er warf einen Blick ins Zimmer zurück, da waren seine Freunde Caulaincourt und Exelmans und der junge, unschuldsvolle Fleury de Chaboulon. – Ach, es gab noch Freunde. Der und jener hatte ihn verraten. War er ein Gott, zu strafen und zu zürnen? Er war nur ein Mensch. Sie aber hielten ihn für einen Gott. Und wie von einem Gott verlangten sie von ihm Zorn und Strafe, und wie von einem Gott erwarteten sie von ihm Verzeihung. Er aber hatte keine Zeit mehr, wie ein Gott zu zürnen und zu strafen und hierauf zu verzeihen. Er hatte keine Zeit. Deutlicher als die Rufe der Menge vor den Fenstern und die vielfältigen Geräusche seiner Dragoner in den Gärten und im Haus hörte er das zarte, aber unbarmherzige Ticken der Standuhr auf dem Kamin hinter seinem Rücken. Er hatte keine Zeit mehr zu strafen. Er hatte nur noch Zeit, zu verzeihen und sich lieben zu lassen, zu schenken und zu geben: Gnaden, Titel und Ämter, alle armseligen Gaben, die ein Kaiser zu vergeben hat. Die Großmut verlangt weniger Zeit als der Zorn. Er war großmütig.
III
Die Glocken schlugen Mitternacht. Die Zeit lief, die Zeit rannte. Das Ministerium! Die Regierung! Der Kaiser mußte eine Regierung haben! Kann man ohne Minister und ohne Freunde regieren? Die Minister, die man bestellt, damit sie andere überwachen, müssen auch noch bewacht werden! Die Freunde, denen man vertraut, werden selber mißtrauisch und erwecken Mißtrauen! Das Volk, das vor den Fenstern jubelt und heute die Nacht zum Tage macht, ist wankelmütig! Der Gott, auf den man vertraut, ist unbekannt und unsichtbar! Jetzt hat der Kaiser das Ministerium: Namen! Namen! Decres verwaltet die Marine und Caulaincourt das Ministerium des Äußeren; Mollieu den Staatsschatz und Gaudin die Finanzen; Carnot wird hoffentlich der Minister des Innern werden; und Cambaceres wird Erzkanzler: Namen! Namen! – Von den Türmen schlägt es eins und zwei, und bald bricht der Morgen an ... Wer wird die Polizei übernehmen?
Eine Polizei braucht der Kaiser, ein Schutzengel genügt nicht. Der Kaiser erinnert sich seines alten Ministers der Polizei, Fouché hieß er. Der Kaiser konnte Befehl geben, den Gehaßten zu verhaften und sogar zu töten. Der hatte ihn verraten. Der kannte alle Geheimnisse im Lande, alle Freunde und alle Feinde des Kaisers. Er konnte verraten und beschützen – und beides zugleich. Ach, alle Freunde, denen man eben noch vertraut hatte, nannten seinen Namen! Er sei geschickt und dem Mächtigen treu, sagten sie. War der Kaiser nicht mächtig? Konnte jemand an seiner Macht zweifeln, und durfte jemand seine Angst sehen? Gab es einen Mann im Lande, den der Kaiser fürchten durfte?
»Holt mir den Fouché!« befahl der Kaiser. »Und laßt mich allein!«
IV
Er sah sich im Zimmer um, zum erstenmal, seitdem er es betreten hatte. Er stellte sich vor den Spiegel. Er sah sein Spiegelbild bis zur Brust. Er runzelte die Brauen, versuchte zu lächeln, prüfte seine Lippen, öffnete den Mund und betrachtete seine weißen, gesunden Zähne. Er kämmte mit den Fingern sein schwarzes Haar in die Stirn, lächelte seinem Spiegelbild zu, der große Kaiser dem großen Kaiser. Er war mit sich zufrieden. Er trat ein paar Schritte zurück und betrachtete sich aufs neue. Er war allein, stark, jung und gesund. Er fürchtete keinen Verräter.
Er ging rundum durch das Zimmer, betrachtete die eben abgerissenen Tapeten, die zerfetzten Lilien des Königs, schmunzelte, hob einen der messingnen Adler hoch, der in der Ecke lehnte, und blieb schließlich vor einem kleinen Altar stehn. Es war ein glattes Stück aus schwarzem Holz. Ein verlorener, ferner Duft von Weihrauch entströmte dem verschlossenen Schubfach, und auf dem Altar stand, weiß und gespenstisch, ein kleines, elfenbeinernes Kruzifix. Unbeweglich, unveränderlich, ewig ragte das knöcherne, spitze, bärtige Angesicht des Gekreuzigten in die unstete, von unsteten Kerzen erhaltene Helligkeit des Zimmers. Sie haben vergessen, den Altar zu entfernen, dachte der Kaiser. Hier hat jeden Morgen der König gekniet. Und Christus hat ihn nicht erhört! »Ich brauche keinen!« sagte der Kaiser plötzlich laut. Und: »Weg mit ihm!« Er hob die Hand. Und es war ihm in diesem Augenblick, als müßte er knien. Und er fegte dennoch in diesem gleichen Augenblick mit einer flachen, wie zur Ohrfeige geöffneten Hand das Kruzifix vom Altar zu Boden. Es fiel auf den schmalen Streifen unbedeckten Parketts, mit trockenem, hartem Schlag. Der Kaiser bückte sich. Das Kreuz war zerbrochen. Mit ausgebreiteten, elfenbeinernen, dünnen Armen, die ihren schmerzlichen Halt nicht mehr hatten, lag auf dem nackten, blonden, schmalen Brett des Parketts der Erlöser, das weiße Bärtchen und die spitze Nase gegen den Plafond gestreckt, nur noch die verschlungenen Beine und Füße am unversehrt gebliebenen Stamm des kleinen Kreuzes.
In diesem Augenblick klopfte es an der Tür, und man meldete den Minister der Polizei.
V
Der Kaiser blieb an der gleichen Stelle stehn. Sein linker Stiefel verdeckte die weißlichen Trümmer des Kruzifixes. Er verschränkte die Arme, wie es seine Art war, wenn er etwas erwartete, wenn er etwas überlegte oder wenn er den Anschein erwecken wollte, daß er etwas überlege. Er hielt sich so selbst gleichsam fest, er fühlte seinen Körper mit seinen eigenen Händen, den Schlag seines Herzens prüfte und ordnete er mit der rechten Hand. Man kannte und liebte diese seine Haltung. Vielhundertmal hatte er sie vor dem Spiegel probiert. Vieltausendmal hatte man ihn so gemalt und gezeichnet. Diese Bilder hingen in vieltausend Stuben, in Frankreich und in allen Ländern der Welt, in Rußland und Ägypten. Ach, er kannte seinen Polizeiminister, den gefährlichen, ungläubigen, alten und ewigen, der niemals jung gewesen war und der niemals geglaubt hatte. Eine dürre, glänzende Spinne, hatte er Netze geflochten und zerstört, zähe, geduldig und ohne Leidenschaft. Den ungläubigsten aller Menschen, den eidbrüchigen Priester, empfing der Kaiser in der Haltung, in der ihn Millionen Gläubige zu sehen gewohnt waren. Da er jetzt die Arme verschränkte, fühlte er nicht nur sich selbst, sondern er ließ auch den Gehaßten den Glauben der Millionen Gläubigen fühlen, die den Kaiser mit seinen verschränkten Armen verehrten und liebten. Als sein eigenes Denkmal erwartete der Kaiser den Minister.
Der Minister stand schon da, er hielt den Kopf geneigt. Der Kaiser rührte sich nicht. Es war, als hätte sich der Minister verneigt, nicht wie man den Kopf beugt vor den Großen, sondern wie man ihn hält, um das Gesicht zu verbergen und wie um irgend etwas auf dem Boden zu suchen. Der Kaiser dachte an das zerbrochene Kruzifix, das sein linker Stiefel verdecken mochte – und vor jedermann gewiß verborgen hätte, nur nicht vor dem Blick dieses Polizisten. Es erschien dem Kaiser unwürdig, seinen Platz zu verlassen, und unwürdig auch, daß er etwas verbarg. »Sehen Sie mir ins Gesicht!« befahl er, und er legte den alten, siegreichen Klang in seine Stimme. Der Minister hob den Kopf. Er hatte ein dürres Gesicht, Augen von unbestimmbarer Farbe, zwischen hell und dunkel, die sich vergeblich bemühten, ganz geöffnet zu sein, dem Zwang der Lider zu widerstehen, die von selbst immer wieder niederfielen, obwohl er sich den Anschein gab, als versuchte er, sie immer wieder zu heben. Seine kaiserliche Uniform war tadellos und vorschriftsmäßig, aber wie um die ungewohnt nächtliche Stunde anzudeuten, in der sich ihr Träger befinden sollte, nicht ganz geschlossen. Wie durch Zufall war ein Knopf an der Weste offen. Der Kaiser sollte diesen Mangel sehn – und er sah ihn auch. »Ordnen Sie Ihr Kleid!« sagte der Kaiser. Der Minister lächelte und schloß den Knopf.
»Majestät!« begann der Minister, »ich bin Ihr Diener!«
»Ein getreuer Diener!« sagte der Kaiser.
»Einer Ihrer treusten!« erwiderte der Minister.
»Man hat nicht viel davon gemerkt«, sagte der Kaiser sanft, »in den letzten zehn Monaten.«
»Aber in den letzten zwei«, antwortete der Minister. »An meinem Glück, Eure Majestät heute hier wiederzusehn, habe ich seit zwei Monaten gearbeitet.«
Der Minister sprach langsam und leise. Er hob nicht, er senkte nicht den Ton. Aus seinem schmalen Mund schlichen die Worte hervor, eine Art rundlicher, wohlgenährter Schatten, stark genug, wahrgenommen zu werden, behutsam genug, um nicht ebenso kräftig zu werden wie die Worte des Kaisers. Seine langen, sacht gekrümmten Hände hielt der Minister hilflos und respektvoll an den Schenkeln. Es war, als verneigte er sich auch mit den Händen.
»Ich habe beschlossen«, sagte der Kaiser; »die Vergangenheit zu begraben. Hören Sie, Fouché? Die Vergangenheit. – Es ist nicht erfreulich.« »Sie ist nicht erfreulich, Majestät.«
Er wird zutraulich, dachte der Kaiser.
»Es wird viel zu tun geben, Fouché«, sagte er. »Man darf den Leuten keine Zeit lassen. Man muß ihnen zuvorkommen. Haben Sie übrigens Nachrichten aus Wien?«
»Schlechte Nachrichten, Majestät«, sagte der Minister. »Der kaiserliche Minister des Äußern, Herr Talleyrand, hat alles verdorben. Dient den Feinden Eurer Majestät besser, als er jemals Eurer Majestät gedient hat. Ich habe ihn nie – Eure Majestät erinnern sich – für ehrlich gehalten. Es wird viel zu tun geben, gewiß! Um all die Aufgaben zu lösen, bedarf es einer festen Hand –«
Fouché hielt seine Hände derart an den Schenkeln und halb geschlossen, als verberge er etwas in ihnen. Die etwas allzu langen, goldenen, gestickten Palmen am Ärmel verbargen wie absichtlich die Handgelenke. Man sah nur die langen, griffigen Finger. – Verräterfinger, dachte der Kaiser. Damit kann man kleine, niederträchtige Zetteleien am Schreibtisch spinnen. Diese Hände haben keine Muskeln. Ich werde ihn nicht zu meinem Außenminister machen! ...
Der Kaiser hatte, während er überlegte, unwillkürlich den Fuß von den Scherben des Kreuzes weggeschoben. Er wollte zum Fenster gehn. Er glaubte zu sehen, daß Fouché aus seinen verdeckten Augen auf das Kreuz schiele, und es war ihm peinlich. Er trat rasch einen Schritt vor, warf das Kinn hoch und sagte, um die Audienz schnell zu beenden, laut und befehlend: »Ich ernenne Sie zu meinem Minister!«
Der Minister blieb unbeweglich. Nur das Lid seines rechten Auges hob sich ein wenig über die Pupille, als wenn es gleichsam erwachte. Es war, als ob sein Auge lauschte und nicht sein Ohr.
In einem Tonfall, der dem Minister von allzu lässiger Selbstverständlichkeit schien, fuhr der Kaiser fort:
»Sie übernehmen das Ministerium der Polizei, das Sie so verdienstvoll geleitet haben.«
In diesem Augenblick fiel das neugierig gehobene Lid wieder über die Pupille. Es verhüllte einen kleinen, grünen Blitz.
Der Minister blieb unbeweglich. – Er überlegt, dachte der Kaiser, er überlegt zu lange.
Endlich verbeugte sich Fouché. Aus einer ganz trockenen Kehle kamen seine Worte:
»Ich freue mich aufrichtig, Eurer Majestät wieder dienen zu dürfen.«
»Auf Wiedersehn, Herzog von Otrante!« sagte der Kaiser.
Fouché erhob sich aus der Verbeugung. Er stand eine geringe Weile starr da, mit ganz geöffneten, gleichsam erstaunten Augen blickte er genau in die Richtung der kaiserlichen Stiefel, zwischen denen die elfenbeinernen Splitter des Kreuzes schimmerten.
Dann ging er.
Er schritt, ein paarmal halbe Grüße mit gesenktem Kopf austeilend, durch das Vorzimmer. Man hörte seinen Tritt nicht. Lautlos ging er, in zarten Schuhen, wie in Strümpfen, die steinernen Stufen hinunter, an den kauernden, hingelagerten, schnarchenden Dragonern vorbei, in den Garten, an den wiehernden und mit den Hufen scharrenden Pferden, an den halberleuchteten Zimmern und an den noch nicht ganz geschlossenen Türen vorbei. Sorgsam wich er dem verstreuten Sattelund Lederzeug aus. Als er vor dem Gitter stand, pfiff er leise. Sein Sekretär kam heran. »Guten Morgen, Gaillard«, sagte er. »Nun sind wir wieder ein bißchen Polizeiminister. Er kann nur Krieg machen und keine Politik! In drei Monaten bin ich mehr als er!« Er wies mit dem Finger rückwärts über die Schulter nach dem Schloß.
»Es sieht schon jetzt aus wie ein Heerlager«, sagte Gaillard.
»Es sieht schon jetzt aus wie ein Krieg«, antwortete der Minister.
»Ja«, sagte Gaillard, »aber wie ein verlorener.«
Nebeneinander, brüderlich, gingen sie die Straße dahin, hinein in den nächtlichen Nebel, heimisch in ihm und bald von ihm verschlungen.
VI
Die Zeit ging unaufhaltsam, hurtiger schien sie dem Kaiser als je zuvor in seinem Leben. Zuweilen hatte er die beschämende Empfindung, daß sie ihm nicht mehr gehorchte wie einst, wie vor Jahren. – Vor Jahren! sagte er sich, und er rechnete nach, und er ertappte sich dabei, daß er zu denken und zu zählen begann wie ein Greis. Früher bestimmte und lenkte er allein den Gang der Stunden, sein Maß hatten sie und seine Fülle, seine Macht und seinen Namen verkündeten sie in vielen Teilen der Welt. Heute gehorchten ihm noch vielleicht die Menschen, die Zeit aber rannte ihm davon, zerfloß und verschwamm, sobald er sie greifen wollte. Vielleicht gehorchten ihm nicht einmal mehr die Menschen! Er hatte sie eine Weile nur freigelassen. Ein paar kurze Monate hatten sie nicht mehr seinen zähmenden und lockenden Blick gespürt, nicht den festen und schmeichelnden Griff seiner Hand, nicht den drohenden und zärtlichen, den grollenden und den lüsternen Ruf seiner Stimme. Gewiß, so war es, sie hatten ihn nicht vergessen – konnte man seinesgleichen vergessen?–, aber sie waren seiner entwöhnt. Ohne ihn hatten sie gelebt, manche auch gegen ihn und im Einvernehmen mit seinen königlichen Feinden. Sie hatten sich daran gewöhnt, ohne ihn zu leben.
Er saß da, allein zwischen vielen und häufig wechselnden Menschen und Freunden. Bald kamen seine Brüder, seine Schwestern, seine Mutter. Die Zeit ging, es wurde heller und wärmer, der Frühling von Paris wurde stark und prächtig, er sah fast aus wie ein Sommer. Die Amseln schmetterten in den Gärten der Tuilerien, bedächtig und schwer begann schon der Flieder zu duften, die Nachtigall vernahm der Kaiser an manchen Abenden, wenn er allein durch den Garten ging, die Hände am Rücken, den Blick gesenkt auf den Kies der Wege. Der Frühling war da. In solchen Stunden fiel ihm ein, daß er ein ganzes Leben den ewigen Wechsel der Jahreszeiten so zur Kenntnis genommen hatte, wie er gewohnt gewesen war, günstige oder ungünstige Gelegenheiten wahrzunehmen, in seinem Sinne ausgeführte oder mißverstandene Befehle, gelungene oder widerwärtige Situationen, wohlwollende oder gehässige Launen der Natur. Die Erde war ein Terrain, der Himmel ein Bundesgenosse oder ein Gegner, der Hügel ein Punkt der Beobachtung, das Tal eine Falle, der Bach ein Hindernis, der Berg eine Deckung, der Wald ein Hinterhalt, die Nacht eine Rast, der Morgen ein Angriff, der Tag eine Schlacht und der Abend ein Sieg oder eine Niederlage. So einfach war es früher gewesen. – Vor Jahren! dachte der Kaiser.
Er kehrte ins Haus zurück. Er wollte das Bild seines Sohnes sehn. Es verlangte ihn in trüben Stunden eher nach seinem Kind als nach seiner Mutter. Außergewöhnlich, wie er war, Erzeugnis einer Willkür der Natur und ihre Ausgeburt, hatte er gleichsam auch ihre Gesetze verkehrt, und er war nicht mehr das Kind seines Geschlechts, sondern geradezu wie der Vater seiner Vorfahren. Von seinem Namen lebten seine Ahnen. Und die Natur war rachsüchtig – er kannte sie! Da sie ihm erlaubt hatte, Glanz den Vorfahren zu verleihen, mußte sie ihn seinen Nachkommen verweigern. – Mein Kind! dachte der Kaiser. Er dachte an seinen Sohn mit der Zärtlichkeit eines Vaters, einer Mutter und mit der eines Kindes. Mein unseliges Kind! dachte der Kaiser. Er ist mein Sohn – ist er auch mein Erbe? – Ist die Natur so wohltätig, daß sie meinesgleichen wiederholt? Ich habe ihn gezeugt, mir ist er geboren. Ich will ihn sehn.
Er betrachtete das Bild, das pausbäckige Antlitz des Königs von Rom. Es war ein braves, rundliches Kind, wie es deren Tausende geben mochte, gesund und unschuldig. Ergeben sahen seine sanften Augen dem noch unbekannten, schrecklichen, schönen und gefährlichen Leben entgegen. Es ist mein Blut! dachte der Kaiser. Er wird nichts mehr zu erobern haben, aber er wird bewahren können. Ich hätte ihm gute Ratschläge zu geben ... Ich kann ihn nicht sehn! ...
Der Kaiser trat zwei Schritte zurück. Es war später Nachmittag, durch die offenen Fenster schwebten die Dämmer ins Zimmer und schlichen langsam die Wände entlang. Das dunkle Kleidchen des kaiserlichen Sohnes verschwamm unsichtbar in ihnen. Bleich leuchtete nur noch sein liebliches und sehr fernes Antlitz.
VII
Auf dem Tisch stand die Sanduhr aus geschliffenem Beryll. Durch ihren schmalen Hals floß der gelbliche, zarte Strahl des Sandes und füllte unaufhaltsam die untere Schale. Sachte schien der Strahl zu fließen; schnell schien sich die untere Schale zu füllen. So hatte der Kaiser seine Feindin, die Zeit, ständig vor Augen. Er vergnügte sich manchmal damit, die Uhr umzustülpen, ehe sie abgelaufen war, ein kindisches Spiel. Er glaubte an die geheimnisvolle Bedeutung der Daten, der Tage, der Stunden. Am zwanzigsten März war er heimgekehrt. Am zwanzigsten März war ihm sein Sohn geboren. An einem zwanzigsten März hatte er einst einen seiner unschuldigen Feinde erschießen lassen, den Herzog von Enghien. Der Kaiser hatte ein gutes Gedächtnis. Die Toten ebenfalls. Wie lange brauchte der Tote noch, um sich zu rächen?