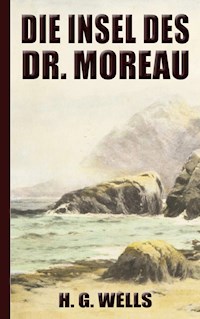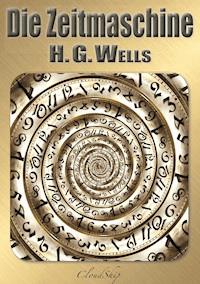Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Cloudship
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Auf einer Schiffspassage im Pazifischen Ozean vor der Küste Südamerikas wird Edward Prendick nach einem Streit mit dem Käpt'n in einem Beiboot ausgesetzt. Er kann sich auf eine nahe Insel retten, auf der andere Passagiere des Segelschiffs an Land gehen. Dort findet er eine seltsame, höchst verstörende Welt vor, in der Zwitterwesen aus Mensch und Tier leben. Urheber des Horrors ist der mysteriöse Doktor Moreau, ein aus London stammender Wissenschaftler, unterstützt von seinem Assistenten Montgomery. Prendick erfährt nach und nach mehr über die Experimente Moreaus; und die Abgründe, die sich vor ihm auftun, werden immer schauderhafter. Die Sache eskaliert, nachdem Moreau von einem seiner Geschöpfe angefallen wird ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 214
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Innentitel
Klappentext
Einleitung
Kapitel 1 – Im Rettungsboot der Lady Vain
Kapitel 2 – Auf dem Weg nach Nirgendwo
Kapitel 3 – Die unheimliche Fratze
Kapitel 4 – An Bord des Schoners
Kapitel 5 – Ankunft bei der Insel
Kapitel 6 – Die grusligen Bootsleute
Kapitel 7 – Die verschlossene Tür
Kapitel 8 – Die Schreie des Pumas
Kapitel 9 – Das Ding in den Wäldern
Kapitel 10 – Ein menschlicher Schrei
Kapitel 11 – Die Jagd auf den Mann
Kapitel 12 – Der Hüter des Gesetzes
Kapitel 13 – Eine Verhandlung
Kapitel 14 – Doktor Moreau erklärt
Kapitel 15 – Über das Volk der Bastarde
Kapitel 16 – Wie die Bastarde Blut leckten
Kapitel 17 – Katastrophe!
Kapitel 18 – Moreaus Auffindung
Kapitel 19 – Montgomerys ›Feierabend‹
Kapitel 20 – Allein mit dem Tiervolk
Kapitel 21 – Der Rückfall des Tiervolks
Kapitel 22 – Als Mensch allein
Über den Autor
Impressum
Fußnoten
Klappentext
Auf einer Schiffspassage im Pazifischen Ozean vor der Küste Südamerikas wird Edward Prendick nach einem Streit mit dem Käpt’n in einem Beiboot ausgesetzt. Er kann sich auf eine nahe Insel retten, auf der andere Passagiere des Segelschiffs an Land gehen. Dort findet er eine seltsame, höchst verstörende Welt vor, in der Zwitterwesen aus Mensch und Tier leben. Urheber des Horrors ist der mysteriöse Doktor Moreau, ein aus London stammender Wissenschaftler, unterstützt von seinem Assistenten Montgomery. Prendick erfährt nach und nach mehr über die Experimente Moreaus; und die Abgründe, die sich vor ihm auftun, werden immer schauderhafter. Die Sache eskaliert, nachdem Moreau von einem seiner Geschöpfe angefallen wird ...
Einleitung
Am 1. Februar 1887 sank die Lady Vain nach Kollision mit einem verlassenen Schiff, etwa auf 1 Grad südlicher Breite und 107 Grad westlicher Länge.
Am 5. Januar 1888 – also elf Monate und vier Tage später – wurde mein Onkel Edward Prendick, ein Privatier, der zweifellos in Callao1 an Bord der Lady Vaingegangen war, und den man für ertrunken gehalten hatte, auf 5° 3’ südlicher Breite und 101° westlicher Länge in einem kleinen, offenen Boot aufgefischt, dessen Name nicht zu entziffern war, das aber vermutlich zu dem vermissten Schoner Ipecacuanhagehört hatte. Sein Bericht klang so seltsam, dass man ihn für übergeschnappt hielt. Später erklärte er, sich vom Moment des Verlassens der Lady Vainan nichts mehr erinnern zu können. Sein Fall wurde damals unter Psychologen als ein merkwürdiges Beispiel für Gedächtnisverlust infolge physischer und geistiger Überanstrengung viel diskutiert. Die folgende Erzählung fand der Unterzeichnete, sein Neffe und Erbe, unter seinen Papieren; es lag ihr jedoch keine ausdrückliche Bitte um Veröffentlichung bei.
Die einzige Insel nahe der Gegend, in der mein Onkel aufgefischt wurde, ist Nobles Isle, ein kleines unbewohntes vulkanisches Eiland. Sie wurde 1891 von der H.M.S. Scorpion besucht. Eine Gruppe von Matrosen landete an, fand aber nichts Lebendiges vor, außer merkwürdigen weißen Nachtschmetterlingen, einigen Schweinen und Kaninchen und ein paar ziemlich seltsam aussehenden Ratten. Also bleibt diese Erzählung in ihren wesentlichen Punkten durch Zeugen unbestätigt.
Dies alles vorausgeschickt, scheint es mir in Ordnung, diese unheimliche Geschichte im Einklang mit den Absichten meines Onkels, wie ich annehme, zu veröffentlichen. Wenigstens Folgendes lässt sich sicher sagen: Mein Onkel verschwand auf etwa 1° südlicher Breite und 107° westlicher Länge aus den Augen der Menschen, und er erschien nach elf Monaten in derselben Gegend des Ozeans wieder. In der Zwischenzeit hat er auf irgendeine Weise überlebt.
Und es hat sich später erwiesen, dass ein Schoner namens Ipecacuanha mit einem betrunkenen Kapitän John Davis im Januar 1887 mit einem Puma und anderen Tieren an Bord aus Arica2 auslief, dass das Schiff auch in verschiedenen Häfen des Südpazifik wohlbekannt war, und dass es (mit einer beträchtlichen Ladung Kopra an Bord) endgültig aus den Meeren verschwand, nachdem es im Dezember 1887, einem Datum, das völlig zu meines Onkels Erzählung passt, von Bayna aus einem unbekannten Schicksal entgegen segelte.
Charles Edward Prendick
(Der Neffe des Autors)
Kapitel 1 – Im Rettungsboot der Lady Vain
Ich habe nicht die Absicht, dem, was bereits über den Untergang der Lady Vain geschrieben wurde, etwas hinzuzufügen. Wie allgemein bekannt, kollidierte sie zehn Tage nach ihrer Ausfahrt aus Callao mit einem treibenden Wrack. Das Beiboot wurde nach achtzehn Tagen vom Kanonenboot I. M. Myrtle mit sieben Mann der Mannschaft aufgefischt, und die Geschichte ihrer Leiden und Entbehrungen ist fast ebenso bekannt geworden wie der weit schrecklichere Fall der Medusa. Ich muss jedoch der bereits veröffentlichten Geschichte der Lady Vain eine andere, ebenso grauenhafte und jedenfalls viel merkwürdigere hinzufügen. Man nahm bisher an, die vier Leute, die im Rettungsboot waren, seien umgekommen. Aber das ist nicht richtig. Ich habe den besten Beweis für diese Behauptung: Ich bin einer von diesen Männern.
Aber zunächst muss ich feststellen, dass im Rettungsboot gar keine vier Leute gewesen sind; es waren drei. Constans, den »der Kapitän ins Rettungsboot springen sah« (Daily News, 17. März 1887), erreichte uns zu unserem Glück und zu seinem Unglück nicht. Er sprang aus einem Gewirr von Tauen unter den Streben des zerschmetterten Bugspriets heraus; ein kleines Seil verfing sich an seinem Knöchel, als er lossprang, und einen Augenblick hing er mit dem Kopf nach unten, dann fiel er und schlug auf einen im Wasser treibenden Block oder Balken. Wir ruderten zu ihm, aber er kam nicht wieder hoch.
Ich sage, ›zum Glück für uns‹ erreichte er uns nicht, und ich könnte beinahe hinzufügen, zum Glück auch für ihn; denn wir hatten nur ein kleines Fass Wasser und etwas nass gewordenen Schiffszwieback bei uns – so plötzlich kam der Alarm, so unvorbereitet war das Schiff auf dieses Desaster gewesen. Wir dachten, die Leute im Langboot seien besser ausgestattet (freilich scheint das nicht der Fall gewesen zu sein), und wir versuchten, sie zu rufen. Sie konnten uns nicht hören, und als sich am nächsten Tag der Sprühnebel auflöste – was erst nach Mittag geschah – , war nichts mehr von ihnen zu sehen. Wir konnten im schwankenden Boot nicht aufstehen, um uns umzusehen. Die See lief in großen rollenden Wellen, und wir hatten alle Hände damit zu tun, ihnen die Spitze des Boots entgegenzuhalten. Die beiden anderen Leute, die sich mit mir zusammen gerettet hatten, waren ein Mann namens Helmar – wie ich ein Passagier –, und ein Matrose, dessen Namen ich nicht mehr weiß; ein kurzer, stämmiger Mann, der stotterte.
Wir trieben hungernd, und nachdem uns das Wasser ausgegangen war, von unerträglichem Durst gequält, acht Tage lang umher. Nach zwei Tagen legte sich die See zu glasiger Ruhe. Der Leser kann sich diese acht Tage wohl kaum vorstellen. Nach einem Tag sprachen wir kaum noch miteinander; wir lagen nur auf unseren Plätzen im Boot und starrten auf den Horizont, oder beobachteten mit Augen, die von Tag zu Tag hohler wurden, das Elend und die Schwäche, die unsere Gefährten übermächtigten. Die Sonne wurde gnadenlos. Am vierten Tag ging das Wasser zu Ende, und wir malten uns schon schreckliche Dinge aus; aber ich glaube, erst am sechsten sprach Helmar aus, was wir alle im Sinn hatten. Unsere Stimmen waren so trocken und dünn, dass wir uns zueinander hinneigten und mit den Worten sparsam umgingen. Ich widersetzte mich mit aller Macht, wollte lieber, wir bohrten das Boot an und kämen zusammen unter den uns folgenden Haien um; aber als Helmar sagte, wenn man seinem Vorschlag folge, hätten wir zu trinken, schloss der Matrose sich ihm an.
Ich wollte aber kein Los ziehen, und nachts flüsterte der Matrose immer wieder mit Helmar. Ich saß im Bug, mein Klappmesser in der Hand – freilich zweifle ich, ob ich das Zeug zum Kampf gehabt hätte. Und am Morgen stimmte ich Helmars Vorschlag zu und wir warfen eine Münze, um den Betreffenden zu finden.
Das Los fiel auf den Matrosen, aber er war der Kräftigste von uns und wollte sich nicht fügen. Er packte Helmar und sie rangen miteinander und standen dabei auf. Ich kroch durchs Boot zu ihnen hin und wollte Helmar helfen, indem ich den Matrosen am Bein festhielt; aber der Matrose kam ins Stolpern, als das Boot schwankte, und die beiden fielen auf den Bootsrand und rollten zusammen über Bord. Sie sanken wie die Steine. Ich erinnere mich, dass ich darüber lachte und mich wunderte, warum ich lachte. Das Lachen packte mich wie etwas, das gar nicht zu mir gehörte, sondern von außen kam.
Ich lag, wie lang weiß ich nicht, auf einer der Ruderbänke und dachte, wenn ich nur die Kraft dazu hätte, würde ich Meerwasser trinken und mich wahnsinnig machen, um schnell zu sterben. Und während ich noch so dalag, sah ich ein Segel über den Horizont auftauchen, aber ich betrachtete es völlig unbeteiligt, als handle es sich um ein Gemälde. Mein Geist muss weggetreten sein, und doch besinne ich mich ziemlich deutlich auf alles, was dann geschah. Ich erinnere mich, wie mein Kopf mit den Wellen schwankte, und wie der Horizont mit dem Segel darüber auf und nieder tanzte. Aber ich entsinne mich nicht minder deutlich, dass ich überzeugt war, tot zu sein; und dass ich darüber sinnierte, welch eine Ironie es doch sei, dass diese Leute, die nur um so knapp zu spät kamen, mich nicht mehr lebendig vorgefunden hatten.
Eine endlose Zeit, so schien es mir, lag ich mit meinem Kopf auf der Ruderbank und beobachtete den tanzenden Schoner – es war ein kleines Schiff, vorn und hinten wie ein Schoner getakelt –, der aus dem Meer heraufkam. Er lavierte in einem immer weiteren Zirkel hin und her, denn er kreuzte gegen den Wind. Es fiel mir keinen Augenblick ein, den Versuch zu machen, die Aufmerksamkeit auf mich zu lenken, und ich erinnere mich dann an nichts mehr genau, bis ich mich in einer kleinen Kabine wiederfand. Ich habe eine dunkle Ahnung davon, wie man mich das Fallreep hinaufhob und wie mich ein großes, rotes Antlitz, mit Sommersprossen gesprenkelt und von rotem Haar umgeben, über die Reling hinweg anstarrte. Auch hatte ich den flüchtigen Eindruck, ein dunkles Gesicht mit eindringlichen Augen zu erkennen, die mir ganz nahe waren; aber das hielt ich für einen Albtraum, bis ich es wieder sah. Ich entsinne mich ferner, dass mir irgendetwas zwischen den Zähnen eingeflößt wurde. Und das ist alles.
Kapitel 2 – Auf dem Weg nach Nirgendwo
Die Kabine, in der ich mich befand, war klein und recht schmuddelig. Ein junger Kerl mit Flachshaar, einem borstigen, strohfarbenen Schnurrbart und hängender Unterlippe saß bei mir und hielt mein Handgelenk. Eine Minute lang blickten wir uns an, ohne zu sprechen. Er hatte wässrige, graue, ausdruckslose Augen.
Dann hörte ich genau über uns ein Geräusch, als wenn ein eisernes Bettgestell umgeworfen wird, und dann das leise, gefährliche Knurren eines großen Tieres. Zugleich sprach der Mann wieder.
Er wiederholte seine Frage: »Wie fühlen Sie sich jetzt?«
Ich glaube, ich sagte, ich würde mich ganz gut fühlen. Ich konnte mich nicht besinnen, wie ich hierher gekommen war. Er muss mir die Frage vom Gesicht abgelesen haben, denn ich brachte kein Wort hervor.
»Sie wurden in einem Boot gefunden – am Verhungern. Auf dem Boot stand der Name Lady Vain, und auf dem Bootsrand waren Blutflecken.« In dem Moment fiel mein Blick auf meine Hand: Sie war so dünn, dass sie wie ein schmutziger, mit losen Knochen gefüllter Lappen aussah, und die ganze Sache mit dem Boot fiel mir wieder ein.
»Nehmen Sie etwas hiervon«, sagte er und gab mir eine Dosis von einem eiskalten roten Zeug.
Es schmeckte wie Blut, aber es schien mich zu stärken.
»Sie hatten Glück«, sagte er, »dass Sie von einem Schiff mit einem Arzt an Bord aufgefischt wurden.« Er sprach mit sabbernder Artikulation und einer Spur von Lispeln.
»Was für ein Schiff ist dies?« fragte ich langsam, heiser vom langen Schweigen.
»Es ist ein kleiner Kauffahrer aus Arica und Callao. Ich habe nicht gefragt, woher er ursprünglich stammt. Aus dem Land der Dummköpfe, vermutlich. Ich selber bin Passagier, von Arica kommend. Der alberne Idiot, dem es gehört – er ist zugleich der Kapitän, heißt Davis – , hat sein Patent verloren oder sowas. Sie kennen die Art Mann – nennt das Ding die Ipecacuanha, dümmlicher Name. Freilich, wenn viel See ist und kein Wind, dann läuft sie ganz ordentlich.«
Da begann oben der Lärm von Neuem: Ein knurrendes Brummen, und gleichzeitig war eine menschliche Stimme zu hören. Dann sagte eine andere Stimme einem ›gottverlassenen Idioten‹, er solle ›aufhören‹.
»Sie waren fast tot«, sagte mein Gegenüber. »Es stand Spitz auf Knopf. Aber ich habe Ihnen einiges Zeug gespritzt. Sehen Sie die Stiche am Arm? Injektionen. Sie waren fast dreißig Stunden weggetreten.«
Mein Gehirn arbeitete träge. Jetzt lenkte mich das Bellen einer Anzahl Hunde ab. »Kann ich feste Nahrung zu mir nehmen?« fragte ich.
»Dank meiner Künste!«, sagte er. »Das Hammelfleisch köchelt schon.«
»Ja«, sagte ich bekräftigend, »ich könnte ein wenig Hammelfleisch vertragen.«
»Aber«, sagte er zögernd, »wissen Sie, ich möchte um mein Leben gern erfahren, wie es kam, dass Sie alleine in dem Boot waren.« Ich meinte, in seinen Augen einen gewissen Verdacht zu lesen.
»Verdammtes Heulen!«
Er verließ die Kabine plötzlich, und ich hörte ihn heftig jemanden schelten, der ihm in Kauderwelsch zu antworten schien. Es klang, als endete die Sache mit Hieben, aber darin, glaube ich, täuschten meine Ohren sich. Dann schrie er die Hunde an und kam gleich darauf in die Kabine zurück.
»Nun?« fragte er in der Tür. »Sie wollten gerade anfangen, mir zu erzählen.«
Ich nannte ihm meinen Namen, Edward Prendick, und sagte ihm, wie ich mich auf die Naturwissenschaft verlegt hatte, um den Stumpfsinn meiner behaglichen Existenz loszuwerden. Das schien ihn zu interessieren. »Ich habe selber ein wenig naturwissenschaftliche Studien betrieben – habe Biologie auf der Universität abgeschlossen – dem Regenwurm die Eierstöcke rausgeholt und der Schnecke die Raspelzunge und all das, lieber Himmel! Vor zehn Jahren war das. Aber weiter, weiter – erzählen Sie mir, was auf dem Boot geschah.«
Er war wie’s schien bezüglich der Aufrichtigkeit meiner Geschichte befriedigt, obgleich ich ziemlich knapp berichtete – denn ich fühlte mich furchtbar schwach –, und als ich zu Ende erzählt hatte, kam er gleich auf das Thema Naturwissenschaft und seine eigenen biologischen Studien zurück. Er begann mich detailliert nach der Tottenham Court Road und der Gower Street zu befragen. »Existiert ›Cablatzi‹ noch? Was für ein Laden das war!«
Er war offenbar ein ganz normaler Student der Medizin gewesen, denn unaufhaltsam steuerte er das Thema Vergnügungslokale an. Er erzählte mir ein paar Anekdoten. »Alles hinter mir gelassen«, sagte er. »Vor zehn Jahren. Wie ulkig alles war! Aber ich habe einen Esel aus mir gemacht ... Hab’ mich aus dem Rennen geworfen, ehe ich einundzwanzig war. Ich kann mir denken, jetzt ist dort alles anders ... Aber ich muss mal nach dem Esel von Koch schauen, was er mit Ihrem Hammelfleisch macht!«
Das Knurren oben begann so plötzlich und mit so wilder Wut von Neuem, dass es mich erschreckte. »Was ist das?« rief ich ihm nach, aber die Tür war schon zugefallen. Er kam mit dem gekochten Hammelfleisch zurück, und ich war vom dem appetitlichen Duft so angeregt, dass ich den Lärm des Tieres schnell vergaß.
Nach einem Tag abwechselnden Schlafens und Essens war ich so weit wiederhergestellt, dass ich aus meiner Koje steigen, an das Bullauge treten und die grünen Wellen sehen konnte, die mit uns Schritt zu halten versuchten. Montgomery – so hieß der flachshaarige Mann – kam wieder herein, als ich dort stand, und ich bat ihn um etwas Anzuziehen. Er lieh mir ein paar Segeltuchsachen von sich, denn das, was ich im Boot getragen hatte, sagte er, sei über Bord geworfen worden. Sie saßen mir ziemlich lose, denn er war breit und langgliedrig.
Er sagte mir beiläufig, der Kapitän läge dreiviertel betrunken in seiner Kabine. Als ich die Kleider entgegennahm, begann ich ihn über den Zielhafen des Schiffes auszufragen. Er sagte, das Schiff solle nach Hawaii fahren, aber es müsse ihn zuerst absetzen.
»Wo?« fragte ich.
»Auf einer Insel ... Ich lebe da. Soweit ich weiß, hat sie keinen Namen.«
Er starrte mich mit hängender Unterlippe an und sah plötzlich so vorsätzlich dumm aus, dass mir schien, er wolle meinen Fragen ausweichen. »Danke«, sagte ich, und er trat aus der Kabine.
Kapitel 3 – Die unheimliche Fratze
Wir traten aus der Kabine. An der Kajütstreppe trafen wir auf einen Mann, der den Weg verstellte. Er stand mit dem Rücken zu uns auf der Schiffsleiter und spähte über die Scherstöcke der Luke. Es war ein missgestalteter, kurzer, breiter, plumper Kerl mit einem Buckel, haarigem Nacken und zwischen den Schultern eingesunkenem Kopf. Er war in robusten dunkelblauen Denimstoff gekleidet und hatte ganz besonders dickes, grobes, schwarzes Haar. Ich hörte die nicht zu sehenden Hunde wütend knurren, und sofort zuckte er zurück und stieß dabei gegen meine Hand, die ich ausstreckte, um ihn mir vom Leib zu halten. Er drehte sich mit animalischer Behändigkeit um.
Das vor mir aufblitzende Gesicht erschreckte mich zutiefst. Es war seltsam entstellt, vorspringend, und erinnerte an eine Schnauze; der große, halb offene Mund zeigte so kräftige weiße Zähne, wie ich sie noch nie in einem menschlichen Mund gesehen hatte. Die Augen waren blutunterlaufen, und kaum ein Ring Weißes lag um die nussbraunen Pupillen. Eine seltsame Glut und Aufregung spiegelte sich in diesem Gesicht.
»Zum Henker!« schimpfte Montgomery. »Warum gehst du nicht aus dem Weg?« Der Mann mit dem schwarzen Gesicht trat ohne ein Wort zur Seite.
Ich stieg weiter die Treppe hinauf und starrte ihn dabei instinktiv, fast gegen meinen Willen an. Montgomery blieb einen Moment am Fuß der Treppe stehen. »Du hast hier nichts verloren, das weißt du«, sagte er bedächtig. »Dein Platz ist vorne.«
Der Schwarzgesichtige duckte sich.
»Die ... wollen mich vorn nicht haben.« Er sprach langsam, mit belegter Stimme.
»Wollen dich vorn nicht haben!« wiederholte Montgomery mit drohender Stimme. »Aber ich sage dir, du gehst!« Er wollte noch etwas hinzufügen, blickte dann aber plötzlich zu mir hoch und folgte mir die Leiter hinauf. Ich hatte angehalten und schaute zurück, noch immer unbändig erstaunt über die groteske Hässlichkeit dieses schwarzgesichtigen Geschöpfes. Ich hatte nie zuvor so ein abstoßendes und verstörendes Gesicht gesehen, und dennoch – wenn man diesen Widerspruch hinnehmen kann – hatte ich gleichzeitig die seltsame Empfindung, als sei ich doch irgendwie schon einmal genau diesen Zügen und Gesten begegnet, die mich jetzt entsetzten.
Später fiel mir ein, dass ich ihn vermutlich zu Augen bekommen hatte, als man mich an Bord hob, doch räumte das meinen Verdacht einer früheren Begegnung nicht aus. Aber andererseits, wie man so ein absurdes Gesicht schon einmal gesehen haben sollte, und dann vergessen, wann und wo das war, das überstieg ebenfalls meine Vorstellungskraft.
Da Montgomery nun Anstalten machte, mir zu folgen, wurde meine Aufmerksamkeit wieder frei, und ich wandte mich um und sah mich auf dem glatten Deck des kleinen Schoners um. Durch die Töne, die ich zuvor gehört hatte, war ich schon teils auf das, was ich nun sah, vorbereitet. Jedenfalls hatte ich noch nie so ein schmutziges Deck gesehen. Es war mit Rübenabfall, Fetzen von grünem Zeug und unbeschreiblichem Schmutz übersät. An den Hauptmast waren mit Ketten eine Anzahl grauer Hetzhunde gefesselt, die jetzt in meine Richtung sprangen und bellten, und ein riesiger Puma war in einen eisernen Käfig am Besanmast3gesperrt, der viel zu eng war, um dem Tier auch nur Raum zu lassen, sich umzudrehen. Außerdem gab es an Steuerbord einige große Ställe mit einer Anzahl Kaninchen, und ein einzelnes Lama war vorn in etwas gequetscht, das mehr eine Schachtel als eine Kiste war. Die Hunde hatten Beißkörbe um die Schnauzen. Das einzige menschliche Wesen an Deck war ein hagerer, schweigsamer Seemann am Steuerrad.
Die geflickten, verdreckten Treibsegel standen stramm im Wind; überhaupt schien das kleine Schiff volle Segel gesetzt zu haben. Der Himmel war klar, die Sonne zur Hälfte hinter den westlichen Horizont getaucht; langlaufende, schaumgekrönte Wogen begleiteten uns. Wir traten am Steuermann vorbei nach Backbord und blickten auf das Wasser, das schäumend unter den Kiel lief, und auf die Blasen, die im Kielwasser tanzten und vergingen. Ich drehte mich um und schaute das ekelhafte Schiffsdeck entlang.
»Ist das hier ein schwimmender Zoo?« fragte ich.
»Sieht fast so aus«, sagte Montgomery.
»Was sollen die wilden Tiere? Handelsgut? Denkt der Kapitän etwa, er kann sie irgendwo in der Südsee loswerden?«
»Danach sieht es aus, nicht wahr?« sagte Montgomery und wandte sich wieder dem Kielwasser zu.
Plötzlich hörten wir von der Schottluke her einen Schrei und eine unflätige Schimpftirade, und der verformte schwarzgesichtige Mensch kam schnell herauf geklettert. Dicht hinter ihm ein massiver, rothaariger Mann mit weißer Mütze. Als sie ersteren sahen, wurden die Hetzhunde, die inzwischen alle das Bellen satt hatten, wieder wild aufgeregt, heulten und sprangen zerrend gegen ihre Ketten. Der Schwarze zögerte vor ihnen, und das gab dem Rothaarigen Gelegenheit, ihn einzuholen und ihm einen fürchterlichen Schlag zwischen die Schulterblätter zu versetzen. Der arme Teufel stürzte hin wie ein gefällter Ochse und rollte im Schmutz zwischen die wütend erregten Hunde. Zu seinem Glück hatten sie Beißkörbe. Der Rothaarige grunzte triumphierend, taumelte und geriet, wie mir schien, wahrlich in Gefahr, entweder rückwärts die Kajütstreppe hinunterzustürzen, oder vorwärts über sein Opfer zu fallen.
Als der zweite Mann aufgetaucht war, fuhr Montgomery heftig dazwischen. »Aufhören da vorn!« schrie er warnend. Ein paar Matrosen waren am Bug zu sehen.
Der Mann mit dem schwarzen Gesicht rollte, merkwürdig jammernd, hilflos zwischen den Pfoten der Hunde umher. Keiner machte Anstalten, ihm zu helfen. Die Bestien taten, die Schnauzen in ihn rammend, ihr Bestes, um ihn in den Wahnsinn zu treiben. Behände tanzten ihre schnellen grauen Leiber über der plumpen, gefällten Gestalt. Und die Matrosen feuerten sie vom Bug her an, als ginge es um ein Sport-Spektakel. Montgomery stieß einen zornigen Laut aus und ging weiter über das Deck. Ich ihm hinterher.
Im nächsten Moment hatte sich der Mann mit dem schwarzen Gesicht aufgerafft und taumelte vorwärts. Er stolperte vor die Wanten4, hielt keuchend an und sah über die Schulter hinweg zu den Hunden zurück. Der Rothaarige grunzte ein befriedigtes Lachen.
»Hören Sie, Käpt’n«, sagte Montgomery, stärker lispelnd als sonst, den Rothaarigen am Ellbogen fassend: »So geht das nicht.«
Ich stand hinter Montgomery. Der Kapitän drehte sich halb um und sah ihn mit den feierlich weggetretenen Augen eines Betrunkenen an. »Was geht nicht?« fragte er; und fügte, nachdem er Montgomery eine Minute lang schläfrig ins Gesicht geblickt hatte, hinzu: »Verdammter Knochensäger!«
Mit einer ruckartigen Bewegung versuchte er, seine Arme freizukriegen, und nach zwei vergeblichen Versuchen stampfte er seine fleckigen Fäuste in die Seitentaschen.
»Der Mann ist Passagier«, sagte Montgomery. »Ich rate Ihnen, die Hände von ihm zu lassen.«
»Fahr’ zur Hölle!« rief der Kapitän laut. Plötzlich drehte er sich um und taumelte gegen die Bordwand. »Mach’ was ich will auf meinem eigenen Schiff«, rief er.
Ich denke, Montgomery hätte ihn jetzt in Ruhe lassen sollen – denn der Bastard war nun einmal betrunken. Aber sein Gesicht wurde nur noch aschfahler und er folgte dem Kapitän zur Reling.
»Passen Sie auf, Käpt’n«, sagte er. »Der Mann gehört zu mir und soll nicht misshandelt werden. Er ist gequält worden, seit er an Bord kam.«
Eine Minute lang hielten seine alkoholischen Dämpfe den Kapitän sprachlos. »Verdammter Knochensäger!« war alles, was er dann zu sagen hatte.
Ich sah, dass Montgomery ein unangenehmes Temperament hatte, und mir war auch klar, dass es sich allmählich zur Weißglut gesteigert hatte.
»Der Mann ist betrunken«, sagte ich, vielleicht zu aufdringlich; »Da können Sie nichts ausrichten.«
Montgomery verzog hässlich seine hängende Lippe. »Er ist immer betrunken. Meinen Sie, das entschuldigt einen Angriff auf einen Passagier?«
»Mein Schiff«, begann der Kapitän, und deutete mit seiner Hand wahllos gegen die Käfige, »war ein sauberes Schiff. Schauen Sie‘s jetzt an.« Es war offensichtlich alles andere als sauber. »Mannschaft«, fuhr der Kapitän fort, »eine saubere, respektable Mannschaft.«
»Sie haben zugestimmt, die Tiere mitzunehmen.«
»Ich wollt’, mir wär Ihre höllische Insel nie vor Augen gekommen. Was zur Hölle ... brauchen Sie Viecher wie diese auf so ‘ner Insel? Und dann Ihr Mann da ... wenn man ihn so nennen kann. Er ist ‘n Verrückter. Und er hat am Heck nichts zu suchen. Bilden Sie sich ein, das ganze verfluchte Schiff gehört Ihnen?«
»Ihre Leute quälen den armen Teufel schon, seit er an Bord kam.«
»Er ist ‘n Teufel, ‘n hässlicher Teufel. Meine Leute können ihn nicht ausstehen. Ich kann ihn nicht ausstehen. Keiner kann ihn ausstehen. Nicht mal Sie selber.«
Montgomery wandte sich ab. »Sie lassen den Mann auf jeden Fall in Ruhe«, sagte er und nickte bekräftigend mit dem Kopf.
Aber nun brauste der Kapitän auf. Er erhob die Stimme: »Wenn er noch mal an dieses Ende des Schiffs kommt, schneid’ ich ihm die Gedärme raus, sage ich Ihnen. Schneid’ ihm seine verdammten Gedärme heraus. Wer sind Sie denn, dass Sie mir Anweisungen geben wollen? Ich sage Ihnen, ich bin der Käpt’n auf diesem Schiff – Käpt’n und Eigner. Ich bin das Gesetz hier, sag’ ich Ihnen – das Gesetz und die Propheten. Ich hab’ den Handel gemacht, einen Mann und seinen Assistenten nach Arica und wieder zurück zu bringen und dabei noch ein paar Tiere mitzunehmen. Ich hab’ nie den Handel gemacht, einen verrückten Teufel und einen albernen Knochensäger zu transportieren.«
Nun, egal wie er Montgomery nannte. Ich sah, wie dieser einen Schritt nach vorne machte und trat dazwischen. »Er ist betrunken«, sagte ich. Der Kapitän begann eine Fluchorgie, noch schlimmer als die erste.
»Halten Sie die Klappe«, sagte ich, während ich mich scharf an ihn wandte, denn ich hatte in Montgomerys bleichem Gesicht Gefahr gesehen. Lieber lenkte ich die Wut auf mich selber.
Jedenfalls war ich froh, etwas zu verhindern, das einer Schlägerei ungemütlich