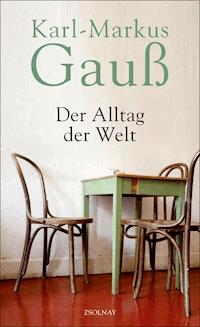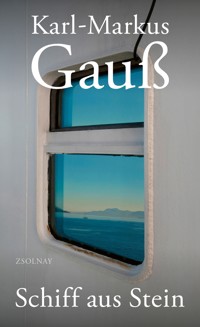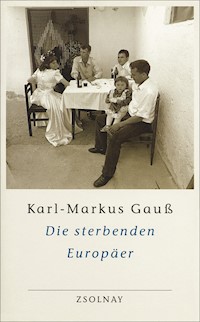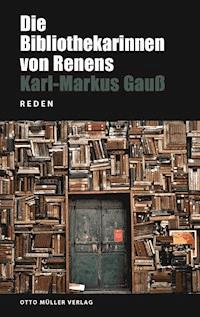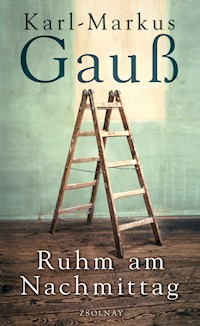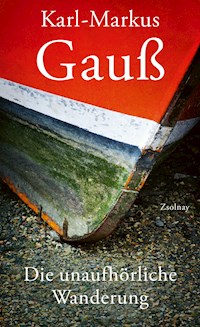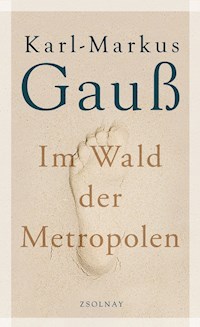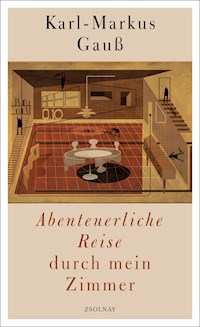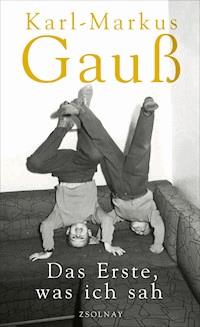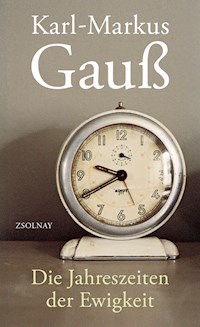
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Karl-Markus Gauß ist ein präziser „Chronist des Alltags“ (NZZ) – In „Die Jahreszeiten der Ewigkeit“ liegen Weltbühne und Ortsbesichtigung nur einen Absatz entfernt. Die Jahre von seinem 60. zu seinem 65. Geburtstag bilden den Rahmen des neuen Journals von Karl-Markus Gauß. Doch verführt er uns, ihm weit zurück in die Geschichte zu folgen und mit ihm den Blick auf die Verwalter der Zukunft zu werfen. Von der Weltbühne zur Ortsbesichtigung ist es für Gauß meist nur ein Absatz: Helmut Schmidts Begräbnis schließt er kurz mit Henry Kissingers Rolle in Vietnam, die Kriegsversehrten, denen er einst auf dem Schulweg begegnete, mit der Flüchtlingskrise von 2015, den Tod eines Freundes mit den digitalen Ingenieuren der Unsterblichkeit. Der vielgerühmte Gauß-Sound: sanft und präzise, abschweifend und von aphoristischer Schärfe. Und immer elegant.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 382
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Karl-Markus Gauß ist ein präziser »Chronist des Alltags« (NZZ) — In »Die Jahreszeiten der Ewigkeit« liegen Weltbühne und Ortsbesichtigung nur einen Absatz entfernt.Die Jahre von seinem 60. zu seinem 65. Geburtstag bilden den Rahmen des neuen Journals von Karl-Markus Gauß. Doch verführt er uns, ihm weit zurück in die Geschichte zu folgen und mit ihm den Blick auf die Verwalter der Zukunft zu werfen.Von der Weltbühne zur Ortsbesichtigung ist es für Gauß meist nur ein Absatz: Helmut Schmidts Begräbnis schließt er kurz mit Henry Kissingers Rolle in Vietnam, die Kriegsversehrten, denen er einst auf dem Schulweg begegnete, mit der Flüchtlingskrise von 2015, den Tod eines Freundes mit den digitalen Ingenieuren der Unsterblichkeit.Der vielgerühmte Gauß-Sound: sanft und präzise, abschweifend und von aphoristischer Schärfe. Und immer elegant.
Karl-Markus Gauß
Die Jahreszeiten der Ewigkeit
Journal
Paul Zsolnay Verlag
Ich protestiere gegen dumme Witzbolde und Leser mit schlechten Absichten.
La Bruyère
Übersicht
Cover
Über das Buch
Titel
Über Karl-Markus Gauß
Impressum
Inhalt
1
Die Mehrheit der Minderheiten
Intermezzo 1
: Sprachen, Wörter
2
Heimatgefühle
Intermezzo 2
: Kleine Charakterkunde
3
Schneller als das Erdbeben
Intermezzo 3
: Lesen und Schreiben
4
Von der Sichtbarkeit
Intermezzo 4
: Skizzen von unterwegs
5
Die Vermeidung der Trostlosigkeit
Epilog
1
Die Mehrheit der Minderheiten
Ich verließ meine Wohnung, ohne überlegt zu haben, ob ich mich vor dem Haustor nach rechts in Richtung Altstadt oder nach links in das vorstädtische Viertel meiner Kindheit begeben sollte. Seit ich das Alter erreicht hatte, in dem ich mich nur mehr selten zu einem bestimmten Termin an einem vereinbarten Ort einfinden musste, überließ ich die Entscheidung immer häufiger den Füßen, die am besten wussten, wohin ich wollte. Es war der Tag im Mai, an dem ich sechzig wurde, als sie mich binnen einer halben Stunde zu dem Schulweg brachten, auf den ich 54 Jahre vorher zum ersten Mal eingebogen war. Er hatte an einem Garten vorbeigeführt, in dem ein wütender Hund tagaus, tagein den Zaun entlangraste, vorbei am Haus des Kriegsversehrten mit dem Holzbein, der in seinem Schmerz, ich weiß nicht, ob über den verlorenen Krieg oder das fehlende Bein, manchmal einen tierischen Schrei hören ließ, vorbei am Brennnesselmeer, das dunkelgrün über die aufgelassene Barackensiedlung flutete und durch das zu waten eine von den Freunden erzwungene Mutprobe war, und vorbei an der Kohlenhandlung, in deren Hof die Kinder der armen Leute auf der schwarzen Erde Fußball spielten, bis sie am Abend, wie wir damals sagten, schwarz wie die Neger geworden waren. Heute war kein Köter zu sehen, die Knochen des Invaliden moderten seit einem halben Jahrhundert in einem Grab, das vermutlich von niemandem mehr besucht wurde oder gar aufgelassen worden war, das Areal der Kohlenhandlung war mit Einfamilienhäusern überbaut worden, die wilden Kinder waren auseinandergestoben und mussten bald das Pensionsalter erreicht haben. Dieser Weg voller Gefahren und Verlockungen war unsere Odyssee gewesen, die Ausfahrt ins Abenteuer, von der wir nur über kühne Umwege heimfinden wollten.
Die Aiglhof-Siedlung, die den Namen des alten Bauerngutes trägt, auf dessen Gelände sie am Beginn des Zweiten Weltkriegs ursprünglich für Aussiedler aus Südtirol, die so genannten Optanten, errichtet wurde, lag betäubt in ihrer vormittäglichen Verlassenheit. In meiner Erinnerung waren immer viele Menschen auf den allesamt nach k. u. k. Generälen benannten Straßen und in ihren kleinen Gärten zu sehen gewesen, es war ein dauerndes Kommen und Gehen und Stehenbleiben und Disputieren vor den zweigeschoßigen Häusern, diese Geselligkeit aller Tage, die die Lebensform des Aiglhofes ausgemacht hatte. Nur wenige hinter dem Rollator trippelnde Alte kamen mir jetzt entgegen, die mich keines Blickes würdigten. Endlich sah ich doch ein junges Paar: eine bleiche, in ihrer Übermüdung wie ausgekargt wirkende Mutter, die von ihrem alleinerziehenden Fünfjährigen behutsam durch die Siedlung geführt wurde.
Zwei unserer jüngeren Freundinnen haben jetzt, ehe es zu spät für sie geworden wäre, doch noch Kinder bekommen. Ich freue mich für sie, nicht weil ich glaubte, dass es die Berufung der Frau wäre, Mutter zu werden; vielmehr weil ich erfahren habe, wie gut einem Kinder tun können. Mich haben die meinen von der schweren Krankheit des Zynismus, die mich an Leib und Seele zu zersetzen drohte, geheilt und vor dem selbst verschuldeten Untergang gerettet. Wer Kinder hat, kann es sich nicht gemütlich in seinem Weltverdruss einrichten und als Kollaborateur des Missglückenden darauf setzen, dass die Dinge ihn schon in der schlechten Meinung, die er von ihnen hat, bestätigen werden. Jeder weiß, dass man Kindern als Gutenachtgeschichte nicht erzählen darf, dass die Welt ungerecht sei, von gewissenlosen Schurken beherrscht werde, das Gute eine Niederlage nach der anderen erleide und wir alle dereinst zu Staub zerfallen werden.
Weil wir dazu neigen, eines Tages selbst zu glauben, was wir erzählen, werden wir endlich überzeugt sein, dass die schöneren Geschichten, die wir uns für sie haben einfallen lassen, die wahren sind. So werden die Kinder zu den Eltern ihrer Eltern, indem sie diese durch ihr schlichtes Hiersein neu erschaffen.
Die Zukunft im Gefrierschrank. Facebook und Google kündigen ihren hochqualifizierten Mitarbeiterinnen einen Zuschuss für den Fall an, dass sie ihre Eizellen einfrieren, ihre Zukunft im Gefrierschrank deponieren und ihren Firmen länger ihre ganze Arbeitskraft zuteil werden lassen. Nicht die Arbeitskraft soll gemäß den Bedürfnissen der Frauen verändert, sondern deren biologischer Lebensbogen den Anforderungen des Betriebs entsprechend ausgetrickst werden.
Was wir zu begreifen haben: Es ist leichter, die Natur des Menschen zu manipulieren, als die sozialen Verhältnisse zu verändern. Der ökonomische Verwertungszwang erweist sich als unveränderlich, er ist Naturgesetz ohne Natur. Was verändert werden kann, das ist die Natur selbst, und wenn wir etwas gelernt haben, dann dies: Was immer gemacht werden kann, das wird gemacht werden.
Dann lieber gar keine Kinder. Der berühmte Modeschöpfer mit dem weißen Zopf, ein Greis mit dem Antlitz einer durch Gerbung haltbar gemachten Jugend, begründet, was zu begründen es keinerlei moralische Verpflichtung gibt, warum er nämlich nie Kinder haben wollte: »Entweder sind sie besser als ich oder schwächer. Beides wäre furchtbar.« Den Narziss kränkt, wenn seine Kinder ihn an Ansehen, Können, Begabung übertreffen; aber es kränkte ihn ebenso, würde ausgerechnet aus den seinen nichts Außergewöhnliches werden. An dem Mann finde ich nichts zu tadeln, er weiß um seine Antriebskräfte und hat das Richtige getan.
Als ich die tangentiale Hauptstraße entlangschritt, in der meine Familie gewohnt hatte, passierte ich das Haus, in dessen erstem Stock H., vier Jahre älter als ich und mit einem meiner Brüder befreundet, aufgewachsen war. Das einzige Kind immerzu besorgter Eltern, einer mageren Frau mit leiser, litaneienhaft beschwörender Stimme und eines nahezu sprachlos aus dem Krieg heimgekehrten Beamten, war früh in einem besonderen Status anerkannt. Bereits als Jüngling hatte er sich den durch nichts mehr zu erschütternden Ruf erworben, grüblerisch in seinem Unglück verfangen zu sein. Er zog erst in mittlerem Alter in einen anderen Stadtteil, nach dem Tod seiner Eltern, zu denen er als Jugendlicher, wenn sie gemeinsam auf der Straße gingen, immer Abstand hielt und gesenkten Hauptes ein paar Meter vor oder hinter ihnen schlurfte, als gehörten die drei nicht zusammen. Manchmal läuft er mir in der Stadt über den Weg, sein Körper ist vom beständigen Unglück aufgeschwemmt und unförmig geworden, aber über dem schaukelnden Doppelkinn sitzt immer noch das Gesicht des traurigen Kindes. Ein Auserwählter der Verzweiflung, hängt er an seinem Unglück, als wäre dies das Meisterstück, das ihm gelungen ist und das von ihm bleiben wird.
Über die Vorzüge der Einkindfamilie doziert in dem witzigen Roman »Unendlichkeit. Die Geschichte eines Augenblicks« von Gabriel Josipovici die Hauptfigur, ein Mr. Pavone, an dessen geistiger Signatur sich die des Komponisten Giacinto Scelsi abzeichnet. Pavone alias Scelsi sagt da: »Jedes Kind sollte ein Einzelkind sein, es sollte, so wie in China, ein Gesetz geben, das es verbietet, mehr als ein Kind zu haben. All der seelische Schmerz, der der Menschheit zugefügt wurde, wurde ihr nicht von Vätern und Müttern zugefügt, sondern von Brüdern und Schwestern. Freud hat, besessen von Vater und Mutter, nie begriffen, welche Kraft den Geschwistern innewohnt.«
Das ist ein bemerkenswerter, fast möchte ich sagen, bemerkenswert italienischer Gedanke. Denn Italien ist ja der Staat, der auf einem Brudermord gründet, der Mythos des alten Rom ist der Mord von Romulus an Remus, der über die Mauer gesprungen war, die ihre Herrschaftsgebiete trennte. Umberto Saba grübelte über dieses Phänomen und sah in der italienischen Geschichte — gerade in der Ära Mussolinis, die er zurückgezogen in seinem Antiquariat in Triest überstand — den unheilvollen Hass der Geschwister aufeinander wirken. Nicht die Autorität, der Vater, die Herrschaft wird attackiert, sondern der Konkurrent um deren Liebe, Achtung, Benefizien. So gedeutet, hätten die Italiener grundsätzlich nicht das Zeug zu Revolutionären, weil sie, buhlend um die Gunst des Führers, nicht diesen, sondern immer nur einander beseitigen möchten, oder, wie Saba sagt: »Die Italiener wollen sich dem Vater hingeben und als Gegenleistung die Erlaubnis von ihm erhalten, die Brüder zu töten.«
Carl Djerassi, der mit dem Ruhm, der »Vater der Anti-Babypille« zu sein, aufrichtig gehadert hat, ist hochbetagt gestorben. Als ich zwei seiner im Alter verfassten literarischen Werke rezensierte, hat er mir, wohlorganisiert in diesen Sachen, binnen weniger Stunden auf digitalem Wege gedankt. Aus jedem seiner Dankessätze sprach jedoch die Bitte, bald noch viel mehr für ihn als unterschätzten Dichter zu tun und es zu meiner Herzensangelegenheit zu machen, für ihn und sein literarisches Schaffen zu fechten. Dieser Mann, der für vieles so begabt war und so vieles zuwege brachte, der Ehrendoktorate in aller Welt einsammelte, steinreich wurde und freigebig Künstlern den Aufenthalt auf seinem kalifornischen Landgut ermöglichte, litt furchtbar darunter, nicht etwa dass er den Nobelpreis für Medizin oder Chemie, sondern den für Literatur verpasste, der ihm als der einzig erstrebenswerte erschien. Er war ein hochprofessioneller Manager seines eigenen Ruhmes, aber der Ausnahmefall eines Narzissten, der wusste, dass er einer war, und der sich nicht scheute, das auszusprechen. Seine drängenden Appelle und Bitten, dass ich mich doch für ihn und sein Schaffen in die Schanze werfen möge, waren unverschämt, aber wie er diese Unverschämtheit selbst einräumte, das war nicht uncharmant.
Die Anti-Natalisten bilden eine philosophische Sekte, deren Lebens-, nein Anti-Lebenslehre David Benatar mit dogmatischer Folgerichtigkeit seiner Argumente formuliert. Durch nichts, schreibt er, sei es zu rechtfertigen, Geschöpfe in die Welt zu setzen, denen das Leben mehr Leid als Glück bescheren werde und die eines Tages, ohne ihre Zustimmung in die Welt geworfen, diese ohne ihre Zustimmung wieder werden verlassen müssen. Beides scheint mir nicht zusammenzupassen, denn wer sein Leben als das reine Unglück erfährt, wird den Tod nicht zu fürchten haben, sondern als das Tor verstehen, durch das es hinaus aus dem Gefängnis führt. Glück empfinden zu können — was viele Menschen für sich in Anspruch nehmen —, hält Benatar für eine biochemisch verursachte Selbsttäuschung, mit der die Evolution die Menschheit zu ihrem eigenen Nachteil ausgestattet hat, ist es doch das größte Unglück der Gattung, dass sie nicht schon längst ausgestorben ist. Daher sind sogar jene, die den Fluch, geboren zu sein, mit dem Glück aufgewogen sehen, vor ihrem Sterben ein Leben gehabt zu haben, in Wahrheit zu bedauern, selbst wenn sie verstockt an der Illusion ihres erbärmlichen Lebensglücks festhalten.
Auch den Konsequenzialisten ist die Kinderlosigkeit ein Gebot. Allerdings nicht weil sie den Menschen lieben und ihm das Leiden, leben und sterben zu müssen, ersparen wollen, sondern der Umwelt zuliebe, der sie den Menschen ersparen möchten, sodass sie am Ende gar keine Umwelt mehr wäre. Kann man dem Planeten Erde durch ein Leben ohne Auto jährlich 1,5 Tonnen CO2 ersparen, wären es durch ein nicht gelebtes Leben, also die energetische Einsparung einer einzigen Existenz, gewaltige 8,4 Tonnen im Jahr. Konsequenzialistisch frage ich mich aber, warum wir durch Selbstabschaffung einem von den Menschen gesäuberten Planeten zu CO2-freier Luft verhelfen sollten? Aus Respekt vor der Materie? Da halten andere Planeten, die nie von der Seuche Mensch befallen wurden, ganz andere Dinge aus. Der Merkur schert sich nicht darum, dass seine Temperatur zwischen 173 Grad minus und 473 Grad plus schwankt. Auf dem Planeten Wasp-18b sind Sauerstoff und Wasserstoff nicht einmal in Spurenelementen vorhanden, dafür das Giftigste des Giftigen, Kohlenstoff-Monoxid, in unvorstellbarer Konzentration. Und über den vor ein paar Jahren entdeckten Stern HD 189.733 ziehen Stürme mit einer Geschwindigkeit von 7000 Kilometern in der Stunde. Die haben das alle ganz ohne Menschen hingekriegt, sodass man zu ihrem Schutz keine Vernichtungsphantasien der Gattung Mensch in die philosophische Tat umzusetzen braucht.
Über die Vernichtungsphantasien, deren intellektuelle Arabesken die Diskussion über Wert und Würde des Lebens, über Schuld und Schande der Menschheit begleiten, gerate ich nachts manchmal ins Grübeln. Denn ich bin zwar ein Kunstschläfer, der überall und fast zu jeder Tages- oder Nachtzeit einschlafen kann, aber alle drei, vier Monate gelingt es mir nicht, und darüber gerät mein Körper so aus dem Gleichgewicht oder meine Seele in solche Unruhe, dass ich gleich mehrere Tage keinen Schlaf mehr finde, nicht in der Nacht, wenn ich mein Herz heftiger klopfen höre, nicht tagsüber, wenn mich leichter Schwindel befällt. Ich stelle dann alles ein, was schädlich ist — das Rauchen, das Trinken von Kaffee oder Alkohol, das beständige Nachschauen, ob das Smartphone eine neue Nachricht für mich hat — und schalte mich auf körperlichen Sparmodus herunter. Es ist merkwürdig, dass ich in dieser Verfassung leichthin Dinge verfassen kann, an denen ich vorher trotz ausdauernden Bemühens gescheitert bin, aber irgendwann lasse ich auch das Schreiben und Denken sein, setze mich in den Lehnstuhl und warte darauf, dass ich nicht mehr bemerke, noch immer wach zu sein. Jetzt werde ich von der Schlaflosigkeit beherrscht, sie füllt mich völlig aus.
Dennoch habe ich mich nie der Gemeinde der Schlaflosen zugerechnet, jener Menschen, die an der Insomnia leiden und dies für eine Auszeichnung halten, weil es die Zugehörigkeit zu einem Stamm der Auserwählten bedeutet. Dieser schlaflosen Elite gehörten und gehören ganz verschieden geartete Menschen an, die paradoxerweise der nämliche Stolz auszeichnet, nämlich dass sie entweder aus Willensstärke mit sehr wenig Schlaf auskommen oder sie unbeabsichtigt gar keinen finden können: Leonardo da Vinci, Nikola Tesla und Ivo Andrić, Napoleon, Hitler, Thatcher, Barack Obama, es wird keine vernünftige Familienaufstellung daraus.
Und natürlich E. M. Cioran, der aus Rumänien stammende französische Aphoristiker, Philosoph, Essayist, der von seiner Schlaflosigkeit wie von einem erlesenen Wein sprach, in dem alle Bitternis seiner Existenz gekeltert war. Cioran verdient die Verehrung, die ihm für Bücher wie »Vom Nachteil, geboren zu sein« von abgeklärten Skeptikern und Genießern stilistischer Brillanz gezollt wird, jedenfalls: Immerhin hat er vor dem Zweiten Weltkrieg in hysterischen Tiraden nur die Vernichtung der Juden gefordert, während er danach, von seinem Antisemitismus bekehrt, die Menschheit selbst als Krebsgeschwür des Planeten erkannte, das es sich verdient habe, ausgemerzt zu werden. Wenn man mit seinen rassistischen Austilgungsphantasien gegen eine einzige oder ein paar Menschengruppen wütet, zieht man sich den Ruf eines Faschisten zu, mit dem sich in postfaschistischen Zeiten nicht gut renommieren lässt; gerät man hingegen in verzückte Raserei, wenn das Menschengeschlecht insgesamt als unwertes Material abgetan wird, dann adelt einen dies zum Denker, der sich nicht scheut, mutig an die dummen Tabus dummer Menschen zu rühren.
Im Radio hörte ich gestern einen berühmten Sohn über seinen verstorbenen Vater sagen: »Er wollte immer helfen, unterstützen und so weiter.« Niemals auf dieses Undsoweiter heruntergebracht zu werden, das ist einer der Wünsche, mit denen ich in mein siebentes Jahrzehnt gehe.
Als ich die Geburtstagsinspektion im Revier meiner Kindheit beendet hatte, kam ich auf dem Heimweg durch den benachbarten Stadtteil Maxglan bei dem geräumigen Haus vorbei, in dem ein Schriftsteller und Maler meines Alters gelebt hatte. Er war ein begabter Kerl und überheblicher Säufer, der seine Frau zuerst methodisch zur Alkoholikerin erzog und sie dann verließ. Nach ihrem Selbstmord ist er aus Salzburg verschwunden, wo er seine Kinder von Verwandten großziehen ließ. Er flüchtete sich ins Hinterland eines Meeres und gab periodisch in Interviews den erfolgreichen Künstler von Welt, während er an alle möglichen Institutionen Bettelbriefe schrieb, aus denen hervorging, dass er nahezu mittellos geworden war und große Entbehrung litt. Vor zwei Jahren ist er gestorben, nach langer Krankheit, die ihm, wie auf Fotos im Internet zu erkennen ist, grausam alles Fleisch von den Knochen geschabt hat.
Ich suchte damals jemanden für meine Zeitschrift, der einen Nachruf auf ihn verfassen wollte, aber ich fand niemanden. Seine Freunde und Freundinnen von früher, geradezu betreten von meiner Anfrage, sagten alle ab, selbst wenn sie mit ihm einst um die Häuser gezogen sind oder im Bett gelegen waren. Alle, die ich auf ihn ansprach, machten abweisende Miene, nicht einmal reden mochten sie über ihn, und wenn ich ihnen doch etwas entlockte, murrten sie nur: Was für ein rücksichtsloser Mensch!
Alles hat er für seinen Traum vom freien Künstlerleben gegeben, aufgegeben, seine Familie, Freunde, bürgerliche Existenz, und als er tot war, zeigte sich tatsächlich niemand bereit, ihm ein gutes Wort nachzurufen. Keinen Einzigen fand ich, dem etwas eingefallen wäre, das sich zur Rechtfertigung dieses Mannes hätte anführen lassen, der in seinen jungen Jahren als Originalgenie durch unsere kleine Stadt ging, für seinen hochmütigen Witz, seine Begabung und seine von Anbeginn wie unanfechtbare Selbstsicherheit bewundert wurde und noch keine sechzig war, als er nahezu vergessen und völlig unbeklagt starb.
Kraftvoll trauern. Zwei Stunden nachdem ihr Mann, der Schauspieler Robin Williams, Selbstmord verübt hat, verlautbart seine eben zur Witwe gewordene Frau über Twitter: »Mein Herz ist gebrochen.« Bewundernswert, welche Kräfte Menschen mit gebrochenen Herzen mobilisieren können, während die Leiber ihrer lieben Verstorbenen noch nicht einmal Zeit hatten zu erkalten.
Hingegen dies. Ein Hochwasser hat einen Landstrich in Norwegen überflutet. Im Fernsehen sieht man ein Dorf, vom Helikopter aus aufgenommen, das unter Wasser steht, einzelne Häuser sind eingestürzt oder fast vollständig mitgerissen worden. Ausgerechnet der Friedhof, der an einem kleinen Hügel angelegt wurde, ragt wie eine Insel des Lebens aus dem aufgewühlten Meer.
Ein kerniger Mann im Gewand des Landarbeiters, der als Bürgermeister vorgestellt wird, tritt vor die Kamera. Und sagt in der Stunde des Unglücks: »Wir haben großes Glück gehabt, dass das Wasser nicht weiter gestiegen und der Friedhof unversehrt geblieben ist. Häuser können wir wieder aufbauen.«
Vom Glück. Nimmt man sich die einschlägigen Ratgeber, therapeutischen Anweisungen, esoterischen Verheißungen vor, die heute Propaganda für das Glück machen, erkennt man bald, dass es darin meist gar nicht um Glück, sondern um Zufriedenheit geht. Um eine zuverlässig zu erreichende mittlere Betriebstemperatur der Maschine Mensch, die mit einer erneuerbaren, im eigenen Seelenkraftwerk hergestellten Energie ausgestattet wird. Gelehrt wird eine besondere Technik der Selbstregulierung, die vor extremen Stimmungen schützt und dem fleißig Lernenden vermittelt, wie er mit sich, den anderen, dem Gegebenen auskommen könne, und dies ein ganzes zufriedenes Leben lang.
Dagegen spricht auch nichts, außer dass Glück etwas anderes ist, nämlich eine Lebensberufung, an der man nicht zweifeln und die man nicht vergessen, aber auch nicht mit dem stumpfen Behagen der Zufriedenheit verwechseln darf. Ich möchte nicht gegen ein verweichlichtes Streben nach Zufriedenheit einen Heroismus des Glücks ausrufen, aber statt sich mit der Zufriedenheit zufriedenzugeben, gilt es doch, den Anspruch auf Glück selbst in glücklosen Zeiten aufrechtzuerhalten. Die Zufriedenheit verspricht, dass einer mit sich keine Scherereien haben und mit den anderen zu einem erträglichen Ausgleich finden werde, sie ist also eine fast schon staatsbürgerliche Art von Wohlbefinden. Das Glück hingegen ist kein solches Beruhigungsmittel, sondern… Sondern.
Das Glück hat eine dürre nervige Cousine, den Spaß, und einen behäbigen selbstgefälligen Vetter, die Zufriedenheit.
Das gute Leben. Wie man es auch theoretisch entwerfen mag, es hat zwei Vorbedingungen, ohne die es praktisch nicht gelingen wird: sinnvolle Tätigkeit und freie Zeit — also Arbeit und Muße.
Die verbesserte Welt. Ein emphatischer junger Ingenieur hält einen Vortrag über die glücklich roboterisierte Welt von morgen. Es wäre gewiss angenehm, wenn Roboter uns die schwere körperliche Arbeit abnähmen und dabei von anderen Robotern überwacht würden, die deren Fehler erkennen und korrigieren. Wie der Techniker redet und redet, gewinne ich den Eindruck, er träume von einer Welt ohne Menschen, weil erst sie eine Welt ohne Fehler wäre. Er spricht sich ins Delir, so grandiose Verbesserungen der verbesserten Roboter schweben ihm vor, in einer sich selbst verbessernden Welt; einer Welt ohne Tragik und Schmerz, denn dies waren ja Störungen, die den fehleranfälligen Menschen charakterisierten, gegen die ein Programm der permanenten Selbstkorrektur die Roboter immunisieren wird. Das menschliche Virus der Fehlbarkeit wird sich in der Welt der Roboter nicht mehr ausbreiten können.
Ja, die beiden würden sich gut verstehen, der namenlose Elektroniker der Weltverbesserung und der Hohepriester der Menschenabschaffung namens Benatar.
Bei einer Wanderung auf den Untersberg ist Georg Daxner ausgerutscht und über einen steilen Steig tödlich abgestürzt. Im Advent hatte er im Salzburger Volksgarten immer seine Zelte aufgestellt und Zirkusgruppen aus aller Welt zu einem Festival eingeladen. Ich erinnere mich, wie ich ihn das erste Mal sah. Es war vor einer Aufführung des Winterfests, als ich einen Mann in einem bunten, karierten Sakko erblickte, der über die Menge schaute, die ins Zelt strömte: interessiert, fast am Sprung, um ordnend einzugreifen, aber zugleich lässig, unaufgeregt, zuversichtlich. Als die Vorstellung zu Ende war, stand er wieder da, als wollte er mit eigenen Augen sehen, dass die Zuseher und Zuseherinnen den Zirkus beschwingt, nein verzaubert verließen.
Mit seinem Einfallsreichtum und seiner fürsorglichen Aufmerksamkeit ist er mir bald als Ideal des Impresarios erschienen. Zwei, drei Mal im Jahr kreuzten sich unsere Wege, und Georg berichtete mir dann mit sich überstürzender Begeisterung von seinen Plänen. Ich widersprach ihm selten, weil ich gegen seine Fähigkeit, sich und uns zu begeistern, nicht ankämpfen wollte.
Verzauberung ist ein Zustand, in dem wir für kurze Frist das Kind in uns wiederentdecken, diesem sein Recht einräumen und uns daran erinnern, dass zum Leben auch das Wunder gehört. Man kann nicht in permanenter Verzauberung existieren, aber bereit sein, sich jeden Augenblick bezaubern zu lassen, was über das ästhetische Empfinden unmittelbar zur Ethik des Alltags führt.
K. schickt mir ein Foto aus Berlin. Vor einer Baustelle haben Sponti ein Transparent aufgehängt: »Für die sofortige Abschaffung des Alltags.« Sie sehen den Alltag als lebensfeindlichen Ort der Pflichten und träumen vom ewigen Feiertag. Was für Kleingeister! Der Alltag ist es, der humanisiert, gefeiert, geliebt zu werden verdient, sonst wird nix draus: nichts aus dem Alltag, nichts aus dem Festtag. Nichts mit dem guten Leben.
Ein Popstar. Tausend Zeitungen haben ihn heute auf dem Titelblatt: den bärtigen Mann von dreißig Jahren mit dunkel schimmernden Augen, der in der einen Hand die Flagge des IS, in der anderen ein Maschinengewehr hält. Das Bild hat das Zeug zur Ikone, es ist der attraktive Che Guevara des Islamismus, den es zeigt. Hochmütig blickt er direkt in die Kamera und wirkt dabei doch entrückt. Er ist Mitglied einer Mörderbande, die verheerende Anschläge verübt und die Bewohner eines Dorfes massakriert hat. Für heute ist er, wonach sich nicht nur Jugendliche sehnen: weltberühmt. So machen die entsetzten und von dem Entsetzen begeisterten Medien Propaganda für den IS.
Vor einem Jahr hat der IS sein Kalifat ausgerufen. Den verfeindeten Geheimdiensten der befreundeten westlichen Staaten blieb das Offenkundige verborgen, dass sich vor ihren Augen eine bestens ausgerüstete militärische Bewegung bildete, die binnen weniger Monate riesige Gebiete erobern würde. Die Soldaten des IS jagen Millionen Menschen in die Flucht, sie haben Abertausende zu Tode gefoltert, auf dem Scheiterhaufen verbrannt, sie öffentlich geköpft, gesteinigt und zahllose Frauen versklavt. Seit Monaten sind bizarre Videos im Netz zu sehen, die die Schlächter selbst anfertigen, nicht allein um ihre Feinde in Angst und Schrecken zu versetzen, sondern auch um in aller Welt Kombattanten zu rekrutieren, die sich nicht trotz dieser Bilder, sondern wegen ihnen der Folterbande anschließen wollen.
Auch aus Österreich sind Jugendliche über die Türkei in den Irak und nach Syrien geschleust worden, die alles dafür gaben, sich endlich als Gotteskrieger austoben zu dürfen. Nach ein paar Monaten möchten die meisten wieder zurück. Was soll man mit ihnen anfangen, die sich blutbesudelt als doppelte Opfer sehen, zuerst Opfer der westlichen Gesellschaft, die ihnen den Respekt verweigert, dann Opfer des IS, der sie als Soldaten im Krieg einsetzen und nicht als Gäste begrüßen will, die ein Anrecht darauf haben, mit Sklavinnen versorgt zu werden.
Rundweg falsch ist es, ihnen zugutezuhalten, dass viele aus übersteigertem, fehlgeleitetem Gerechtigkeitsempfinden in den Krieg gezogen wären. Sie gaben das langweilige Leben zuhause auf, weil sie das Versprechen lockte, ungestraft foltern, vergewaltigen, töten zu dürfen. Der religiöse Fanatismus, zu dem sie, in Glaubensfragen zumeist völlig ahnungslos, über einen islamistischen Crashkurs fanden, ist die Schmierenkomödie, die sie sich dabei selber vorspielen, um das, was sie vorhaben, mit reinem Gewissen tun zu können. Nun haben sie erlebt, dass es zwar geil ist, zu foltern, zu vergewaltigen, zu töten, aber doch nicht so geil, womöglich im Gefecht zu sterben. Da überkam sie das Heimweh nach dem langweiligen Leben zuhause, wo man sich in manch ruhiger Stunde an die Abenteuer der Jugend wird erinnern können.
Der Kommunismus der Toten. Ich hege die Hoffnung, dass der Kommunismus wenigstens im Jenseits ohne seine irdischen Makel, Fehler, Verbrechen verwirklicht werde. Gehe ich über einen Friedhof, erfüllt es mich mit Wohlgefallen, wenn ich auf den Grabsteinen entziffere, dass hier Universitätsprofessoren und Hilfsarbeiter, Reiche und Arme, Bemerkte und Unbemerkte nebeneinander zu liegen gekommen sind. Unter der Erde versammeln sich lauter Ungleiche, doch Gleichgewordene, die einst unterschiedliche Überzeugungen gehegt haben und einander womöglich sogar in Feindschaft zugetan gewesen waren. Schlendere ich zwischen ihren Gräbern, fühle ich das versöhnliche Gefühl in mir wachsen: So verschieden sie im Leben waren, sind sie jetzt doch alle zu den verlorenen, verschwundenen Kindern derselben Erde geworden.
Ich muss aber akzeptieren, dass es in der globalisierten Welt überall Angehörige ethnischer, kultureller, religiöser Gruppen gibt, die nur in gründlich von allem Fremden gesäubertem Gelände bestattet werden möchten. Mir ist dieser Wunsch unverständlich, ich halte ihn für beschränkt, ja für menschenfeindlich über den Tod hinaus. Aber ich akzeptiere natürlich, dass Millionen Muslime, die in Europa leben, es als eines ihrer wichtigsten religiösen Anliegen erachten, dereinst nicht neben den Leichen der Ungläubigen oder Falschgläubigen zu liegen zu kommen. Wie ich auch anerkenne, dass viele Juden aus der nämlichen Vorstellung von Reinheit heraus als Tote unter sich bleiben möchten. Und dass auf dem schönsten Friedhof von Salzburg, dem der Benediktiner von St. Peter, nur die Gebeine getaufter Katholiken bestattet werden dürfen.
Der Wunsch, sich in der modernen Welt mit ihren fließenden Grenzen abzugrenzen, zu separieren, noch im Tode den Kreis der Seinen zu schließen, treibt seltsame Blüten. In Berlin ist der erste Friedhof für Lesbierinnen eröffnet worden, zwölf von ihnen, die noch unter den Irdischen weilen, haben darin bereits ein Bleiberecht für später erworben. Jede Kleinstadt braucht in Wahrheit nicht bloß einen kommunalen und drei oder sechs konfessionelle Friedhöfe, sie braucht Hunderte Friedhöfe, um den zahlreichen Minderheiten, die voneinander unterschieden zu werden begehren, gerecht zu werden: einen Friedhof nur für die Anhängerschaft eines bestimmten Fußballklubs, einen für die Freunde des lateinamerikanischen Turniertanzes, einen für Mitglieder der Selbsthilfegruppe Laktoseunverträglichkeit … Ihr alle, die ihr im Leben mit Menschen auskommen musstet, die anders waren als ihr, könnt euch zuversichtlich ins Jenseits wenden: Wenigstens der Tod wird euch von denen absondern, die gleich euch gestorben sind.
Die Mehrheit besteht aus lauter gesellschaftlichen Minderheiten, das ist neu. Früher bestand die Mehrheit eben aus der Mehrheit, deren Mitglieder sich nicht dadurch definierten, dass sie sich mit ihren Eigenheiten, Überzeugungen, Hobbys, in ihrer Individualität von den anderen unterschieden. Heute aber fühlt sich ein jeder diversen Minderheiten zugehörig und daher mehrfach benachteiligt. Darum fordern wir alle Respekt für uns und die Weise, nach der wir leben möchten, wir fordern die Umgestaltung des öffentlichen Raumes, der Sprachregelungen, des Steuersystems, der Verwaltung gemäß spezifischen Eigenheiten, die wir als die unseren entdeckt haben.
Weil ich etliche Jahre an den Rändern Europas unterwegs war und Bücher über die kleinsten Nationalitäten und Sprachgruppen geschrieben habe, wurde ich manchmal als Minderheiten-Gauß apostrophiert, meist mit spöttischem Unterton. Anfangs war ich tatsächlich nahe daran zu glauben, die Angehörigen von Minderheiten hätten schon durch die bloße Tatsache, nicht zur Mehrheit zu gehören, dieser etwas voraus. Die Bewunderung, die ich für sie empfand, gleich ob ich ihnen auf dem litauischen Land an der Memel nachspürte oder sie in den großen Städten mitten in Europa entdeckte, ist mir mit der Zeit aber selbst verdächtig geworden. Die Romantisierung hat immer etwas Bemächtigendes, weil sie an den Anderen, den Fremden, den Menschen in seiner minoritären Situation nicht das Maß anlegt, das diesem angemessen ist, sondern jenes, dessen wir selbst bedürftig sind. Also müssen ausgerechnet die, die es aus historischen, politischen, sozialen, kulturellen Gründen schwerer haben als wir, nicht allein benachteiligt, sondern strafweise auch noch edler, mutiger, schlichtweg besser sein als wir. Es ist unverschämt, just Benachteiligten die Last aufzubürden, frei von dem berechnenden Egoismus wie der feigen Angepasstheit zu leben, die dem Normalidioten der Mehrheit durchaus heilig ist.
Mittlerweile gibt es jedoch längst nicht mehr nur die leidenden oder um ihre gerechten Anliegen kämpfenden Minderheiten, wir sind vielmehr eine Gesellschaft der Minderheiten geworden. Und wenn etwas den gesellschaftlichen Zusammenhalt bedroht, außer der Schweinerei, dass sich eine Minderheit von Profiteuren den Reichtum der Gesellschaft unter den Nagel reißt, dann ist es der Aufstand der hunderterlei Minderheiten.
Jeder von uns gehört mehreren an und bekommt es fortwährend mit Angehörigen anderer Minderheiten zu tun, die ihre Interessen vom Staat ebenfalls nicht hinreichend berücksichtigt und ihre Eigenheit von der Gesellschaft zu wenig gewürdigt sehen: die Anwohner des Flughafens, die sich gerichtlich gegen den Lärm wehren, die Reisenden der Billig-Airlines, die sich das Menschenrecht auf Direktflüge nach Antalya nicht nehmen lassen wollen, Nichtraucher, die das Rauchen auch in Räumlichkeiten verbieten möchten, die sie selbst nie aufsuchen, Raucher, die ihrem Laster überall frönen zu dürfen als Probe auf die Freiheit selbst verstehen, Eltern, die um die Gesundheit ihrer Kinder in Kindergarten und Schule bangen, und Eltern, die Impfungen gegen die hochansteckenden Masern oder andere Infektionen als Anschlag auf die körperliche Unversehrtheit ihrer Kinder verweigern … Jeder hat recht, wenn er sein Recht einfordert, aber alle zusammen kämpfen sie trotzdem nicht für eine gerechte Gesellschaft, was immer das sei.
Die kulturellen Minderheiten überwiegen die sozialen inzwischen bei weitem, dabei war schon die Aufspaltung der sozialen Schichten, von denen es einst nicht sehr viele gegeben hat und die zudem relativ homogen waren, ein folgenreicher Akt der gesellschaftlichen Differenzierung. Und jetzt: Wohin man sieht, lauter Minderheiten! Welche Parteien könnten sie, ihrer aller Interessen verfechtend, noch zu einer neuen Mehrheit vereinen? Jene sicher nicht, die es sich zum Anliegen machen, wechselnden diskriminierten Gruppen ihre Unterstützung anzubieten. Denn die meisten Minderheiten schätzen die meisten Minderheiten nicht.
Selbstmordattentäter. Er tritt heute meist als frömmlerischer Djihadist auf, der möglichst viele Unbeteiligte in die Luft sprengt, darunter auch sich selbst als den einzigen nicht zufällig Beteiligten. Dennoch stellt er weniger ein religiöses als ein popkulturelles Phänomen dar, das ohne die digitalen Netzwerke niemals weltweite Popularität erlangen hätte können. In Wahrheit wollen die frommen Attentäter, die unpolitischen Massakrierer von der amerikanischen Highschool und der deutsche Copilot, der eine Maschine mit 140 Passagieren gegen den Fels steuerte, nämlich dasselbe: Rache nehmen für die Kränkung, die drei Minuten Berühmtheit, die jedem versprochen sind, nicht erlangt zu haben, und eine möglichst große Begleittruppe mit in den feigen Abgang reißen, denn allein zu sterben ist schwer.
Unser Gotteskrieger. Er sagt, er wolle ins Paradies. In Wahrheit will er nur nicht in Dinslaken bleiben.
Es war ein vom Hochnebel in Grau gehaltener Tag und im Friedhof St. Peter war es, mitten in der geschäftigen Stadt, mit einem Mal so still, dass ich den wütenden Schrei der Krähen hörte, die vor der silbernen Felswand, an die der Friedhof gebaut ist, ihre Kreise zogen. Dann sah ich die kleine Urlauber-Familie langsam durch den Friedhof schreiten, voran ein vitaler Mann um die sechzig, mit langen grauen Haarsträhnen, dann eine verblassend blonde Frau, in deren wallender Kleidung das Hippiemädchen von einst steckte, und endlich dieser zehnjährige pummelige Bub, das verträumte Kind seiner relativ alten Eltern. Er verschlang ein riesiges Sandwich, dessen Mayonnaise sich gelb in seinen Mundwinkeln sammelte, und stupste dabei mit der Schuhspitze mechanisch an die steinerne Einfassung des Grabes, vor dem er stehen geblieben war; der Vater hielt einen der Plastikbecher von Starbucks in der Hand, mit denen es Mode wurde, Kaffee in Biermengen zu saufen, und die Frau stapfte rauchend zwischen den Gräbern herum. Ich geriet in Zorn über die mampfende, schlürfende, paffende Achtlosigkeit der drei, obwohl ich natürlich wusste, dass er völlig unberechtigt in mir hochschoss.
Mein Geheimnis. Manchmal male ich mir aus, wie ich einen Gewalttäter, einen Brutalinski, einen ungehobelten Lackel in die Schranken weise. Zuerst fertige ich ihn mit höhnischen Worten ab und reize ihn mit verächtlichen Gesten, auf dass ich ihm, wenn er mich endlich attackieren möchte, blitzschnell zuvorkomme. Ich sage zu einem Mann mit Sakko und Krawatte, der sich am Marktstand vordrängt, dass er ein Neandertaler sei, der sich ins 21. Jahrhundert verirrt habe, und wenn er sich aufplustert, trete ich ihm lächelnd gegen das Schienbein, ramme ihm das Knie in den Unterleib, drehe ihn mit festem Griff am Ohr von mir weg und befördere ihn mit einem Tritt in die Gosse. Ich tue das aber nur, wenn es sich um Gewalttäter handelt. Gewalttäter in Taten oder mit Worten. Oder durch ihre Absichten, die sie vor mir nicht verbergen können. Es ist also die Notwehr der Zivilisation selbst, die mich zu ihrem Werkzeug erkoren hat.
Mein Feind. Bei einer Einladung saß ich abends einem Mann gegenüber, der mir beständig recht gab, buchstäblich bei allem, was ich sagte. Er nickte zustimmend, wenn ich etwas Belangloses von mir gegeben hatte, er bekräftigte mich, wenn ich auf fragwürdigen Behauptungen beharrte, und gab mir stets auf eine Weise recht, als wolle er sich dafür bedanken, dass ich etwas aussprach, was er selbst sich schon lange gedacht hatte. Wir tranken und prosteten einander zu, ich schwadronierte dahin, und er gab mir recht. Er stimmte mir gewissermaßen prinzipiell zu, was ich in eitler Verblendung erst nach einiger Zeit bemerkte. Dann fragte ich mich, ob er der geborene Haussklave war, der auch jedem anderen zugestimmt hätte, oder es speziell auf mich abgesehen hatte: als mein Feind, der mich durch beständigen Zuspruch demoralisieren wollte.
Störung der Totenruhe. Im Fernsehen ist ein spanischer Archäologe zu sehen, wie er ergriffen über das streicht, was vom Rückgrat eines vor 500 Jahren verstorbenen Menschen übrig geblieben ist und aus einem Grab in der Kirche der Trinitarierinnen in Madrid hervorgekratzt wurde. Die Knochen von beiläufig 15 Toten wurden hier gesichtet, gesichert und bewertet, um die eines einzigen zum vollständigen Gerippe ordnen zu können. Was da liegt, soll das Skelett von Cervantes sein, genau weiß man es nicht, weil keine Nachfahren von ihm mehr leben oder ausfindig zu machen wären, mit deren Genen das in den Knochen aus der Kirche gespeicherte Erbgut verglichen werden könnte. Um schamlos die Knochen eines Mannes zu betrachten, der nicht geschrieben hat, damit wir selig vor seinem Knochenwerk erschauern, werkten etliche Archäologen monatelang und wurden 14 weitere Menschen der Totenruhe entrissen. Man wird ihn nicht mehr lesen, aber seine Knochen bestaunen. Triumph der Nachwelt: Sie bemächtigt sich des Wehrlosen, dem sie zu huldigen behauptet.
Die Wehrlosen. Auf dem Gate des Flughafens Wien wartete ich darauf, dass die Maschine nach L’viv aufgerufen wird. Mir gegenüber saß eine Dreißigjährige, die eingenickt war. Sie war auf der durchbeulten Bank mit dem Gesäß nach vorne gerutscht, sodass sie gleichsam ihre Scham und ihr Gesicht präsentierte, den Unterkiefer hinuntergeklappt, die obere Reihe der Zähne entblößt, die geschlossenen Augen himmel- oder gottwärts gerichtet wie eine Sterbende.
Der Schlafende ist im Besitz der äußersten Wehrlosigkeit. Man glaubt, selbst der Böswillige müsse vor dieser Wehrlosigkeit resignieren und sich abwenden. Aber es ist anders, denn er fühlt sich durch den Anblick des Schlafenden verlockt, ihn zu schänden. Und macht er ihm auch nicht den Garaus, indem er ihn erschlägt, und stiehlt er ihm auch nicht seine Habseligkeiten, verletzt er doch seine Integrität, indem er von ihm, der sich in diesem Augenblick nicht wehren kann, ein Foto schießt und es dem ewigen Archiv des Internet einspeist.
Flughafen und Tod. Am Flughafen, in dem Tausende entweder von einem Terminal zum anderen hasten oder in abgestumpfter Trägheit erstarrt sind, vermeine ich oft den Hauch des Todes zu verspüren. Nicht dass ich den Absturz, den Abflug in den Tod fürchtete. Eher hat es mit der Ortlosigkeit dieses Ortes zu tun, damit, dass wir hier keine Spur unserer Anwesenheit hinterlassen können, und dabei leben wir doch mit dem Anspruch, sichtbar zu werden, sichtbar zu bleiben.
Ob auf dem Flughafen viele Menschen sterben? Wie der König aller Schnellschreiber, Manuel Vázquez Montalbán, der über hundert Bücher und rund achttausend Zeitungsartikel veröffentlichte? Auf die Schnelle sind ihm dabei erstaunlich originelle, kluge und witzige Bücher gelungen, ehe ihn auf dem Flughafen Bangkok jener tödliche Herzinfarkt einholte, vor dem er, wie eine nahe Freundin und Internistin in einem Film über ihn sagte, seit Jahren auf der Flucht gewesen war. Ich habe vor langem zwei, drei seiner historischen Romane gelesen, die wohlrecherchiert, mit gedankenreichen Passagen versetzt und unterhaltsam sind, und auch einen der Kriminalromane, die ihn weltberühmt und reich machten: diese Serie um den Privatdetektiv Pepe Carvalho, der sich am liebsten in den Ramblas von Barcelona herumtreibt, sarkastisch die Ära der Transición, des Übergangs vom Frankismus zur Demokratie, kommentiert und nebenbei Mordfälle aufklärt, während er hauptsächlich damit beschäftigt ist, sich in Lokalen durch umfangreiche Menüs zu essen oder zuhause am Herd zu stehen und zu kochen.
Niemals hat ein Kommunist das gute Leben so konsequent mit dem Kulinarischen verbunden und Speisen wie Getränke mit solch liebevoller Hingabe beschrieben wie Vázquez Montalbán. Es sind exquisite Speisen, die Pepe Carvalho sucht, aber mehr noch die einfachen Gerichte der Region, die Vázquez Montalbán rühmt, der einer katalanischen Kochkunst nachspürte, die gerade dabei war, verlorenzugehen. Die linke Bewegung hat sich früh aufgespaltet, schon Jahrhunderte ehe dieser Begriff erfunden wurde, und auf der einen Seite einen revolutionären Asketismus propagiert, auf der anderen ein besseres Leben für alle gefordert. Die einen wurden in ihrem revolutionären Streben vom Hass auf die Reichen beflügelt, die sündhaft prassen, die anderen verlangten mit Heinrich Heine Zuckererbsen für alle Menschenkinder. Vázquez Montalbán hat mit ausgeprägt sozialem Appetit verfochten, dass sich die Revolte nicht mit dem Verzicht, sondern dem Genuss verschwistere.
Der berühmte, von der österreichischen Justiz bis nahe an die Vernichtung seiner bürgerlichen Existenz verfolgte, stets von einer Schar ihm ergebener Gefolgsleute begleitete Tierrechtler Martin Balluch verkündet in einem Interview über den Wert des Essens: »Mir ist es wirklich egal, was ich esse, wenn es mir nur Energie liefert.« Wie er es sagt, scheint er, ein Saint-Just der Askese, stolz darauf zu sein, dass ihm Nahrungsaufnahme nur als Energiezufuhr etwas gilt und er alles, was nicht dazu dient, seine Maschine namens Körper am Laufen zu erhalten, als überflüssige Vergeudung sieht.
Es ist ein Verbrechen, dass es Tierfabriken gibt, in denen Tiere mit Hormonen und Antibiotika vollgestopft, in digital hochgerüstete Ställe und Legebatterien gepfercht werden. Es ist ein Verbrechen, dass die landwirtschaftlichen Flächen der Erde von einer oligarchischen Agrarindustrie in Besitz genommen werden, die die Böden vergiftet, die Kleinbauern in den Ruin treibt. Ach, es gibt Anlass genug, dass einem beim Essen der Appetit vergehe. Aber nach etlichen Tausend Jahren der Zivilisierung stolz darauf zu sein, dass einer alles fressen kann, wenn es ihm nur Energie liefert, ist ein Armutszeugnis sondergleichen. Da prahlt einer damit, dass ihm die Fülle des Lebens einzig dazu dient, ihr das Nützliche abzupressen.
Vielleicht wird in fünfzig, in 250 Jahren das Tier als Verwandter des Menschen geachtet werden, den zu töten und zu verzehren als barbarischer Akt gebannt ist wie heute der Kannibalismus. Aber mögen es nicht die Bußprediger der Askese sein, die uns diesen moralischen Fortschritt bescheren!
Eine spät bekehrte Vegetarierin berichtet im Fernsehen von ihrem Erweckungserlebnis. Sie habe mit einem Bekannten in einem teuren Restaurant zu Abend gegessen und sich auf einmal, zu ihrer eigenen Bestürzung, vor diesem schmatzenden, sich die Fleischstücke schwitzend in den Rachen stopfenden Mann so geekelt, dass sie wortlos aufstand und zur Toilette eilte, um sich zu erbrechen.
Sie ist eine unauffällige Mittvierzigerin, die erst, indem sie von der moralisch-vegetativen Revolte ihres Körpers erzählt, zur strahlenden Rachegöttin erwacht, fast dass Funken der Entrüstung aus ihren dunklen Augen schössen. Ich sehe, dass es sie jetzt noch schüttelt vor Ekel, und frage mich, was der Bekannte zu sagen haben würde, an dem sich so heftige Abscheu entzündete, dass es zum Umsturz einer Lebenshaltung ausreichte, ein Titan der Unappetitlichkeit, der seiner Begleiterin, von der er vielleicht hoffte, sie mit einem Festmahl für eine Liebesnacht gewogen zu stimmen, auf den empfindlichen Magen geschlagen ist. Es war der Ekel vor diesem bestimmten Menschen, der sie zur Vegetarierin werden ließ, der Respekt vor dem Tier im Allgemeinen kam erst später dazu und hätte alleine nicht ausgereicht. Konvertiten, die spät und aus Enttäuschung den Glauben wechseln, neigen zu Fanatismus, da lobe ich mir die frühberufene Vegetarierin, die ich schon von ihrem ersten Tag an kenne, sie hat mit elf Jahren beschlossen, der lieben Tiere wegen kein Fleisch mehr zu essen, und hält sich bis heute daran, da sie ihren fleischfressenden Gästen durchaus nicht bloß mit Gemüseplatten aufwartet.
Wenn ich niedergeschlagen bin und von den politischen Nachrichten genug habe, blättere ich in der Neuen Zürcher Zeitung zu den Todesanzeigen weiter, um zuverlässige Aufmunterung zu erfahren. Heute war einer Parte ein Gedicht von Ludwig Christoph Heinrich Hölty angefügt:
O wunderschön ist Gottes Erde,
und wert, darauf vergnügt zu sein;
drum will ich, bis ich Asche werde,
mich dieser schönen Erde freuen.
Nachdem ich das gelesen hatte, stieg ich im Wohnzimmer auf die Leiter, um im Regal mit den deutschen Klassikern nachzusehen, ob ich nicht einen Band Höltys hatte, und tatsächlich, da stand er ja, eine jener Ausgaben mit Goldprägung, die ich als Schüler und Student auf Flohmärkten kaufte, von denen ich mich auf zufällig gefundene Fährten setzen ließ und die bereits damals nicht viel kosteten. Heute bekommt man sie nahezu geschenkt, sie gelten als unverkäuflich, weil es immer weniger Menschen gibt, die sich für Literatur, zumal für die, die vor mehr als hundert Jahren geschrieben wurde, interessieren, und weil die Jüngeren die damalige Druckschrift gar nicht mehr lesen können. Ich blätterte ein wenig in dem Buch und stieß auf das Gedicht »Lebenspflichten«.
Ungewisser, kurzer Daur
Ist dies Erdenleben;
Und zur Freude, nicht zur Traur
Uns von Gott gegeben.
Der all dies so schlicht und schön schrieb, dass es nach 250 Jahren unmittelbar zu mir spricht, wurde selbst nur 28 Jahre alt. Er soll verunstaltet, abgrundtief hässlich, aber kindlich heiteren, weltfreundlichen Wesens gewesen sein. Lenau schrieb, als er von seinem Tod erfuhr: »Hölty! dein Freund, der Frühling, ist gekommen. Klagend irrt er im Haine, dich zu finden.« Herrlich, der Düsterste der Düsteren, Lenau, spricht vom Freund des Frühlings!
Vor Jahren ging ich in Wien über den Friedhof Hernals, um einmal vor dem Grab des Philosophen und Schriftstellers Günther Anders zu stehen. Meinem zweiten Journal, »Von nah, von fern. Ein Jahresbuch«, hatte ich 2003 eine Notiz von ihm als mein eigenes Credo vorangestellt, weil es, was mich selbst täglich an den Schreibtisch führt, in präziser Verknappung fasst: »Nicht deshalb bricht er auf, weil er ein Ziel vor Augen sieht, sondern weil er keines vor Augen sieht. Aber um eines zu sehen. Nicht deshalb greift er zur Feder, weil er eine Einsicht hat, sondern weil er keine hat. Aber um eine zu gewinnen.«
Statt seines Grabes, das ich auf dem ersten Rundgang nicht fand, entdeckte ich das eines Salzburger Landsmannes, um den es mehr Legenden als gesichertes Wissen gibt. Ob der 1850 verstorbene Dichter Ferdinand Sauter so abgehaust war, wie die Legende geht, und er seine Gedichte tatsächlich in den Wirtshäusern für ein paar Gläser Wein aus dem Stegreif schuf, ist fraglich, aber die Verse, die auf seinem Grabstein stehen, sind jedenfalls beste österreichische Literatur und universale Lebenskunst:
Viel genossen, viel gelitten,
Und das Glück lag in der Mitten;
Viel empfunden, nichts erworben,
Froh gelebt und leicht gestorben.
Frag nicht nach der Zahl der Jahre,
Kein Kalender ist die Bahre,
Und der Mensch im Leichentuch
Bleibt ein zugeklapptes Buch.
Deshalb, Wandrer, zieh doch weiter,
Denn Verwesung stimmt nicht heiter.
Es ist drei Uhr früh, und seitdem ich, gerade erst eingenickt, aus dem Schlaf auffuhr, spüre ich diese Beklemmung in der Brust. Ich gehe ins Bad und werfe zwei Aspirin C in das Glas Wasser. Mit leisem Zischen lösen sich die Tabletten auf, sie schaukeln von einer zur anderen Seite, als würden sie sich dagegen wehren, aufgelöst zu werden. Ich schaue in das Glas und denke mir im schmerzenden Neonlicht, das ist das Leben, das nicht aufgeben will, und das ist am Ende doch der Tod: die Auflösung. Dann trinke ich den Tod zum Zwecke des Überlebens in großen Schlucken.
Lazarus. Von allen Geschichten um das Leben Jesu beeindruckte mich als Kind keine so sehr wie die von Lazarus, der vier Tage tot ist und dessen in Tüchern gehüllte Leiche bereits zu stinken begonnen hat. Jesus aber sagt zu ihm: Steh auf und geh! Und Lazarus erhebt sich und tritt mit seinen Totenflecken wieder unter die Lebenden.
Das Herrliche ist, dass Lazarus nicht ins ewige Leben ein-, sondern ins irdische zurückkehrt. Sein irdisches Leben, so schwer es war, möchte der Mensch noch einmal haben, nicht das jenseitige, ewige gewinnen.
Hat auch die Ewigkeit ihre Jahreszeiten? Der Opa war zwar gestorben und in die Ewigkeit eingegangen, aber ihm wurden nach seinem Tod noch Enkel geboren. Als Kind stellte ich mir vor, dass die Ewigkeit ihren Frühling, ihren Sommer, Herbst und Winter haben werde, auch sie würde, wie ich an allem Lebendigen beobachten konnte, wachsen und vergehen und in neuer Gestalt wiederkehren. Das kann nicht sein, wies mich der Bruder zurecht, denn die Ewigkeit, das ist eben die Endlosigkeit des Endlosen, sonst wäre sie ja nicht ewig. Sie gefiel mir nicht, diese Ewigkeit, die Zeit war mir lieber, und ich bin, so lange es nur ging (und weitergehen mag), ihr Anhänger geblieben, der sie gegen die Ewigkeit verteidigen will.