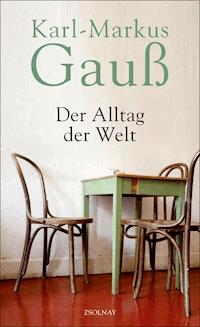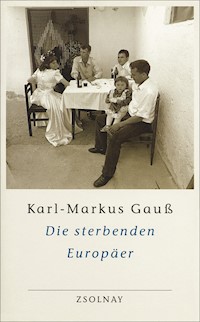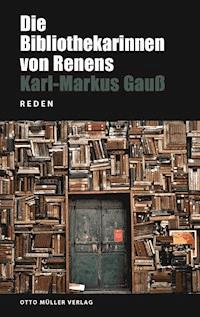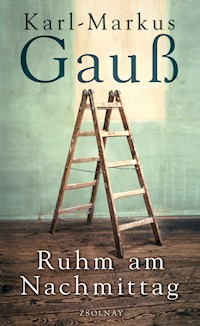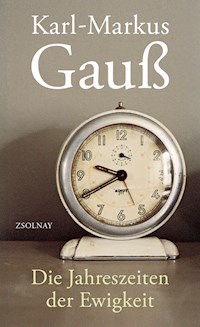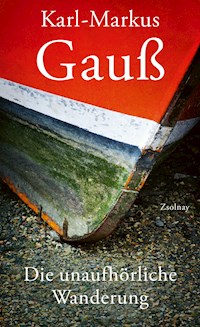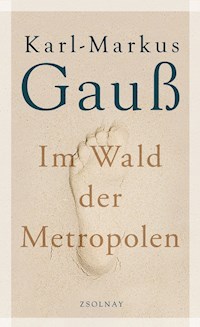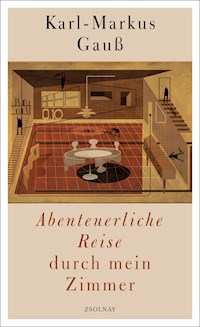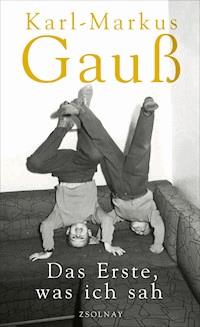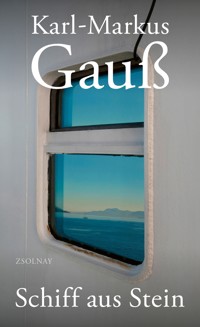
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Karl-Markus Gauß – Träger des Leipziger Buchpreises – findet die Zusammenhänge im unmerklichen Detail. Miniaturen von unterwegs, die Momente des Glücks beschwören und das Staunen lehren. Orte, an denen sich Wundersames ereignet, und Träume, die ins Leben wirken. Karl-Markus Gauß erzählt von der „Kunstesserin“ in einer Wiener Trattoria, von einem Friedhof im Osten Europas, der letzten Zigarette seines Vaters, der „Schönheit hässlicher Städte“: Stets sieht er die Zusammenhänge im unmerklichen Detail und zeigt das Leben in der Schwebe zwischen Wirklichkeit und Traum. In suggestiver Sprache fasst Gauß die Themen, mit denen er berühmt wurde, auf überraschende und ganz neue Weise. „So gelangt man bald hierhin, bald dorthin, auf einer Reise ohne Ankunftszeit, in eine Stimmung, die nahelegt, man könne die Stunden mit nichts Besserem verbringen.“ (Hannes Hintermeier, F.A.Z.)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 165
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Miniaturen zum 70. Geburtstag von Karl-Markus Gauß — der Träger des Leipziger Buchpreises findet die Zusammenhänge im unmerklichen Detail.Miniaturen von unterwegs, die Momente des Glücks beschwören und das Staunen lehren. Orte, an denen sich Wundersames ereignet, und Träume, die ins Leben wirken. Karl-Markus Gauß erzählt von der »Kunstesserin« in einer Wiener Trattoria, von einem Friedhof im Osten Europas, der letzten Zigarette seines Vaters, der »Schönheit hässlicher Städte«: Stets sieht er die Zusammenhänge im unmerklichen Detail und zeigt das Leben in der Schwebe zwischen Wirklichkeit und Traum. In suggestiver Sprache fasst Gauß die Themen, mit denen er berühmt wurde, auf überraschende und ganz neue Weise. »So gelangt man bald hierhin, bald dorthin, auf einer Reise ohne Ankunftszeit, in eine Stimmung, die nahelegt, man könne die Stunden mit nichts Besserem verbringen.« (Hannes Hintermeier, F.A.Z.)
Karl-Markus Gauß
Schiff aus Stein
Orte und Träume
Paul Zsolnay Verlag
Willkommen, Amalia Sophie
Die längsten Nasen meines Lebens.
Die zwei längsten Nasen meines Lebens habe ich in einem Wagen der Berliner S-Bahnlinie 7 zwischen den Stationen Westkreuz und Bahnhof Bellevue gesehen. Die eine ragte aus einem schmalen und bleichen, mit roten Pusteln gesprenkelten Gesicht, das einem mageren Siebzehnjährigen gehörte, der gelocktes dunkles Haar und geradezu leuchtend schwarze Augen hatte. Seine Nase war lang und dünn und spitz, und er trug sie wie ein Schwert durch die Welt, deren Luft er mit jeder Kopfbewegung durchsäbelte. Ihm gegenüber saß ein pummeliges Mädchen mit hennarot gefärbtem Haar, das in seinem Leuchten schwamm. Ihr rundliches Gesicht hing an einer breiten, dabei völlig ebenmäßig geschnittenen Nase, die stark aufgebogen war, sodass man, selbst wenn sie den Kopf gerade hielt, in zwei Nasenlöcher von enormem Ausmaß blickte.
Hätten sie nicht nur Augen für einander gehabt, wäre ihnen nicht entgangen, wie hingerissen ich von ihrem Anblick war. Sie lächelten sich beständig und wortlos an, nicht auf die hochmütige Weise derer, die mit ihrer grinsenden Unzufriedenheit zufrieden sind. Eher auf die verschwörerische Art, wie sie Menschen eigen ist, die sich noch nicht lange kennen, aber glücklich sind, jemanden gefunden zu haben, mit dem sie sich in einem vollständigen Einklang des Weltempfindens fühlen, sodass sie über die Dinge, die sie sehen oder hören, gar nicht erst zu reden brauchen, da ihnen doch ihr Lächeln des Einverständnisses genügt.
Anfangs vermutete ich, die beiden wären einander vielleicht in einer tapferen Leidensgemeinschaft verbunden und würden sich gegenseitig Ermutigung zulächeln, wie zwei Mitglieder einer Selbsthilfegruppe, die sich auf der Heimfahrt vom wöchentlichen Treffen befanden. Aber schon bei der Station Savignyplatz, als eine laute Gruppe Jugendlicher den Waggon stürmte, kam mir vor, dass ihr Lächeln von ganz anderer Art war: stolz, selbstbewusst, ein wenig überlegen gar. Die beiden wussten etwas, das die anderen nicht einmal ahnten. Sie wussten, dass sie die beiden Schönsten in dieser S-Bahn waren, und dass es ihre Nasen waren, diese hinausragenden Zinken, die sie so schön machten. Wie unerschütterlich in diesem Wissen, das sie miteinander teilten, in der Bewunderung, die sie füreinander empfanden, schaukelten sie dahin im Glück, für das sie keine Worte, nur ihre Augen brauchten, und in gewissem Sinne ihre Nasen.
Ein Freiburger Traum.
In der ersten Nacht im Freiburger Hotel Rappen träumte ich von einem Friedhof im Süden, der sich auf einem Felsen hoch über dem Meer erstreckte. In der Mittagsstille war nichts zu hören als der Wind, der die Zypressen zittern ließ, und der Schrei eines Vogels, der über der Friedhofskapelle kreiste. Ich wusste nicht, in welchem Land ich mich befand, doch war mir der Ort nicht völlig fremd. An der nicht ganz mannshohen Mauer aus geschichteten weißen und weißfleckigen Steinen, über die der Blick weit auf das Meer mit seinen sich kräuselnden Wellen fiel, entdeckte ich ein Grabmal, auf dem die Lebensdaten eines in mittleren Jahren verstorbenen Mannes verzeichnet waren und ein vom Salz des Meeres und der Luft halb zersetztes Foto angebracht war, das mich zeigte, der ich hier seit 27 Jahren bestattet lag. Ich stehe vor dem Grab, sehe den Vogel, der sich aus der Höhe übermütig fallen lässt, und den Wind in den zitternden Ästen der Bäume, spüre die Hitze an meiner pulsierenden Schläfe, schaue auf das Meer hinaus und bin so erschüttert, dass ich erwache.
Draußen ist es laut, ich stehe auf und tappe die paar Schritte zum Fenster des Hotelzimmers, das auf den Platz des Münsters schaut, dessen Glocke halb sechs zu schlagen beginnt. Zwei Fahrzeuge der städtischen Reinigung fahren über den Platz, vier Männer aus dem Süden in orangen Overalls trotten ihnen hinterher und picken mit Spießen Dinge auf, die die Fahrzeuge mit den sich drehenden Besen nicht aufnahmen. Ausgelassen feuern sich die vier gegenseitig an, sie sind so gut gelaunt, als wäre ihre Arbeit gegen den Schmutz der Stadt ihr Morgenvergnügen. Hinter ihnen erhebt sich das mächtige Münster mit seinen roten und sandfarbenen Steinen. Auf den Strebepfeilern des Langhauses hocken groteske Figuren, die dort vor siebenhundert Jahren draufgesetzt wurden, um das Böse zu verschrecken und von den Generationen an Bauleuten, die das Münster errichteten, fern zu halten; alle Figuren haben das steinerne Maul weit aufgerissen, sie sind die Wasserspeier, die auf den, der sich ihrer Kirche in böser Absicht nähert, giftiges Wasser aus ihren Eingeweiden hinunterspeien würden.
Als die Reinigungskräfte den Marktplatz gesäubert haben, fahren von der Straße, in der ihre Fahrzeuge verschwunden sind, die ersten Bauern, Fischer, Bäcker, Metzger, Floristen herein und steuern ihre Wägen zu den markierten Stellplätzen. Auch sie unterhalten sich lauthals, in einer halben Stunde werden sie ihre Obst- und Gemüsestände aufgebaut, die Verkaufsflächen mit Käse, Forellen, Marmelade- und Pestogläsern, mit Gewürzen und Kräutern, mit Spielwaren und allerlei Tand belegt und in den Imbissbuden den Grill angeworfen haben, auf dem bis Mittag immer neue Würste bei schwacher Hitze vor sich hinrösten. Die Zuversicht, die vom alten Platz der Arbeit aufsteigt, erfasst auch mich, sodass ich mich wieder hinlege, mit dem Vorsatz, in denselben Traum zurückzufinden und noch einmal über den Friedhof zu gehen, um mich an meinem Grab von dem zu verabschieden, den ich an diesem Ort zurücklasse.
Schnitzler träumt.
Zu den achttausend Seiten des Tagebuchs, das Arthur Schnitzler von seinem dreizehnten Lebensjahr bis kurz vor seinem Tod führte, gehören auch die vielen Nachtseiten, auf denen er seine Träume festhielt und zu deuten versuchte. So wichtig waren sie ihm, dass er sich 1921 daranmachte, in seinen Tagebüchern, die er in einer von ihm selbst nur schwer zu entziffernden Handschrift verfasst hatte, alle Passagen zu sichten, die von Träumen handelten, und sie seiner Sekretärin in die Schreibmaschine zu diktieren. Nach 428 Seiten waren sie mit dem Typoskript in der Gegenwart angelangt, doch erst achtzig Jahre nach seinem Tod ist sie veröffentlicht worden, diese fortgesetzte Auseinandersetzung eines Schriftstellers mit sich selbst, mit den Urgründen seiner Existenz, den nie versiegenden Quellen der Angst, mit den nächtlichen Unterhaltungen der Seele.
Wovon träumt dieser Sohn eines berühmten Arztes, der ihm als kolossal übermächtiger Vater entgegentrat; dieser Ehemann, der sich zeitweise den anstrengenden Luxus mehrerer Geliebten leistete, die voneinander nichts wissen sollten und von denen allesamt seine Ehefrau nichts wissen durfte; dieser Vater, dessen erstgeborener Sohn bei der Geburt starb und dessen geliebte Tochter 1928 Selbstmord verübte? Über vier Jahrzehnte wird Schnitzler in Varianten immer wieder von einer merkwürdigen Verspätung träumen: »Heute Nacht ein entsetzlicher Traum; ich komme zu spät zu meinem Begräbnis, werde schon erwartet. Stehe vor dem Haustor und sehe die Kränze und suche zu erraten, von wem sie sind. Bin tief betrübt. Habe Angst, mich in den Sarg zu legen, dann redet mir die Mutter zu.« Wie es manchen Träumen eigen ist, hat auch dieser seinen Witz: Etwa dass den Toten interessiert, von wem welcher Kranz ist, der auf seinem Grab liegen wird. Oder dass die Mutter dem Verstorbenen gut zuredet, sich in den Sarg zu legen, während der Vater in den Träumen als ewig nörgelnde, herummäkelnde Autorität erscheint, die den Sohn ermahnt, endlich etwas Gescheites mit seinem Leben anzufangen. Wie Schnitzler träumend oft auf seinem eigenen Begräbnis anzutreffen ist, wiederholt sich ihm im Schlaf auch der Schrecken, zu seiner Hinrichtung abgeholt zu werden.
1899 war in Wien ein epochales Buch erschienen, das versprach, eine Methodik vorzustellen, mit der das rätselhafte Reich der Träume erforscht und über seine Träume auch der Mensch verstanden werden könne. Schnitzler hat Sigmund Freuds »Traumdeutung« sofort gelesen und manche Anregung von ihm bezogen. Je älter er wurde, umso skeptischer betrachtete er jedoch die Psychoanalyse. Träume gehen seltsame Wege, und daher ist es nicht verwunderlich, dass Schnitzler im Schlaf wiederholt tat, was er tagsüber vermied, nämlich Sigmund Freud zu begegnen. Selbst träumend wollte er sich die Deutungsmacht über sein Unbewusstes jedoch von Freud und dessen Schülern nicht rauben lassen.
Die letzte Zigarette meines Vaters.
Es war in dem kleinen Park hinter der Station für Chirurgie, in dem der Rasen unter den mächtigen Bäumen auch im Frühsommer braun blieb, dass ich mit meinem Vater auf einer Bank saß und er die letzte Zigarette seines Lebens rauchte. Einige Wochen vor seinem Tod hatte er mit einer Wut, die nur selten aus seinem wohltemperierten Gemüt aufschoss, gemerkt, dass ihm die vertrauten Speisen und Getränke fremd wurden, dass er keine Sicherheit im Schmecken mehr hatte. Den Wein fand er fade, er trank ihn weiter, aus Treue einem alten Laster gegenüber und in ratloser Empörung, dass er ihm nicht mehr die Freuden von früher bot. Gerichte, die mit dem Saft von Zitrusfrüchten versehen waren, empfand er auf einmal als bitter, und bei Süßem klagte er, dass es schmalzig schmecke. Er erschrak, eine Selbstverständlichkeit des Lebens ging ihm gerade verloren, das Vertrauen in den gleichbleibenden Geschmack der Dinge, in dem sich der Zusammenhang unseres Lebens erneuert.
Er war der kompromissloseste Raucher meines Lebens, sogar beim sonntäglichen Mittagessen, wenn seine Lieblingssuppe serviert wurde, hielt er drei, vier Mal mit dem Löffeln inne, um nach der im Aschenbecher abgelegten Zigarette zu greifen und einen tiefen Zug zu machen. Im Garten des Spitals, in dem er am nächsten Tag überraschend für uns und die Ärzte, aber vielleicht nicht für ihn selber starb, zündete er sich auf der hölzernen Bank, die meist leer blieb, weil sie in einem immerwährenden Schatten lag und der Juni noch kühl war, eine Zigarette an, verzog das Gesicht zu einer Grimasse, die ich, so weinerlich und kindlich trotzig, noch nie an ihm gesehen hatte, und sagte: »Jetzt schmeckt mir das Rauchen auch nicht mehr!« Nachdem er die Zigarette verächtlich weggeschnipst hatte, gingen wir stumm zurück zur Station, und auf dem Weg fiel uns, die wir einander sonst so gerne ins Wort fielen, weil das undisziplinierte Streitgespräch seit jeher zu unseren höchsten Vergnügungen als Vater und Sohn gehört hatte, mit einem Mal auf, wie laut der Kies unter unseren Füßen knirschte.
Fiktiver Onkel, realer Neffe.
Im eisigen Winter 2000 saß ich in einem überheizten Raum der Jüdischen Gemeinde von Sarajevo und unterhielt mich mit einem alten, unablässig rauchenden und für diesen Ort geradezu elegant in englisches Tweed gekleideten Mann. Er kommentierte den Niedergang seines Lebens gleich wie den Zerfall Jugoslawiens mit beißendem Witz und bevorzugte lakonische Sätze wie »My future goes cemetery«. Er sei ein pensionierter Oberst der jugoslawischen Volksbefreiungsarmee und heiße Albahari, ja, genau so wie der Schriftsteller, sein Neffe. Von diesem hatte ich einige Romane gelesen, die die historischen Verwerfungen Serbiens und die persönlichen Niederlagen seiner Bewohner in schmerzwacher Prosa erkunden. Einige Jahre später, als der Oberst vielleicht schon für immer in seiner Zukunft angekommen war, las ich David Albaharis Miniaturen, seine »Kurzen Geschichten und dauerhaften Wahrheiten über Liebe, Traurigkeit und den ganzen Rest«.
Die längsten nehmen nicht viel mehr als eine Seite ein, die kürzesten bestehen aus wenigen Zeilen: »Manchmal bin ich so müde, dass ich im Stehen, mit offenen Augen, einschlafe. Sobald ich sie schließe, werde ich wach.« Meist haben die Geschichten ein alltägliches Vorkommnis, ein wiederkehrendes Gefühl, eine wenig aufregende Beobachtung zum erzählerischen Anlass, und fast alle kippen von einem Satz zum anderen, mitunter von einem Wort zum nächsten. »Am Abend, während die Schatten wachsen, wächst auch die Angst des Jungen, und sie wird immer stärker trotz der Stimme, die unter seinem Bett ständig wiederholt: Keine Angst, Junge, du bist nicht allein, du bist überhaupt nicht allein.«
Als ich David Albahari bei einem Literaturfest in Salzburg kennenlernte, auf dem er — schmal wie Kafka — in elegantem Tweed erschien, erzählte ich ihm von meiner Begegnung in Sarajevo und erkundigte mich nach seinem Onkel. Er dachte angestrengt nach und wirkte fast verzweifelt, als er sagte: »Ich kenne ihn nicht, ich weiß nicht, wer das sein könnte!« Es klang, als müsste er eine Schuld einbekennen, denn er zweifelte nicht an seinem fiktiven Onkel, sondern an sich, dessen realem Neffen.
Görz, Via Rastello.
Es war eine gute Idee, gegen elf Uhr vormittags von der Piazza della Vittoria in Gorizia, der Provinzstadt in Julisch-Venetien, in die lange, schmale Via Rastello einzubiegen. Als ich einen ersten Blick in die Straße warf, die mit einer leichten Biegung zu der kleineren Piazza Cavour führt, kam mir vor, ich hätte dieses Bild schon oft gesehen, das war eine jener italienischen Straßen, die ich in hundert Orten entlanggegangen bin und die mir hunderte Male gefallen haben. Ein Extrakt all dieser zugleich ruhigen und geschäftigen Straßen in der Provinz, schien mir die Via Rastello Italien selbst zu repräsentieren.
Die Via reihte einfache Läden, teure Boutiquen, Cafés, Vinotheken, Kleider- und Fetzengeschäfte, eine Lottoannahmestelle, Antiquitätenhandlungen, Handwerksbetriebe, Büros, Geschäfte für besonderen Bedarf wie Messer oder Uhren aneinander. Ungefähr auf halber Strecke befand sich auf zwei Stockwerken ein Großkaufhaus, das schon seit längerem geschlossen sein musste, dessen Schild »Krainer & Comp.« aber noch zu entziffern war und in dessen Innerem ich hinter beschmutzten Auslagen prächtige alte Holzregale und das Museumsstück einer Cassa ausmachen konnte. Aus dem Innenhof des Palazzo daneben moderte es kräftig heraus, hier fanden bis vor kurzem Veranstaltungen mit Techno-Musik statt, mittlerweile war das baufällige Areal gesperrt worden. Würde ich in ein paar Jahren noch einmal nach Görz kommen, um in der Via Rastello Italien zu suchen, fände ich das elegante Kaufhaus und den verfallenden Palazzo vermutlich restauriert vor, denn die Straße selbst schien sich, trotz leerstehender Geschäfte, nicht auf Verfall, sondern auf neues Leben eingestellt zu haben. Immerhin lag sie an einer alten Handelsroute, und das Viertel zu Füßen des Festungshügels zählte zu den ältesten der Stadt.
Wie das Metallwarenhaus Krainer & Comp. oder die Orologia Gianni Fuchs zeugten in dieser Straße viele Namen davon, dass Gorizia einst Görz geheißen hatte; und in seiner österreichischen Zeit, die immerhin vierhundert Jahre währte, Italiener, Slowenen, Deutsche, Friulaner in einer viersprachigen Stadt zusammen gelebt hatten, die zudem eine alte jüdische Gemeinde hatte, von deren Mitgliedern sich um 1900 die einen als italienische, die anderen als österreichische Patrioten verstanden und für den italienischen Nationalstaat von morgen oder die Monarchie der vielen Nationalitäten von gestern eintraten.
Einer jüdischen Familie aus Görz, in der Deutsch gesprochen wurde, entstammte Carlo Michelstaedter, der 1903 nach Wien zog, um Mathematik zu studieren, im Jahr darauf aber nach Florenz übersiedelte, um die Sprache zu wechseln und ein italienischer Philosoph zu werden. Am Ende der Via Rastello, vor dem Haus mit der Nummer 91, stieß ich auf seine lebensgroße Statue, die ihn in Bronze als eleganten, geradezu zierlichen Jüngling zeigt, mit Denkerstirn und halb schmerzlich, halb abweisend nach unten gezogenen Lippen, die eine Hand hat er lässig in die Hosentasche gesteckt, in der anderen hält er einen Sommerhut. Michelstaedter ist der intellektuelle Stadtheilige von Gorizia, ein Genius, auf den sich alle möglichen philosophischen Schulen und politischen Bewegungen bezogen haben und vielerlei Geister und Ungeister beziehen konnten, weil er nur wenige und vieldeutige Schriften hinterlassen hat, war er doch erst 23 Jahre alt, als er im Oktober 1910 in den Tod ging. Veröffentlicht hatte er außer einigen Zeitungsartikeln nur wenig, aber am Tag vor seinem Selbstmord hat er seine Dissertation abgeschlossen, »La persuasione e la rettorica«, Überzeugung und Rhetorik, die grandiose Ouvertüre auf ein Lebenswerk, das ungeschrieben blieb.
Die geradezu bekenntnishafte akademische Arbeit fasziniert durch ihren formalen Einfallsreichtum, sie vereint Abhandlungen, Essays, Dialoge, Parabeln mit Passagen von exquisiter Metaphorik und bizarrem Humor. Wer hätte je das erste Kapitel seiner Doktorarbeit so begonnen: »Ich weiß, dass ich will, und es gibt nichts, was ich will. Ein Gewicht hängt an einem Haken, und da es hängt, leidet es daran, nicht sinken zu können; es kann von dem Haken nicht loskommen, denn was ein Gewicht ist, hängt, und was hängt, hängt ab.« Michelstaedter konstatierte, dass seit der griechischen Antike die Sprache und die Dinge, Denken und Leben auseinandergetreten seien und es diese Entfremdung wäre, die die abendländische Kultur geprägt und nun in eine unaufhebbare Krise getrieben hat. Halb Studie, halb poetisches Exerzitium, ist »Überzeugung und Rhetorik« ein widersprüchliches Werk, was es dem faschistischen Publizisten Julius Evola erleichterte, sich auf jene Passagen zu stürzen, die den jüdischen Intellektuellen als Metaphysiker der Macht erscheinen lassen; spätere Exegeten erklärten ihn zum Propheten des Existenzialismus oder brachten ihn gar mit der marxistischen Frankfurter Schule in Verbindung.
Es war fast zwölf Uhr, als ich vor seiner Statue am Ende der Via Rostello stand, und als die Kirchenglocken Mittag schlugen und ich mich umwandte, sah ich über den Dächern einen der beiden grünen Türme der barocken Chiesa Sant’ Ignazio. Ich ging die Straße zurück und kam bei einem Café vorbei, das fünf Tische im Freien auf die für Verkehr gesperrte Straße gestellt hatte. An zwei der Tische saßen je vier Männer, die lautstark Karten spielten, um die beiden anderen hatten sich die Zeitungsleser gruppiert, die über ihre großformatigen Blätter hinweg heftig miteinander debattierten, und am fünften Tisch an der Hauswand saß ich, der ich dem Stück des Straßentheaters folgte, das gerade gegeben wurde. Es dauerte eine Weile, bis mir auffiel, dass es sich um lauter alte Männer handelte, die zu dieser Stunde hier beisammensaßen, und es lauter alte Männer waren, die vorbeikamen, stehen blieben, ein paar Worte sagten, weitergingen oder sich einen Stuhl nahmen und sich zu den anderen setzten. Und dann brauchte ich noch eine Weile, bis ich begriff, dass einer dieser alten Männer ich selber war, der ich über die Häufung ausgelassener alter Männer in einer Straße sinnierte, an deren Ende dem als Jüngling in den Tod gegangenen Genius dieser Provinz gehuldigt wurde. Endlich sah ich, dass es doch eine weibliche Rolle in diesem Stück gab, das wuschelige Haar der jungen Schauspielerin war rot gefärbt, ihr Gesicht wächsern weiß geschminkt und die Unterlippe von einem Piercing durchbohrt. Sie bewegte sich zwischen den alten Männern mit zielstrebiger Freundlichkeit, sie gab die Kellnerin, also musste sie bedienen, aber sie tat es so resolut, dass ich mich fragte, ob sie nicht doch die Regisseurin war.
Der Friseur aus der Rruga Gjuhadol.
Viele Jahre hatte ich mich darauf gefreut, endlich nach Shkodra, in die österreichische Stadt im Nordwesten Albaniens, zu reisen. Und dann das! Stundenlang zog ich durch die Stadt, die mich so lange angezogen hatte, und ich fand nichts, das mich zu verweilen reizte. Nach einigen Stunden musste ich mir einbekennen, dass mir die Stadt besser gefallen hatte, als ich sie nur aus Geschichten, Legenden, Fotos kannte. Bis ich in das Viertel um die Rruga Gjuhadol geriet, in dem die Leute an klapprigen Holztischen im Freien saßen, sich von einer Straßenseite auf die andere unterhielten und den Fremden, der durch ihr Reich schritt, mit zunickender Neugier beäugten.