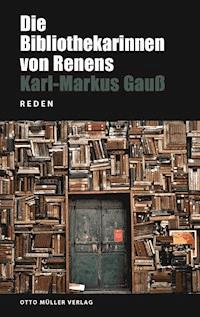Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wieser Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: wtb Wieser Taschenbuch
- Sprache: Deutsch
Vor 25 Jahren erschien im Wieser Verlag ein Buch, das rasch für Furore sorgte und die literarische Debatte im gesamten deutschen Sprachraum beeinflusste: "Tinte ist bitter. Literarische Porträts aus Barbaropa". In diesem Band und in der nachfolgenden Essaysammlung "Die Vernichtung Mitteleuropas" hat Karl-Markus Gauß kenntnisreich und leidenschaftlich einen Kontinent vermessen, dessen Literatur im Westen bis dahin kaum beachtet worden war. Seine Porträts von ermordeten, exilierten, totgeschwiegenen Autoren aus Mähren und Galizien, Ungarn, Slowenien und Kroatien, aus Triest und Bukarest führten aus der Mitte an die Ränder Europas und aus der Vergangenheit mitten in die Gegenwart der politischen Umbrüche. In der vorliegenden Auswahl sind sie wiederzuentdecken: die große, zum Schweigen gebrachte Literatur "Barbaropas", die Hoffnung auf einen neuen europäischen Selbstentwurf, die Sprachlust eines Autors, der schon in seinen ersten Büchern als unverwechselbarer Stilist angetreten war. Miroslav Krleža, Miklós Radnóti, Danilo Kiš, Oskar Jellinek, Ernst Sommer, Hermann Ungar, Fulvio Tomizza, Ciril Kosmač: Acht Essays, geschrieben vor gut einem Vierteljahrhundert. In ihrer Aktualität ungebrochen, zeugen sie heute zudem schmerzlich von den kulturellen und politischen Versäumnissen seither. In der vorliegenden Auswahl sind sie wieder zu entdecken: die große, zum Schweigen gebrachte Literatur "Barbaropas" und die Hoffnung auf einen neuen europäischen Selbstentwurf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 166
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
GAUSS • TINTE IST BITTER
KARL-MARKUS GAUSS
Tinte ist bitter
Literarische Porträts aus Barbaropa
Die Herausgabe dieses Buches erfolgte mit freundlicherUnterstützung durch das Land Kärnten.
wtb 14
A-9020 Klagenfurt/Celovec, 8.-Mai-Straße 12Tel. + 43(0)463 370 36, Fax. + 43(0)463 370 [email protected]
Copyright © dieser Ausgabe 2014 bei Wieser Verlag GmbH,Klagenfurt/CelovecAlle Rechte vorbehaltenLektorat: Josef G. PichlerISBN 978-3-99047-011-4
Inhalt
Vorwort
Miroslav KrležaoderDie Literatur darf nichts vergessen
Ciril KosmačoderBauer, Partisan und Tod
Oskar JellinekoderIch wandle im Schatten, der mich ergreift
Miklós RadnótioderMauern entstehen um mich, Städte und Länder verschwinden
Ernst SommeroderAls die Hoffnung auf Heimkehr für immer erlosch
Hermann UngaroderJammer und Unglück, Scherz und Lustigkeit
Danilo KišoderAuf dem Grunde des Pannonischen Meeres
Fulvio TomizzaoderPlädoyer für »convivenza«
Vorwort
Vor 25 Jahren war die Zukunft besser. Binnen wenigen Monaten brach eine Herrschaft zusammen, die das politische und soziale Leben vom Schwarzen Meer bis zur Ostsee, vom Balkan zum Baltikum reglementiert hatte. Grenzen, schwer bewacht und schier unüberwindlich aufgerüstet, wurden durchlässig und endlich niedergerissen, Staaten, die wie für ewige Zeiten abgeblockt und der brüderlichen Vormacht der Sowjetunion unterworfen waren, errangen ihre Souveränität, und Millionen Menschen, die keine staatsfrommen Untertanen bleiben wollten, brachen auf, ihre Obrigkeiten zu stürzen und ihr Schicksal zu wenden. Was die Literatur Mitteleuropas vorweggenommen hatte, spielerisch und ketzerisch, polemisch und poetisch, schien mit einem Male gesellschaftliche Realität werden zu können. Es waren gerade die kleinen Staaten Mittel- und Südosteuropas, diese historischen Regionen und Landschaften, auf die das ausschließende Prinzip des Nationalstaats niemals gepasst hatte, die jetzt ihre Tributpflicht aufkündigten und in die Geschichte zurückkehrten. Der tschechische Schriftsteller Milan Kundera hatte für dieses Zwischenland den alten und vielfach missbrauchten Begriff »Mitteleuropa« ins Spiel gebracht und damit eine gar nicht vage, sondern konkrete Hoffnung verbunden: dass in Europa, das so lange in einen Westen und einen Osten geteilt war, auch etwas Drittes geschichtsmächtig werden könnte; eben jenes Mitteleuropa, von dem in den Jahren vor dem Zusammenbruch des Ostblocks so viele schwärmten und das auf zahllosen Kongressen von klugen und altklugen Leuten beschworen wurde.
Wenn Mitteleuropa weder Westen noch Osten war, worin bestand dann sein Anderssein? Darauf wurden jede Menge kulturhistorische, mythologische, politische, ideologische, ökonomische Antworten gegeben. Die einen führten den humanen Skeptizismus an, den die Mitteleuropäer, belehrt durch ihre historischen Erfahrungen, gegenüber den großen Verheißungen des Fortschritts hegten, gleich ob dieser mit der Entfesselung der kapitalistischen Marktkräfte oder der Entfaltung einer klassenlosen Gesellschaft verbunden wurde. Andere bezogen sich auf die alte Donaumonarchie, als wäre sie eine kakanische Idylle der vielen Völker gewesen, nach deren Maß aktuelle Konflikte mit lebensweisem Pragmatismus gelöst werden könnten. Nicht wenigen erschien Mitteleuropa als Vision, dass sich zwischen Kapitalismus und Kommunismus ökonomisch etwas Drittes entwickeln würde, ein Modell für die ganze Welt, über die so lange die Alternative verhängt war, sich entweder diesem oder jenem zu ergeben. Nicht zuletzt aber sollte die Europäische Union durch die aufbegehrenden Mitteleuropäer, die sich aus der Bevormundung befreit hatten, wichtige Impulse erhalten, was das Selbstbewusstsein der zivilen Gesellschaft, die kulturelle Vielfalt in einer Ära der Globalisierung anbelangt.
In dieser Zeit, in der die Zukunft besser war als vorher und nachher, habe ich zwei Bücher im Wieser Verlag veröffentlicht, in denen es um die Literatur jenes so häufig angerufenen und in so vielen ideologischen Scharmützeln benutzten Mitteleuropa ging. Der erste Band, »Tinte ist bitter. Literarische Porträts aus Barbaropa«, erschien 1988, der zweite, »Die Vernichtung Mitteleuropas«, 1991. Zusammen vereinten sie 24 Porträts von ermordeten oder totgeschwiegenen, vertriebenen oder verlachten Schriftstellern aus Mähren und Galizien, Ungarn und Rumänien, Serbien, Kroatien, Slowenien, aus Triest, Prag und Wien. Mein Vorsatz, gar nicht bescheiden, war ein doppelter: Zum einen den realen Reichtum, den die mitteleuropäische Kultur seit dem 19. Jahrhundert ausgebildet hatte, bekannt zu machen; und zum anderen diesen Reichtum nicht gleich an jene zu verraten, die gerade dabei waren, mit ihm neues Schindluder zu treiben. Denn wie oft wurden damals ketzerische Geister, die von der habsburgischen Obrigkeit verfolgt worden waren, missbraucht, um nachträglich für jene Welt von gestern zu zeugen, gegen die sie einst angeschrieben hatten! Wie gedankenlos wurde von einem »versunkenen Europa« gesprochen, das doch alles andere als hübsch melancholisch untergegangen, vielmehr ausgelöscht, vernichtet worden war! Und erst die Phrase, dass Polen, Ungarn, Bulgarien endlich nach »Europa zurückgekehrt« wären! Ja, lagen diese Länder denn vorher in Asien? Mit der Floskel von der Rückkehr der einst unter kommunistische Kuratel gestellten Länder wurde wie nebenhin die Selbstheiligsprechung Europas vollzogen. Wo Diktatur herrscht, dort kann nicht Europa sein, als wäre der Faschismus von den Asiaten, der Stalinismus und Kolonialismus von den Afrikanern erfunden worden … Kurz, ich wünschte, dass die lebendige Vielfalt der mitteleuropäischen Literatur entdeckt, aber zugleich verhindert werde, sie ihres subversiven Wesens zu berauben und aus dem Funken der Revolte eine Bußkerze des Konservativismus zu machen. Lese ich heute diese Porträts, staune ich über die leidenschaftliche Identifikation, in die ich mich mit diesen hundert oder immerhin fünfzig Jahre vor mir geborenen Autoren begab, und über den stilistischen Furor, mit dem ich meine Dauerbereitschaft zur Empörung bekundete. Zugleich wird mir die Stimmung jener Jahre gegenwärtig, die Hoffnung, dass vieles, was Europa gehemmt und verunstaltet hatte, nun von ihm abfallen werde, und der Zweifel, ob die großen politischen Weichen nicht bereits anders gestellt sein könnten und mit der Geschichte von gestern, vorgestern auch manche ihrer Gespenster wieder auftauchen würden.
25 Jahre später, was ist aus den Hoffnungen, was aus den Befürchtungen geworden? Im Jahr 2014 gedenkt Europa des Kriegsausbruchs von 1914, als wäre dieses Gedenken schon der beste Beitrag, den es zum Frieden von heute leisten könne; ein Frieden, der nirgendwo gesichert ist und, wenn er doch da und dort immerhin seit Jahrzehnten hält, beständig von Meeren des Krieges umbrandet wird. 2014 ist der Krieg nach Europa selbst zurückgekehrt, in die Ukraine an einem der Ränder Europas, wo seit jeher verschiedene Nationalitäten aufeinandertreffen, die in Wahrheit doch stets aufeinander bezogen und ineinander verwoben waren. Bald nach 1989 hatte der Krieg Jugoslawien erfasst und diesen Staat, der einer der Erben der Donaumonarchie war und mehrere Nationalitäten vereinte, ungemein blutig zerfallen lassen. Der Zerfall geschah paradoxerweise just zu einem Zeitpunkt, an dem etwas ganz anderes auf die europäische Tagesordnung gesetzt wurde, nämlich die Vereinigung vieler Staaten, die dafür immer mehr von ihren nationalen Kompetenzen an die übernationalen Institutionen der gemeinsamen Union abzugeben hätten. Europa, hatte Miroslav Krleža gesagt, wird größer und kleiner zugleich, und ich befürchtete schon 1989, dass es sogar das Kunststück zuwege bringen werde, sich zu vereinen und zugleich zu zerfallen. Nicht nur in Italien, wo es angefangen hat, sondern auch anderswo arbeiten regionalistische Bewegungen längst daran, dass ihr Staat in Regionen zerfalle; sie tun das aber nicht, weil es gegen eine faschistische Staatsmacht anzukämpfen gälte, die den Menschen autoritär sogar das Recht auf ihre Muttersprache bestritten hat, sondern um den Wohlstand, den sie inzwischen erlangt haben, nicht mit jenen Regionen teilen zu müssen, die vom ökonomischen Fortschritt abgehängt wurden. Überall regen sich regionalistische Bewegungen, die gewissermaßen reichsunmittelbar zu Brüssel, zu Straßburg, den Zentralen der Union selber werden möchten, also auf Zerfall und Vereinigung gleichzeitig setzen. Auf der anderen Seite ist der Appetit auf neues Land, das man dem eigenen angliedern, anschließen könnte, noch längst nicht überall gestillt. Unverschämt meldet die ungarische Regierung ihre Ansprüche auf Regionen und Städte in der Slowakei, in Serbien und Rumänien an, wo zahlreiche Ungarn leben. Selbst die Überzeugung, dass wenigstens innerhalb der Union der Nationalismus und Rassismus nie mehr wieder werde mobilmachen können, erweist sich nicht nur am ungarischen Exempel als trügerisch.
Und was ist, da die Grenzen fielen, aus den ost- und südosteuropäischen Staaten geworden, ihrem alten kulturellen Erbe und ihrer im Kampf gegen die sowjetische Vormacht gewonnenen Renitenz? Ach, jenes Mitteleuropa, von dem Kundera sprach, ist uns heute ferner, als es damals war, da weite Teile von ihm noch hinter dem Eisernen Vorhang verborgen lagen. Der freie Austausch von Gedanken, er hat der sich erst bildenden europäischen Gesellschaft keineswegs so reiche Früchte eingetragen wie der Austausch von Waren und Arbeitskräften jener Elite, die entschlossen daranging, sich ein grenzenloses Europa des Profits unter den Nagel zu reißen. Ökonomisch hat sich der Westen den Osten einverleibt, der dafür umgekehrt dem Westen nicht seine besten, sondern seine gefährlichsten und reaktionärsten Traditionen als Dankesgabe anbietet. Das alles hat natürlich auch damit zu tun, dass die europäische Osterweiterung der Union just zu einem Zeitpunkt erfolgte, in dem der Neoliberalismus sich riesige neue Gebiete zu erschließen versuchte, ein Unterfangen, für das rücksichtlose Geschäftemacher in manchen Institutionen der Europäischen Union dienstbare Gehilfen fanden. Mit der Wirtschaftskrise, die jene, die sie verschuldet haben und an ihr verdienen, auch noch dafür nutzen, vermeintlich gesicherte soziale Errungenschaften europaweit abzuschaffen, wurde aus einigen Beitrittsländern Abrissunternehmen, aus anderen Musterschüler des Neoliberalismus, die die Traditionen der Solidarität, der sie doch ihr Entstehen verdankten, selbst verächtlich machen und kappen; jene aber, die der Union noch nicht angehören, warten draußen als Bittsteller.
Ist heute also alles schlecht, sogar die Zukunft? Nein, zur Nostalgie besteht kein Anlass, die Verklärung der gestürzten Despoten ist abgeschmackt, und der Wunderglaube, es würden sich die Dinge wie von selbst verbessern, wenn nur erst wieder der nationale Egoismus regierte, ist albern. Die Voraussetzungen, dass sich ein soziales Europa bilde, sind heute, trotz alledem, besser als zu Zeiten, da einander im Westen ökonomisch ähnliche, aber national verfeindete Staaten gegenüberstanden und im Osten alle Nationen unter einem sie entmündigenden Machtblock vereint waren. Der intellektuelle und politische Austausch über die Grenzen hinweg, von Portugal bis nach Rumänien, kann heute leichter gelingen, da die Menschen nicht mehr durch viele Grenzen voneinander getrennt sind. Freilich ist dazu etwas vonnöten, was ich vor 25 Jahren geradezu pathetisch verlangte: dass die Europäer nämlich begännen, sich endlich für sich selbst zu interessieren, für jenes Europa, das immer noch Terra incognita geblieben ist und der Entdeckung harrt.
Karl-Markus GaußSommer 2014
Miroslav KrležaoderDie Literatur darf nichts vergessen
Als würde dies alleine ihn rechtfertigen und im Reich der Kultur, Zweigstelle Wien, beheimaten, wird er in nachgereichten Wiener Legenden gerne als Verehrer des Karl Kraus feilgeboten; ja, im gewiss ehrlichen Bemühen, damit auch sein Werk zu rühmen, hat man ihn gar zum »kroatischen Kraus« – ja was eigentlich: erhoben, ernannt, verdammt? Aber was hat, da schon Karl Kraus nichts für und nichts mehr gegen seine Verehrer von heute kann, ein ausländischer Dichter, zumal einer vom Balkan, was hat schon Miroslav Krleža, dieses Jahrhundertgenie, mit den Vergleichen zu tun, auf die man ihn bringt? »Das imposante Gebäude der europäischen Zivilisation ist aufgebaut auf den Knochen zahlloser besiegter europäischer Völker«, schrieb Krleža einmal, und es war gegen das Vergessen gerichtet, »daß es zwei Europas gibt. Neben dem klassischen westeuropäischen, museal-grandiosen, historisch-pathetischen Europa lebt noch ein zweites, das bescheidene, in die Ecke gedrängte, seit Jahrhunderten immer wieder unterworfene periphere Europa der östlichen und südöstlichen europäischen Völker. Dies sind die Völker im Baltikum, im Donau- und Karpatenraum und auf dem Balkan, denen es bestimmt ist, nicht innerhalb der europäischen Mauern zu leben, sondern antemural, eine Art Glacis bildend gegen die osmanische und mongolische Gefahr und gegen alle anderen Bedrohungen militärischer und politischer Art. In europäischer Sicht ist das Schicksal dieser Völker zwischen Baltikum, Karpaten, Adria und Balkan mit dem westeuropäischen Triumph der nationalen Waffen und Geister nicht zu vergleichen, denn die osteuropäischen Randvölker gehören jener Zivilisation zu, der es nicht vergönnt war, sich nach europäischem Standard zu entwickeln, weil stärkere Mächte ihnen jegliches Recht auf materielle und moralische Existenz bestritten haben.«
Friedrich Torberg, approbierter Nachfolger und selbst ernannter Sachwalter des Karl Kraus auf Erden, hat den, der all dies schrieb, hat Miroslav Krleža einmal als »altösterreichischen Rebellen« bezeichnet: Rebell gemildert durch Kakanien, Kommunist, aber von harmlos-pannonischer Verstiegenheit, mochte dies bedeutet haben sollen, und so sehr es auch überrascht, dass ausgerechnet Torberg dieses eine Mal einen radikal anders Gesinnten nicht in die Nichtigkeit verdammte, sondern zu würdigen versuchte – freilich doch wiederum nur, indem diesem das Andersgesinnte gestutzt wurde, bis nur mehr das Gesinnte übrig war, das in Torbergs eng geschnürtes Gesinnungskorsett passte –, so wenig einfallsreich ist doch der Versuch gewesen, den schärfsten Kritiker der Donaumonarchie gleichsam zu deren liebenswert-ungezogenen Sohn zu machen. Die gar nicht so sanfte Besitzergreifung Krležas, der bald zum balkanprovinziellen Jünger des Karl Kraus ausgerufen, bald, und viel schlimmer, zum Heimatdichter einer größeren kakanisch-mitteleuropäischen Heimat von gestern verniedlicht wird, diese Besitzergreifung konnte ihren kruden Zugriff bisher recht unangefochten sicher führen, hatte sie doch bloß Krležas ganzes Werk, nicht aber auch dessen allgemeine Kenntnis gegen sich. Ein Name, dessen man sich schmücken kann, ohne fürchten zu müssen, dass das, wofür er steht, auch weiter bekannt geworden ist; eine Figur, ungestraft hin- und herzuschieben auf jenem Schachbrett, an dem sich in mitteleuropäisch-illuminierten Cafés kongresserprobte Saloneuropäer darum bemühen, matte geistige Frische zu zeigen – nicht viel mehr ist Miroslav Krleža zuletzt in Österreich gewesen, während in Deutschland, zugegeben, seine Unbekanntheit ohnehin so enorm ist, dass er nicht einmal in kultursnobistischer Absicht gerühmt wird, eben weil mit ihm so wenig verbunden wird, dass kein fahler Schimmer des Ruhms auf den Ruhmredner selber abfiele.
Der einstige k. u. k. Kadett Miroslav Krleža hat sich ein schriftstellerisches Leben lang mit Österreich, mit der in einem Weltkrieg auseinandergebrochenen Monarchie der Habsburger, mit Anspruch und Wirklichkeit des riesigen k. u. k. Staatsgebildes auseinandergesetzt, und immer wieder beschäftigte er sich in leidenschaftlichen Polemiken und weit gespannten Studien, in Romanen und Essays, Novellen und Reden, Bekenntnissen und Analysen mit »Österreich«, mit österreichischen Künstlern und Politikern, Hoffnungen und Illusionen … Doch war es kein trauerndes Requiem für Habsburg, wie der ironische Titel einer seiner Erzählungen und einer Prosasammlung lautet, kein Requiem auf die entschwundene Donaumonarchie, die Krleža anstimmte, kein Abgesang auf die Habsburger und ihr vorgeblich übernationales Reich. Nein, in den vierzig Bänden, die Krležas Œuvre fassen – ein Œuvre, das für die Literatur des 20. Jahrhunderts schon in einer einzigartigen Vielfalt der Formen hingebreitet liegt – ist Österreich nie eine melancholisch betrauerte Größe, nie eine Kategorie des Humanen und sein Ende daher auch kein Anlass der Wehmut. »Österreich« stand in Krležas so widersprüchlichem wie unverwechselbarem Werk von Anfang an als Name der Verführung zum Schlechten, der Versuchung, der Unterdrückung, der Demoralisierung, und mit kalter Verzweiflung gleich wie mit heißem Zorn zeichnete Krleža ein ganz anderes Österreich als jenes, das uns gemütlich-altösterreichische Rebellen und deren so gar nicht rebellische Verklärer anempfehlen; Krležas Mitteleuropa war habsburgisch verdüstert und ganz verschieden von dem, das heute vielenorts wie ein versunkenes Atlantis kakanischer Humanität besungen wird.
Miroslav Krleža war so sehr fixiert auf die Nachtseiten des habsburgischen Reiches, in dem doch einst die Sonne nicht unterzugehen vermochte, dass er seine Gestalten, wenn er sie als Helden der Oberflächlichkeit kenntlich machen wollte, bevorzugt mit österreichischen Attitüden ausstaffierte; eine Vorliebe für den pompösen Salonmaler Hans Makart etwa, wie sie der dümmelnde k. u. k. Großgespan i. P. Titus Andronicus Fabriczy-Glembay in dem Schauspiel Die Glembays gleich anfangs zeigt, lässt schon darauf schließen, dass hier ein Titan der Geschwätzigkeit angetreten ist, seinen bis in die tiefsten Abgründe hinein oberflächlichen Charakter ein Theaterstück lang vorzuführen. Und erst recht wenn leis im Hintergrund die Walzermelodeien erklingen und die »Straußlimonade« zu sprudeln beginnt, schafft Krleža über derlei österreichische Ingredienzen rasch eine unerträgliche Verdickung der Atmosphäre zu zäher Dummheit und Niedertracht. Sogar sein Selbstbild als Autor, seinen Entwurf als Dichter schärfte Krleža sich über eine Reihe grandioser Essays, Verwerfungen fast allesamt, in denen er sich bevorzugt von österreichischen Schriftstellern abzugrenzen und abzuheben versuchte. Selbst dort, wo er bewunderte, ja eben dort, kritisierte er unnachsichtig scharf, kenntnisreich wie aus vertrauter, doch mit Bedacht gemiedener Nähe. Über Hugo von Hofmannsthal, der gerne zum Repräsentanten jenes konservativ-humanen Österreich angerufen wird, dessen Untergang von 1918 in den abschüssigen Weg zu größeren europäischen Katastrophen geführt habe, über Hofmannsthal und seinen Niedergang vom feinsinnigen Knaben Loris zum Feuilletonisten der habsburgischen Militärmacht urteilte er 1928: »Die Schönheiten Hofmannsthals sind schön wie die planimetrischen Verhältnisse englischer Parkanlagen, die für herrschaftliche Genüsse herbstlicher Stimmungen geschaffen sind. Es ereignete sich aber, daß diese lyrischen Parks Kriegsgebiete wurden, daß dieses poetische Europa von einem Wirbel blutiger Kriege fortgeweht und der Poet Hofmannsthal kaiserlich-königlicher Oberleutnant wurde, dem nichts anderes übrig blieb, als patriotischer Hymniker zu werden. «
Zweifellos war es unter allen österreichischen Dichtern tatsächlich Karl Kraus, den Krleža am meisten – oder besser: noch am ehesten – geschätzt hat. Der kompromisslose Kampf gegen Kriegstreiber und Kriegsgewinnler und der Wunsch, dieser »großen Zeit« der großen Verbrechen ein unbestochener Zeuge zu sein, verband ihn so wie die gewaltige Rhetorik und Sprachmacht gewiss mit ihm. Doch hat Krleža die selbst gewählte Beschränkung des Karl Kraus zwar geachtet, doch für sich selbst verworfen: Auch er hat sich die Presse zum entlarvten und höhnisch bloßgestellten Feind gemacht, seine künstlerische Energie jedoch nie für diesen aufgebraucht, im Gegenteil. Krležas Lebenswerk, weit verzweigt in Erzählungen, Romanen, Novellen, Gedichten, Theaterstücken, wissenschaftlichen Studien, kritischen Abhandlungen, politischen Pamphleten und Essays, war dem Ideal der Totalität verpflichtet, im Ganzen wie in jedem seiner Teile, und von hier aus, von dieser Überzeugung, dass die Welt, deren zerborstene Einheit die Kunst wiederherzustellen hat, reicher und komplexer ist als grelle Spiegelungen in verkommenen Presseerzeugnissen, hat er das Werk des Karl Kraus für sich verworfen.
Zugleich wütend und tiefschürfend, in höchste polemische Schärfe zugespitzt war Krležas Kritik an österreichischer Kunst und Literatur, und unbedingt und kompromisslos ist auch die Verwerfung, die er dem »österreichischen Prinzip« in der Politik angedeihen ließ; natürlich galt sie zuerst den staatstragenden Schichten und deren großösterreichischen Ideologien, nicht minder aber schloss sie auch die »kaiserliche Hofratspolitik« der Sozialdemokratie, die »marxistische Winkeladvokatur« jener Austromarxisten ein, die den Traum einer fortdauernden Hegemonie der »Deutschösterreicher« über die in das Reservat einer bloß kulturellen Autonomie entlassenen Slawen der Donaumonarchie träumten …
Zeitlebens ist der gewesene Kadett Krleža in österreichischen Fragen kein kühler, kein interesseloser Beobachter geworden, und noch im hohen Alter tönte meist Empörung und Verachtung auf, wenn er sich der österreichisch-ungarischen Welt von gestern besann. Noch sein letzter, grandioser Monumentalroman Zastave – Die Flaggen ist auch der Auseinandersetzung mit der Donaumonarchie gewidmet, und wenn Krleža mit zunehmendem Alter zunehmendes Interesse am Entwurf einer anderen übergreifenden europäischen Ordnung zeigte, zog er deren kulturellen Umriss doch niemals nach dem Schattenbild der alten Donaumonarchie, ja stets gleichsam gegen diese. Und doch war sein schneidend scharfer, sprachgewaltiger Spott allem Habsburgischen, sein enzyklopädisch gebildeter Hohn allem mitteleuropäisch Entflammten gegenüber keine verspätete Grablegung einer ohnehin längst abgestorbenen Welt. Nein, Krleža hat nicht Gespenster geweckt, um sie ihrer Geisterhaftigkeit zeihen zu können, es ging ihm nicht um nachgetragenen Hass, sondern um das Gedächtnis der Menschen, um das Gedächtnis – also um die Zukunft, eine Zukunft aus gestalteter Vergangenheit.
Nach Jahren erzwungenen Schweigens und eines von Gestapo und Ustaschi zugleich überwachten und bedrohten Hausarrestes wandte sich Miroslav Krleža 1945 mit einem fulminanten Essay an die Öffentlichkeit. Sein Entwurf einer sozialistischen, aber nicht parteipflichtigen Kunst, einer gesellschaftskritischen, aber nicht ideologisch verschnittenen Literatur hatte ihm in den dreißiger Jahren nach dem Hass der konservativen gefährlicher noch den der stalinistischen Kulturverweser eingetragen, die Jagd auf Abweichler in den eigenen Reihen machten. Was er nun in kämpferisch-streitbaren Essays zur Kultur und Kulturpolitik forderte, entzündete zwar sogleich wieder die alte kalte Bürokratenwut gegen ihn, indes, beschimpft, bedroht, verleumdet, konnte sich Krleža nun doch behaupten, ohne seine Position preisgeben zu müssen oder sich ins Schweigen zurückdrängen zu lassen.
»Unser Volk«, meinte er 1945 in seinem Essay Literatur heute, der andere Verpflichtungen der Kunst als jene durch Partei und Bürokratie durchaus anerkannte, »unser Volk, das an fremden Herden und fremden Tischen Almosen aus fremder Hand empfangen hat, jahrhundertelang hungrig und nackt wie Vieh, das fremde Herren geschoren und gehäutet haben … ist das Thema unserer Literatur. Mit den Augen der Literatur beschaut sich das Volk durch die Jahrhunderte, und damit sein Gedächtnis nicht wie eine Wolke im Wind verfliegt, darf die Literatur nichts vergessen. « Nichts darf die Literatur vergessen, niemanden darf sie vergessen … Das erste Werk, das Krleža dem Gedächtnis des kroatischen Volkes schrieb, war der Erzählband Der kroatische Gott Mars;