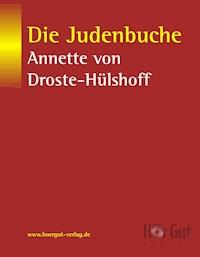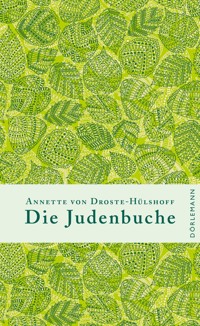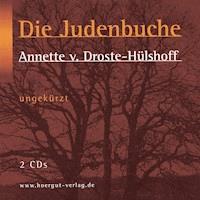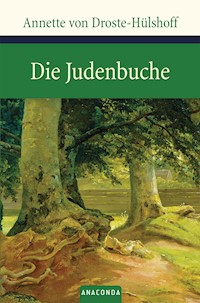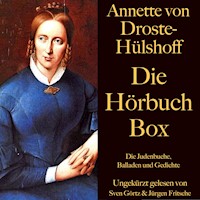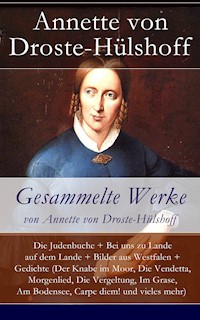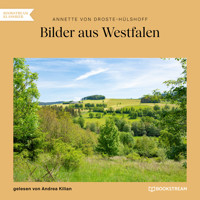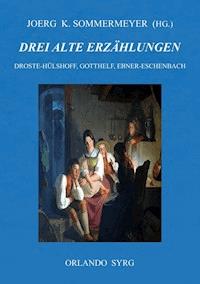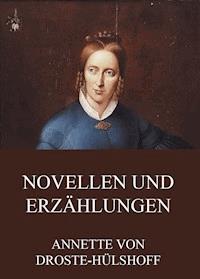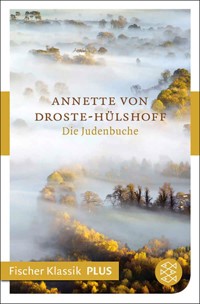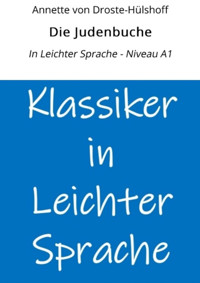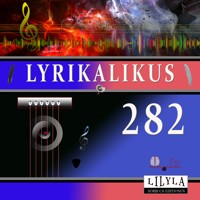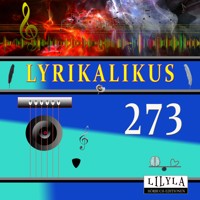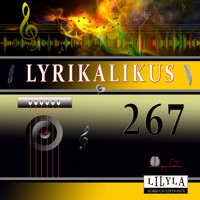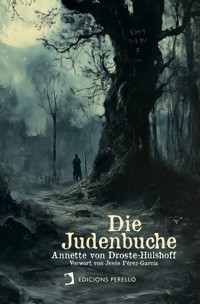
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Edicions PerellóHörbuch-Herausgeber: BÄNG Management & Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Universell
- Sprache: Deutsch
In einem abgelegenen norddeutschen Tal im 18. Jahrhundert erschüttert ein mysteriöses Verbrechen eine geschlossene, von alten Bräuchen geprägte Gemeinschaft. Annette von Droste-Hülshoff verwebt eine eindringliche Geschichte über Schicksal, Gerechtigkeit und die Geheimnisse, die zwischen den Bäumen des Waldes verborgen sind, mit einer eindringlichen Prosa. Die Judenbuche ist ein Klassiker des deutschen frühen Realismus, der uns einlädt, über Schuld und Wahrheit in einer Welt nachzudenken, in der nichts so ist, wie es scheint.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 91
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Diese Sammlung würdigt die wichtigsten Werke der Weltliteratur, jeweils in ihrer Originalsprache.
Die Serie „Deutsche Briefe“ enthält Titel wie: Die Verwandlung von Franz Kafka; Gebrüder Grimms beste Märchen von Jacob und Wilhelm Grimm; Die unsichtbare Sammlung von Stefan Zweig; Die Leiden des jungen Werther von Johann Wolfgang von Goethe; Das kalte Herz von Wilhelm Hauff unter anderen...
Annette von Droste-Hülshoff
DIE JUDENBUCHE
© Ed. Perelló, SL, 2025
© Vorwort von Jesús Pérez-García
© Deckblatt-Design: José Cazorla García
Calle Milagrosa Nº 26, Valencia
46009 - Spanien
Tlf. (+34) 644 79 79 83
http://edperello.es
I.S.B.N.: 979-13-87576-57-8
Das Fotokopieren oder freie Online-Stellen dieses Buches ohne Genehmigung des Herausgebers ist strafbar.
Alle Rechte vorbehalten. Jede Form der Vervielfältigung, Verbreitung, Eine öffentliche Kommunikation oder Transformation dieser Arbeit kann nur erfolgen mit der Erlaubnis ihrer Inhaber, sofern gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Kontaktieren Sie CEDRO (Spanisches Zentrum für Reprografische Rechte, www.cedro.org) wenn Sie einen Ausschnitt dieser Arbeit fotokopieren oder scannen müssen.
Vorwort
Annette von Droste-Hülshoff: Die Judenbuche. Ein Sittengemälde aus dem gebirgichten Westfalen. Dieses Werk entstand zwischen 1837 und 1841/42. Es erschien erstmals im Morgenblatt für gebildete Leser, Stuttgart, vom 22. April bis 10. Mai 1842. Der in der ausklingenden Romantik geschriebenen Novelle ist ein Gedicht vorangestellt, denn die Lyrik war eine Gattung, die dem damaligen Geschmack besonders innig lag. Es folgt, zur Prosa übergehend, die knappe Nennung der Hauptfigur und die ausführliche Schilderung eines Dorfes, das inmitten eines dunklen Waldes in einer westfälischen, gebirgigen Landschaft verloren liegt, wofür mehrere Gegenden in Betracht kommen, darunter auch das immer noch heute abgelegene hügelige Sauerland. Andere geographische Bezeichnungen in Westfalen werden ebenfalls genannt: Telgengrund, Roderholze, Teutoburger Wald. Die Schauplätze bleiben zunächst vage, aber es dauert nicht lange, bis der Teutoburger Wald in der Nähe des Weser-Berglandes, in Norddeutschland, am Nordrand der Mittelgebirge, explizit gemacht wird. Mitte des 18. Jahrhunderts, der angegebenen Zeit des Geschehens, gehörte das Gebiet teils zum Fürstbistum Paderborn, teils zum Fürstbistum Corvey.
Die ersten Zeilen des erzählenden Teils lauten: „Friedrich Mergel, geboren 1738, einziger Sohn eines kleinen Gutsbesitzers in dem Dorf B.“. Die Tendenz des sentimentalen Romans des achtzehnten Jahrhunderts, die Aufmerksamkeit auf eine kurz nach ihrer Geburt in Bedrängnis geratene Person zu richten, wird fortgesetzt. Aber an die Stelle eines tugendhaften hilflosen Mädchens tritt hier ein Junge. Auch andere Abweichungen sind zu verzeichnen. Der Brauch, die Protagonisten mit ihren Initialen zu benennen, wird umgekehrt. Die Initialen stehen nicht mehr für die Person, sondern für den Ort, das „Dorf B.“, eine kleine Ortschaft, die mit einem ausgeprägten deterministischen Sinn und einer unverblümten Rohheit beschrieben wird, die den Naturalismus in vieler Hinsicht vorwegnehmen. Mit Merkmalen etwa, die im 21. Jahrhundert die zeitgenössische Literatur und die Filme über die Hillbilliesoder Hinterwäldler der Appalachen in den heutigen Vereinigten Staaten von Amerika inspiriert haben könnten.
Die Leserin oder der Leser erfährt, dass das Dorf B. „die hochmütigste, schlauste und kühnste Gemeinde des ganzen Fürstentums“ sei. Die Einheimischen sind zäh und überleben in einem Klima primitiver Gewalt, in dem Raufereien als normales Mittel zur Beilegung von Differenzen angesehen werden, und wo das Fortbestehen mit der Missachtung fremden Eigentums und ziviler Umgangsformen einhergeht. Der Holzraub („Forstfrevel“) ist unausrottbar und wird durch die Flüsse begünstigt, die den Abtransport der gestohlenen Stämme erleichtern. Die Förster retten bei diesen Vorfällen ihre Haut, indem sie Prellungen und manchmal auch Knochenbrüche in Kauf nehmen. Ferner wird die niederste Ebene der Gerichtsbarkeit von den kleinen Grundbesitzern ausgeübt, die „nach ihrer redlichen Einsicht“ Recht sprechen, ohne kaum auf juristische Finessen einzugehen oder Rechtsurkunden zu Rate zu ziehen.
Das Haus, in dem Friedrich Mergel aufwächst, befindet sich in einem schäbigen Zustand, Unglücksfälle hatten ihren Teil dazu beigetragen, aber im Großen und Ganzen war das Elend selbst verschuldet – „viel Ordnung und böse Wirtschaft“ waren im Spiel. Der Vater war ein Säufer. Die erste Ehefrau floh kurz nach der Heirat und starb bald darauf. Fritz war der Sohn einer zweiten Frau, Margreth, die sich allein um das Kind kümmern musste, als der Vater eines Tages verschwand. In einer stürmischen Nacht, nach romantischer Szenerie, ereignete sich ein weiteres Unheil. Eine Windsbraut erhob sich, im Schornstein rasselte es wie ein Kobold, an der Tür ahnte der kleine Fritz den Teufel. Die Mutter fiel in Ohnmacht und als sie wieder zu sich kam, war eine Schar Männer ins Haus eingedrungen – der vermisste Ehemann war von Hülsmeyer tot aufgefunden worden. Des Weiteren gehörte Hülsmeyer zu der Sorte von Menschen, die sich nicht scheuten, Holz und Reh zu stehlen. Für ihn hatte Margreth nur beschönigende Worte übrig, auch wenn zwischen ihnen weder verwandtschaftliche noch enge freundschaftliche Beziehungen bestanden: „Hülsmeyer sei ein ordentlicher, angesessener Mann“. Und über Aaron, der von Hülsmeyer gescholten und um ein paar Groschen erleichtert worden war, sagte sie: „Die Juden sind alle Schelme“.
Der junge Friedrich seinerseits wird verständnisvoll gezeichnet, seine dunklen Seiten, in denen Niedertracht und Verschlagenheit lauern, werden aber keineswegs vertuscht. Er habe gerade Glieder, dazu die blonden Locken von Onkel Simon, der ihn adoptierte. Er sei fein und schlank, mit fast edlen Zügen und gepflegtem langem Flachshaar. Das übrige Äußere sei jedoch nicht so makellos –es sei „zerlumpt, sonnenverbrannt und mit dem Ausdruck der Vernachlässigung und einer gewissen rohen Melancholie in den Zügen.“ Gegenüber seinen Untergebenen ist Fritz schroff und hart, gegenüber seinen Schuldnern und Vorgesetzten feige und ausweichend.
Eine festliche Szene illustriert bestens diese zwielichtigen Charaktereigenschaften Friedrichs, die sich ohne Weiteres auch auf andere Figuren übertragen lassen, und in diesem Zusammenhang werden die Spannungsverhältnisse und sozialen Missstände im Dorf näher beleuchtet. Im milden Herbst um 1760, als alle Scheunen mit Korn und alle Keller mit Wein gut gefüllt waren, als es überall Lustbarkeiten gab, mehr Betrunkene, Schlägereien und Streiche als je zuvor, fand eine Hochzeit statt. Der Jubel und das Gelächter waren an allen Enden zu hören, Branntwein und Kaffee flossen in Strömen, Geigen und Baßviolen ertönten glänzend aus dem Orchester. In dieser festlichen Stimmung stolzierte Friedrich umher wie ein Hahn, machte sein Recht als erster Elegant geltend. Und gebieterisch und hochmütig behandelte er seinen Schützling, Johannes. Als dieser arme Teufel beim Diebstahl eines halben Pfündchen Butter – als Vorrat für „die kommende Dürre“ – erwischt wurde, beschimpfte Fritz den Delinquenten als „Lumpenhund“, und entließ ihn, nicht ohne ihm vorher ein paar derbe Maulschellen und einen tüchtigen Fußtritt zu verpassen. Friedrich fiel beim Ball auch durch eine Uhr auf. Wilm Hülsmeyer, sein Nebenbuhler und erzähltechnisch eine Nebenfigur, die stellvertretend für das soziale Gefälle, den Neid und den schelmischen Überlebenskampf agiert, lässt das damals kostbare Stück nicht ohne sarkastische und schuldzuweisende Kommentare passieren: „Hast du sie bezahlt?“ – „Du weißt wohl, der Franz Ebel hatte auch eine schöne Uhr, bis der Jude Aaron sie ihm wieder abnahm [als Pfand für unbezahlten Schulden, so wie es angedeutet wird].“
Bald darauf erschien „der Jude Aaron, ein Schlächter und gelegentlicher Althändler aus dem nächsten Städtchen“, und mahnte Friedrich laut vor allen Leuten um den Betrag von zehn Talern für eine gelieferte Uhr. Fritz war wie vernichtet fortgegangen. Die Tenne, ein norddeutsches Wort für Scheune, Lohdiele oder Halle, brach in Gelächter und antisemitische Rufe aus, die seit Jahrhunderten zu den althergebrachten Topoi religiöser Intoleranz im christlichen Europa gehören: „Packt den Juden! Wiegt ihn gegen ein Schwein!“
Es ereignen sich weitere Vorfälle, eine besonders arglistige Bande von Holzfrevlern hält die Ordnungshüter in Schach, und eines Tages erscheint ein toter Förster mit einer Axt im Kopf, dessen Fall unaufgeklärt bleibt. Doch erst der Tod des Juden Aaron bringt die Scheinheiligkeit und das gegenseitige Misstrauen im Gemeindeleben so richtig zum Ausdruck. Schließlich hängt an der Judenbuche, wo Aaron aufgefunden wurde, auch die Leiche eines aus türkischer Sklaverei Altangesessenen. Lapidar endet die Novelle mit der Übersetzung eines hebräischen Spruches, der auf der Buche steht: „Wenn du dich diesem Ort nahest, wo wird es dir ergehen, wie du mir getan hast.“
Der französische Schriftsteller der Romantik Alfred de Vigny (1797-1863) definierte den Begriff „Geschichte“ als einen Roman, der vom Volk geschrieben wird. Auch Annette von Droste-Hülshoff reiht sich in diese Koordinaten ein, die im 19. Jahrhundert die Erzählung zur wichtigsten literarischen Gattung werden ließen. Romantische Vorstellungen wie die Mythisierung des Volkes als schöpferisches Kollektivwesen oder die Vorliebe für das Gespenstische, Unheimliche und Irrationale flossen ein. Die Judenbuche ist sehr fein nuanciert. Der Zeitgeist wird sehr gut eingefangen. Die Leserinnen und Leser werden mit einem Tableau konfrontiert, in dem das Dorfleben und die Dynamik des Hinterwäldlerdorfes die konkreten Personen überlagern. Der dunkle Wald selbst wird in gewisser Weise zum Akteur, er liefert die Kulisse, wirkt aber gleichzeitig auf die Menschen ein, die sich zwischen den Bäumen tummeln, das Holz bewachen oder stehlen, und eine einzelne Buche wird zum Magneten des Bösen, der Niedertracht, des Hasses und der Vorurteile – kein Wunder, dass diese Judenbuche als Titel des Werkes fungiert.
Annette von Droste-Hülshoff (1797, Burg Hülshoff bei Münster/Westfalen – 1848, Burg Meersburg) war eine begnadete Romantikerin und zugleich eine Frau ihrer Zeit. Sie entstammte dem wohlhabenden katholischen Adel Norddeutschlands und musste sich dem korsettierten Milieu der biedermeierlichen Bourgeoisie und der puritanischen Sittenstrenge Mittel- und Nordeuropas fügen. Daher auch der Untertitel der Novelle, der mit kantisch konservativen Untertönen auf die Kommentierung gesellschaftlicher Normen und Normenverfall verweist: „Sittengemälde aus dem gebirgichten Westfalen“. Damit wird auch eine Brücke von der Romantik in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zum Realismus und Naturalismus der Literatur in der zweiten Hälfte geschlagen. Aufschlussreich ist die Stellung des Weiblichen in diesem menschlichen Ökosystem. Die Frauen in der patriarchalischen Gesellschaft der Judenbuche leiden unter den toxischen Gewohnheiten der Männer, die zu Trunksucht und Gewalt neigen, sind aber gleichzeitig Beispiele einer starken inneren Kraft. Die fiktive Margreth, die Mutter von Fritz, ist ein herausragendes Beispiel dafür, welche Rolle Frauen in den mittleren und verwahrlosten Schichten der Gesellschaft spielen, wie sie ihre Sippe unter schwierigen Bedingungen aufziehen und beschützen und wie sie sich durchschlagen. Auch Annettes Lebensweg verlief in ähnlich schwierigen Bahnen – obwohl ihr Leben auf den ersten Blick von Luxus und Schlössern geprägt war. Die Würde einer der größten Dichterinnen der deutschsprachigen Literatur wurde von Droste-Hülshoff erst nach ihrem frühen Tod zuteil. Ihr Konterfei zierte einen 20-Mark-Schein der Bundesrepublik, und ihre bekanntesten Texte, das Gedicht Der Knabe im Moor und die Novelle Die Judenbuche, gehören heute zum literarischen Kanon.
Jesús Pérez-García
Die Judenbuche
Wo ist die Hand so zart, daß ohne IrrenSie sondern mag beschränkten Hirnes Wirren,So fest, daß ohne Zittern sie den SteinMag schleudern auf ein arm verkümmert Sein?Wer wagt es, eitlen Blutes Drang zu messen,Zu wägen jedes Wort, das unvergessenIn junge Brust die zähen Wurzeln trieb,Des Vorurteils geheimen Seelendieb?Du Glücklicher, geboren und gehegtIm lichten Raum, von frommer Hand gepflegt,Leg hin die Wagschal, nimmer dir erlaubt!Laß ruhn den Stein — er trifft dein eignes Haupt!