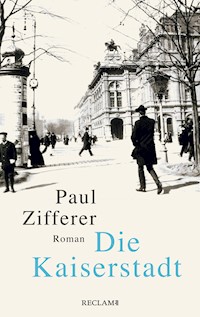
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine literarische Wiederentdeckung im besten Sinne, zum hundertjährigen Erscheinungsjubiläum neu aufgelegt! Als Toni Muhr im Herbst 1916 aus dem Krieg nach Wien zurückkehrt, wird gerade Kaiser Franz Joseph I. feierlich zu Grabe getragen. Auch sonst scheint Tonis Welt aus den Fugen zu geraten: Sein Arbeitgeber hat ganz offensichtlich das chemische Patent, das er ihm kurz vor seinem Einzug zum Wehrdienst vergebens zum Kauf angeboten hatte, einfach selbst angemeldet und damit während Tonis zweijähriger Abwesenheit einen sagenhaften Reichtum erwirtschaftet. Und Tonis Ehefrau Lauretta verhält sich zunehmend merkwürdig – betrügt sie ihn etwa mit seinem Chef?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 525
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Paul Zifferer
Die Kaiserstadt
Roman
Reclam
2023 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung: FAVORITBUERO
Coverabbildung: © Iberfoto / Bridgeman Images
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2023
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-962111-1
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-011443-8
www.reclam.de
Inhalt
Lauretta
Maria Jadwiga
Christine
Zu dieser Ausgabe
Nachwort
Wiener Konfusionen
Erstes Buch
Lauretta
Toni Muhr erinnerte sich später nicht mehr, wie er vom Westbahnhof auf den Neuen Markt geraten war. Er fühlte Müdigkeit und Schwere in allen Gliedern und hatte nur den einen Wunsch, so schnell als möglich nach Hause zu gelangen.
Auf der Ringstraße war jeder Wagenverkehr eingestellt, und erst hier erfuhr er, dass der alte Kaiser heute begraben wurde. Die Todesnachricht hatte ihn wohl erreicht, als er, aus der Kriegsgefangenschaft heimkehrend, in einer Linzer Cholerabaracke zur Quarantäne lag. Aber seither war eine Woche verstrichen, vielleicht noch darüber: Alles Zeitmaß schien ausgelöscht. Toni Muhr hätte kaum den Tag seiner Abreise von der Insel Elba bestimmen können, noch die Dauer seines Aufenthaltes in der Cholerabaracke. Er wusste nur, dass seine Beurlaubung zweimal verzögert worden war, weil sich gerade an dem Tage, da er freigelassen werden sollte, ein neuer Krankheitsfall ereignet hatte.
Nun blickte er bestürzt auf den Menschenstrom, der, als ein letztes, unerwartetes Hindernis, seinen Weg versperrte. Allmählich aber gelang es ihm doch, trotz der vielen Wachposten, bis zur inneren Stadt vorzudringen. Er wies Urlaubszettel und Marschroute vor; so ließ man ihn ziehen.
Unwillkürlich bog Toni Muhr seine Schultern, machte sich klein. Er sah kläglich aus in seiner fleckigen, arg zerknitterten Uniform, die nach Formalin roch. Nur das Sternchen eines Gefreiten hatte er am Kragen, und sogar die gelben Einjährigenstreifen fehlten ihm, obgleich er Doktor der Chemie war und sich in Fachkreisen eines gewissen Rufes erfreute.
Ehedem, nach Vollendung seiner Studien, hatte es Toni Muhr als Glück betrachtet, nicht sein ganzes Militärjahr abdienen zu müssen wie die anderen, sondern als Ersatzreservist schon nach wenigen Wochen entlassen zu werden. Sein Vater, der Weinbauer in Grinzing war, drang auf schnelles Geldverdienen, und in der Katlein’schen Fabrik gab es gerade eine freie Stelle. Als dann der Krieg ausbrach, hatte man ihn ohne viel Umstände ins Feld geschickt; nicht einmal die notwendigen Gewehrgriffe waren ihm geläufig gewesen.
Nun kehrte er heim. »Ich wohne in der Stallburggasse«, wiederholte er immer wieder tonlos den Posten, die ihn anhielten, und warf die Gurten seines Rucksackes von der einen Schulter auf die andere; kopfschüttelnd blickte man ihm nach. So kam er bis zum Neuen Markt, zwischen den Menschenmassen sich scheu hindurchwindend, den Blick im Leeren. Hier aber fand er sich bald so fest eingekeilt, dass nach vorne wie nach rückwärts der Weg gleichermaßen abgeschnitten war.
Von allen Seiten regneten Schimpfworte. »So a Druckeberger«, hieß es, »so a Tachanierer.« Und man lachte.
Ein berittener Wachmann wurde aufmerksam und sprengte herbei. Der Kies, der über das Pflaster gestreut war, knirschte unter den Hufen des tänzelnden Pferdes. Toni Muhr gab nun jeden Widerstand auf und wartete. Wenn er es recht bedachte, hatte er in den letzten zwei Jahren nichts anderes getan als gewartet, in vielen schlimmen Lebenslagen immer wieder gewartet. Und nun, zwei Straßenbiegungen von Ziel und Zuflucht getrennt, galt es noch einmal: stillestehen und warten.
Von einem Turm schlug es drei Uhr. Toni Muhr hatte noch nichts gegessen. Manchmal fühlte er, wie sein Herz aussetzte und dann wieder schnell zu laufen begann, als wollte es das Versäumte nachholen. Auch daran war er nun schon gewohnt, seit jenem Tage am Ochridasee, wo ihn zum ersten Male die große Schwäche befallen hatte.
Es war ein heller, sonniger Frühwintertag, die leichtbewegte kühle Luft tat wohl. Deputationen der einzelnen Regimenter nahmen ihre Plätze ein; gertenschlanke junge Leute mit harten, von der Sonne gebräunten Antlitzen. Trotz ihrer feldgrauen Uniformen schienen sie irgendwie zur Parade herausgeputzt, und auch ihre goldenen und silbernen Ehrenzeichen waren hier, in solcher Anhäufung, der inneren Kostbarkeit beraubt und hatten etwas Paradehaftes.
Toni Muhr bedachte, dass ihm selbst niemals der Sieg begegnet war. Denn als die verbündeten Heere in Serbien eindrangen, hatte er doch wieder das Schicksal der Fliehenden, der aus ihrem eigenen Lande Verjagten, geteilt. Plötzlich sah er das Bild vor sich, wie er damals bei Schabatz gefangen genommen worden war. »Sie sind ein Chemiker«, hatte sein Hauptmann zu ihm gesagt, »da müssen S’ auch was von der höheren Technik verstehen.« Und so war er beauftragt worden, auf einer Saveinsel an Schanzarbeiten teilzunehmen, während schon die Serben in den Ausläufern des Rudnikberges ihren Vorstoß begonnen hatten. Nach langem, mühseligem Verbergen war die kleine Abteilung endlich aufgegriffen worden. Toni Muhr empfand noch jetzt das Beschämende dieses Hervorkriechens und Sichertappenlassens; wie Strolche hatten sie alle ausgesehen.
Eine Halbeskadron der Kaiserdragoner ritt feierlich vorüber, strahlend und glänzend im Sonnenlicht. Die schwarz ausgeschlagenen Pforten der Kapuzinerkirche taten sich auf. Man blickte in eine dunkle Tiefe, ganz ferne flimmerte Kerzenlicht. Ein weißbärtiger Mönch in brauner Kutte, den Geißelstrick um die Lenden, trat hervor und lehnte nun, Gebete lispelnd, am Eingang; neben ihm eine hagere Gestalt im Bischofsornat, mit Krummstab und Mitra.
Toni Muhr geriet wieder ins Träumen. Er stand vor dem Donnerbrunnen, und das leise Plätschern des Wassers in der feierlichen Stille trug seine Gedanken auf und nieder. Sein Blick fiel auf die nackten weiblichen Figuren, die sich über den Rand des Brunnenbeckens schwangen. Er wusste, dass sie österreichische Flüsse darstellten; eine aber trug das Antlitz der »schönen Lebzelterin«, die einst hier auf dem Platze ihren Laden hatte, dicht an der grauen Kirche. Der junge Rafael Donner, der gegenüber in einer Mansarde wohnte, hatte sie geliebt, wenngleich sie leichtfertig war, als das Kind eines französischen Coiffeurs, und es mit den Kavalieren des Prinzen Eugen hielt. Toni Muhr überlegte, welche von den Figuren wohl die schöne Lebzelterin sein mochte.
Und da musste er an Lauretta denken.
Lauretta war seine Frau, aber es schien ihm noch immer wunderbar genug, dass sie gerade ihn geheiratet hatte. Sie entstammte einer alten italienischen Familie, ihr Vater, Ermete de Saluzzo, leitete seinen Namen von einer jüngeren Linie des berühmten Markgrafengeschlechtes her. Manchmal auch sprach er von der Dichterin Diodata Saluzzo, einer entfernten Verwandten, die er noch als ein altes Mütterchen ihre zierlichen und galanten Verse habe vortragen hören.
Sein Vater, ein einflussreicher Verwaltungsbeamter in österreichischen Diensten, hatte in Mailand großes Haus geführt. Ermete de Saluzzo aber, der ein seltsam verwelschtes Wienerisch sprach und als ein Wohlleber auch die Wiener Küche – mit leichter Betonung der italienischen Elemente in ihr – zu schätzen verstand, übte keinen bestimmten Beruf aus, sondern begnügte sich mit losen Beziehungen zu einer Versicherungsgesellschaft.
Bis zum Derby trug Herr von Saluzzo einen hohen Zylinder mit schmaler, flacher Krempe, den »Stößer«, dazu lichte Gamaschen. Er freute sich, wenn die Fiaker an der Straßenecke ihn mit Hutschwenken und tiefem Verneigen beim Namen riefen. Hager und stelzbeinig schritt er einher, winkte den wohlhabenden Bekannten, die er gelegentlich eine Polizze hatte unterschreiben lassen, von weitem gönnerhaft zu oder reichte ihnen vorsichtig zwei Finger seiner schmalen, ringgeschmückten Hand.
Lauretta war sein jüngstes Kind, ihr älterer Bruder Gino hatte bei Görz einen kleinen Besitz, von dem er alljährlich ein Fässchen Öl nach Wien sandte. Der zweite, Rudi, war schon auf gut Wiener Boden, im sogenannten Freihaus, geboren, gerade hundert Jahre nach der »Zauberflöte«, die, gleich ihm italienisch-wienerischen Geblütes, an der nämlichen Stätte das Licht der Welt erblickt hatte. Von Papageno mochte Rudi Saluzzo die quecksilberne Beweglichkeit geerbt haben. Dem Beispiel seines Vaters folgend, vermied er jede festverankerte Tätigkeit, war jedoch stets in tausend Geschäfte verwickelt, die ihn nichts angingen und die er nur aus Liebhaberei für andere besorgte; man nannte ihn allgemein »das Freunderl«.
Übrigens waren Rudi Saluzzo und seine Geschwister noch durch festere Blutbande mit dem Wiener Theater verknüpft, und zwar durch ihre Mutter, Frau Johanna, die dereinst, als Tochter eines kunstsinnigen Hofrats und mit einer kleinen deklamatorischen Begabung ausgestattet, an der Burg ihr schauspielerisches Unterkommen gefunden hatte. Herr Ermete de Saluzzo, der zu jener Zeit regelmäßig die Premieren besuchte und für Hallenstein schwärmte, verliebte sich in sie und glaubte eine Jugendtorheit zu begehen, indem er ihr seine Hand anbot.
Bald jedoch erkannte er, wie vorsichtig und klug seine Wahl gewesen war. Erst in der Ehe schien Frau Johanna, die sich schnell zu bürgerlicher Rundlichkeit entwickelte, ihr wahres Rollenfach entdeckt zu haben. Das ganze Haus wäre sicherlich auseinandergefallen, wenn sie es nicht zusammengehalten hätte. Wer immer in der Familie etwas verschuldete – und es gab noch eine ganze Reihe von Onkeln und Tanten und Vettern und Neffen und Nichten, die ewig etwas auf dem Kerbholz hatten –, sogleich wurde Frau Johanna gerufen, die alles Krumme wieder geradebiegen musste.
Lauretta war ihr Liebling; vielleicht, weil sie ihr die meisten Sorgen bereitete. »Lauretta ist ein schwieriges Kind«, erklärte sie oft, »ihre Schönheit steht ihr im Wege.«
Als Lauretta noch in die Schule ging, stürzte sich ein Gymnasiast, der sie in der Tanzstunde kennen gelernt hatte, ihretwegen aus dem Fenster. Wenn die Familie Saluzzo in die Sommerfrische reiste, folgte immer ein Schwarm von Anbetern hinterdrein, und sobald einer in Ungnade gefallen war, musste Signor Ermete mit ihm spazieren gehen.
Lauretta ließ sich von allen bewundern und liebte keinen; die Männer und die ganze Welt schienen nur Spiegel ihrer Schönheit. So geriet sie in manchen Verdruss. Einer der beleidigten Werber hatte Herrn von Saluzzo – des Spazierengehens in seiner Gesellschaft überdrüssig – sogar zum Duell gefordert. Das musste ein Ende nehmen. Herr von Saluzzo bestand darauf, dass Lauretta heiraten sollte, und er dachte dabei natürlich an eine Heirat nach seinem Geschmack: vornehmes Haus, Monatsfiaker, wie es sich eigentlich bei Lauretta von selbst verstand.
Zuerst aber wurde sie noch strafweise mit ihrer Mutter in einen winzigen Ort an der dalmatinischen Küste, nahe von Spalato, verschickt, wo einige Mitglieder der so weitverzweigten Familie Saluzzo in alten, halbzerfallenen Kastellen saßen. Eisenbahnverkehr gab es nicht; nur jede Woche einmal ein Schiff. Hier nun lernte Lauretta den Toni Muhr kennen, der eine romantische Ferienreise auf einem Frachtdampfer unternommen hatte und für kurze Zeit in Spalato ans Land ging.
Er gefiel Lauretta auf den ersten Blick, gerade weil er so wortkarg war und ihr gar keine Komplimente machte. Sie fand, dass ihn sein schwermütiges Wesen vorzüglich kleide, und heimlich hatte sie es darauf abgesehen, ihn doch zu einer Huldigung zu bringen wie die anderen, wobei es indessen geschah, dass sie sich selbst über beide Ohren in ihn verliebte – und Frau Johanna mit ihr.
Herr von Saluzzo, der in seiner zierlichen Schrift lange Briefe schrieb, voll weitausholender Zukunftspläne, musste sich mit einem Schwiegersohn abfinden, der in einer chemischen Fabrik ein anständiges, doch keineswegs ungewöhnliches Jahresgehalt bezog und dessen Vater ein einfacher Weinbauer in Grinzing war.
Toni Muhr und seine junge Frau hatten sich in einer kleinen Atelierwohnung eingerichtet; sie lebten da wie die Turteltauben, wenngleich nicht in der stillen Zurückgezogenheit, die dem Geschmack Toni Muhrs entsprochen hätte. Es meldeten sich eine Reihe alter Bekannter Laurettas, füllten die kleine, behagliche Wohnung und fanden es sehr gemütlich.
Allmählich gewöhnte sich Toni Muhr daran, immer fremde Leute anzutreffen, wenn er aus dem Bureau nach Hause kam, und später fand er es sogar begreiflich, dass er auch im Bureau zum Telefon gerufen wurde, um für seine junge Frau kleine Bestellungen entgegenzunehmen. Man beglückwünschte ihn Laurettas wegen, man sagte ihm, er habe die schönste Frau Wiens heimgeführt, und da ihm selbst dergleichen Anerkennung willkommen war, konnte es ihn nicht wundernehmen, dass Lauretta sich von gesellschaftlichem Glanze angezogen fühlte und ringsum, wie Blumen zu einem Strauß, alle die huldigenden Worte pflückte, deren sie nun einmal bedurfte und die er ihr nicht zu bieten vermochte.
Dann war der Krieg gekommen. Während des furchtbaren Zuges durch Albanien war Toni Muhr ohne Nachricht geblieben, und erst auf Elba hatte ihn jener schlimme Brief erreicht, in dem Lauretta, schmeichelnd und treuherzig, wie es ihre Art war, auseinandersetzte, sie bringe es nicht über sich, ihn zu betrügen, und sie liebe jetzt einen anderen. Lange habe sie mit sich gekämpft, ob sie ihm die volle Wahrheit mitteilen solle, aber hässliches Versteckenspielen müsste die Erinnerung an eine Vergangenheit beschmutzen, die sie rein und makellos zu erhalten wünsche. Zum Zeichen, dass er sie verstehe, erbitte sie von ihm ein gutes Wort; er solle sie trösten, wie er es oft vorher getan.
Als Toni Muhr diesen Brief zu Ende gelesen hatte, war es ihm eingefallen, dass Lauretta einmal, gleich in den ersten Tagen ihrer Ehe, zu ihm gesagt hatte: »Du musst mich so fest liebhaben, dass ich dir alles erzählen kann.« Und da sah er sie nun vor sich sitzen, zum Greifen nahe. Im Plauderton berichtete sie von ihrer Untreue: »Warum bist du so fern«, hörte er sie sagen, »es ist deine Schuld.«
Und Toni hatte Lauretta das gute und tröstende Wort gesandt, nach dem sie verlangte.
Von der nahen Stephanskirche begannen die Glocken zu läuten. Das riss Toni Muhr aus seinen Gedanken. »Endlich«, sagte ein dicker Herr, der ein grünes Steirerhütel trug – derselbe, der ihn vorher einen »Tachanierer« gescholten hatte –, und hob seinen kleinen Sohn, der unter Tränen gierig ein Stück Backwerk verzehrte, auf seine Schulter. Er schien jetzt umgänglich und geneigt, mit Toni Muhr ein Gespräch anzuknüpfen. Den Schimpf, den er ihm vorher zugefügt, hatte er vergessen. »Da kommen s’ schon«, sagte er und schwitzte vor Aufregung.
Aber es verging noch eine Viertelstunde, bis mit einem Male, unerwartet, an der Ecke der Kupferschmiedgasse, die mächtige Kuppel des Leichenwagens auftauchte. Zwischen den Leibgarden und Edelknaben zogen tänzelnd acht Rappen die riesenhafte federnde Karosse. Zwischen den blitzenden Lanzen, den nickenden Reiherfedern erkannte Toni Muhr den greisen Leibkutscher, der auf dem Bocke saß.
Wie oft war er doch als Kind diesem Kutscher begegnet, wenn der Wagen des Kaisers mit den goldenen Rädern durch die Mariahilferstraße surrte; dem Kutscher zur Seite der Leibjäger, mit dem flatternden Federbusch.
Sobald das Gefährt zur Ringstraße einbog, hörte man schon den langgezogenen, gellenden Ruf des Schnarrpostens vor dem äußeren Burgtor: »Gewehr heraus« und den dumpfen Wirbel der Trommeln. Die Soldaten, die Nachtdienst taten, stürzten sich auf ihre Gewehre, der Offizier grüßte mit dem Säbel. Und schon tönte auch vom inneren Burghof her derselbe Ruf, derselbe Trommelwirbel, jedem Wiener wohlvertraut, ein Schaustück für viele Generationen von Knaben.
Nun war auch dieser Kutscher uralt geworden, wie alles rings um den Kaiser, den man da zu Grabe trug, weißhaarig alles, umsponnen von silbernen Fäden, als etwas Unwirkliches und Vergangenes.
Der Wagen stand: Einen Augenblick lang schwebte der Sarg des Kaisers, schwarz in goldenem Rahmen, hoch über den Stufen, im dunklen Schacht der Kirchentür, dem fernen Licht entgegen. Silberne Trompeten bliesen den Generalmarsch.
Der dicke Herr mit dem Steirerhütel begann sogleich zu schwätzen. Er hatte seinen Sohn wieder auf den Boden gestellt und schnäuzte ihm mit einem rotkarierten Tuch die Nase. »Haben S’ schon g’hört, Kimpolung ist eing’nommen«, sagte er zu Toni Muhr. »Die Rumänen hat’s derwischt. Nachher kommen die Katzelmacher dran. Der Bagaschi vergunn i’s.«
Toni Muhrs Gedanken folgten dem Sarge, der im Dunkel der Kirche verschwunden war. Nun besann er sich, dass er vor acht Tagen schon irgendwo die ganze Zeremonie beschrieben gelesen hatte. Alles, was sich da zutrug, war nach uralten Vorschriften genau vorherbestimmt: alle Feierlichkeit und Trauer, vielleicht sogar die Tränen. Als der Kaiser geboren wurde, wusste man schon, wie man ihn begraben würde. Es war Toni Muhr, als hörte er im Innern der Kirche, gegen das metallene Tor der Gruft, in althergebrachter Weise, den Stab des Obersthofmeisters pochen, der Einlass begehrte für den Kaiser und König, worauf die ferne Stimme des Priors aus der noch immer verschlossenen Gruft emporklang: »Nicht Kaisern und Königen werde hier aufgetan, sondern nur sündigen Menschen.«
Der dicke Herr neben Toni Muhr sprach emsig weiter fort: »Alsdann, i sag’s, wie’s is. In vier Wochen betteln s’ um Frieden.« Und da Toni Muhr nichts erwiderte, schloss er mit einem spöttischen Seitenblick: »Da müssen S’ Ihna scho tummeln, wann S’ no ins Feld zurechtkommen wollen.«
2
Der erste Bekannte, den Toni Muhr in der Stallburggasse antraf, war sein Feind, der Hausbesorger, Herr Bela Nagy, der eine Dienerstelle im ungarischen Ministerium bekleidete und erst nach Bureauschluss seine Frau, mit der er in steter Zwietracht lebte, in der Portierloge ablöste; das Haus war das Band, das sie zusammenhielt.
Herr Bela Nagy war ein schöner Mann; man konnte sich keinen prächtigeren Heiducken vorstellen: In dem krebsroten Gesicht hing der gewaltige schwarze Schnurrbart, der immer wie lackiert aussah. Den Toni Muhr mochte er nicht leiden, weil dieser einmal seine Frau vor besonders harter Züchtigung geschützt und mit dem Wachmanne gedroht hatte. Er vermied indessen, seine Abneigung merken zu lassen, sondern begrüßte den Heimkehrenden laut und überschwänglich, öffnete ihm auch sogleich den Aufzug mit der ungarischen Einladung: »tessék«, die ihm vornehmer dünkte als das einfache deutsche »Bitte!«, und streckte die Hand zum Empfang des Trinkgeldes aus, mit einer Geläufigkeit, wie sie nur langjährige Übung verleiht.
Da stand also Toni Muhr vor seiner eigenen Wohnungstür und las seinen Namen auf dem kleinen Bronzeschild über dem Briefkasten. Er hatte das Schild schmaler in Erinnerung gehabt, und auch der Name, den er da las, kam ihm seltsam fremd vor: Doktor Anton Muhr! Er hatte sich niemals anders rufen hören als »Toni«. Es war ihm zumute, als sollte er sich selbst, nach langer Trennung, einen förmlichen Antrittsbesuch abstatten.
Die Glocke schrillte. Ein fremdes Stubenmädchen öffnete die Tür, musterte argwöhnisch den Einlassbegehrenden und rief dann, nicht eben freundlich: »Es ist niemand zu Hause!«
»Ich bin der Doktor Muhr«, erklärte Toni, und da das Mädchen noch immer nicht gewillt schien, ihm den Weg freizugeben, zog er seine Marschroute hervor. »Es ist ja wahr«, sagte er lächelnd, »ich muss mich legitimieren. Vielleicht fragen Sie auch den Hausbesorger, der kennt mich.«
Nun wurde ihm aufgetan.
»Verzeihen der gnä’ Herr«, stammelte das Mädchen verwirrt, und Toni Muhr konnte feststellen, wie merkwürdig sie ihrer Herrin in allem Äußeren glich. Sie trug eine Bluse, die er selbst einmal Lauretta geschenkt hatte, ihr Haar war genauso gesteckt, wie vor Zeiten das Haar Laurettas, und sie schien sogar dasselbe Parfüm zu gebrauchen.
»Wie heißen Sie?«, fragte Toni Muhr.
»Poldi«, antwortete die Zofe.
»Also bitte, Poldi, schauen Sie, dass ich bald etwas zu essen bekomme. Ich sterbe vor Hunger.« Er reichte ihr den Rucksack und machte ein paar Schritte zum Badezimmer. Dann hielt er inne und rief das Mädchen zurück: »Wissen Sie nicht, wann die gnädige Frau nach Hause kommt?«
Nein, Poldi wusste es nicht. Die gnädige Frau hatte nur vorhin telefoniert, man solle ihretwegen nicht mit dem Nachtmahl warten.
Toni Muhr besann sich einen Augenblick, ehe er noch eine zweite Frage stellte: »Ob denn die gnädige Frau nichts davon gesprochen habe, dass sie ihn dieser Tage erwarte?«
Nein, die gnädige Frau hatte nichts davon gesprochen.
Nun zog Toni Muhr die Türe hinter sich zu. Er hörte, wie das Stubenmädchen die Köchin herbeirief und wie beide angelegentlich im Flüsterton etwas berieten. Als er dann im Bade saß, vernahm er noch die Stimme einer dritten Frauensperson, die man »Fräulein Klara« ansprach, Toni Muhr vermutete, dass es sich um eine Hausschneiderin handelte. Auch ihre Stimme klang bestürzt und spottend zugleich.
Ich habe es sicherlich sehr dumm angestellt, überlegte Toni, ich hätte die Mädchen zusammenrufen und ihnen ein paar nette Worte zur Begrüßung sagen sollen. Wäre Lauretta zu Hause gewesen, hätte sie mich einen Bauern gescholten.
Toni Muhr hatte in seinem Kleiderkasten eine Uniform gefunden, die vom Schneider seinerzeit zu spät abgeliefert worden war. Nun kam sie ihm wohl zustatten. Toni Muhr fand, dass er ordentlich kriegerisch aussah, seit er nicht mehr das schmutzige Zeug aus dem Felde auf dem Leibe trug, und er besann sich des überraschenden Eindruckes, als er, beim Rückzug aus Serbien, einen Tagmarsch vor Valona, zum ersten Mal funkelnagelneu herausgeputzten italienischen Truppen begegnet war.
Die Gefangenen – nicht anders als die serbische Begleitmannschaft – trugen Fetzen voll Ungeziefer am Leibe, die notdürftig mit Bindfäden an Nacken und Lenden befestigt waren. Die ganze Erscheinung der schattenhaft hinwankenden Gestalten mit ihren ausgehöhlten erdfarbenen Antlitzen musste sehr schrecklich gewesen sein, denn die jungen italienischen Truppen, die, eben erst ins Feld entsandt, ihrer ansichtig wurden, brachen in wilde Verwünschungen gegen den Krieg aus. Den Gefangenen aber war diese Begegnung nicht minder sonderbar erschienen. Ein italienischer Oberst trabte da auf einer wohlgenährten Irländer Stute über einen gepflegten Gartenweg, und die ganze Menschheit, der sie hier begegneten, war wohlgepflegt; rosenrot die Wangen der jungen Leute, ihre Uniformen nach dem neuesten Schnitt.
Das Stubenmädchen Poldi schien die Veränderung, die mit Toni Muhr vorgegangen war, wohlgefällig anzumerken. Sie betrachtete ihn jetzt viel freundlicher, während sie ihm das Essen auf den Tisch stellte. Ihre Augen glitten zufrieden über sein volles aschblondes Haar und sein kleines Schnurrbärtchen. Auch der leidende Ausdruck seines Gesichtes schien ihr zu gefallen.
»Der gnä’ Herr wird sehr strapaziert sein«, sagte sie mitleidig, und da Toni schwieg, fügte sie hinzu: »Der gnä’ Herr muss schon entschuldigen, die Marie hat net g’wusst, ob der gnä’ Herr die Eierspeis’ lieber fest haben will oder locker, aber die Topfenhaluschken sind delikat; die Marie hat sie von z’ Mittag aufgehoben.«
Toni Muhr gab sich ganz der animalischen Freude des Essens hin. Er kaute langsam und bedächtig. Damals, in Valona, hatten sich die Leute wie Tiere auf das Essen gestürzt, und auf dem Schiff, das sie nach Asinara brachte, waren viele von ihnen, wie vom Blitz getroffen, tot hingefallen. Die Ärmsten hatten die reichliche Speise nicht mehr vertragen.
Poldi hatte den Tisch im Atelier gedeckt, und Toni Muhr fand alles prächtig und wunderbar, das blank geputzte Silber, die kristallene Karaffe, die schönen Teller mit dem Altwiener Blumenmuster; er streichelte das Tischtuch, und es war ihm, als sei er in einem sehr vornehmen Hause zu Gast geladen.
Als Poldi den Kaffee brachte, glaubte er sich irgendwie dankbar erweisen zu müssen. »Es war alles ausgezeichnet«, sagte er, »besonders die Haluschken.«
»Ja, die sind eine Spezialität von der Marie«, betonte das Mädchen zufrieden und räumte den Tisch ab.
Toni Muhr sah sich im Zimmer um. Alles schien ihm viel stattlicher und prächtiger, als er es verlassen hatte, die Vorhänge, die Wandbespannung und die Teppiche. Er schritt auf und nieder und freute sich der Lautlosigkeit dieses Hinschreitens.
Plötzlich blieb er vor dem Kamin stehen. Da hing ein großes Bild Laurettas, das er nicht kannte.
Die künstlerische Wirkung war durchaus zu loben, das musste sich Toni Muhr sogleich eingestehen – und doch gab es da einen Zug, der ihn unangenehm berührte. Etwas Fremdes schob sich zwischen das Bild und seine Erinnerung, so dass Toni Muhr zu diesem dunklen Erinnern wie zu einer Beschwichtigung seine Zuflucht nahm.
Jenem ersten schlimmen Briefe Laurettas nach Elba waren andere gute gefolgt, in denen niemals wieder von dem spukhaften Unbekannten die Rede war, dem sie ihre Liebe zugewendet hatte. Sie schien voll teilnehmender Sorge, sie sprach davon, wie schwer ihr die Trennung sei, und ihr Vater hatte es durch seine Florentiner Verwandtschaft durchgesetzt, dass Toni Muhr als Austauschinvalide heimkehren durfte.
Auf dem Bilde aber saß Lauretta in einem goldenen Armstuhl und »regierte«. So hatte er ehedem die sichere Haltung genannt, die sie annahm, wenn sie in Gesellschaft ging und Konversation führte. Er hatte dann immer die Empfindung gehabt, als entgleite sie ihm. Sie konnte stundenlang so fort reden, wie eine ganz andere, über alle möglichen Dinge, von denen sie zu Hause niemals sprach und die sie innerlich nichts angingen. In Gesellschaft aber sprach sie von ihnen, mühelos und geläufig.
Sie war dann in einer Art klug, die Toni erstaunen machte und betrübte in einem. Er stand abseits und hörte zu: Worte, die er selbst gesagt, aber nicht ganz so, wie Lauretta sie jetzt vorbrachte, Worte, die er in einem Buch unterstrichen gefunden hatte, das auf ihrem Toilettentisch gelegen war; Zitate, die sein Schwiegervater Ermete de Saluzzo, der sich auf seine Belesenheit etwas zugute tat, im Munde führte – und auch diese Zitate nicht immer richtig, sondern dem Zweck angepasst. Lauretta hatte es niemals leiden mögen, wenn er ihr so zuhörte. »Du machst mich unsicher«, sagte sie, und es war Toni jedes Mal gewesen, als ob eine ungemein präzise Mechanik ins Stocken geriete.
Dieses also war Lauretta, wie sie Toni aus dem Bilde entgegentrat, in tief ausgeschnittenem, kostbarem Abendkleid, eine große Perle an einer dünnen Platinkette, die um den Hals geschlungen war. Toni Muhr kannte diese Perle nicht. Angst schnürte ihm die Kehle zu … Aber vielleicht war das Schmuckstück nur für den besonderen Anlass geborgt oder vom Maler auf Laurettas Wunsch hinzugefügt worden …
Toni Muhr öffnete die Glastür, die zu einem schmalen Balkon führte, der in einem scharfen Winkel um die Hausecke lief und so nach zwei Richtungen hin Aussicht bot. Um dieser Aussicht willen hatte Toni vormals die Wohnung gemietet.
Auf der einen Seite blickte man in das Gassengevierte hinab, wie in tiefe Schachte und Abgründe, die sich hier auftaten und kreuzten. Darüber sprengte ein steinernes Viergespann in schnaubendem Anstürmen, die Quadriga der Hofbibliothek, von der Göttin Minerva gelenkt, riesenhaft vergrößert, unheimlich nahe.
Auf der anderen Seite aber stand im Abendglanz der untergehenden Sonne die Stephanskirche; nicht so, wie man ihr sonst begegnete, wenn man durch die Stadt schritt, sondern wunderbar verwandelt. Da unten konnte man immer nur ein winziges Stück von ihr erhaschen, einen Bogen, ein Tor, und auf dem kleinen Platze vor der Kirche musste man vollends steilauf blicken, wollte das liebende Auge den Turm betrachten.
Hier aber war der Dom gleichsam über die Dachfirste all der Häuser ringsum von der Faust Gottes emporgehoben und stand einsam wie auf einem Bergrücken. Die bunten glasierten Ziegel des Daches leuchteten in ihrem flammenden und blitzenden Zackenmuster. Und jenseits dieses vielfältigen Glanzes stieg – selbst farblos, doch in einen Glorienschein goldig leuchtender, klarer Winterluft getaucht – der Turm zur Höhe. Die steinernen Figuren und Spitzen, die ihn umgaben, schienen nur Weggenossen, die irgendein Unnennbares, Körperloses aufwärts und immer weiter aufwärts begleiteten. Immer spärlicher wird das Gefolge, immer steiler der Weg. Der Stein wird durchsichtig, vermählt sich der Luft, ist nur noch Sehnsucht und Aufschwung; hoch oben der Knauf wie eine goldene Weltkugel, darüber ein Adler als Wetterfahne – Himmelsweite.
Über die niedrigen Dächer in der Tiefe hatte sich indessen Nebel gesenkt, der feierlich hinwallte, und es war, als setzte sich der Dom in Bewegung, wie ein Schiff im Meer. Wohin ging die Fahrt? Heidnisch glitzerte noch immer das Dach, übersät von Edelsteinen, und Toni musste denken: »Orient … Orient!« Das lockte und zog. Einsam aber griff der Turm in die Luft, Schiffmast und Wegweiser. Im goldgelben Hauch zitterte ein Stern.
Toni Muhr fühlte ein großes Glück in seinem Herzen aufsteigen. Er trat ins Atelier zurück und schloss die gläserne Türe; Dämmerung erfüllte den Raum. Er musste an seine Kindheit zurückdenken. Da war manchmal die Welt wie mit schweren Eisentoren verriegelt erschienen, nirgends ein Weg, nur schleichende Angst, diese furchtbare Kinderangst, die keine Rettung sieht. Und dann war plötzlich doch die befreiende Wendung gekommen, irgendein überraschendes Verzeihen, eine unverdiente Gnade. Die eisernen Tore sprangen auf, die Welt stand wieder offen. Man brauchte vergangene Schuld nicht weiter zu sühnen; man hatte nichts verwirkt.
Und Toni Muhr dachte: »Vielleicht wird auch jetzt wieder alles gut, vielleicht liebt Lauretta gar nicht den andern, den Unbekannten. Vielleicht gibt es diesen Unbekannten überhaupt nicht, und sie hat mich nur mit ihm geschreckt. Vielleicht ist auch mein Herz nicht so arg mitgenommen, wie die Militärärzte es behaupten.« Schon früher einmal war er ja von ähnlichen Beschwerden geplagt worden; doch ein paar Tage Urlaub, ein Ausflug auf die Rax machte den Schaden wieder gut.
Vielleicht war auch diesmal sein Herz nur »nervös«, und es gab nichts Unwiederbringliches in seinem Leben, nichts, wofür sich keine Verzeihung fand. Er war doch so jung, trotz der zwei schweren Kriegsjahre. Er fing eben erst zu leben an; die Studienzeit zählte doch nicht.
»Arbeiten«, dachte Toni, »nur schnell hingehen und arbeiten!« Der Müßiggang des Krieges mit all seiner zerfahrenen Geschäftigkeit hatte ihn schmerzlicher getroffen als andere. Von Kindheit auf war er es gewöhnt gewesen, die Zeit rechtschaffen eingeteilt zu sehen, wie ein Stück Brot, mit dem man sein Auslangen finden muss einen ganzen Werktag lang. Und der Werktag seines Vaters begann früh am Morgen, und er endete erst bei Sonnenuntergang. Die schwere Weinbauerarbeit krümmte die Schultern nieder, spannte sich eisern ums Jahr.
Zu Ostern gab’s das Fastenhauen, mit dem man nie fertig wurde wegen des ewigen Leutemangels und der Witterung. Und Mitte Mai folgte schon das Jathauen. Der Weinstock hatte zu treiben begonnen; man musste ihm Luft verschaffen, sonst blieb er sitzen. Es war die wichtigste Verrichtung. Wer das Jathauen versäumt, hat das Lesen verkauft, sagten die Leute. Und so gab’s Arbeit ohne Ende bis zur Weinlese, die um Theresia begann. Nun endlich wurden die Trauben abgeschnitten, in die Butten getan und von dort in den Maischbottich und von dem Maischbottich auf die Presse. Der Most rann von der Bürden in die Rinne, und die Körner fingen sich im Sieb.
Bis zu Weihnachten blieb der Most im Fasse, und während der ersten Gärung durfte man sich nicht in den Keller wagen. Der Stickstoff löschte das Licht aus, und man verlor die Besinnung. So war Tonis Mutter gestorben. Sie hatte einen Korb mit Äpfeln holen wollen, die im Keller eingelagert waren; der Weindunst riss sie um. Mit einem nassen Schwamm im Munde war der Vater ihr nachgeeilt, sie zu retten. Er kam zu spät.
Von seiner Mutter hatte Toni Muhr nicht viel mehr im Gedächtnis behalten als dieses eine schreckensvolle Bild, wie man sie aus dem Keller trug, blass und leblos und eingehüllt in den schweren, betäubenden Weindunst. Oft, wenn die anderen tranken und Lieder sangen, hatte er dieses Bild vor Augen, wie sie die tote Mutter aus dem Keller brachten; und das Frohsein der anderen schien ihm teuer erkauft.
Toni Muhr streckte die Glieder, bis sie knackten. Er brauchte seine Gesundheit, er wollte arbeiten, nach zwei verlorenen Jahren endlich wieder arbeiten. Er konnte sich jetzt gar keine Erholung gönnen, er musste sogleich ans Werk gehen. Nach der Superarbitrierung wollte er gelegentlich wegen seines Herzens einen Spezialisten befragen.
Aber vielleicht war es am besten, sich um all dies gar nicht zu kümmern. Warum immer das Schlimmste annehmen? Vielleicht war der Krieg nun wirklich zu Ende. Nur schnell hingehen und arbeiten! Und als wollte Toni Muhr seinen Vorsatz gleich zur Tat werden lassen, schritt er auf die kleine Kammer zu, die im Winkel zwischen Atelier und Schlafzimmer gelegen war, aber eigentlich schon einen Teil des Dachbodens bildete, und die ihm seinerzeit als privates Laboratorium gedient hatte. Erstaunt tat er einen Schritt zurück, als die elektrische Birne an der Decke den völlig verwandelten Raum beleuchtete.
Auf den Regalen rings an der Wand sah er statt der alten Gläser und Retorten einen ganzen Berg kunstvoll getürmter Schachteln in allen Größen und Formen; runder und eckiger Schachteln und ganz schmaler, langer; blaugestreifter Schachteln und rosenroter und heliotropfarbener mit weißen Schlingen und Schleifen, wie sich die großen Modewarengeschäfte ihrer bedienen, alle viel zu geräumig für ihren nichtigen Inhalt an Seide, Spitzen und Federn. Sie füllten das kleine Gemach, hielten es besetzt. Auf den marmornen Experimentiertisch hatte Lauretta eine dreiteilige Psyche schrauben lassen.
Toni Muhr war zumute, als sei er gestorben und käme seine eigene Erbschaft besichtigen. Sein Laboratorium war nun ein Ankleidezimmer. Er läutete dem Mädchen. »Wissen Sie nicht, wo die gnädige Frau die Schriften hingetan hat, die ich hier aufzubewahren pflegte?«
Poldi wies auf einen Karton, den sie unter ein paar Hutschachteln hervorzog. »Hier«, sagte sie und wischte mit einem Tuche den Staub ab. Ihre Handbewegung war genau die Laurettas.
Toni Muhr begann sogleich zu suchen; er hatte kurze Zeit vor dem Kriege im Laboratorium der Katlein’schen Fabrik einige Versuche mit Blutkohle durchgeführt, wie sie von einem Prager Gelehrten angeregt worden waren. Es handelte sich da um ganz neue Wege. Die besondere Eigenschaft der Tierkohle, verschiedene Stoffe an der Oberfläche festzuhalten, war allerdings längst bekannt, und man verwendete solche Kohle schon seit geraumer Zeit in den Zuckerfabriken, um den Rübensaft zu entfärben.
Aber nun kam es darauf an, die Kohle auch für die Behandlung von Cholera und Ruhr, kurz all der Darmerkrankungen nutzbar zu machen, die im Kriege so zahlreiche Opfer forderten. Um diese schädlichen Keime wirksam zu bekämpfen, musste es gelingen, eine ganz leichte und auf das Feinste zerstückelte Tierkohle herzustellen, von organischen Substanzen vollkommen befreit. Mit dem alten Verfahren war da nichts auszurichten.
Deutlich entsann sich Toni Muhr des Nachmittags, als er, ins Laboratorium eingeschlossen, die letzten entscheidenden Proben angestellt hatte. Das neue Präparat wurde hintereinander mit Lauge, dann mit verdünnter Salzsäure gekocht. Zitternden Herzens hatte Toni die Retorte in Händen gehalten. Seine Kohle gab keinen Farbstoff mehr ab; der Versuch war geglückt.
Toni Muhr hatte die Aufzeichnung seiner Arbeit mit allen nötigen Tabellen und Analysen damals sogleich der Fabriksleitung angeboten. Aber zu jener Zeit schien der Krieg noch so ferne, die Verwertung der Muhr’schen Experimente versprach wenig Erfolg, man kümmerte sich nicht um sie.
Nun hatte sich all dies verändert. Toni Muhr wollte nicht mehr in die Katlein’sche Fabrik zurückkehren. Die Heeresverwaltung war sicher froh, ein verlässliches Mittel erwerben zu können, das den schrecklichen Seuchen Einhalt gebot; nun erst recht, wenn die vielen Gefangenen heimkehrten.
Toni Muhr sah sich an der Spitze eines mächtigen, vom Staate eingerichteten Unternehmens, ungeheure Geldmassen rollten ihm zu. Er fühlte sich von einem wahren Fieber ergriffen, Geld, viel Geld zu verdienen. Und er dachte wieder an Lauretta.
Aber die Aufzeichnungen waren nicht zu finden. Den ganzen Inhalt des Kartons wühlte er durch, wendete jedes Blatt einmal, zweimal, dreimal – vergebens.
3
Es war schon recht spät, als Toni Muhr enttäuscht den braunen Karton zur Seite schob. Einmal hatte die Poldi ihren Kopf zur Türe hereingesteckt und gefragt, für welche Zeit der gnädige Herr das Abendessen wünsche, er aber hatte nur kurz abgewinkt.
Nun schritt er wieder im Atelier auf und nieder. Wie seltsam, dass gerade diese wichtigen Papiere fehlten! Er musste Lauretta fragen … Lauretta … Wo blieb sie nur! Das Schlimmste war dieses ewige Warten, das alle Kraft verzehrte.
Toni Muhr entsann sich eines fernen Abends, da er gleichfalls Lauretta zu Hause erwartet hatte. Sie war bei Bekannten eingeladen gewesen, während ihn eine dringende Arbeit am Schreibtisch festhielt. Und obgleich er damals genau gewusst hatte, dass sie unmöglich vor Mitternacht zurück sein konnte – eine Freundin sollte sie um diese Zeit heimbegleiten –, war er doch allmählich in eine so törichte Besorgnis geraten, dass es ihn auf die Straße hinuntertrieb.
Er bildete sich ein, Laurettas Weg genau zu kennen, aber in seiner Hast war er schon in wenigen Minuten bis zu dem Hause der befreundeten Familie gelangt, ohne Lauretta begegnet zu sein. Eine halbe Stunde lang hatte er dann noch an der Straßenecke gewartet, jeden einzelnen Gast, der mit hochgestelltem Kragen vorüberkam, misstrauisch bespähend, bis es ihn auch hier nicht mehr länger hielt und er, einem plötzlichen Entschlusse folgend, ins Haus eindrang. Denn so musste man wohl sein wildes Überrennen des schlaftrunkenen Portiers bezeichnen.
Mit wenigen Sätzen war er die Treppe emporgestürmt. Die Hausleute hatten sich schon zurückgezogen; ein alter Diener, in Hemdärmeln, löschte gerade die Achter im Salon und berichtete Toni Muhr in der steifen Lakaienart, hinter der man doch verhaltenen Spott merken konnte, »die gnädige Frau sei längst fortgegangen«.
Richtig fand er sie auch zu Hause im Bett und schon nahe dem Einschlafen. Als er ihr sein Abenteuer erzählte, brach sie in ein so lautes und übermütiges Lachen aus, dass Toni Muhr, trotz seines Verdrusses, mit einstimmen musste. Um ganz Wien hatte während der nächsten Wochen diese Geschichte die Runde gemacht. Und jedes Mal, wenn man sie in Gegenwart Laurettas erzählte, war diese von neuem ins Lachen geraten und hatte Toni Muhr in ihrer Ausgelassenheit mit fortgerissen. Aber eigentlich schien ihm der Vorfall gar nicht so lustig. Er kam sich selbst unsäglich albern vor und hatte dabei die Empfindung, als sei ihm irgendwie Unrecht geschehen.
Nun lief er wieder durch die Wohnung, rastlos von einem Zimmer ins andere. Er riss die Glastüre zum Balkon auf, als hätte Lauretta den Weg von der Stephanskirche durch die Luft zurücklegen können, aber er sah nur die Sterne in der klaren, lautlosen Nacht. Dann wollte er die Zofe herbeirufen, um sie irgendetwas zu fragen, aber er entsann sich rechtzeitig wieder des Dieners in Hemdärmeln, der ihn damals in dem befreundeten Hause mit seiner höhnischen Korrektheit zurechtgewiesen hatte.
Was konnte er denn von dem Mädchen erfahren, was wollte er von ihr erfahren? Er war froh, dass sie sich nicht mehr blicken ließ. Die Uhr auf dem Kamin schlug eins, glasdünn, geisterhaft. Sein Kopf brannte.
Mit einem Male vernahm er, vom Vorzimmer her, das knarrende Geräusch eines Schlüssels, der sich zurechttastete. Und als er hinauslief, sah er gerade, wie auch der Riegel des Doseschlosses sich gespenstig zurückschob. Der Hausflur war erleuchtet, hinter der Glasfüllung der Wohnungstür stand ein Schatten.
Toni Muhr fühlte sein Herz in wuchtigen Schlägen gegen das Gehäuse von Brust und Rücken klopfen; es war so, als wollte es von Stund ab seine Freiheit haben. Ein unbeschreiblicher Schmerz erfüllte ihn ganz und gar.
Lauretta stand vor ihm, genau so, wie auf dem Bilde im Atelier; eine große Dame, die Besuch macht. Dann aber wurde sie seiner ansichtig, stieß einen Schrei aus – einen leisen Schrei, einen Kehllaut des Entzückens, verwandelte sich, war Lauretta und flog in seine Arme.
Das Täschchen, das sie in der Hand gehalten hatte, glitt zur Erde nieder, der Hut schob sich in den Nacken und löste die Haare auf. Sie achtete dessen nicht. »Liebling!«, rief sie, »Liebling! Der Hausbesorger hat’s mir gesagt, aber ich hab’s gar nicht glauben wollen. Da bist du ja, Liebling!«
Tränen standen in ihren Augen. Sie schob ihren Arm unter den Tonis und hielt ihn fest. »Wie schön, dass du nun wieder da bist, Toni, Liebling. Versprich mir, dass du nie mehr von mir fortgehen wirst, dass du mich nie mehr verlassen wirst! Sag: Ich schwöre – wie beim Fahneneid!« Und sie lachte. »Toni, Liebling, wie hast du’s nur fertig gebracht, mich so lange allein zu lassen.«
Ihre Augen hatten die Fähigkeit, in der Freude groß zu werden und zu leuchten wie Kerzen.
»Du hast noch immer die langen Wimpern, Lauretta«, stotterte Toni Muhr, nur um etwas zu sagen.
»Gefallen sie dir noch?«, fragte Lauretta. »Erinnerst dich, wie du mir einmal zwei rote Zündhölzel auf die Wimpern gelegt hast: zum Balancieren. Ach, wie verliebt waren wir doch, Toni, Liebling! Ich bitte und beschwöre dich, du musst auch jetzt wieder in mich verliebt sein. Nicht wahr, du willst. Nicht wahr, ich gefalle dir noch! Und wenn ich dir nicht mehr gefalle, lass mich’s um Himmels willen nicht merken, ich könnte es nicht überleben. Du musst mich immer lieb haben, Toni, verstehst du! Bedingungslos lieb haben, auf Gnade und Ungnade.«
Ihr zwitscherndes Lachen erfüllte den Raum. Die ganze Wohnung, die vorher dem Heimkehrenden kalt und fremd erschienen war, hatte nun mit einem Schlage Leben und Bewegung erhalten, kam ihm nahe, war ihm vertraut.
Lauretta hatte den Hut abgelegt und wandte sich ihm wieder zu: »Hat man dir nur ordentlich zu essen gegeben, Liebling? Hast du genachtmahlt? Nein, so was, niemand kümmert sich um den armen Mann. Du musst ja schrecklich hungrig sein!«
Sie schleppte alle möglichen guten Sächelchen herbei, öffnete eine Sardinenbüchse, schob ihm Schokoladebonbons in den Mund: »Echte Kugler mit harter Füllung. Du weißt, so wie ich sie gern habe; die sind rar geworden, Liebling. Wenn ich nur geahnt hätte, dass du heute ankommst. Warum hast du mir nicht telegrafiert?«
»Nun freilich«, beantwortete sie gleich wieder selbst ihre Frage, »die Telegramme sind jetzt so lange unterwegs; denk dir, manchmal habe ich vier Briefe von dir auf einmal bekommen und dann monatelang nicht das geringste Lebenszeichen.«
»Wie lieb du bist«, sagte Toni Muhr und streichelte Laurettas Wange.
Sie saß nun beruhigt auf seinen Knien, schlenkerte ein wenig mit den Beinen und begann zu erzählen: »Um deine Freilassung hat sich Tante Carlotta bemüht. Du weißt, die in Florenz, deren Tochter ins Kloster gegangen ist, und dann die Fürstin Lubecka. Wir müssen sie gleich morgen besuchen oder übermorgen, denn morgen gönne ich dich niemandem; morgen gehörst du mir allein, nicht wahr, Liebling, mir ganz allein.«
»Dir allein«, wiederholte Toni Muhr.
Lauretta nickte befriedigt. »Hast du noch etwas von dem Leichenbegängnis gesehen?«, fragte sie. »Denk dir, ich war von den Katleins eingeladen, das heißt vom Alexander Katlein, der macht mir jetzt den Hof, der alte Narr, mit seinem zerquetschten Mund, der könnt’ mir gefallen! Aber er ist doch dein Chef, wie der andere, der Theodor, der keine Frau anschaut, nicht wahr? So hab ich halt die Einladung angenommen. Weißt du, Liebling, mit den Katleins muss man sich jetzt vertragen. Die sind hochgekommen im Krieg. Sie sollen schon über hundert Millionen verdient haben.«
»Die Leute schwätzen«, verwies Toni, aber eigentlich hatte er etwas ganz anderes sagen wollen. Er hielt den Mund geöffnet, besann sich und schwieg.
»Hast dich verschluckt«, fragte Lauretta und lachte. »Wo bin ich denn nur stehen geblieben? Also richtig: Beim ›Chic Parisien‹ in der Kärntnerstraße hat der Alexander Katlein ein Fenster gemietet. Wir waren unser zehn. Und denk dir, wie das Leichenbegängnis vorüber war, haben wir uns Modelle angeschaut, die neuesten Pariser Modelle. Sie werden aus der Schweiz geschmuggelt. Und da ist die Trauerstimmung verflogen gewesen, man hat nur noch von den Kleidern gesprochen. Was sagst du dazu, Liebling? Nun ja, Gelegenheit macht Diebe. Man soll sich eben in einem Modehaus kein Leichenbegängnis anschauen. Und denk dir, dann hat uns der Katlein zum Tee eingeladen, alle zehn. Und aus dem Tee ist ein Nachtmahl geworden und aus dem Nachtmahl eine Abendunterhaltung. Man hat den Kaiser ganz vergessen gehabt und auch das Begräbnis, weißt du. Es war eine so merkwürdige Stimmung, Liebling. Der Katlein hat einen Toast gesprochen auf die Zukunft und auf den Sieg und dass in vier Wochen der Krieg aus ist, und darauf mussten wir alle anstoßen. Dann hat sich einer zum Klavier gesetzt und hat zuerst so feierliche Sachen gespielt; später aber einen Ragtime. Da haben wir getanzt. Denk dir, Liebling … Aber ich bitte dich, sprich mit keinem Menschen davon, sonst werden wir am Ende noch eingesperrt. Es ist ja eigentlich eine Majestätsbeleidigung gewesen oder so etwas, nicht? Aber ich kann nichts dafür, und ich bin auch viel zeitlicher fortgegangen als die anderen. Und da hab ich nun dich gefunden, Toni, Liebling.« Sie umarmte ihn stürmisch.
Mit einem Male fiel es ihr ein, dass sie die ganze Zeit gesprochen und Toni noch gar nicht hatte zu Worte kommen lassen. Nun schämte sie sich. »Das sind doch lauter Nichtigkeiten. Jetzt musst du mir erzählen, du hast so Großes erlebt, alles musst du mir erzählen.«
Es erwies sich indessen, dass Toni, sobald man ihn befragte, nichts Bestimmtes zu erzählen wusste. Da war eine Mauer hinter ihm, kalt und steil, ohne Griff. Wo man nur anrührte, tat es weh.
»Hast du nie an mich gedacht?«, fragte Lauretta.
Natürlich hatte er an sie gedacht.
»Oft?«, fragte Lauretta.
»Sehr oft«, sagte Toni langsam und senkte den Kopf.
Lauretta bemerkte sein Innehalten nicht. »Gab es keinen Augenblick«, forschte sie weiter, »wo du mich in deiner Nähe fühltest, Liebling, über alle Ferne hinweg, dir nahe?«
Ja, es gab in der Tat solch einen Augenblick: damals, wie er die Orangenschale gefunden hatte.
Und nun begann Toni lächelnd zu erzählen: Es war in einer albanischen Dzamija – einer Moschee mit anschließendem Gehöft –, da habe man für eine Nacht das Lager aufgeschlagen. Eine ganze Kolonne Gefangener und der Major, der sie begleitete, ein wilder Gesell, der es mit seinen Leuten noch ärger hielt als mit den Gefangenen, die sie bewachen sollten.
Alle Zeit vorher, drei Wochen lang, habe es unaufhörlich geregnet; eine Kotpfütze habe zumeist als Liegestatt gedient. An Schlafen war kaum zu denken. In der Dzamija aber sei ihm ein Platz auf einer Veranda angewiesen worden, ziemlich geschützt vor Regen und Wind. Da habe er sich zum ersten Mal wieder, in ein Leintuch gehüllt, ausstrecken können. Seine Decke nämlich sei ihm gleich zu Beginn des Rückzuges, nahe bei Nisch, gestohlen worden. Er habe den Marsch in jämmerlicher Ausrüstung unternommen; mit einem Polsterüberzug statt eines Rucksackes, einem Porzellanteller als Kochgerät und einer gläsernen Flasche, die ihm oft genug als Kopfkissen gedient hatte. Das Bettlaken aber, sein kostbarster Besitz, sei ihm wie ein Leichentuch erschienen.
Und wie ein Toter habe er wahrhaftig damals in der Dzamija geschlafen; bis gegen vier Uhr morgens. Und als er nun aufgesprungen sei, habe er in der Ferne einen roten Streifen am Horizont erblickt. Kein Tröpfchen Regen sei mehr niedergefallen. Lauretta könne sich nicht vorstellen, welches Glücksgefühl sich da seiner bemächtigt habe. Es sei entsetzlich kalt gewesen; alle Glieder schmerzten. Aber er habe sich gesagt: »In wenigen Stunden geht die Sonne auf, in wenigen Stunden wird es warm sein; vielleicht um neun Uhr, vielleicht erst um elf Uhr. So lange hältst du es bestimmt noch aus. Du wirst leben.«
Im Überschwang seiner Freude habe er sogar seinen dünnen Überzieher ausgezogen, der mit Wasser vollgesogen war wie ein Schwamm und ihm seit Wochen klatschnass am Körper hing. Den habe er nun zum Trocknen über ein Geländer gebreitet, eine Übereiltheit, die er bald bereuen sollte. Denn das nasse Zeug sei sofort vereist gewesen statt zu trocknen, und er habe in den nächsten Marschstunden den hartgefrorenen Überzieher vor sich hertragen müssen wie einen Ofenschirm.
Seine gute Laune aber sei doch nicht zu zerstören gewesen, und die Sonne sei wirklich aufgegangen, und es sei wirklich warm geworden an diesem Tage; beinahe erträglich.
Und da habe er plötzlich auf einem Hügelrücken eine frische Orangenschale gefunden, mitten in der Wildnis, wo es nichts Lebendiges gab, nicht Tier, noch Pflanze, noch Frucht. Er habe die Orangenschale aufgehoben und sich an ihrem Duft gefreut, viele Tage lang, und es sei ihm gewesen, als begleite ihn irgendein Warmes und Leuchtendes, von der Sonne goldig Gefärbtes durch das fremde, unwegsame Land. Und das Fluchen des serbischen Majors habe ihn nicht mehr schrecken können und auch die Kolbenstöße der Soldaten nicht; er habe sich immer vorgesagt: »Alles wird gut, alles wird wieder gut!« Und Lauretta sei neben ihm einhergeschritten.
»Du armer, lieber Mann«, sagte Lauretta mit gedrosselter Stimme. Und nach einer Pause: »Wie schön du erzählen kannst! Du musst der Fürstin Lubecka von deinen Abenteuern erzählen. Ich bin so stolz auf dich, Liebling. Alles musst du erzählen, damit sie mich beneiden, und ich will nichts tun als still dasitzen und dir zuhören.«
Sie hatte ihn wieder untergefasst und schritt mit ihm durch die Wohnung. Als sie zu dem kleinen Raum kamen, der früher seiner Arbeit gedient hatte, errötete sie: »Ich wusste ja nicht, Liebling, wann du wiederkehren würdest.«
»Was ist denn mit den Papieren geschehen«, fragte Toni, »die hier in der Schublade gelegen sind?«
»Die Papiere?«, wiederholte Lauretta überrascht; sie musste erst nachdenken. »Richtig, Liebling, die liegen alle zusammen in einer braunen Schachtel, damit ja nichts verloren geht.«
»Ich hab in der Schachtel schon nachgesucht«, sagte Toni, »ein Teil der Papiere fehlt und gerade der wichtigste.«
»Das kann nicht sein«, meinte lächelnd Lauretta. »Du bist noch immer der Alte. Erinnerst du dich, wie du unser erstes Mädchen, die Anna, immer beschuldigt hast, es sei ein ganz wichtiges Papier beim Aufräumen verloren gegangen, und dann stellte es sich heraus, dass es brav an seiner Stelle lag. Ich musste dir suchen helfen. Ich will es wieder tun, du weißt, ich habe eine glückliche Hand.«
Plötzlich besann sie sich. »Waren es Papiere in einer blauen Mappe?«, fragte sie.
Toni bestätigte eifrig.
»Die hat man von der Fabrik abgeholt, kurz, nachdem du ins Feld gegangen warst. Der Wessely kam sie holen. Ich ließ ihn selbst nachsuchen, weil er sich doch besser auskennt. Aber ich erinnere mich, dass er eine blaue Mappe mitgenommen hat.«
Toni Muhr blickte verstört vor sich hin.
»Du wirst doch jetzt nicht an Geschäfte denken, Liebling«, flehte Lauretta, und als Toni noch immer schwieg, beschwichtigte sie: »Du kannst ja mit dem Wessely sprechen, der hat deine Papiere gewiss nicht ins Feuer geworfen. Du weißt, wie genau der ist.«
»Natürlich«, sagte Toni Muhr, »natürlich«, mit dem gedrückten Tonfall, den Lauretta einstmals »verbindlich« genannt hatte und den er annahm, wenn er an etwas ganz anderes dachte, als wovon man zu ihm sprach. Lauretta hatte ihm oft gesagt, er solle sie lieber schlagen, als so verbindlich zu reden und zu lächeln.
Nun standen ihr wieder die Tränen in den Augen. Er sah es. Gleich war er nahe. »Lauretta, verzeih mir.«
Er schaltete das elektrische Licht aus, Mondlicht flutete ins Zimmer. »Ah!«, sagte Lauretta und streckte ihm die Arme entgegen. Draußen in der klaren Winterluft ragte ein dunkler spitzer Schatten zur Höhe, darüber ein Stern.
Toni Muhr stellte keine Frage mehr. Noch wohnte in seinem Herzen dumpf und quälend der Zweifel: Wie ist’s mit dem andern, dem deine Liebe zuflog, als ich ferne war? Aber ihre heißen Lippen schienen die Antwort zu geben: »Nun bist du mir nahe – nun bin ich dir nahe. Fühlst du nicht, dass ich nur dich liebe, dich allein!«
4
Während Toni Muhr sich am nächsten Tage ankleidete, hörte er, wie Lauretta alle Verwandten und Freunde von seiner Ankunft telefonisch in Kenntnis setzte. Der Apparat stand in Laurettas Ankleidezimmer, das früher sein Laboratorium gewesen war. Lauretta hatte ihn während seiner Abwesenheit dort anbringen lassen; das war ihm gestern entgangen.
Nicht nur aus Sparsamkeit hatte Toni Muhr ehedem kein Telefon im Hause dulden wollen. Es war ihm der Gedanke verhasst, dass jeder Fremde, wann immer es ihm beliebte, eine unsichtbare Türe aufreißen und mitten ins Zimmer treten konnte. Das laute Glockensignal, sagte er, zerstöre die besten Gedanken, das Telefon verderbe den Charakter der Menschen, wie es ihre Stimme verändere; die Gutmütigsten würden unerträglich. Laurettas Gesicht aber verklärte sich, wenn sie die Hörmuschel zur Hand nahm. Sie konnte auch in einem fremden Haus ganz aufgeregt werden, sobald die Telefonglocke schrillte.
Klatschnass saß sie nun im Bademantel da, Tropfen perlten über den vorgestreckten Arm, und ihre Stimme lief durch die Stadt, treppauf, treppab, klingelte hier und dort an den Türen, rief andere Stimmen herbei, begann mit ihnen ausführliche Gespräche, die plötzlich um neuer Gespräche willen abgebrochen wurden, deren unermüdliche Lebhaftigkeit stets als Beginn und stets als Fortsetzung gelten konnte.
Toni Muhr brauchte des Morgens immer erst Sammlung. Da war so vieles zu überdenken, von dem letzten Tage noch und von dem bevorstehenden, viel Dumpfes zu lösen, jeder Tag war neu, sonderbar, unheimlich, man musste sich erst zurechttasten, sich wieder zur Welt in Beziehung bringen. Er brauchte eine ganze Weile, ehe er reden konnte, Lauretta aber war, sobald sie nur die Augen aufschlug, mitten in die Gegenwart verstrickt. Sie sprang mit beiden Füßen zugleich aus dem Bett, und so war sie auch heute vor der Wortkargheit Tonis mit lautem Hallo zum Telefon geflüchtet.
Er hörte sie nach allen Seiten hin Verabredungen treffen, mehr als man in den nächsten zehn Jahren einhalten konnte, so dünkte es ihm. Allen erzählte sie von der großen Überraschung: wie sie gestern heimgekehrt war und Toni angetroffen hatte. Immer fand sie neue Worte zur Beschreibung ihres Glückes, kramte auch gleich Erlebnisse des »wilden Kriegers« aus, wie sie ihn nannte, und pries ihn mit den entzückten Worten eines jungen Mädchens nach dem ersten Ball.
»Er ist bildhübsch geworden«, rief sie, »ihr werdet es sehen!«
Um elf Uhr kam die Familie Saluzzo; beinahe vollzählig. Nur Gino fehlte.
»Brav, mein Junge«, sagte der alte Herr von Saluzzo und tätschelte mit zwei vorsichtig ausgestreckten Fingern Tonis Wange.
Frau Johanna fiel ihrem Schwiegersohn um den Hals, ihre Küsse knallten. »Prächtig siehst du aus, prächtig!«, sagte sie und rollte das »R« – eine ferne Erinnerung an das Theater. Das ganze Zimmer war voll Lärmens, als ob ein Dutzend Menschen zu gleicher Zeit von verschiedenen Dingen gesprochen hätten.
Nun erst fand Frau Johanna Zeit, Toni wirklich anzublicken. Sie bemerkte, wie ausgehöhlt sein Antlitz war, und sah zwei tiefe Furchen, die von der Nase zum Munde liefen.
»Ein wenig müde bist du gewiss. Ja, das bist du«, sagte sie. »Aber wir werden dich schnell wieder dick füttern. Komm nur in mein Spital auf dem Stubenring. Da haben wir vor ein paar Wochen einen Fall gehabt, den alle für verloren hielten: Sepsis. Ein Bub von zwanzig Jahren, der aussah wie ein Greis, gelb und vertrocknet. Nahrung wollte er keine mehr zu sich nehmen, nur rauchen. Er hatte schon das Bewusstsein verloren, aber er rauchte noch immer. Sie sagten, es sei Agonie. Während der Geistliche ihn mit den Sterbesakramenten versah, führte er die Zigarette immerfort zum Munde, in ruckweisen Absätzen, wie ein Automat. Die Augen waren gläsern zur Decke gerichtet. So ging es die ganze Nacht und den folgenden Tag. Wenn eine Zigarette zu Ende war, tastete er unruhig die Decke entlang, bis man ihm wieder eine neue zwischen die Finger klemmte … Was wollte ich nur sagen! Richtig: Auch dieser junge Mensch lebt. Wir haben ihn über das Schlimmste hinweggebracht. Jetzt raucht er schon seine Zigarette aufrecht im Bette sitzend.«
Sie unterbrach sich, als sie gewahr wurde, dass niemand ihr zuhörte. Scheltend wandte sie sich an Lauretta: »Dich habe ich wieder einen ganzen Monat nicht im Spital gesehen, kein Funken Pflichttreue ist in dir!«
»Die Lauretta möcht’ halt immer nur die Fee Cheristane spielen«, warf Rudi lachend ein. – Eigentlich sagte er »spülln«, seine Aussprache fiel leicht ins Wienerische. – »Immer nur die Händ’ auflegen, freundlich zureden, ein ›Lichtblick‹ sein. Das passt ihr halt. ›O, Cheristane! Dich erblicke ich auf dieser Erde wieder, du Himmelsbild aus meiner Rosenzeit! Kaum wagt mein welkes Aug’ den Blick zu heben zur Morgenröte deiner ew’gen Jugend. O, zieh nicht fort, verweile noch!‹«, deklamierte er in mühsamem Hochdeutsch.
»Da passen wir ja gut zusammen«, rief Lauretta, »ich die Cheristane und du der Verschwender.«
Herr von Saluzzo mahnte zur Ruhe. »Bitte keinen Streit«, sagte er, »das riecht nach Gesindestube.«
Toni Muhr wollte von Gino hören; der war noch immer in Galizien bei seinem Erzherzog.
»Mich nennt er einen Austriacante«, seufzte der alte Herr von Saluzzo. »Was weiß der Gino von der Irredenta! Als Bauer ist er auf seinem Gut gesessen und hat denen sein Öl verkauft, die es kaufen wollten.«
»Welches ist denn jetzt deine Beschäftigung?«, fragte Toni Muhr seinen Schwager Rudi Saluzzo.
»Er hat ja gar keine«, antwortete Lauretta für ihn.
»Der Rudi ist eine Familienschande«, seufzte der alte Herr von Saluzzo.
»Nur weil ich enthoben bin«, verteidigte sich Rudi.
»Wofür bist du denn eigentlich enthoben?«, fragte von obenher der Vater. »Für welches Unternehmen? Du hast keine feste Anstellung. Ein gesunder Mensch – in dieser Zeit.«
Lachend erwiderte Rudi: »Ich hab kein Unternehmen, und ich will auch keins haben. Wozu Geld verdienen? Der Krieg frisst das Geld, es bleibt nichts übrig. Du, lieber Papa, mühst dich mit deinen Geschäften und triffst es am End’ doch nicht so gut wie der Katlein, der Millionen zusammenscharrt. Und auch von seinen Millionen wird nichts übrig bleiben, gar nichts; der Krieg frisst alles auf.«
»Vortreffliche Ausrede für Müßiggänger«, rief Herr von Saluzzo erbost.
»Ich widerlege den Krieg«, erklärte Rudi mit gespieltem Ernst. »Das ist sehr wichtig, vielleicht wichtiger, als ihr glaubt.«
»Fammi piacere1«, sagte Herr von Saluzzo frostig, um dem Gespräch ein Ende zu bereiten. Ungeduldig blickte er auf die Uhr, denn er wurde zum Mittagessen im Klub erwartet; es waren teils geschäftliche, teils Repräsentationspflichten, die ihn riefen.
Auch Frau Johanna hatte es eilig; denn am Nachmittag gab es Spitalsinspektion. Toni Muhr hatte sie in eine Ecke gezogen. Er wollte bestimmte Fragen an sie richten, aber es war so schwer, einen passenden Übergang zu finden. »Lauretta …«, begann er endlich.
»Sie ist ein so liebes Kind«, setzte Frau Johanna fort. »Ein wenig schwierig war sie immer; aber so lieb, nicht wahr? Wie sie sich über deine Heimkehr gefreut hat! Wie sie dich anblickt! Immer mit Tränen in den Augen, vor lauter Freude. Ein so gutes Kind!« Sie umarmte Toni noch einmal stürmisch, nötigte ihm das Versprechen ab, sie schon am nächsten Tage bei der Ausspeisung zu besuchen, und wirbelte zur Türe hinaus.
Hoheitsvoll, stelzbeinig folgte Herr von Saluzzo nach.
Rudi blieb allein zurück und lud sich zum Mittagessen ein. »Wenn ihr erlaubt«, sagte er, »ich esse zumeist bei Freunden und überlasse es fast immer dem Zufall, wo mein Rindfleisch gekocht wird. So was wie Häuslichkeit gibt es ja nicht mehr für mich, seit dieser verwünschte Krieg ausgebrochen ist. Mama ist stets unterwegs und Papa auch.«
Als die drei jungen Leute zusammen bei Tische saßen, brachen sie, wie auf ein gegebenes Zeichen, in ein fröhliches Lachen aus. Lauretta, weil sie sich innerlich freute, dass Rudi der steifen Gemessenheit des Vaters, vor der sie Scheu empfand, so unverschämt zuleibe ging. Rudi Saluzzo lachte, weil ihm die stille, verlässliche Art Tonis, rein als Schauspiel genommen, Vergnügen bereitete. Und Toni Muhr lachte, von der Lebensfreude der beiden Geschwister mit fortgerissen, wie jemand, der aus einem dunklen Schacht ans Licht kommt, und das Herz wird ihm leicht, weil er die Sonne wieder scheinen sieht.
»Ist das nicht merkwürdig«, stellte Rudi Saluzzo fest, »jetzt hat man sich die ganze Zeit nur mit mir beschäftigt: was ich wohl unternehme oder nicht unternehme, obgleich da verdammt wenig zu erwarten ist. Aber was du zu unternehmen gedenkst, Toni, darnach hat niemand gefragt.«
»Vor allem muss er sich jetzt erholen«, erklärte Lauretta, und auf ihren Wink wurde eine verstaubte Flasche Wein aus dem Keller geholt, eine von dem Dutzend, das Tonis Vater für den Friedensschluss und die siegreiche Heimkehr der Truppen bestimmt hatte.
Dies brachte das Gespräch auf den Alten, und es erwies sich, dass Lauretta ihn schon längere Zeit nicht gesehen hatte. Doch Rudi Saluzzo war ihm bei einer Heurigenfahrt in Grinzing begegnet und versicherte, dass er blühend aussehe; so trank man auf das Wohl des Vaters Muhr.
Als die Gläser wieder auf dem Tische standen, sagte Toni: »Deine Frage, lieber Rudi, was ich jetzt zu tun gedenke, ist leicht zu beantworten. Ich sehe meine Arbeit vor mir, und ich habe sie immer vor mir gesehen. Das Schmerzlichste in diesen Kriegsjahren war vielleicht, dass sie mich von der Arbeit abdrängten. Ihr könnt euch nicht verstellen, was das heißt, Pläne übereinander getürmt zu wissen, zur Ausführung reife und andere im Werden begriffene und andere noch verschleiert und fern und doch so anziehend, wie eben die Ferne ist; und man weiß nicht, werde ich dahin gelangen, ist mir noch die Zeit gegönnt, und man hat nur den einen Gedanken: Arbeiten, wie einer, der einen hohen Berg besteigen will, nur den einen Gedanken hat: Wandern.«
»Bravo!«, rief Lauretta und blickte triumphierend um sich.
»Du wirst doch wieder in die Katlein’sche Fabrik eintreten?«, fragte Rudi Saluzzo nach einer Pause.
»Nein«, erwiderte Toni zögernd, »die Fabrik, die mir das tägliche Brot bringen sollte, hat von mir mehr gefordert, als sie mir geben konnte. Damals vor dem Kriege glaubte ich noch Zeit verschwenden zu können, als käme es gar nicht auf ein paar Jahre an. Ich war ja so jung, wir alle waren so jung, nicht wahr? Doch jetzt kommt es auf die Zeit an, auf jedes Jahr, auf jeden Tag. Und vielleicht ist es nicht nur ein erbärmliches, sondern auch ein sehr schlechtes Geschäft, wenn man sich um des täglichen Brotes willen Stück für Stück ausgibt, statt geduldig zu warten, bis ein Werk gelingt.«
»Und wie gedenkst du es dir bis dahin einzurichten? … Mit dem täglichen Brot, meine ich«, warf Lauretta ein, fühlte jedoch, dass sie etwas Dummes gefragt hatte, und brach ab.
Toni Muhr erwiderte ruhig: »Ich habe kurz vor Ausbruch des Krieges eine Erfindung gemacht, die zu jener Zeit wenig praktischen Nutzen versprach, aber jetzt wohl einiges Geld ins Haus bringen muss; vielleicht sogar viel Geld. Es handelt sich um ein Verfahren zur Gewinnung von Tierkohle für Heilzwecke.«
Rudi Saluzzo fuhr mit einem Sprung in die Höhe: »Tierkohle für Heilzwecke? Das ist ja schon erfunden.«
»Du irrst«, sagte Toni ein wenig pedantisch wie immer, wenn er von beruflichen Dingen sprach. »Ich meine ein ganz neues Verfahren, das niemand kennt außer mir und dem Katlein, und der hat es seinerzeit nicht einmal zum Patent anmelden wollen, als ich es ihm verschlug.«
Rudi Saluzzo wurde immer erregter. »Was fällt dir ein, Toni. Denk nach. Der Katlein erzeugt schon zwei Jahre lang solche Tierkohle in seiner Fabrik. Damit hat doch sein großes Geldverdienen angefangen und seine Verbindung mit dem Ärar. Jetzt fabriziert er alles, was der gute Krieg braucht, seit ein paar Wochen auch giftige Gase; neulich sind zwölf Arbeiter in seiner Fabrik umgekommen.«
Toni Muhr wurde unsicher. »Weißt du’s bestimmt«, fragte er stockend, »dass der Katlein Tierkohle herstellt?«, und zu Lauretta gewendet: »Der Wessely hat die blaue Mappe geholt?«





























