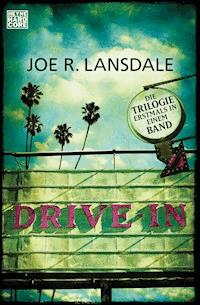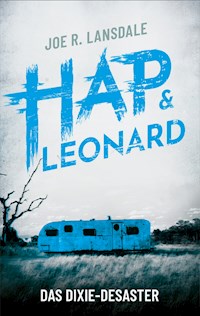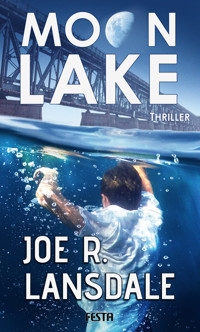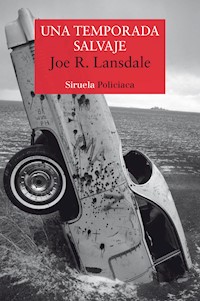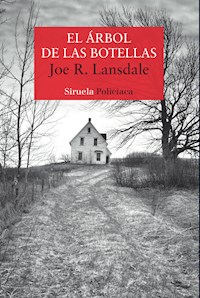2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Willkommen in der Finsternis...
Richard Dane ist ein anständiger Bürger und Familienvater. Doch eines Nachts ändert sich sein Leben von Grund auf. Richard stellt einen Einbrecher und erschießt ihn. Für die Polizei ist der Fall klar: Notwehr. Doch als der Vater des Erschossenen beschließt, Rache für seinen Sohn zu nehmen, wird eine Kette von blutigen Ereignissen in Gang gesetzt. Um seine Familie zu schützen, greift Richard zu extremen Mitteln ...
Der Roman erschien in Deutschland bereits 1997 unter dem Titel "Kalt brennt die Sonne über Texas".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 405
Veröffentlichungsjahr: 2015
Sammlungen
Ähnliche
ZUM BUCH
Eine Kleinstadt in Texas, Ende der achtziger Jahre, in einer heißen Sommernacht. Richard Dane, Familienvater und arbeitsamer Bürger, schreckt aus dem Schlaf. Geräusche dringen aus der unteren Etage seines Hauses. Richard nimmt die Waffe, die er griffbereit neben seinem Bett hat, und schleicht sich aus dem Schlafzimmer. Wenige Sekunden später ist nichts mehr wie zuvor. Richard befindet sich in einem wahren Albtraum: Vor ihm liegt der Einbrecher, den er erschossen hat, die Tapete seines Wohnzimmers ist mit Blut besudelt. Auch wenn ihm jeder versichert, richtig und in Notwehr gehandelt zu haben, ist Richard tief erschüttert. Doch die Bedrohung ist realer, als er denkt. Ben Russel, Vater des Einbrechers und ein harter Gewalttäter, beginnt, Richard und dessen Familie systematisch zu terrorisieren. Richard schreitet zur Tat. Es gelingt ihm, Russel zu überwältigen, aber die Ereignisse nehmen plötzlich eine völlig neue Wendung. Richard muss sich fragen, wer seine wahren Feinde sind. Es wird Blut fließen, viel Blut ...
Der wilde Noir-Klassiker von Joe R. Lansdale ist die Romanvorlage zum Filmereignis Cold In July mit Michael C. Hall, Don Johnson und Sam Shepard.
ZUM AUTOR
Joe R. Lansdale, geboren 1951, zählt zu den großen amerikanischen Erzählern. Er hat mehr als vierzig Romane in verschiedenen Genres geschrieben und erhielt zahlreiche namhafte Auszeichnungen, u. a. den American Mystery Award und den Edgar Award. Lansdale lebt mit seiner Familie in Nacogdoches, Texas.
Inhaltsverzeichnis
Wer immer gegen Monster kämpft, sollte dabei möglichst nicht selbst zum Monster werden.
Dieser Roman ist mit viel Liebe und großem Respekt dem Gedenken an meinen guten Freund und Agenten Ray Puechner gewidmet. Er war ein einzigartiger Mensch und wird sehr vermißt.
Ich möchte mich bei Gary L. Brittain, David G. Porter und Bob LaBorde für ihren Rat zu bestimmten technischen Details in diesem Roman bedanken.
TEIL 1
Söhne
1
In jener Nacht hörte Ann das Geräusch als erste.
Ich schlief. Ich hatte seit geraumer Weile nicht mehr gut geschlafen. Es gab einige Probleme bei der Arbeit, und hinzu kam, daß unser vierjähriger Sohn Jordan die vergangenen beiden Nächte krank gewesen war. Er hatte gehustet, sich übergeben und uns damit ständig geweckt. Aber diese Nacht schlief er fest, und ich war wie erschlagen.
Ich wurde wach durch Anns Ellbogen in meinen Rippen und ihr Flüstern: «Hast du das gehört?»
Das hatte ich nicht, aber der Klang ihrer Stimme überzeugte mich, daß sie ganz gewiß etwas gehört hatte, und es war nicht nur der Ruf eines Nachtvogels gewesen oder ein Hund, der sich an den Mülleimern hinter dem Haus zu schaffen machte. Ann zählte nicht zu den ängstlichen Menschen; sie hatte ein unglaubliches Gehör, wahrscheinlich als Ausgleich zu ihrem schlechten Sehvermögen.
Ich rollte mich auf den Rücken und lauschte. Einen Augenblick später hörte ich ein Geräusch. Es war die Glastür im rückwärtigen Teil des Hauses, die ins Wohnzimmer führte. Sie wurde vorsichtig zurückgeschoben. Was Ann anfänglich gehört hatte, war höchstwahrscheinlich das Aufbrechen des Schlosses gewesen. Ich dachte an Jordan, der in seinem Zimmer auf der anderen Seite des Flurs schlief, und spürte fröstelnd, wie mich eine Gänsehaut überlief und bis zur Schädeldecke hochkroch.
Ich drückte meine Lippen an Anns Ohr und flüsterte: «Psssst.» Ich kroch vorsichtig aus dem Bett, griff mir meinen Morgenmantel vom Bettpfosten und schlüpfte aus reiner Gewohnheit hinein. Ein Lichtstrahl unserer Nachtbeleuchtung auf dem Hinterhof drang durch einen Vorhangspalt. Ich konnte gut genug sehen, um zum Wandschrank zu gehen, die Tür zu öffnen und einen Schuhkarton vom obersten Bord zu ziehen. Ich stellte den Karton aufs Bett und öffnete ihn. In ihm lagen ein kurzläufiger 38 er und eine Schachtel Patronen. Ich lud die Waffe schnell und instinktiv. Als ich damit fertig war, war mir schwindlig, und ich merkte, daß ich die Luft angehalten hatte.
Wegen Jordans Krankheit hatten wir es uns zur Gewohnheit gemacht, unsere Schlafzimmertür offenzulassen, damit wir ihn hören konnten, wenn er nachts rief. Daher kam ich leichter auf den Flur. Den 38 er hielt ich ans Bein gepreßt. In diesem Augenblick wünschte ich mir, wir würden in der Stadt wohnen und nicht hier an der Straße am See auf unserem fünf Morgen großen Grundstück. Wir waren nicht direkt isoliert, aber in einer Situation wie dieser lief es doch auf dasselbe hinaus. Unser nächster Nachbar war eine Viertelmeile entfernt, und unser Haus war von einem dichten Kiefernwald und undurchdringlichem Buschwerk umgeben, in dem sich die Schatten fingen.
Es war eigenartig, aber als ich in den Flur trat, wurde ich mir der Wände des Hauses bewußt, und ich spürte, wie eng der Flur tatsächlich war. Sogar die Decke erschien mir niedrig und erdrückend, und ich konnte den Teppichflor zwischen meinen Zehen spüren. Er kam mir so scharf wie Nadeln vor. Mir schoß der Gedanke durch den Kopf, ob die Noppen wohl hoch genug waren, um sich darin zu verstecken.
Ich konnte den Lichtkegel der Taschenlampe im Wohnzimmer tanzen sehen, hin und her flatternd wie ein im Glas gefangener Nachtfalter, und ich konnte hören, wie Schuhe leise über den Teppich glitten.
Ich versuchte, den Kloß in meiner Kehle hinunterzuschlucken, als ich mich Zentimeter für Zentimeter vorwärts schob und behutsam um die Ecke ins Wohnzimmer trat.
Der Einbrecher kehrte mir den Rücken zu. Das Nachtlicht im Hinterhof schien durch die Glastür und ließ die Konturen des Mannes erkennen. Er war groß und dünn, trug dunkle Kleidung und eine dunkle Wollmütze. Er leuchtete mit seiner Lampe auf ein Gemälde an der Wand und überlegte wahrscheinlich, ob es einen Diebstahl wert war oder nicht.
Es war es nicht. Es war eine billige Landschaft vom Jahrmarkt. Ann und ich kannten den Künstler, und so hatten wir das Bild gekauft. Es bedeckte den Teil der Wand genausogut wie ein Picasso.
Der Einbrecher kam zur gleichen Schlußfolgerung über den Wert beziehungsweise Unwert, denn er wandte sich von dem Bild ab, und dabei fiel der Strahl seiner Taschenlampe auf mich.
Einen Augenblick lang standen wir beide wie Zaunpfähle. Dann flackerte seine Taschenlampe, und mit der freien Hand faßte er an seinen Gürtel. Instinktiv wußte ich, daß er nach einer Waffe griff. Aber ich konnte mich nicht bewegen. Es war, als habe man mir Zement in Adern und Poren gepumpt und der sei augenblicklich erstarrt.
Er zog die Waffe aus seinem Gürtel und feuerte. Die Kugel pfiff an meinem Kopf vorbei und bohrte sich in die Wand hinter mir. Ohne überhaupt nachzudenken, riß ich den 38 er hoch und drückte auf den Abzug.
Sein Kopf schnellte zurück und dann wieder nach vorn. Die Wollmütze rutschte zur Seite, fiel aber nicht runter. Er trat steifbeinig zurück und setzte sich auf die Couch, als sei er müde. Sein Revolver fiel auf den Boden, und dann glitt ihm die Taschenlampe aus der anderen Hand.
Ich wollte meinen Blick nicht von dem Mann lassen, aber ich stellte fest, daß meine Augen der Bewegung der Taschenlampe folgten, als sei ich hypnotisiert. Kreisend rollte sie mir auf dem Fußboden entgegen, kam zum Stillstand, kullerte einen Schritt zurück und blieb dann still liegen. Ihr Licht umfloß meine Füße wie eine helle Honiglache.
Plötzlich merkte ich, daß mir die Schüsse in den Ohren dröhnten und der Zement meinen Körper verlassen hatte. Ich zitterte, die Waffe immer noch auf den Einbrecher gerichtet, der es sich scheinbar auf der Couch bequem gemacht hatte.
Ich holte tief Luft und wollte auf ihn zugehen.
«Ist er tot?»
Ich machte fast einen Luftsprung. Ann war hinter mir.
«Verdammt noch mal», sagte ich. «Ich weiß nicht. Mach das Licht an.»
«Bist du okay?»
«Außer daß ich mir in die Hosen geschissen hab, ja. Mach das Licht an.»
Ann drückte auf den Schalter, und ich bewegte mich langsam vorwärts. Die Waffe hielt ich vor mir, halb in der Erwartung, daß er von der Couch aufspringen und mich packen würde.
Aber er bewegte sich nicht. Er saß einfach da, sah sehr gefaßt aus und sehr lebendig.
Bis auf sein rechtes Auge. Das beeinträchtigte die lebensechte Wirkung, denn es war weg. An seiner Stelle befand sich jetzt nur ein dunkles, feuchtes Loch. Blut quoll aus den Winkeln, floß über und rann seine Wange hinab wie scharlachrote Tränen.
Ich ertappte mich dabei, daß ich auf sein unversehrtes Auge starrte. Es glänzte noch immer, wurde aber langsam matt. Es sah so sanft und so braun aus wie das eines Rehs.
Ich wandte den Blick ab, bemerkte dann aber etwas ebenso Gräßliches. An der Wand über der Couch, teilweise über das billige Landschaftsbild versprüht, konnte ich Spritzer von Blut und Gehirn erkennen sowie kleine weiße Partikel, die vermutlich Knochensplitter waren. Ich malte mir aus, wie die Austrittswunde am Hinterkopf des Mannes aussehen mochte. Ich hatte irgendwo gelesen, daß eine Kugel beim Austritt ein viel größeres Loch hinterläßt als bei ihrem Eintritt. In einem blitzartigen Anflug von Wahnsinn fragte ich mich, ob ich wohl meine Faust dort hineinstecken und hin und her drehen könnte.
Doch das wollte ich nicht wirklich wissen.
Ich steckte den Revolver in die Tasche meines Morgenmantels und machte ein paar taumelnde Schritte. Der Raum wurde heiß, schien wie Wachs zu schmelzen und ich mit ihm. Ich sackte zusammen und streckte meine Hände aus. Ich griff nach den Knien des Toten, um nicht ganz zu Boden zu gehen. Ich konnte das Schwinden seiner Körperwärme durch die Hosen spüren.
«Sieh ihn nicht an», sagte Ann.
«Scheiße, sein verdammtes Hirn klebt an der ganzen Wand.»
Ann wurde schlecht. Sie fiel neben mir zu Boden, den Arm um meine Schultern, und wie Mönche vor einem Schrein neigten wir unsere Köpfe. Aber statt Gebeten ergoß sich aus unseren Mündern Erbrochenes, bekleckerte den Teppich und die Schuhe des Toten.
Jordan wachte nicht einmal auf.
2
Die Polizisten waren nett. Echt nett. Sie waren zu zehnt. Sechs in Uniform, die anderen Detectives in Zivil. Die Detectives glichen ganz und gar nicht den Fernseh-Cops, die ich erwartet hatte. Keine schlampigen Burschen in offenen Trenchcoats, denen die Soße von ihren Chili dogs auf den Schlips kleckerte. Sie trugen sogar nette Anzüge. Keine schlechten Manieren. Sehr höflich. Keine Verdächtigungen. Sie nahmen das, was geschehen war, anstandslos zu Protokoll.
Der für die Untersuchung zuständige Mann war ein Lieutenant namens Price. Er sah aus wie ein Filmstar. Er war wohl so ungefähr fünfunddreißig. Seine Haare waren perfekt gekämmt, und er hatte helle blaue Augen, die zu seinem teuren Anzug paßten. Seine Schuhe waren so glänzend poliert, daß es einem geradezu ins Auge sprang.
Er kam herüber und berührte meinen Arm. «Alles okay, Mr. Dane?»
«Ja», sagte ich, noch immer den Nachgeschmack des Erbrochenen im Mund. «Prima.»
«Ihnen blieb kaum was anderes übrig. Er hat zuerst auf Sie geschossen.»
Ich nickte. Ich bereute nicht, was ich getan hatte. Ich haßte es nur, daß ich dazu gezwungen gewesen war.
«Ich mußte auch einmal einen Mann töten», sagte Price. «In Ausübung meines Dienstes. Aber es war hart, drüber wegzukommen. Ehrlich gesagt kommt man nie ganz drüber weg. Und wenn man Mensch bleiben will, sollte es auch so sein. Sie dürfen sich keine Vorwürfe machen.»
«Mache ich auch nicht. Aber das hilft mir auch nicht weiter.»
Ann war mit Jordan ins Schlafzimmer gegangen, der schließlich doch von den Geräuschen der umherstöbernden Polizisten aufwacht war. Sie beschäftigte ihn dort hinten, damit er den toten Mann nicht zu sehen bekam.
Der tote Mann.
Ich warf einen Blick auf die Couch, wo der Mann gesessen hatte. Ich bildete mir ein, daß er eine Vertiefung hinterlassen hatte, aber in Wahrheit wußte ich, daß die Couch vom langen Gebrauch nur durchgesessen war. An der Stelle, wo er sein Leben ausgehaucht hatte, waren die Kissen von Blut beschmutzt, und das Zeug an der Wand und auf der Landschaft sah im Moment aus wie ein wildes abstraktes Gemälde.
Ich entsann mich, wie der Friedensrichter hereingekommen war, um die Augen noch ganz verschlafen. Er trug eine Pyjamajacke und Jeans. Ein Hosenbein steckte im Cowboystiefel, das andere war über den Stiefel gezogen. Nachdem er den Mann für tot erklärt hatte, murmelte er etwas davon, daß auch Kleinstädte ihren Leichenbeschauer haben sollten. Dann ging er wieder, und nachdem die Polizisten den Leichnam näher inspiziert und fotografiert hatten, schafften ihn zwei Männer vom Bestattungsunternehmen fort.
Ich betrachtete abermals die Wand, und die blutige Schmiererei sah nicht mehr wie ein Gemälde aus, sondern eher, als habe jemand mit ein paar faulen Tomaten geworfen. Bei der Vorstellung wurde mir mulmig, und ich mußte würgen, obwohl ich nichts mehr im Magen hatte, was ich hätte auskotzen können.
Ich tat einen tiefen Atemzug, aber das half nichts, denn er verstärkte nur das saure Aroma von Erbrochenem und den kupfernen Geruch von Blut.
«Setzen Sie sich lieber», sagte Price.
«Mir geht’s gut», sagte ich.
«Setzen Sie sich trotzdem.»
Ich schätze, mein Gesicht war bleich geworden. Price half mir zu einem Stuhl und hockte sich neben mich.
«Soll ich Ihnen Wasser holen?» fragte er. «Oder sonst irgendwas?»
«Mir geht’s gut. Kennt einer von Ihnen zufällig diesen Mann?»
«Ziemlich gut sogar. Heißt Freddy Russel. Kleine Nummer. Hat ab und zu eingebrochen, meistens in dieser Gegend, aus der er auch stammt, wie man leider sagen muß. War immer mal wieder im Knast, ganz wie sein Alter. Sie haben dem Knilch einen Gefallen getan.»
«Klar doch.»
«Wundern Sie sich nicht. Manchmal sind Burschen wie der mit Absicht unvorsichtig, weil sie hoffen, erwischt zu werden und wieder in den Knast zu kommen, wo sie’s leichter haben. Oder sie hoffen, daß sie sich was Längerfristiges einfangen. ’ne Kugel zum Beispiel.»
«Er hatte nicht vor, sich umbringen zu lassen, als er auf mich schoß.»
Price lächelte. «Gut gesagt. Soviel zur Amateurpsychologie.»
«Danke, daß Sie versuchen, mich aufzumuntern. Sehr anständig von Ihnen.»
«Wie ich schon sagte. Für mich ist das nichts Neues. Hören Sie, meinen Sie, daß Sie mich aufs Revier begleiten könnten? Damit ich eine offizielle Aussage bekomme. Dauert auch nicht lange. Ein Streifenwagen nimmt Sie mit und bringt Sie auch wieder zurück. Wir lassen einen Mann hier bei Ihrer Frau und dem Jungen. Sie kann dann irgendwann morgen vorbeikommen und selbst ihre Aussage machen.»
«Gut», sagte ich. «Lassen Sie mich nur Ann Bescheid sagen, und dann ziehe ich mich an.»
3
Es war einfach. Ich sagte Price dasselbe, was ich ihm auch zu Hause gesagt hatte. Es erschien jetzt nur etwas ferner, als sei es jemandem anderen geschehen und ich hätte es aus einer gewissen Distanz beobachtet.
Der Raum, in dem er meine Aussage aufnahm, roch nach kaltem Zigarettenrauch, aber das war auch das einzige, das meiner Vorstellung von einem Polizeirevier entsprach. Der Raum sah eher aus wie das Büro einer Versicherungsgesellschaft. Ich hatte zu viele Fernsehserien und Filme gesehen, erwartete Staub, Spinnweben, leere Kaffeebecher, halb gegessene Pizzen und grelles Licht.
Groß möbliert oder dekoriert war der Raum nicht. Ein paar Belobigungsurkunden an der Wand, ein Aktenschrank, ein aufgeräumter Schreibtisch, eine Schreibmaschine, Papier eingespannt und Price an der Tastatur. Price und ich waren allein im Raum.
Ich brauchte zwanzig Minuten, um alles noch mal zu erzählen, von Anfang bis Ende.
«Und jetzt?» fragte ich.
«Nicht viel», sagte Price. «Das geht jetzt vor die Grand Jury. Die hören sich Ihre Aussage, die Ihrer Frau und meine eigene an. Dann wird nicht weiter ermittelt. Sie müssen nicht einmal vor Gericht.»
«Sind Sie sicher?»
«Klarer Fall von Notwehr. Er ist mit der Absicht, Sie zu berauben, eingebrochen und hat auf Sie geschossen. Sie befinden sich im legalen Besitz einer Waffe. Er ist ein aktenkundiger Ganove, Sie sind ein angesehener Bürger der Gemeinde. Wir haben nicht den geringsten Grund, Sie irgendeiner Gesetzesübertretung zu verdächtigen. Das wär’s. Bis auf Ihren Revolver. Wir behalten ihn eine Weile, bis die Ermittlungen auch offiziell eingestellt werden. Dann geben wir ihn Ihnen zurück. Ich werde Sie von einem Beamten nach Hause bringen lassen.»
Als ich zu Hause angekommen war, nickte mir der Polizist, der bei Ann geblieben war, zu und fuhr mit dem anderen weg. Ich ließ mich in den Wohnzimmersessel sinken und betrachtete die Couch. Ich konnte mir nicht vorstellen, mich je wieder auf sie zu setzen. Ich beschloß, sie morgen fortschaffen zu lassen und eine neue zu kaufen. Ich wollte auch die blutbesudelte Landschaft loswerden und die Wand neu streichen lassen. Mein Gott, ich dachte daran umzuziehen und hätte es auch getan, wenn ich es mir hätte leisten können.
Ann saß auf der Stuhllehne und legte einen Arm um mich. «Alles okay?»
«So okay, wie’s geht. Geh ins Bett, Liebling. Ich komme auch.»
«Ich werde ein bißchen klar Schiff machen ... bevor Jordan aufsteht.»
Mir wurde klar, was sie meinte – die Wand, die Couch und das Bild. Sie vermochte nur nicht die Worte zu finden.
«Ist es in Ordnung, wenn wir das machen?» fragte ich. «Beweise und so. Hat die Polizei nichts dagegen?»
«Der Beamte hat mir gesagt, wann immer wir saubermachen wollen, können wir loslegen. Sie haben Fotos gemacht, alles, was sie brauchten.»
«Ich werde dir helfen.»
Wir füllten einen Plastikeimer mit warmem Seifenwasser und rieben die Couch ab. Das Landschaftsbild warfen wir in den Müll, und die Wand wischten wir so sauber wie möglich. Die Couch war ruiniert. Das Blut war eingesickert und zu dunklen Flecken geronnen. Es hinterließ einen schwachen Geruch im Zimmer, der uns daran erinnerte, was geschehen war.
Wir säuberten den Teppich und verstreuten Backpulver, um den Geruch des Erbrochenen loszuwerden. Es half ein wenig. Als wir fertig waren, goß ich das Seifenwasser in den Küchenausguß und sah zu, wie es dunkel in den Abfluß strudelte. Ich warf die Lappen weg, die wir benutzt hatten, und versprühte etwas Raumspray.
Ich weiß nicht, warum, aber das Sprühen kam mir lachhaft vor, wenn auch auf bittere Weise. Ich stellte mir ständig einen Werbespot für Raumspray vor, in dem angepriesen wurde, daß es nicht nur den Geruch von Fisch und Zwiebeln vertrieb, sondern auch den von Blut, Hirn und Erbrochenem.
Ann duschte, und ich wusch mich im Badezimmerwaschbecken. Obwohl kein Tropfen Blut an mir war, kam ich mir vor wie Lady Macbeth, die sich mit ihren verdammten Blutflecken abmüht.
Der Tod in der Realität war ganz gewiß nicht wie der Tod im Fernsehen. Er war fies und roch und klebte an einem wie eine schlimme Krankheit.
Notwehr oder nicht, ich kam mir nicht vor wie Dirty Harry. Ich fühlte mich einfach schlecht, schlechter, als ich mich je im Leben gefühlt hatte.
«Laß uns ins Bett gehen», sagte Ann. Sie kam aus der Dusche, und sie sah gut aus. Ihre fünfunddreißig Jahre sah man ihr nicht an. Ihre Brüste hingen vielleicht ein wenig, aber alles andere an ihr war hübsch, und an den Brüsten sollte es nun wirklich nicht liegen. Sie war meine Frau, und ich liebte sie. Ich wußte, daß sie sich mir jetzt anbot. Ich erkannte es an der Art ihrer Bewegungen, als sie die Duschhaube abnahm und sich die langen blonden Haare wie eine Lichtflut über die Schultern fallen ließ, und daran, wie sie sich leicht übertrieben reckte, das Handtuch langsam über ihre langen Beine gleiten ließ und dann verführerisch damit über ihre feuchten Schamhaare strich.
Sie lächelte mich an. «Wir könnten kuscheln, was meinst du?»
«Ich bin eigentlich noch nicht müde», sagte ich blödsinnigerweise.
«Also können wir um so länger kuscheln. Und später schlafen.»
«Können wir versuchen», sagte ich. «Geh schon mal vor, ich komm dann auch gleich ins Bett. Muß nur noch ein paar Dinge erledigen.»
Sie trocknete sich zu Ende ab und stieg in ihr Höschen, wobei sie ihre Beine anmutig streckte. Es reichte fast, um mich zu erregen, auch nach dem, was vorher geschehen war. Fast.
Sie zog ihren Morgenmantel an, küßte mich auf die Wange und ging hinaus. Der Geruch ihres Duschgels hing in der Luft.
Ich pinkelte, duschte und putzte mir die Zähne. Ich zog meinen Morgenmantel an und ging durchs Haus, um die Schlösser der Türen zu überprüfen, die nach außen führten. Sie waren alle in Ordnung, natürlich bis auf das an der aufgebrochenen Tür. Ich überprüfte auch die Fenster, und als ich in Jordans Zimmer damit fertig war, blieb ich an seinem Bett stehen, legte ihm seinen Teddybär wieder unter die Decke und hüllte ihn fest ein. Am liebsten hätte ich einen Stuhl herangezogen und ihm beim Schlafen zugesehen, aber ich ging hinaus in die Garage, holte Draht und eine Kneifzange und bastelte eine Art Riegel an der Tür, die Freddy Russel aufgebrochen hatte.
Dann ging ich in die Küche und schenkte mir ein Glas Milch ein. Das Haus kam mir seltsam vor, als sei es nicht mehr meins. Es war keine Zufluchtsstätte mehr. Man hatte es heimgesucht. Ich fühlte mich wie das Opfer einer Vergewaltigung. Mißbraucht. Unser Haus war nicht mehr der private Raum, erfüllt von unserem Geist, unseren Gedanken, ja auch unseren Streitereien. Es war nur noch ein Gegenstand aus Glas, Holz und Steinen, das jeder beliebige Schurke mit einer Brechstange oder einem Schraubenzieher aufbrechen konnte.
Die Milch schmeckte wie Kreide und lag mir metallschwer im Magen. Ich schüttete den Rest in den Ausguß und ging ins Bett.
Ann schlief schon, und ich war dankbar dafür. Ich hatte befürchtet, sie würde auf einen Mitleidsfick bestehen: sexuelle Erste Hilfe. Manchmal reagierte sie so, und ich haßte das. Sie meinte es nur gut, aber deshalb fand ich doch keinen Gefallen daran. Heute nacht hätte es mich abgestoßen, wie sehr ich sie auch liebte oder wie verführerisch sie auch sein mochte.
Ich lag da, betrachtete die Decke und lauschte auf Anns Atem. Der Magen drehte sich mir von der Milch, und die Erinnerung an das Geschehene kreiste unaufhörlich in meinem Kopf: ein Wirbel aus Schatten und gedämpften Geräuschen, eine Taschenlampe, Revolverstahl, das Pfeifen einer Kugel an meinem Ohr, das Knallen meiner eigenen Waffe, Licht, das anging, die leere Augenhöhle, Blut und Hirn auf dem Landschaftsbild und eben der Wand, an der wir unsere jährlichen Weihnachtskarten befestigten.
Erst als das Tageslicht anbrach, war mir nach Schlafen zumute.
4
Ich hätte weiterschlafen können, aber ich tat es nicht. Ich stand auf, zog mich für die Arbeit an und ging in die Küche, um mich zu Ann und Jordan an den Tisch zu setzen.
Wie gewöhnlich spielte Jordan mit seinem Essen. Es verging kaum ein Morgen ohne eine Auseinandersetzung zwischen mir und dem Jungen oder dem Jungen und seiner Mutter. Immer hatte es damit zu tun, wie er aß oder daß er am Tisch spielte. Der Bengel konnte nicht das Haus verlassen, ohne zuvor seine Milch umgeschüttet zu haben. Es war wie ein morgendliches Ritual, das eingehalten werden mußte.
Er stellte Tausende kleiner Dinge an, die mich die Wände hinauftrieben. Ann ging es nicht anders. Jeden geschlagenen Tag hatten wir zwar unsere Freude an ihm, waren aber auch höllisch wütend auf ihn. Wir fragten uns, ob wir von einem Vierjährigen vielleicht zuviel verlangten oder ob er tatsächlich ein echter Rabauke war. Oder, schlimmer noch, ob da nicht ein Krimineller heranwuchs, gezeugt von uns, ausgeliefert unserer Ungeduld und unserem Zorn, geprägt von seinen Genen – einer, der alles angenommen hatte, was wir an uns haßten, und nichts von dem, was wir schätzten.
Außerdem hatte ich jeden Abend, wenn ich zu Bett ging, das Gefühl, daß ich nichts richtig machte, sosehr ich mich auch bemühte. Es verging kein Tag, ohne daß ich den kleinen Burschen anschrie oder auf irgendeine Weise meine Beherrschung verlor, und ganz sicher sagte ich öfter nein zu ihm als ja. Obwohl ich mich bemühte, ihm zuzuhören, wenn er beschrieb, was der Pink Panther und Woody Woodpecker und Pokey Puppy getan hatten, gab es Augenblicke, da knarzte seine kleine Stimme wie Kreide auf einer Wandtafel, und ich hatte für seine Begeisterung einfach kein Ohr mehr. Und ich wußte, daß er es genau spürte.
Und dann war da auch noch das andere Kind, das, an das ich öfter dachte, als ich je erwartet hatte. Das, das Ann achteinhalb Monate in sich getragen hatte. Dessen Bewegungen ich gefühlt hatte und das ich hatte rumoren hören, wenn ich mein Ohr auf ihren Bauch legte. Das Kind, das ihren Körper vergiftet hatte, das die Ursache dafür war, daß sie tagelang ins Krankenhaus mußte. Das schließlich den Anruf spät in der Nacht ausgelöst hatte, mit dem sie mir mitteilte: «Unser Baby ist tot.» Dann hatte sie zu weinen angefangen.
Sie gaben ihr Medikamente, um die Geburt einzuleiten, und dann präsentierten sie uns den Leichnam. Ein kleines Mädchen. Sie sagten, wenn wir sie nicht haben wollten, würden sie die Leiche zu Forschungszwecken obduzieren und dann beseitigen. Später fand ich heraus, daß sie sie uns in einem schwarzen Müllbeutel überreicht hätten, wenn wir sie hätten haben wollen.
Manchmal dachte ich, wir hätten sie uns wenigstens ansehen sollen. Ihr vielleicht einen Namen geben sollen und sie beerdigen lassen. Dann wieder hatte ich das Gefühl, wir hatten das Richtige getan. Aber richtig oder falsch – das Gesicht des Kindes, das ich niemals gesehen hatte, tauchte in meinen Träumen auf: ein kaltes, graues Gesicht mit geöffneten Augen, und die Augen waren wie die von Ann, hell, hellgrün. Und dann wachte ich auf. Schweißgebadet.
Manchmal fuhr ich am Krankenhaus vorbei und sah dunkle Wolken darüber hängen, Wolken, die Regen zu bergen schienen. Aber ich wußte, daß es Rauch war von den schwarzen Verbrennungsöfen draußen; Verbrennungsöfen, in denen Nachgeburten und die Überreste von Laborversuchen beseitigt wurden. Und ich fragte mich, ob mein namenloses Kind nach der Autopsie dort gelandet war. Nichts als verdorbenes Fleisch in einem schwarzen Müllsack, zur Unkenntlichkeit verbrannt, zu Ruß geworden, der sich festsetzte am Krankenhausdach und seinen Außenwänden.
Wenn ich von diesen Dingen träumte oder an sie dachte, kam mir immer auch Jordan in den Sinn, und ich fragte mich, wie er wohl mit meinen Unzulänglichkeiten als Vater zurechtkam. In solchen Augenblicken kam ich mir vor wie ein schlechter Schauspieler, verkleidet als Elternteil in einer Schulaufführung.
Ich nahm mir vor, mich an diesem Morgen von nichts irritieren zu lassen, was er tat. Es war das millionste Mal, daß ich diesen Vorsatz faßte. Jedesmal war es mir mißlungen, ihn einzuhalten, aber wie bei einer Art Zen-Übung meinte ich, daß stetige Wiederholung es mir schließlich erleichtern würde. Und nach dem, was in der letzten Nacht geschehen war, sah ich die Welt in einem gänzlich neuen Licht und war verletzlicher geworden. Es war einfach schön, den Jungen da vor seinen Frühstücksflocken sitzen zu sehen, und wie immer erfüllte mich ein geheimer Stolz, wenn ich meine Züge in seinem kleinen Gesicht wiedererkannte. Seine Haare waren blond wie die seiner Mutter, aber die mandelförmigen Augen, die ausgeprägten Lippen und die Kerbe in seinem Kinn hatte er von mir.
Als ich ihn jetzt betrachtete, hoffte ich, daß ich in seinem Leben eine wichtigere Rolle spielte, als mein Vater es in meinem getan hatte, und ich hoffte, daß ich ihn nicht so plagen würde, wie mein Vater mich plagte. Daß er, wenn alles gesagt und getan war, mehr von mir haben würde als einige vage Erinnerungen und daß mehr zwischen uns sein würde als Weihnachtskarten aus fernen Städten, unterschrieben mit der Floskel «In Liebe».
Ich lehnte mich vor, küßte und umarmte den Jungen. «Guten Morgen, mein Großer.»
«Was war das für ein Radau letzte Nacht, Daddy?» «Radau» war sein neues Wort. Er benutzte es bei jeder Gelegenheit.
«Ein paar Leute waren zu Besuch.»
«Warum?»
«Wir brauchten sie.»
«Warum?»
«Für ein paar Sachen.»
«Was für Sachen?»
«Nichts Besonderes. Schmeckt dir dein Frühstück?»
«Ja.»
Es war irgend so ein chemisch behandeltes buntes Zeug voll Zucker und Luft. Ich machte mir höllische Vorwürfe, daß ich ihn so was essen ließ, aber seiner Mutter schmeckte es auch. Und dann war da diese verdammte Fernsehwerbung, die alle möglichen Spielsachen als Dreingabe anpries. Davon wurde er geködert, und wie so viele Eltern hatte auch ich meine schwachen Momente. Aber hier und jetzt beschloß ich, daß wir nach dem nächsten Einkauf mit Haferflocken und Granola heimkehren würden, mit Eiern und Speck und mit jeder Menge Obst. Empfehlungen von Richard Dane, Teilzeitmörder, Vollzeitvater.
«Kosten?» fragte Jordan.
Ich tauchte meinen Löffel in den Matsch und füllte ihn mit einem Haufen grellbunter Tierfiguren. Es schmeckte beschissen.
«Siehste», sagte Jordan. «Schmeckt gut. Man kriegt ein Fisbie für den Deckel von ’ner Packung.»
«Tatsächlich?»
«Mhm.»
«Iß das Zeugs auf, dann schicken wir den Deckel ein. Vielleicht kannst du ja mit Haferflocken anfangen, wenn es alle ist. Das wär doch mal was zur Abwechslung. Haferflocken.»
«Mag keine Haferflocken.»
«Eier. Vielleicht Würstchen.»
«Mag ich auch nich. Will nur die bunten Tiere.»
Ich nickte. Ich wollte mich nicht streiten, sondern war dankbar, daß ich ihn von dem Polizeibesuch abgelenkt hatte. Noch dankbarer war ich, daß er letzte Nacht nicht aufgewacht war und den toten Mann auf der Couch gesehen hatte.
«Gehst du zur Arbeit?» fragte Ann.
Sie konnte sehen, daß ich rasiert und für die Arbeit angezogen war, aber sie wollte mir Gelegenheit geben, zu Hause zu bleiben. Dieser Gedanke behagte mir jedoch nicht. Den ganzen Tag daheim zu bleiben, während sie fort war und Jordan sich in der Vorschule befand, würde mich nur veranlassen, die letzte Nacht in Gedanken immer wieder Revue passieren zu lassen. Wenn ich die Couch sah oder den hellen Fleck an der Wand, wo sich das Bild befunden hatte, würde es mich wieder überfallen.
«Klar gehe ich.»
«Ist dir danach?»
«Ziemlich. Ist besser, als hierzubleiben.»
«Konntest du schlafen?»
«Ein bißchen.»
«Tut mir leid, daß ich schon schlief, als du ins Bett kamst.»
«Schon gut. Ich war sowieso zu müde.»
«Deswegen geht man ja ins Bett, Daddy, weil man müde ist», sagte Jordan.
Ich lächelte ihn an. «Da hast du recht. Das hätte ich wissen müssen.»
«Ich weiß alles», sagte er.
Ich zwinkerte Ann zu.
«Was machst du mit deinem Auge, Daddy?»
«Ist was drin.»
«Geht’s raus?»
«Glaub schon.»
Jordan wandte sich wieder seinem Frühstück zu, und ich stellte fest, daß ich wirklich etwas in den Augen hatte.
Tränen.
Ich entschuldigte mich, bevor sie etwas merkten, ging ins Badezimmer, wusch mir das Gesicht und starrte in den Spiegel. Ich dachte, daß eigentlich ein anderes Gesicht zurückblicken müßte, aber es war derselbe Kerl, den ich jeden Tag darin sah. Einen Mann getötet zu haben hatte mein Äußeres nicht im geringsten verändert. Ich wirkte noch immer wie ein ziemlich gesunder, nicht allzu schlecht aussehender 35jähriger Mann mit angehender Glatze.
Jordan erschien in der Tür.
«Muß mal ganz doll.»
«Komm rein.»
«Du mußt raus.»
Ich tätschelte ihm den Kopf, ging hinaus und schloß die Tür. Ich fühlte wieder die Tränen aufsteigen. Gottverdammt, ich war doch noch nie so weinerlich gewesen. Aber dann wurde mir schlagartig klar, was es mit den Tränen auf sich hatte. Es ging nicht nur darum, daß ich einen Mann getötet hatte. Es ging darum, daß mir plötzlich Jordans Sterblichkeit bewußt wurde. Meine eigene hatte ich vor geraumer Zeit akzeptiert, seine jedoch nicht. Nach dem Verlust des ersten Kindes glaubte ich, meinen Tribut gezollt zu haben. Aber jetzt wußte ich, daß das lächerlich war. Es gibt nicht so was wie Tribut. Nichts ist garantiert.
Ich überlegte, was wohl geschehen wäre, wenn Ann den Lärm nicht gehört und mich alarmiert hätte. Was, wenn Jordan das Geräusch gehört hätte, aufgestanden wäre, um nachzuschauen, und in seinem Superman-Pyjama, den Teddybär unterm Arm, ins Wohnzimmer marschiert wäre?
Eine gräßliche Szene spielte sich in meiner Vorstellung ab: Der Einbrecher hört Jordan, dreht sich um, zieht den Revolver, schießt, ohne nachzudenken, und auf der Brust meines Sohnes geht plötzlich eine rote Blüte auf ...
Ich hörte die Toilettenspülung rauschen, ging in unser Schlafzimmer und schloß die Tür. Ich setzte mich auf die Bettkante und hoffte, daß Jordan nicht hereinkäme. Ich versuchte, alle Gedanken an Sterblichkeit aus meinem Kopf zu verbannen, an die Sterblichkeit meiner Familie und an meine eigene. Ich saß einige Minuten lang da, bis die Illusion von Dauerhaftigkeit und absolutem Glück wieder stark genug wurde, um der Realität standzuhalten, und mein inneres Auge blind genug war, nicht zu erkennen, daß sie sich auflöste wie Nebel im Sonnenschein.
5
Nachdem Ann zur Arbeit gegangen war, ließ ich Jordan ein paar Minuten lang einen Zeichentrickfilm sehen und fuhr ihn dann in die Vorschule der Baptistenkirche, bevor ich mich selbst auf den Weg zur Arbeit machte.
Ich parkte hinter meinem Rahmengeschäft und stieg aus. Es war erst halb neun, und die Luft war schon stickig. Der Juli in Ost-Texas ist so. Die Bäume halten die Hitze und lassen dich darin schmoren. Manchmal ist es so schlimm, daß die Luftfeuchtigkeit ihr eigenes Gewicht zu haben scheint, und durch sie zu gehen ist, als versuche man, durch Gelantine zu waten.
Ich stand neben meinem Wagen und atmete die warme Kleinstadtluft. Trotz der Hitze war ich in Augenblicken wie diesem froh, in einer Stadt von vierzigtausend Einwohnern (einschließlich zeitweise zehntausend College-Studenten) und nicht an einem Ort wie Houston zu wohnen. Ann und ich hatten gleich nach unserer Hochzeit eine kurze Zeit dort gelebt. Es war häßlich, hektisch und deprimierend. Und es gab die vielen Verbrechen.
Verbrechen. Ein Witz. Auch eine kleine Stadt wie LaBorde war nicht frei davon. Man frage nur mich, den Einbrecherkiller.
Ich nahm meinen Schlüssel, ging zur Hintertür hinein und machte Kaffee. Um Viertel vor neun tauchten meine Angestellten auf. Valerie und James.
Valerie ist eine gescheite, attraktive Frau und eine gute Rahmenbauerin, wenn auch ein wenig ungeduldig mit den Kunden. James hingegen ist als Rahmenbauer nur so lala, aber ein Meister darin, zu ahnen, was der Kunde wirklich will. Was Valerie jedoch will, hat er noch nicht herausgefunden. Sie zeigt ihm die kalte Schulter. Er verbringt eine Menge Zeit damit, auf ihren Hintern zu starren, so wie ein Bergsteiger hypnotisiert auf einen reizvollen, aber unerreichbaren Gipfel blickt.
Ich hoffte, daß heute eine Menge Arbeit auf mich zukam, damit ich beschäftigt war und vielleicht nicht allzuviel reden mußte. Ich wußte, wenn ich länger über etwas reden würde, käme ich auch auf die vergangene Nacht zu sprechen, und das wollte ich nicht. Die Kunde würde sich auch ohne mein Zutun schnell genug verbreiten. Es waren zwar letzte Nacht keine Reporter aufgetaucht, aber das Ereignis würde mit Sicherheit in der Zeitung erwähnt werden, wenn auch nur als Kurzreport in der Verbrechensrubrik der «LaBorde Daily», die einer richtigen Zeitung ungefähr so ähnelt wie ein Gartenschlauch einer Schlange.
Während Valerie und James sich Kaffee einschenkten, ging ich nach vorn, drehte das «Geschlossen»-Schild auf «Geöffnet» und schloß die Tür auf.
Während ihrer High-School-Pause gegen neun Uhr dreißig rief Ann an.
«Augenblick mal», sagte ich. Ich warf einen Blick auf Valerie und James im hinteren Bereich des Ladens. Valerie arbeitete an einem Rahmen. Sie beugte sich über den Tisch und bot James eine nette Aussicht auf ihren prallen Po. Das rote Kleid, das sie trug, war straff gespannt wie ein Bongo-Fell. James gestikulierte wild und fütterte sie mit Sprüchen, wobei er seine Zähne blitzen ließ und an einer Zigarette paffte. «Da bin ich wieder», sagte ich.
«Alles klar mit dir?» fragte Ann.
«Ich bin nicht gerade in Festtagsstimmung. Aber ja, ich denke, ich bin in Ordnung. Wie steht’s mit dir?»
«Ich nehme mir die nächste Stunde frei, um zur Polizei zu gehen und meine Aussage zu machen. Richard, es ist in der ganzen Schule rum. Ich weiß nicht, wieso, aber es ist so. Ein paar von den Lehrern haben mich danach gefragt. Ich hab versucht, mit ihnen zu reden, aber ich konnte mich nicht besonders gut verständlich machen. Sogar einige von den Kindern haben gefragt.»
«Scheiße. Vielleicht solltest du nach Hause gehen.»
«Muß mich irgendwann damit auseinandersetzen, und ich schätze, das kann ich genausogut gleich tun ... Bist du sicher, daß du okay bist?»
«Alles klar», log ich.
«Gut denn. Ich muß Schluß machen, Baby. Liebe dich.»
«Ich dich auch.»
Gegen halb elf tauchte Jack Crow, der Postbote, auf. Er kam aus der Julihitze herein, die an ihm zu kleben schien. Sie war wie der warme Atem eines Hundes und hing volle fünfzehn Sekunden in der Tür.
Jack ist einer von diesen Typen, die meinen, daß ihre Körpergröße, ihr zerfurchtes Gesicht und ihre Abneigung gegenüber Intellektuellen sie zu echten Männern machen. Er kann nicht einfach nur die Post abgeben und hallo sagen, sondern er muß jeden Morgen ein paar Minuten damit verbringen, Valerie gegenüber anzügliche Bemerkungen darüber zu machen, wie sehr er auf Rothaarige steht und daß sie klasse aussieht – all der Schmonzes, den Männer wie Jack für charmant halten. Gern redet er auch übers Jagen und Fischen oder über seine Kriegserlebnisse. Wenn man ihn reden hört, dann hat Hemingway nur Flußbarsche geangelt, und Audie Murphy war ein Zinnsoldat. Er hingegen ist der wahre Held.
«Mann, die Klimaanlage tut gut», sagte er. «Angenehmen Job habt ihr hier, Leute. Aber ich will euch was sagen, tauschen würde ich nicht. Meiner hält mich in Form.» Er klatschte sich auf den Bauch. «’türlich», sagte er und sah Valerie an, «sind Sie auch gut in Form.»
«Fertiggerichte vor der Glotze», sagte sie.
Er lachte. Es klang, als könne er daran ersticken. Das ließ hoffen.
Er kam zum Ladentisch, lehnte sich darauf und sah mir direkt in die Augen, als seien wir heimliche Verbündete. Dann sagte er laut: «Wie ich höre, haben Sie letzte Nacht einen fertiggemacht.»
Mir rutschte der Magen zwischen die Knie. Ich wußte, daß es geschehen würde, aber die Tatsache, daß die erste Person, die damit kam, Macho Jack war, erschien mir wie eine grausame und unnötige Strafe. Ich wußte nicht, was ich erwidern sollte, und daher sagte ich nichts. Jack führte sowieso das Wort.
«Mack bei der Zeitung drüben hat’s mir erzählt. Sagte, Sie haben dem Hundesohn direkt eins ins Auge verpaßt, ihn sauber abgemurkst. War’s ein Nigger? Oder ’n Mex?»
Valerie und James hörten zu arbeiten auf und kamen an den Tisch.
«Worum geht’s hier eigentlich?» fragte James.
«Dick hat sich letzte Nacht einen vorgenommen», sagte Jack.
Erstens einmal haßte ich es, Dick genannt zu werden. Das ist ein Ausdruck für das männliche Geschlechtsteil, und dann könnte man mich auch gleich Prick, nämlich Schwanz, nennen. Und schon gar nicht wollte ich von Jack so genannt werden.
«Er hat dem Bastard glatt durch den Kopf geschossen», sagte Jack, ohne meine Antwort abzuwarten. «Seinen Arsch kaltgemacht.»
«Das reicht», sagte ich.
«Kein Grund zur Bescheidenheit, Dicky.» Dicky? «Verdammt, ich wäre stolz. Der Hundesohn, der in mein Haus einbricht, kann sich seine Zähne aus dem Arschloch klauben. Ich hab eine Pump Gun Kaliber 12 unterm Bett, und wenn –»
«Hören Sie auf, Jack», sagte ich. «Schluß damit.»
«Braucht man sich doch nicht zu schämen», sagte Jack. «Wenn ich das wäre –»
«Sie waren es aber nicht. Ich war’s. Ich schäme mich nicht deswegen, ich bin aber auch nicht stolz darauf. Wenn Sie Post für mich haben, lassen Sie sie da. Wenn nicht, verschwinden Sie.»
Jacks Gesicht wurde rot, und er verzog den Mund. «Sie legen so ein Arschloch um, und schon riskieren Sie ’ne große Lippe. Scheiße, halten sich wohl für Clint Eastwood.»
«Gehen Sie jetzt», sagte ich.
«Schon gut, Cowboy.» Jack griff in seine Tasche und warf eine Handvoll Briefe auf den Tisch. Sie rutschten von der Kante und fielen zu Boden. «Viel Spaß bei Ihrer beschissenen Post, Dicky.»
Er warf mir einen grimmigen Abschiedsblick zu und stampfte hinaus. Er ließ die Tür lange genug offen, um einen Schwall Julihitze hineinzulassen. «Hoffentlich bricht Ihre beschissene Klimaanlage zusammen», sagte er.
«Und ich hoffe, ein räudiger Hund beißt Ihnen die Eier ab», sagte Valerie.
James und ich drehten uns abrupt zu ihr. Valerie?
Jack stand in der Tür, total geschockt. «Das ist nicht sehr damenhaft», rang er sich ab.
«Sie sagen es», erwiderte Valerie.
Jack schluckte, ließ die Tür los und ging davon. Er sah durch das Schaufenster noch einmal zurück, bevor er außer Sicht war, und Valerie zeigte ihm den Finger.
Valerie sah uns an und wurde noch röter als ihr Kleid. «Na ja», sagte sie, «ich mag ihn eben nicht.»
6
Ich erzählte James und Valerie die ganze Geschichte, und sie reagierten sehr vernünftig. Sie fragten nicht sensationsgierig nach Details. Ich überließ ihnen schließlich den Laden und fuhr zu «Kelly’s». Ich wollte einfach eine Zeitlang nicht mehr darüber reden und auch nicht mit Leuten zusammensein, die davon wußten. Ich brauchte meinen Freiraum, wie man so schön in Kalifornien sagt. Oder wie es in Texas heißt: Ihr könnt mich alle mal ...
Auf meinem Weg dorthin überholte ich Jack. Er drehte noch immer seine Runden und lief gesenkten Kopfes und wütenden Schritts auf dem Bürgersteig. Ich dachte daran, wie Valerie ihn abgefertigt hatte, und beinahe hätte ich gehupt, um ihn daran zu erinnern. Doch ich verzichtete darauf. Mir war nach solchen Scherzen im Moment nicht zumute.
«Kelly’s» ist ein altmodisches Restaurant auf der Westseite der Stadt. Ich esse oft dort. Mir gefällt es, weil es mich an meine High-School-Tage erinnert. Ich bin eigentlich nicht der Typ, der in der Vergangenheit lebt, aber manchmal denke ich ganz gern an sie zurück. Ich pflegte Mädchen zu «Kelly’s» auszuführen, und wir tranken dort Malzbier und aßen Hamburger. Damals gehörte es tatsächlich einem Mann namens Kelly. Aber das war schon ein paar Jährchen her. Er lag jetzt auf dem Friedhof von LaBorde und erfreute sich an den Plastikblumen auf seinem Grab.
Ich konnte nicht bei «Kelly’s» einkehren, ohne an Stud Franklin zu denken, der eines Samstags dort aufgetaucht war und sich mit einer 22er Pistole durch den Kopf geschossen hatte. Ich hatte es nicht miterlebt, aber von vielen, die dabeigewesen waren, gehört. Er kam einfach rein und sagte: «Scheiß auf ihn und auch auf sein Schwein.» Dann setzte er sich die Pistole an den Kopf. Er war wütend, weil er bei einem landwirtschaftlichen Wettbewerb nicht gewonnen hatte. Er hatte speziell dafür ein Schwein aufgezogen, ein ganzes Jahr in dies Schwein investiert, Spezialfutter gekauft und Medikamente. Er wurde von einem Hinterwäldler aus dem Rennen geworfen, der sein Schwein mit altem Brot und Kuchen gemästet und ihm Kautabak verabreicht hatte, um die Würmer zu killen. Später fand man Studs Schwein aufgehängt in dem Edelkoben aus Beton, den er extra gebaut hatte. Keiner traute dem Schwein Selbstmord zu. Bis dahin hatte Stud ganz gesund gewirkt.
Und dann war da die Nische ganz hinten, wo ein Riß im Ledersitz über die Jahre wieder und wieder notdürftig mit Klebeband geflickt worden war. Hier hatte meine erste Romanze ihr Ende gefunden. Ich hatte Kathy Counsel meine Hand aufs Knie gelegt und versucht, sie unter dem Kleid weiter nach oben zu schieben, um den Haupttreffer zu landen. Sie hatte mir eine gelangt, und der Knall dieser Backpfeife hallte durch den Laden wie ein Kanonenschuß. Ich machte mich unter ihrem Gezeter und dem Gelächter der anderen Kids davon. Einen Monat lang ließ ich mich nicht mehr dort blicken. Kathy Counsel wurde ungefähr sechs Monate später von unserem Star-Quarterback Herschel Roman angebufft. Sie mußten die Schule verlassen, und Herschel warf seinen letzten Ball. Danach zapfte er dann Benzin an der Fina-Tankstelle auf der Main Street. Das macht er heute noch. Inzwischen gehört ihm der Laden, und er sieht sich eine Menge Football-Spiele auf dem Fernseher neben dem Coke-Automaten an. Kathy ist fett geworden und hat ein bitterböses Mundwerk. Ihr Sprößling spielt Football, ist darin ein Versager und haßt es, wie man hört. Gelegentlich verspüre ich das Bedürfnis, Kathy anzurufen und mich für die Backpfeife zu bedanken.
Auf dem Hinterhof von «Kelly’s» hatte ich meine einzigen beiden Raufereien ausgetragen. Beide verlor ich. Ich konnte mich nicht einmal mehr darin erinnern, worum es eigentlich gegangen war. Jedenfalls war mein Gegner Jerry Quail gewesen, mein bester Freund aus der High-School. Er wurde nach dem Schulabschluß eingezogen, weil er fürs College nicht geeignet war. Zum Kampfeinsatz in Vietnam kam er nie. Eine Woche, bevor er rüber sollte, fiel er bei einer Übung aus dem Hubschrauber und kam ums Leben. Ich ging zur Beerdigung.
Ich setzte mich in keine der Nischen, sondern nahm an der Theke Platz. Kay kam herüber. Sie war zu dieser Tageszeit die einzige Kellnerin, und ich mochte sie. Sie war hübsch auf ihre blondierte und übertrieben geschminkte Weise, und ich konnte nicht anders – glücklich verheiratet oder nicht: Mir gefiel die Art, wie ihre Hüften unter dem gestärkten weißen Kittel schwangen. Sie hatte das gewisse Etwas, das auch Valerie besaß: eine Eigenschaft, von der Frauen – und ebenso auch Männer – wünschten, man könne sie in Flaschen abgefüllt kaufen.
Ich lächelte, so gut ich konnte, und bestellte Kaffee. Sie schenkte mir ein und sagte: «Ich hab gehört, was passiert ist.»
«Mein Gott», sagte ich, «die Leute in dieser verdammten Stadt können anscheinend alle Gedanken lesen.»
«Sie haben nur große Mäuler», sagte sie. «Jedenfalls tut es mir leid. Ist bestimmt ziemlich hart.»
«Besser hätten Sie es nicht sagen können, Kay. Danke.»
Sie lächelte, und ich ging zu einer der Nischen. Ich saß da, lehnte den Kopf gegen das alte rote Lederpolster und schloß die Augen. Sofort überfiel mich die Erinnerung an letzte Nacht.
Ich öffnete die Augen und trank die Hälfte meines Kaffees in einem Schluck. Er war bitter. Ich bestellte bei Kay eine Coke. Ich nippte daran. Sie war auch nicht besser.
«Darf ich mal das Telefon benutzen?»
Kay stand hinter der Theke und wischte einen Wasserfleck weg. «Bedienen Sie sich. Sie wissen ja, wo es ist.»
Ich ging durch die hintere Tür in den Lagerraum. Der Apparat stand auf einem Telefonbuch im Regal neben Tomatenkonserven. Die waren wohl für das Chili, das auf der Speisekarte stand. Es schmeckte gut, war aber höllisch scharf.
Ich stützte mich auf das Regal und schlug im Telefonbuch eine Nummer nach. Sie stand groß auf der ersten Seite. Ich wählte.
«LaBorde Polizeidienststelle.»
«Ich möchte mit Lieutenant Price sprechen.»
«Einen Augenblick.»
Als Price an den Apparat kam, sagte ich: «Hier ist Dane. Ich wollte nur fragen, was mit Russels Leiche geschehen ist.»
«Die Beerdigung ist übermorgen. Eigentlich hätte sie heute sein sollen, aber man hat eine Autopsie gemacht.»
«Warum?»
«Reine Routinesache. Warum fragen Sie danach?»
«Dieser Russel, hat der außer seinem Alten noch Familie?»
«Ich glaube nicht. Jedenfalls nicht, daß wir wüßten. Der Bezirk trägt die Kosten. Wir nennen das Armenbegräbnis.»
«Wo wird er denn beerdigt?»
«Greenley’s Friedhof. Sie wollen doch nicht etwa dabeisein?»
«Ich hab daran gedacht.»
«Schuldgefühle?»
«So was Ähnliches.»
«Ich weiß, wie Sie sich fühlen, aber Sie verrennen sich da. Sie müssen die Tatsache akzeptieren, daß Sie ihn in Notwehr getötet haben. Er ist in Ihr Haus eingebrochen.»
«Ist mir nur so in den Sinn gekommen. Irgendwie ist es doch nicht richtig, daß er beerdigt wird, ohne daß jemand dabei ist.»
«Meinen Sie, seine Seele ist fröhlicher, wenn Sie am Grab stehen? Der Mann, der ihn getötet hat?»
Ich war einen Augenblick still. Als Price wieder sprach, klang seine Stimme eiskalt. «Hören Sie, ich will nicht, daß Sie sich beschissen fühlen. Okay? Ich will nur sagen, es hat keinen Sinn. Ich möchte bezweifeln, daß er bei Ihrer Beerdigung aufgetaucht wäre, wenn er Sie umgebracht hätte.»
«Darum geht es nicht –»
«Vielleicht doch. Es ist das beste, Sie vergessen es. Sie müssen Ihr Leben weiterleben. Die Leute werden darüber reden, und Sie werden es sich anhören müssen. Es wird eine Weile hart sein. Aber das geht vorüber.»
«Um welche Zeit ist die Beerdigung?»
«Sie sind hartnäckig, was?»
«Seien Sie einfach nett zu mir, Price. Ich weiß nicht, was ich tun werde, aber ich würde mich wohler fühlen, wenn ich Bescheid wüßte. Also wann übermorgen?»
Price seufzte. «Halb zwei. Aber, Dane, tun Sie sich selbst einen Gefallen. Bleiben Sie weg.»
Ich legte auf und rief dann einen guten Freund an, der Maler ist. Zähneknirschend erzählte ich ihm, was geschehen war. Ich versuchte, es einfach und klar darzustellen.
«Mein Gott, Richard, das tut mir leid.»
«Nicht nötig», sagte ich. «Es ist nun mal passiert. Also hör mal, ich möchte, daß du mir mein Wohnzimmer streichst. Es ist zwar kein Blut mehr an der Wand, aber in einem frisch gestrichenen Zimmer würde ich mich einfach besser fühlen.»
«Verstehe ich. Ich trommel meine Jungs zusammen, und mittags sind wir bei dir.»
«Danke, Ted. Und ich rufe einen Schlosser und ein Möbelgeschäft an. Wenn du vor ihnen dort bist, laß sie rein. Du kommst am besten ins Haus, wenn du eine Kneifzange mitnimmst, hinten herum gehst und den Drahtriegel aufkneifst, den ich letzte Nacht gebastelt habe.»
«Kein Problem», sagte Ted.
«Danke.»
Danach suchte ich mir aus dem Telefonbuch die Nummer eines Möbelgeschäfts heraus.