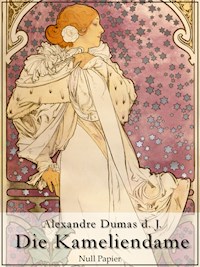
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Klassiker bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Die tragisch-bittere »Kameliendame« ist ein Roman des französischen Autors Alexandre Dumas d. J., der lange Zeit im Schatten seines Übervaters stand, sich aber mit dieser Großen Leidenden der Literaturgeschichte freischreiben konnte. »Die Kameliendame« erschien 1848 und wurde zu einem der größten Erfolge der französischen Literatur. Die Pariser Halbwelt im 19. Jahrhundert: Erzählt wird das tragische Schicksal des »leichten Mädchens« Marguerite Gautier, dieses, obschon natürlich gesellschaftlich geächtet, geht eine unerwünschte Liaison mit einem Jüngling aus besserem Hause ein. Marguerite, hin- und hergerissen zwischen ihrer Liebe und ihrer Plicht, ihrem Geliebten sozial nicht zu schaden, trifft eine folgenschwere Entscheidung. Das Buch ist wundervoll leichtfüßig, ja amüsant geschrieben, wenn man von der Katastrophe absehen kann, die sich nicht aufhalten lässt, egal wie oft man von Neuem beginnt zu lesen. Beflügelt durch den großen Erfolg arbeitete Dumas den Stoff zu einem Bühnenstück um. Die legendäre Schauspielerin Sarah Bernhardt brillierte in der Rolle des »gefallenen Mädchens«. Bekannt ist auch die Verfilmung von 1936, in der Greta Garbo die Titelrolle gab. Musikalisch wurde die Kameliendame ebenso ein Erfolg: Giuseppe Verdi vertonte das Drama 1853 in »La Traviata« als eine der ersten realistischen Opern seiner Zeit. ›Höre, lieber Armand,‹ sagte Margarete zu mir, ›wir Geschöpfe des Zufalles haben phantastische Wünsche und unbegreifliche Liebeslaunen. Wir gewähren dem einen, was wir dem andern versagen. Manche opfern ihr ganzes Vermögen, ohne etwas von uns zu erlangen; andere hingegen gewinnen uns mit einem Blumenstrauß. Unser Herz hat keine andere Zerstreuung und keine andere Entschuldigung, als seine Launen. Du hast mich schneller für Dich gewonnen, als dies je einem Manne gelungen ist, das schwöre ich Dir; warum? Null Papier Verlag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 334
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Alexandre Dumas d. J.
Die Kameliendame
Alexandre Dumas d. J.
Die Kameliendame
(La dame aux camélias)Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] EV: A. Hartleben's Verlag, Wien und Leipzig, 1913 3. Auflage, ISBN 978-3-954184-56-9
null-papier.de/katalog
Inhaltsverzeichnis
Zum Buch
Erste Abteilung
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
Zweite Abteilung
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Klassiker bei Null Papier
Alice im Wunderland
Anna Karenina
Der Graf von Monte Christo
Die Schatzinsel
Ivanhoe
Oliver Twist oder Der Weg eines Fürsorgezöglings
Robinson Crusoe
Das Gotteslehen
Meisternovellen
Eine Weihnachtsgeschichte
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Zum Buch
Die tragisch-bittere »Kameliendame« ist ein Roman des französischen Autors Alexandre Dumas d. J., der lange Zeit im Schatten seines Übervaters stand, sich aber mit dieser Großen Leidenden der Literaturgeschichte freischreiben konnte.
»Die Kameliendame« erschien 1848 und wurde zu einem der größten Erfolge der französischen Literatur.
Die Pariser Halbwelt im 19. Jahrhundert: Erzählt wird das tragische Schicksal des »leichten Mädchens« Marguerite Gautier, dieses, obschon natürlich gesellschaftlich geächtet, geht eine unerwünschte Liaison mit einem Jüngling aus besserem Hause ein. Marguerite, hin- und hergerissen zwischen ihrer Liebe und ihrer Plicht, ihrem Geliebten sozial nicht zu schaden, trifft eine folgenschwere Entscheidung.
Das Buch ist wundervoll leichtfüßig, ja amüsant geschrieben, wenn man von der Katastrophe absehen kann, die sich nicht aufhalten lässt, egal wie oft man von Neuem beginnt zu lesen.
Beflügelt durch den großen Erfolg arbeitete Dumas den Stoff zu einem Bühnenstück um. Die legendäre Schauspielerin Sarah Bernhardt brillierte in der Rolle des »gefallenen Mädchens«. Bekannt ist auch die Verfilmung von 1936, in der Greta Garbo die Titelrolle gab. Musikalisch wurde die Kameliendame ebenso ein Erfolg: Giuseppe Verdi vertonte das Drama 1853 in »La Traviata« als eine der ersten realistischen Opern seiner Zeit.
Erste Abteilung
I.
Ich bin der Meinung, dass man erst nach langer Beobachtung der Menschen imstande ist, Charaktere zu schaffen, gleichwie man erst durch anhaltendes Studium befähigt wird, eine Sprache zu sprechen.
Ich habe noch nicht das Alter erreicht, wo man erfindet, und begnüge mich daher mit dem Erzählen von Tatsachen.
Die folgende Geschichte ist durchaus wahr, ich habe nur die Namen der daran teilnehmenden Personen verändert, denn alle, mit Ausnahme der Heldin dieser Erzählung, leben noch.
Überdies gibt es zu Paris Personen, welche Zeugen der hier gesammelten Tatsachen waren und dieselben bestätigen könnten, wenn mein Zeugnis nicht genügte; ich allein aber wurde durch besondere Verhältnisse in den Stand gesetzt, diese Geschichte zu schreiben, denn ich allein wurde mit allen Einzelheiten so vertraut, um eine genaue, verständliche und vollständige Erzählung geben zu können.
Diese Einzelheiten kamen auf folgende Art zu meiner Kenntnis. Am 12. März 1843 las ich in der Rue Lafitte einen großen gelben Anschlagzettel, welcher die Anzeige eines Verkaufes von Möbeln und Luxusartikeln enthielt. Dieser Verkauf sollte »infolge eines Todesfalls« stattfinden. Die verstorbene Person wurde nicht genannt, aber die Versteigerung des Nachlasses sollte am 16. in der Rue d’Antin von zwölf bis fünf Uhr nachmittags stattfinden.
Am 13. und 14., hieß es auf dem Anschlagzettel, könne man die Wohnung besuchen, in der sich die Möbel, Gemälde und alle zu versteigernden Gegenstände befanden.
Ich war stets ein Liebhaber von merkwürdigen Stücken, ich nahm mir also vor, diese Gelegenheit zu benützen, um dieselben zu sehen und vielleicht etwas davon zu kaufen.
Am folgenden Tage begab ich mich in das bezeichnete Haus der Rue d’Antin. Am Haustor sah ich zwei noch größere Anschlagzettel, welche über die bevorstehende Versteigerung noch genauere Auskunft gaben, als jener, den ich in der Rue Lafitte gesehen hatte. Der Hausmeister sagte mir auf meine Anfrage, dass die zu verkaufenden Gegenstände im ersten Stock zu sehen wären und dass die Wohnung offen sei.
Es war noch früh, und dennoch waren schon Besucher und sogar Besucherinnen da, welche, obgleich in Samt gekleidet und in Kaschmirs gehüllt, den vor ihren Augen ausgebreiteten Luxus dennoch mit Bewunderung betrachteten.
In der Folge begriff ich diese Verwunderung und dieses Erstaunen, denn bei genauer Beobachtung dieses Luxus, der nicht immer von völlig tadellosem Geschmack war, erriet ich bald, wer diese Gemächer bewohnt haben müsse. Überdies erkannte ich in den drei oder vier Besucherinnen, deren elegante Coupés1 vor dem Hause hielten, galante Damen, die in der großen Welt ziemliches Aufsehen machten; ich wusste mir daher ihr Erstaunen und Lächeln zu erklären, so oft ihnen ein Gegenstand von großem Werte vorkam.
Kurz, es unterlag keinem Zweifel, dass ich in der Wohnung einer durch ihren Luxus bekannten femme entretenue war. Wenn es etwas gibt, was galante Frauen zu sehen wünschen, so sind es die Wohnungen jener Rivalinnen, deren Equipagen täglich an ihren eigenen vorüberrollen, die, gleich ihnen, Logen in der Oper und im italienischen Theater haben, und ihre Schönheit, ihre Brillanten und Skandale ohne Erröten zur Schau tragen.
Die Bewohnerin der Prunkgemächer, in denen ich mich befand, war tot; es konnten daher die tugendhaftesten Frauen bis in ihr Zimmer dringen. Der Tod hatte diese glänzende Kloake gereinigt, und überdies konnten sich diese Damen – wenn sie wirklich einer Entschuldigung bedürften – damit entschuldigen, dass sie zu einer öffentlichen Versteigerung kamen, ohne zu wissen, wem die Sachen gehört hatten. Sie hatten die Anschlagzettel gelesen, sie wollten sehen, was in dem Verzeichnisse aufgeführt war; dabei aber konnten sie mitten unter allen diesen Wunderdingen ungehindert die Spuren jenes koketten Lebens aufsuchen, von dem sie ohne Zweifel gar seltsame Dinge gehört hatten.
Unglücklicherweise waren diese Geheimnisse mit der Göttin zu Grabe gegangen und viele Damen vermochten mit dem besten Willen nur zu erforschen, was nach dem Ableben der schönen Sünderin zu verkaufen war, aber nichts von dem, was bei Lebzeiten der letzteren feil gewesen war.
Es gab übrigens gar viel zu kaufen. Der mit Korduanleder tapezierte Speisesaal hatte zwei prächtige Schränke aus der Zeit Heinrich des Vierten, in denen silbernes und vergoldetes Tafelzeug glänzte. Große, gestickte Vorhänge verschleierten die Fenster und Sessel von dem gleichen Stoff umgaben einen kunstvoll geschnitzten Tisch von Eichenholz.
In dem mit großgeblümtem Stoff ausgeschlagenen Schlafzimmer stand auf einer Erhöhung ein prachtvolles Bett, auf Karyatiden2 ruhend, die Faune und Bacchantinnen darstellten. Auf den platten Säulen dieses Bettes waren Wasserkannen angebracht mit Weinranken verschlungen, aus denen Liebesgötter hervorlugten. Die Bettvorhänge waren aus demselben Stoff wie die Tapeten und die Fußdecke bestand aus der schönsten Spitzenstickerei.
Nach diesem Heiligtum zu urteilen, musste die Göttin schön gewesen sein; gewiss war, dass die Priester den Altar geschmückt hatten.
Zwischen den beiden Fenstern stand ein großer Glasschrank mit chinesischem Porzellan und einer Menge allerliebster Spielereien; darüber hing eine Originalzeichnung von Vidal.
In ähnlicher Weise war die ganze Wohnung ausgestattet. Der Salon war weiß, kirschrot und Gold; die Möbel waren von Rosenholz, der Kronleuchter würde einem Fürstensaale zur Zierde gereicht haben und auf dem Kamingesims stand eine Pendule so groß wie ein Kind.
Das Boudoir war in gelbem Seidenstoff tapeziert, Divans, Armleuchter, chinesisches Porzellan und Spitzen, nichts fehlte. Ein Fauteuil,3 dessen Stoff durch häufigen Gebrauch abgenützt war, schien zu beweisen, dass seine Besitzerin einen großen Teil ihrer Zeit auf dem weichen, schwellenden Sitz zugebracht hatte. Ein Piano von Rosenholz deutete auf ihren Kunstsinn.
Ich machte die Runde durch die Zimmer und folgte den Damen, die vor mir eingetreten waren. Sie gingen in ein mit persischem Stoff ausgeschlagenes Zimmer und ich wollte ebenfalls eintreten, als sie lächelnd wieder herauskamen; es schien beinahe, als ob sie sich dieser neuen Merkwürdigkeiten geschämt hätten. Meine Neugierde wurde nur noch größer. Es war das Toilettezimmer und enthielt noch alle jene Luxusgegenstände, in denen sich die Verschwendung der Verstorbenen am höchsten entwickelt zu haben schien.
Auf einem an der Wand stehenden großen Tische, der wohl sechs Fuß lang und drei Fuß breit sein mochte, glänzten alle Schätze, die in dem Laden Aucocs und Odiots4 zu haben sind. Nichts fehlte an der Vollständigkeit dieser Sammlung, und alle die tausend Toilettegegenstände waren von Gold oder Silber. Diese Sammlung hatte indessen nur nach und nach angelegt werden können und sie war offenbar von mehr als einer milden Hand gespendet worden.
Der Anblick des Toilettezimmers einer femme entretenue machte mich nicht so scheu wie die vor mir eingetretenen Damen und ich nahm die Gegenstände genau in Augenschein. Nach einigen Augenblicken bemerkte ich, dass alle diese prächtig ziselierten Gegenstände verschiedene Anfangsbuchstaben und Adelskronen führten. Ich zog daraus den Schluss, dass jeder sein Schmuckkästchen mitgebracht und nicht wieder mitgenommen hatte, und da die Sammlung so reichhaltig war, konnte die Anzahl der Geber wohl nicht ganz klein gewesen sein.
Ich betrachtete alle diese Sachen, deren jede eine Entehrung des armen Mädchens darstellte, und ich dachte, Gott sei doch recht gütig gegen sie gewesen, dass er ihr dle gewöhnliche Strafe, welche die Gefallenen früher oder später trifft, erspart und sie mitten in ihrem Luxus, in ihrer Schönheit und Jugend aus diesem Leben abberufen hatte. Mancher konnte vielleicht noch lange an sie denken, da sie nicht alt geworden war, und das Alter ist ja der erste Tod der Buhlerinnen.
Ich kenne keinen traurigeren Anblick als das Alter des Lasters, zumal bei dem anderen Geschlecht. Es enthält keine Poesie und flößt keine Teilnahme ein. Es erregt ein peinliches Gefühl, diese Trümmer vergangenen Glanzes in der Nähe zu sehen. Diese nimmer endende Reue, nicht über die begangenen Fehltritte, sondern über schlechte Berechnungen und das schlecht verwendete Geld, ist eines der traurigsten Dinge, die man hören kann. Ich habe eine Buhlerin gekannt, der aus ihrer Vergangenheit nichts geblieben war als eine Tochter, die fast ebenso schön war, wie sie nach der Versicherung ihrer Zeitgenossen einst selbst gewesen war. Dieses arme Mädchen war von ihrer Mutter nie anders als aus schnöder Gewinnsucht Tochter genannt worden. Ich erinnere mich, dass sie Louise hieß und eine zarte blasse Schönheit war. Die gewissenlose Mutter forderte von ihr, sie in ihrem Alter auf dieselbe Weise zu ernähren, wie sie das Kind einst ernährt hatte, und Louise – gehorchte ohne eigenes Wollen, ohne Leidenschaft, wie sie einem anderen Befehl gehorcht haben würde. Man hätte sie mit einem Automat vergleichen können. In ihrem Herzen hatte nichts Gutes gekeimt, weil nichts Gutes hineingesäet worden war. Das frühere Lasterleben hatte die bessere Einsicht, die Gott ihr vielleicht gegeben, getötet.
Louise ging fast täglich zu derselben Stunde über die Boulevards. Ihre Mutter begleitete sie beständig und mit derselben sorgsamen Wachsamkeit, wie eine wahre Mutter ihre Tochter begleitet haben würde. Ich war damals noch sehr jung und keineswegs abgeneigt, die leichtfertige Moral unseres Jahrhunderts für mich anzunehmen. Ich erinnere mich jedoch, dass mich der Anblick dieser schändlichen Beaufsichtigung mit Unwillen und Abscheu erfüllte.
Man denke sich dazu das unschuldigste Madonnengesicht, mit dem Ausdruck tiefer Schwermut und geduldiger Ergebung.
Louise wurde bald das Opfer eines schändlichen Verbrechens, das der Anstand näher zu bezeichnen verbietet. Die Mutter lebt noch, der Himmel weiß wie.
Die Geschichte Louisens war mir eingefallen, während ich die silbernen Becher und Schmuckkästchen betrachtete, und es mochte wohl einige Zeit darüber vergangen sein, denn die schönen Besucherinnen waren verschwunden und ich war mit dem Aufseher allein in der Wohnung. Dieser stand an der Tür und beobachtete jede meiner Bewegungen mit großer Aufmerksamkeit.
Seine argwöhnischen Blicke entgingen mir keineswegs und ich trat auf ihn zu.
»Monsieur«, sagte ich zu ihm mit der Höflichkeit, die man solchen Leuten gegenüber beobachten muss, »können Sie mir den Namen der Person sagen, die hier gewohnt hat?«
»Mademoiselle Marguerite Gautier«, antwortete der Aufseher.
Ich erinnerte mich, dass ich wirklich eine in ganz Paris berühmte Schönheit dieses Namens oft gesehen hatte. Es war eine jener Schönen, die durch ihren Aufwand großes Aufsehen machen.
»Wie!« sagte ich zu dem Aufseher, »Marguerite Gautier ist tot?«
»Ja, mein Herr.«
»Seit wann?«
»Ich glaube seit drei Wochen.«
»Und warum gestattet man dem Publikum Zutritt in diese Wohnung?«
»Die Gläubiger meinten, der Ertrag der Versteigerung werde dann größer werden. Die Kauflustigen können im Voraus sehen, welchen Effekt die Stoffe und Möbel machen. Sie begreifen wohl, dass die Kauflust dann größer wird.«
»Sie hatte also Schulden?«
»Ja, ja, sehr viele.«
»Aber der Ertrag der Auktion wird die Schulden doch decken.«
»Es wird gewiss noch mehr eingehen.«
»Wer erhält dann den Überschuss?«
»Die Verwandten der Verstorbenen.«
»Sie hatte also Verwandte?«
»Es scheint so.«
»Ich danke Ihnen«, sagte ich zu dem Manne, der mir diese Auskunft gegeben hatte.
Der Aufseher, der nun wohl sah, dass ich nichts hatte stehlen wollen, grüßte mich höflich und ich verließ die verödeten Prunkgemächer.
»Armes Mädchen«, sagte ich zu mir selbst, als ich in meine Wohnung zurückkehrte; »sie hat gewiss ein recht trauriges Ende gehabt, denn in ihrer Sphäre hat man nur Freunde, wenn man sich wohl befindet.«
Ich fühlte unwillkürlich eine Regung des Mitleids bei dem Gedanken an Marguerites Schicksal.
Dies wird manchem vielleicht lächerlich scheinen, aber ich habe eine unerschöpfliche Nachsicht gegen Sünderinnen und ich gebe mir nicht einmal die Mühe, diese Nachsicht näher zu erörtern.
Als ich eines Tages auf der Präfektur einen Reisepass nahm, sah ich in einer der angrenzenden Gassen ein Mädchen, das von zwei Gendarmen weggeführt wurde. Ich weiß nicht, was sie getan hatte, ich kann nur sagen, dass sie bitterlich weinte, indem sie ein kleines Kind, von welchem man sie trennen wollte, zärtlich umarmte. So lange aber ein weibliches Gemüt noch Tränen hat, ist es noch nicht verstockt; wer noch weinen kann, ist noch nicht ganz verworfen. Tränen sind die zweite Taufe des Gewissens, sie waschen immer etwas ab. Es ist jedoch nicht bloß unsere Absicht, ein philosophisches Buch über die Buhlerinnen zu schreiben. Wir beklagen von ganzem Herzen jene schwachen Geschöpfe, die täglich sündigen, ohne meistens zu wissen, was sie tun, und wir halten uns nicht für berechtigt, strenger gegen sie zu sein, als Christus war. Wir beschränken uns auf die Erzählung der versprochenen einfachen Geschichte, deren Wahrheit wir aufs neue verbürgen, und wir bitten den Leser, aus dieser Erzählung die sich naturgemäß ergebenden Schlüsse zu ziehen, deren Andeutung wir nicht für notwendig halten.
Ein Coupé ist eine zweiachsige Pferdekutsche mit einer halben geschlossenen Kabine und einer Bank für zwei Personen. <<<
Skulptur einer weiblichen Figur mit tragender Funktion in der Architektur. <<<
Lehnstuhl, Lehnsessel oder Armsessel <<<
Berühmte Juweliere der damaligen Zeit <<<
II.
Die Versteigerung war auf den 16. angesetzt. Man hatte einen Tag zwischen den Besuchen der Kauflustigen und der Versteigerung gelassen, um den Tapezierern Zeit zu geben, die Vorhänge, Tapeten u. dgl. abzunehmen.
Ich war damals eben von der Reise gekommen. Es war nicht sehr zu verwundern, dass man mir bei meiner Rückkehr in die Hauptstadt unter den Neuigkeiten den Tod Marguerites nicht als eine jener wichtigen Stadtneuigkeiten gemeldet hat, die man sonst von Freunden und Bekannten nach längerer Abwesenheit zu erfahren pflegt. Marguerite war eine bekannte Schönheit, aber sie war im Grunde doch nur eine fille entretenue, und wie großes Aufsehen diese schonen Sünderinnen unter der Pariser Modewelt im Leben auch machen, so wenig wird ihr Tod beachtet. Es sind Sonnen, die ebenso glanzlos untergehen, wie sie aufgegangen sind. Sterben sie jung, so wird ihr Tod von allen ihren Geliebten zugleich vernommen, denn in Paris leben fast alle Verehrer einer bekannten Buhlerin auf dem freundschaftlichsten Fuße. Zehn Minuten, höchstens eine Stunde lang werden einige Ausdrücke des Bedauerns gewechselt und alle leben dann in ihrer gewohnten Weise fort, ohne dass ihnen die Nachricht eine Träne entlockt.
Wenn man in dieser Hauptstadt der zivilisierten Welt einmal das fünfundzwanzigste Jahr erreicht hat, so werden die Tränen eine zu seltene Ware, als dass man sie so leicht hingeben könnte. Höchstens werden nahe Verwandte, welche die Tränen mit ihrem Nachlass bezahlen, nach Verhältnis des letzteren beweint.
Was mich betrifft, so stand mein Namenszug freilich auf keinem Schmuckkästchen Marguerites, ich hatte sie kaum gesehen und kannte sie nur, wie jeder junge Pariser die bekanntesten Modedamen kennt; aber jenes gleichsam instinktmäßige Mitleid, das ich soeben eingestanden habe, führte meine Gedanken öfter und länger auf ihren Tod zurück, als sie vielleicht verdiente.
Ich erinnerte mich, Marguerite sehr oft in den Champs Elysées gesehen zu haben; sie pflegte dort täglich in einem eleganten blauen Coupé zu erscheinen. Es war mir auch erinnerlich, dass sie nicht nur eine seltene Schönheit gewesen war, sondern auch eine unter ihresgleichen keineswegs gewöhnliche äußere Distinktion gezeigt hatte.
Andere femmes entretenues pflegten auf ihren Spazierfahrten den Kopf beständig zum Schlage hinauszustecken und ihren Bekannten zuzulächeln. Sie tragen außerdem in ihrem Anzuge einen unglaublichen Luxus zur Schau, weshalb sich die wirklich distinguierten Damen äußerst einfach kleiden.
Dabei lassen sich jene Unglücklichen jederzeit von jemand begleiten. Da sich ein Mann nur höchst selten entschließt, ein Verhältnis, das den Schleier der Nacht erheischt, der Öffentlichkeit preiszugeben, und da ihnen die Einsamkeit unausstehlich ist, so fahren sie in Begleitung minder glücklicher »Freundinnen«, die keine Equipage haben, oder alter Buhlschwestern, an die man sich ohne Bedenken wenden kann, wenn man über die jüngeren, die sie begleiten, etwas Näheres zu erfahren wünscht.
Auf Marguerite fanden diese allgemeinen Merkmale keine Anwendung. Sie saß immer allein in ihrem Wagen und war für die Vorübergehenden kaum sichtbar. Im Winter hüllte sie sich in einen großen Kaschmirschal, im Sommer trug sie sehr einfache Kleider; und obgleich sie auf der Promenade vielen ihrer Bekannten begegnete, so lächelte sie ihnen nur selten und so anständig und würdevoll zu, als ob sie eine Herzogin gewesen wäre.
So fuhr sie stets im schnellen Trabe durch die Alleen in das Boulogner Wäldchen. Dort stieg sie aus und ging eine Stunde spazieren; dann setzte sie sich wieder in ihr Coupé und kehrte ebenso schnell, wie sie gekommen war, nach Hause zurück.
Übrigens war ihr eleganter, geschmackvoller Wagen so bekannt, dass sich auf der Place Louis XV. meistens jemand befand, der auf den vorüberfahrenden Wagen deutete und sagte: »Da fährt Marguerite in das Boulogner Wäldchen.«
Ich erinnere mich aller dieser Umstände, deren Zeuge ich zuweilen gewesen war, und ich beklagte den Tod Marguerites, wie man die gänzliche Zerstörung eines schönen Kunstwerkes stets beklagen muss.
Es war in der Tat auch unmöglich, eine reizendere Schönheit zu sehen, als Marguerite Gautier. Sie war groß und vielleicht etwas zu schlank, aber sie besaß im höchsten Grade die Kunst, durch die Wahl und Anordnung ihres Anzuges dieses Versehen der Natur wieder gut zu machen. Ihr Schal, dessen Spitze den Boden berührte, ließ zu beiden Seiten die breiten Volants eines seidenen Kleides sehen, und der große Muff, in welchem sie ihre Hände versteckte, war mit so geschickt verteilten Falten umgeben, dass selbst ein sehr wählerisches Auge an den Umrissen ihrer Gestalt nichts auszusetzen hatte.
Das reizende Köpfchen war der Gegenstand einer besonderen Koketterie; es schien, wie Alfred de Musset sagen würde, von ihrer Mutter so gemacht zu sein, um recht sorgfältig gepflegt zu werden.
Das Gesicht bildete ein unbeschreiblich liebliches Oval. Die Augenbrauen waren so regelmäßig schön und rein, dass sie gemalt zu sein schienen, und die schwarzen Augen waren von langen Wimpern verschleiert, welche auf die sanft geröteten Wangen einen Schatten warfen. Die Nase war fein und edel geformt und gab dem ganzen Gesicht einen geistreichen Ausdruck. Der Mund, der durch keinen Ausdruck von seiner jungfräulichen Schönheit etwas einbüßte, verdiente wirklich, dass man stehen blieb, um ihn anzusehen. Die Haut hatte jenen zarten Flaum, auf welchem das glänzende Tageslicht spielt, wie auf dem Flaum der Pfirsiche, die noch keine Hand berührt hat.
Die glänzend schwarzen Haare waren in zwei breite Scheitel geteilt, welche, sich an den Augenbrauen vorüberziehend, am Hinterhaupte zusammengebunden waren und die Ohrläppchen sehen ließen, an welchen zwei Diamanten im Werte von acht- bis zehntausend Franks funkelten.
Dieses reizende Köpfchen hatte einen ganz kindlich-naiven Ausdruck; man hätte glauben können, diese großen, unschuldigen Augen hätten nie etwas anderes als den blauen Himmel angesehen und der Mund habe nur fromme Worte gesprochen und keusche Küsse gegeben.
Marguerite hatte ihr Porträt von Vidal anfertigen lassen. Dieses ausgezeichnet schöne Bild hatte ich nach ihrem Tode einige Tage zu meiner Verfügung, und es war so wunderbar ähnlich, dass ich mich desselben bediente, um die Nachweisungen zu geben, für welche mein Gedächtnis vielleicht nicht ausgereicht haben würde.
Als ich ihre Wohnung besuchte, war dieses Bild nicht mehr da; ich sah nur das Seitenstück dazu, »la femme aux étoiles«, welches sie gekauft hatte.
Einige in diesem Kapitel enthaltene Nachrichten erfuhr ich erst später, aber ich führe sie hier mit an, um bei Marguerites Geschichte nicht wieder darauf zurückkommen zu müssen.
Marguerite war bei allen ersten Vorstellungen zugegen und brachte jeden Abend im Theater oder auf Bällen zu. So oft ein neues Stück gegeben wurde, saß sie zuverlässig in einer Parterreloge. Drei Gegenstände lagen immer vor ihr: eine Lorgnette, ein Papier mit Zuckerwerk und ein Kamelienstrauß.
Fünfundzwanzig Tage hatte sie weiße Kamelien, an den übrigen fünf Tagen waren sie rot. Die Ursache dieses Farbenwechsels ist nie bekannt geworden; ich führe ihn nur an, ohne ihn erklären zu können; die Besucher der Theater, in denen sie am häufigsten war, und ihre Freunde haben ihn ebenfalls bemerkt.
Man hatte nie gesehen, dass Marguerite andere Blumen trug als Kamelien; ich will jedoch nicht behaupten, dass sie nie andere Blumen bekommen hätte. Sie erhielt daher bei Madame Barjon, ihrer Blumenlieferantin, den Beinamen: »Die Dame mit den Kamelien« und diesen Beinamen hat sie behalten.
Dies war so ziemlich alles, was ich von ihr wusste, als mir der Besuch in ihre Wohnung Gelegenheit gab, mich an alle diese Umstände zu erinnern.
Außerdem wusste ich, wie alle in gewissen Kreisen lebenden jungen Pariser, dass Marguerite die Geliebte der elegantesten jungen Männer gewesen war, dass sie es ganz offen sagte und dass die ersteren selbst sich dessen rühmten. Man war also gegenseitig aufeinander stolz.
Seit drei Jahren jedoch hatte, dem Gerüchte zufolge, nur ein fremder Kavalier, ein alter, außerordentlich reicher Herzog Zutritt bei ihr gehabt. Sie war mit demselben aus dem Badeort Bagnères nach Paris zurückgekehrt und aus Rücksicht gegen diesen neuen und einzigen Verehrer hatte sie, wie man sagte, mit ihren früheren Bekannten gebrochen.
Zum Lohne für diese achtungsvolle Rücksicht – denn das Alter des Herzogs erlaubte ihm nur diese zu belohnen – hatte er ihr die uns bereits bekannte Wohnung, ihre Equipage und Brillanten geschenkt, und sehr oft bemerkte man im Hintergrunde der Loge, in welcher Marguerite saß, das Gesicht des Herzogs, der sich trotz seiner Verwandten nicht scheute mit ihr gesehen zu werden.
In dem letzten Jahre ihres Lebens war der alte Kavalier weit seltener zu ihr gekommen; und dennoch pflegte er sie sorgfältig in ihrer Krankheit, und als sie gestorben war, folgte er ihr zu Grabe.
Sie musste wohl keine gewöhnliche Buhlerin gewesen sein, da ein Greis von so hohem Stande öffentlich den Beweis seiner Liebe zu ihr gab.
Über dieses Verhältnis erfuhr ich später folgendes. Marguerite litt an einem Brustübel, welches sie schon einmal an den Rand des Grabes gebracht hatte. Die Pariser Winter mit den Bällen und Soupers hatten diese Krankheit immer mehr verschlimmert und zuletzt ganz unheilbar gemacht. Im Frühjahr 1842 war sie so schwach, so verändert, dass ihr die Ärzte eine Badekur verordneten und sie ging nach Bagnères.
Zu Bagnères befand sich ein junges Mädchen mit ihrem Vater. Ihre Ähnlichkeit mit Marguerite war unglaublich. Man hätte sie für zwei Schwestern halten können; nur war die junge Fremde bereits im dritten Stadium der Schwindsucht und starb bald nach Marguerites Ankunft.
Der Vater schien untröstlich über den Tod seiner Tochter und sein Schmerz flößte allen, die ihn sahen, die größte Teilnahme ein. Kein Anblick ist übrigens auch betrübender, als ein Greis, der sein Kind beweint. Mitten in dem Kummer, den ihm dieser Tod verursachte, bemerkte der Herzog Margueriten, welche dieselbe Schönheit, dasselbe Alter und dieselbe Krankheit hatte wie seine Tochter.
Es schien ihm, als hätte ihm Gott dieses Mädchen zugeführt, um seinen Schmerz zu mildern und mit jener Selbstvergessenheit, die man an einem Greise immer entschuldigt, zumal wenn dieser Greis so tief betrübt ist, wie der Herzog war, ging er zu ihr, fasste ihre Hände, drückte sie weinend an sein Herz, und ohne zu fragen, wer sie sei, bat er sie um Erlaubnis, sie oft zu besuchen.
Marguerite war mit ihrer Zofe allein, und überdies fürchtete sie auch nicht, sich zu kompromittieren. Sie willigte in das Verlangen des Herzogs und wurde tief gerührt durch die Erzählung, die er ihr bei seinem ersten Besuche machte und durch die Ursachen, die ihn zu ihr geführt hatten.
Zu Bagnères befanden sich Badegäste, welche Marguerite kannten und den Herzog sehr dienstfertig von den Verhältnissen des von ihm fast vergötterten Mädchens in Kenntnis setzten. Der alte Kavalier wurde durch diese Mitteilung schmerzlich ergriffen, denn er sah, dass sich die Ähnlichkeit Marguerites mit seiner Tochter nur auf die äußere Erscheinung beschränkte. Sein Alter und sein Schmerz ließen ihn jedoch bald die Vergangenheit der schönen Sünderin vergessen, die in ihrem reizbaren Zustande leicht für eine Idee zu begeistern war und die, nachdem sie dem Greise weinend die Wahrheit gestanden hatte, ihm versprach, auf ihre frühere Lebensweise gänzlich zu verzichten, wenn er sie wie ein Vater lieben wolle – eine Zuneigung, welche sie noch nie gekannt hatte.
Der Herzog, durch diese Versprechungen gerührt, schenkte der Buhlerin einen großen Teil der Liebe, die er zu seiner Tochter gehabt hatte. Marguerite – dies ist nicht zu übersehen – war damals krank, sie sah in ihrer Vergangenheit eine der Hauptursachen ihres Siechtums, und sie hegte die etwas abergläubische Hoffnung, Gott werde ihr für ihre Reue und Sinnesänderung die Schönheit lassen, an welcher ihr sehr viel lag.
Die Bäder, die Promenaden und die ruhige regelmäßige Lebensweise hatten die Kranke wirklich beinahe wieder hergestellt, als der Sommer zu Ende ging. Der Herzog kaufte eine Postchaise1 und begleitete Marguerite nach Paris, wo er sie fortwährend besuchte, wie zu Bagnères.
Dieses Verhältnis, deren wahre Ursache man nicht kannte, machte unter Marguerites Freundinnen großes Aufsehen, denn der Herzog war als ein sehr reicher Kavalier bekannt und zeigte sich ungemein freigebig gegen Marguerite. Man raunte sich schon in die Ohren, sie habe einen Zaubertrank erfunden und dieses zärtliche Verhältnis des alten Herzogs zu dem jungen Mädchen schrieb man allgemein einer in reichen Kreisen häufigen Lüsternheit zu.
Das Gefühl, welches der alte Kavalier für Marguerite hegte, entsprang indessen aus so reiner Quelle, dass er jedes andere Verhältnis, als das eines Vaters zu einer geliebten Tochter, für eine frevelhafte Entweihung gehalten haben würde. Obwohl er es mit einer Buhlerin zu tun hatte, sagte er ihr doch nie ein Wort, das seine Tochter nicht hätte hören dürfen.
Dies mag vielleicht sonderbar scheinen, aber es war in der Tat so.
Wir wollen jedoch aus unserer Heldin nichts anderes machen, als was sie wirklich war. So lange sie sich zu Bagnères befand, war das Versprechen, das sie dem Herzog gegeben, nicht schwer zu halten und sie hielt es wirklich; als sie aber wieder nach Paris kam, wurde sie an die Bälle und an ihr früheres Leben voll rauschender Zerstreuungen allzu lebhaft erinnert. Die regelmäßigen Besuche des Herzogs waren die einzige Zerstreuung in ihrer Einsamkeit und es zog sie unwiderstehlich zu ihren früheren Gewohnheiten hin.
Dazu kam, dass Marguerite von ihrer Badereise schöner zurückkam, als sie jemals gewesen war. Sie war zwanzig Jahre alt, und das durch sorgfältige Pflege eingeschläferte, aber nicht bewältigte Siechtum machte ihr, wie den meisten Brustkranken, ein mehr bewegtes Leben zum Bedürfnis.
Der sehr lobenswerte Entschluss, den sie zu Bagnères gefasst hatte, verschaffte ihr zu Paris in keine anderen Häuser Zutritt, als in jene ihrer früheren Freundinnen und selbst die ehrbarsten Frauen, denen diese Anekdote erzählt wurde, mochten an ein reines Verhältnis zwischen dem Herzog und Marguerite nicht recht glauben.
Die Verwandten des alten Kavaliers hatten ihm ganz offen erklärt, dass dieses Verhältnis seiner Achtung schade, und um sich selbst und vielleicht auch Marguerite größere Unannehmlichkeiten zu ersparen, hatte er sich genötigt gesehen, seinen schönen Schützling minder oft zu besuchen als anfangs. Um keinen Preis wäre er in den Stunden, wo die boshaften Mutmaßungen mehr Wahrscheinlichkeit haben konnten, zu ihr gekommen. Fast jeden Tag schickte er ihr ein Logenbillett und er selbst erschien, wie bereits erwähnt, in der Loge, blieb eine Weile und begleitete sie dann bis an ihre Haustür, ging aber nie in ihre Wohnung.
In den Champs-Elysées ließ er sie vorüberfahren und folgte ihr in seinem eigenen Wagen bis zum Boulogner Wäldchen, wo sie plaudernd miteinander auf und ab gingen. Er war zufrieden und sie kehrte in ihre Wohnung zurück, während er sich in sein Hotel begab.
Er hatte nicht die mindeste Ahnung, dass Marguerite ihn betrog, denn die Hälfte seiner Zuneigung war in seinem Vertrauen gegründet. Es erfüllte ihn daher mit tiefem Schmerz, als ihm seine unablässig auflauernden Freunde, die sein Verhältnis zu Marguerite sehr anstößig fanden, die sichere Kunde brachten, dass sie nach wie vor die öffentlichen Bälle besuche und zu den Stunden, wo sie keine Überraschung von seiner Seite zu fürchten habe, oft Besuche empfange, die bis zum anderen Morgen dauerten.
Der Herzog überzeugte sich nun, dass ihm Gott nur das leibliche Bild seiner Tochter wiedergegeben, und er fragte Marguerite mit Tränen im Herzen und in den Augen, ob das, was man ihm erzählt, Wahrheit oder Verleumdung sei.
Marguerite gestand, dass es die Wahrheit sei, und gab dem alten Kavalier ganz aufrichtig den Rat, sich fortan nicht mehr mit ihr zu beschäftigen, denn sie fühle sich zu schwach, ihr Versprechen zu halten, und wolle von einem Manne, den sie so täuschen würde, keine Wohltaten mehr annehmen.
Eine Woche stellte der Herzog seine Besuche bei Marguerite ein; länger aber vermochte er es nicht über sich zu gewinnen und am achten Tage ging er zu ihr und versprach ihr, sie so anzunehmen, wie sie sein würde, wenn er sie nur sehen könne und gab ihr das feierliche Versprechen, ihr nie einen Vorwurf zu machen.
So standen die Sachen drei Monate nach Marguerites Rückkehr, nämlich im November oder Dezember 1842.
Geschlossene Kutsche mit vier Rädern, mit einem Sitz für zwei oder drei Passagiere. Erfreute sich besonderer Beliebtheit in England des 18 Jahrhunderts. <<<
III.
Am 16. um 1 Uhr begab ich mich in die Rue d’Antin. Schon auf der Treppe hörte man die laut rufende Stimme der Schätzmeister. Ich eilte in das Zimmer, wo die Versteigerung abgehalten wurde, denn ich wollte etwas haben, das Margueriten gehört hatte.
Das Zimmer war voll von Kauflustigen und Neugierigen. Alle Zelebritäten der lasterhaften Modewelt waren dort versammelt und wurden mit finsteren Blicken gemessen von einigen vornehmen Damen, welche die Versteigerung als Vorwand genommen hatten, um Personen, mit denen sie sonst nie zusammentrafen, und deren Freiheit und Genüsse sie vielleicht im Stillen beneideten, in der Nähe zu sehen.
Die Herzogin von F… stand neben Mademoiselle M…, einem der beklagenswertesten Exemplare unserer modernen Buhlerinnen; die Marquise von T… trug einiges Bedenken, ein Einrichtungsstück zu kaufen, dessen Preis von Madame D…, der stadtkundigsten Sünderin unserer Zeit, hinaufgetrieben wurde; der Herzog von I…, von dem man in Madrid glaubte, er ruiniere sich in Paris, und der nicht einmal seine Einkünfte verbrauchte, plauderte mit Madame M…, einem der geistreichsten Blaustrümpfe, und wechselte zugleich vertrauliche Blicke mit Madame de N…, die eine der elegantesten Equipagen besitzt und ihre beiden stattlichen Rappen um zehntausend Franks nicht nur gekauft, sondern auch wirklich bezahlt hat; endlich war Mademoiselle F…, deren Talent doppelt so viel einträgt als die Mitgift mancher vornehmen Dame und dreimal mehr als die Liebesgunst einer gefeierten Schönheit, trotz der Kälte gekommen, um einige Einkäufe zu machen, und sie war keineswegs unter denen, die am wenigsten angeschaut wurden.
Wir könnten noch die Anfangsbuchstaben vieler in diesem Salon versammelten Personen anführen, die über ihr Zusammentreffen verwundert waren, aber wir würden fürchten, den Leser zu ermüden. Kurz, es herrschte unter allen, vornehmen Damen wie eleganten Buhlerinnen, eine an Ausgelassenheit grenzende Heiterkeit; viele unter den Anwesenden hatten Marguerite gekannt, aber keine schien sich dessen zu erinnern.
Man lachte viel, die Auktionskommissäre schrien aus Leibeskräften: die Handelsleute, welche die vor dem Verkaufstische aufgestellten Bänke eingenommen hatten, versuchten vergebens, Ruhe zu gebieten, um ungestört ihre Geschäfte abtun zu können. Kurz, es war eine sehr geräuschvolle Versammlung.
Ich schlich mich in aller Stille unter den lärmenden Haufen. Das Geräusch machte einen peinlichen Eindruck auf mich, als ich bedachte, wie nahe das Sterbezimmer des armen Geschöpfes war, dessen Nachlass man verkaufte, um die Gläubiger zu befriedigen. Ich war im Grunde weniger gekommen, um zu kaufen, als um zu beobachten und betrachtete die Gesichter der Lieferanten, die den Nachlass versteigern ließen und deren Züge sich verklärten, so oft ein Gegenstand zu einem unerwartet hohen Preise hinaufgetrieben wurde.
Diese Menschen hatten auf die Sünden Marguerites spekuliert, und nachdem sie hundert Prozent von ihr verdient, hatten sie die Unglückliche in ihren letzten Augenblicken gerichtlich verfolgt. Nach ihrem Tode ernteten sie nun die Früchte ihrer Berechnungen und bezogen sogleich die Interessen ihres Kredits. Fürwahr, die Alten hatten recht, dass sie die Kaufleute und die Diebe unter die Obhut Eines Gottes stellten.
Die Versteigerung wurde fortgesetzt. Kleider, Schals, Brillanten wurden mit unglaublicher Schnelligkeit verkauft; mir sagte nichts von dem allen zu und ich wartete noch immer.
Auf einmal hörte ich rufen: »Ein schön eingebundenes Buch, mit Goldschnitt, betitelt: ›Manon Lescaut‹, mit Randglossen – zwanzig Franks!«
»Zweiundzwanzig«, sagte eine Stimme nach einer ziemlich langen Pause.
»Fünfundzwanzig«, sagte ich.
»Fünfundzwanzig«, wiederholte der Auktionskommissär.
»Dreißig« bot der erste.
Ich hatte »Manon Lescaut« so oft gelesen, dass ich das Buch fast auswendig weiß und würde vielleicht nicht mehr geboten haben, wenn nicht der Auktionskommissär hinzugesetzt hätte:
»Ich wiederhole, dass das Buch mit Bleistift geschriebene Randglossen hat.«
Ich war neugierig, die Randglossen zu sehen und rief: »Fünfunddreißig Franks!« in einem Tone, der die Einschüchterung meines Gegners bezweckte.
»Vierzig«, bot dieser.
»Fünfzig!«
»Sechzig!«
»Hundert!« rief ich.
Wenn ich Effekt hätte machen wollen, so würde ich meine Absicht vollkommen erreicht haben, denn es entstand bei diesem Überbieten eine tiefe Stille, und man sah mich an, um zu wissen, wer auf das Buch so erpicht sei.
Der Ton, mit welchem ich mein letztes Wort sprach, schien meinen Gegner zu überzeugen, dass ich nicht ablassen würde, und er stand von einem Wettkampf ab, der doch nur dazu gedient haben würde, den Preis des Buches auf den zehnfachen Wert zu treiben. Er verbeugte sich gegen mich und sagte sehr artig, wenn auch etwas spät:
»Ich trete zurück.«
Da niemand mehr bot, so wurde mir das Buch zugeschlagen.
Da ich eine neue, für meine Börse sehr nachteilige Grille fürchtete, so gab ich meinen Namen an, ließ das Buch auf die Seite stellen und entfernte mich. Die Anwesenden mochten sich wohl wundern, in welcher Absicht ich ein Buch, das man überall um höchstens zehn Franks kaufen konnte, mit hundert Franks bezahlte.
Es wäre in der Tat sehr schwer gewesen, einen triftigen Grund für diesen Wunsch anzuführen. Ich war begierig, das Buch zu sehen, weil es mit Randglossen von Marguerites Hand versehen war und weil ich gern wissen wollte, was die jüngere Schwester zu der Lebensbeschreibung der älteren hätte beifügen können.
Eine Stunde nachher ließ ich das Buch holen. Auf der ersten Seite standen in zierlichen Schriftzügen die Worte:
»Manon à Marguerite. Humilité. Armand Duval.«
Was bedeutete das Wort »humilité«? Erkannte Manon, durch die Meinung des Gebers, Marguerites Überlegenheit in den Künsten der Galanterie, oder einen Vorzug des Herzens an?
Die letztere Deutung war die wahrscheinlichere, denn die erstere wäre nur eine ungebührliche Freimütigkeit gewesen, die niemand unterschrieben haben würde und die auch von Margueriten, welche Meinung sie auch von sich selbst hatte, zurückgewiesen worden wäre.
Ich stellte diese Betrachtungen an, während ich das Buch durchblätterte, das offenbar viel gelesen worden war und hie und da einige mit Bleistift geschriebene, aber fast ganz verwischte Randglossen hatte. Es ergab sich für mich aus dem Buch nichts anderes, als dass Marguerite von einem ihrer Verehrer für würdig gehalten worden war, Manon Lescaut zu verstehen, und dass sie an der Geschichte ihrer Vorgängerin genug Interesse gefunden hatte, um eine Zeit, die sie wenigstens auf eine einträglichere, wenn auch nicht nützlichere Weise hätte benützen können, zu Randglossen zu verwenden.
Ich ging wieder aus und beschäftigte mich erst am Abend beim Schlafengehen mit dem Buche.
Diese rührende Geschichte ist mir in ihren geringsten Einzelheiten bekannt, und dennoch werde ich durch dieselbe, so oft mir das Buch in die Hände fällt, dergestalt gefesselt, dass ich es aufschlage und zum hundertsten Male der Heldin des Abbé Prévost in ihren Verirrungen und auf ihrer Umkehr folge. Diese Heldin ist so wahr geschildert, dass es mir scheint, als ob ich sie gekannt hätte und unter den oben erwähnten Umständen erhielt diese Lektüre einen neuen Reiz durch den Vergleich, den man zwischen Manon und Marguerite angestellt hatte.
»Manon Lescaut«1 ist ohne allen Zweifel das schönste Seelengemälde, das je ein Schriftsteller entworfen, die gründlichste Zergliederung der Leidenschaft, die ein Menschenkenner gemacht hat. Dieses Charakterbild ist durchaus wahr und treffend, und Manons Belehrung durch die Liebe ist nicht minder poetisch schön, als die Bekehrung der Magdalena durch den Glauben.
Ich habe oben gesagt, dass ich gegen Buhlerinnen voll Nachsicht bin; diese Nachsicht ist hauptsächlich durch das wiederholte Lesen dieses Buches entstanden. Den Nachkommen ist das Verdienst der Vorgängerin zugute gekommen, wie gar viele wirkliche Nachkommen aus den Verdiensten ihrer Vorfahren Nutzen ziehen; aber an dem Abende, wo ich Manons Geschichte noch einmal las und dabei an Marguerite dachte, wurde meine Nachsicht wirklich zum Mitleid und beinahe zur Liebe gegen das arme verirrte Mädchen, aus deren Nachlass ich dieses Buch hatte. Manon war freilich in einer Wüste, aber in den Armen eines Mannes gestorben, der sie mit aller Kraft seiner Seele liebte und der Verblichenen ein Grab grub, das er mit seinen Tränen benetzte und in welchem er beim Abschiede sein Herz zurückließ; Marguerite hingegen, eine Sünderin wie Manon, und vielleicht bekehrt wie sie, war im Schoße eines prunkenden Luxus und in dem Bette ihrer Vergangenheit gestorben, aber auch mit verödetem Herzen – und ein verödetes Herz ist weit schrecklicher und erbarmungsloser als die Wüste, in welcher Manon begraben worden war.
Marguerite hatte in der Tat nach der Versicherung einiger Freunde in den zwei Monaten ihres langsamen Schmerzenskampfes keinen wahren Trost gefunden.
Von Manon und Marguerite wendeten sich meine Gedanken auf andere in der eleganten Welt bekannte Sünderinnen, die singend und tändelnd einem fast immer gleichen Ende entgegengingen. Die Unglücklichen! Wenn es unrecht ist, sie zu lieben, so kann man sie doch wenigstens beklagen. Man bedauert den Blinden, der nie das Tageslicht gesehen, den Tauben, der nie die Akkorde der Natur gehört hat, den Stummen, der nie imstande war, seinen Gefühlen eine Sprache zu verleihen – und unter dem Vorwande falscher Scham trägt man Bedenken, diese Blindheit des Herzens, diese Taubheit der Seele, dieses Verstummen des Gewissens zu beklagen, wodurch eine Verirrte jede Erkenntnis des Guten und Bösen verliert und unfähig wird, den Weg des Rechtes zu sehen, die Stimme des Herrn zu vernehmen und die reine Sprache der Liebe und des Glaubens zu sprechen.
Von Zeit zu Zeit aber hat die Welt das erbauliche Schauspiel der Bekehrung einer Verirrten. Gott scheint dadurch die Fehler der anderen sühnen zu wollen, gleichwie durch den Tod des Erlösers die Vergehen aller Menschen gesühnt wurden; und außer den Bekehrten, die ihnen als Beispiel leuchten, sendet er ihnen noch den Priester, der sie absolviert, und den Dichter, der sie verteidigt.
Man frage die Geistlichen in den Städten, und man wird hören, dass sie oft Sünderinnen, welche sie für den Himmel verloren geglaubt, als wahre Christinnen sterben sahen.
Unser großer Dichter Victor Hugo hat »Marion Delorme«, Alfred de Musset hat »Bernerette«, Alexander Dumas hat »Fernande« geschrieben; die Denker und Dichter aller Zeiten haben den Sünderinnen ihr Mitleid gezollt und zuweilen hat sie ein großer Mann durch seine Liebe und sogar durch seinen Namen wieder zu Ehren gebracht. Ich verweile absichtlich so lange bei diesem Gegenstande, denn unter meinen Lesern sind vielleicht schon viele im Begriff, dieses Buch wegzuwerfen, in welchem sie nur eine Verteidigung des glänzenden Lasters zu finden fürchten, und das jugendliche Alter des Verfassers wird ohne Zweifel zur Begründung dieser Besorgnis beitragen. Wer aber bloß durch diese Besorgnis zurückgehalten wird, möge nur getrost weiter lesen, diese Besorgnis wird bald verschwinden.





























