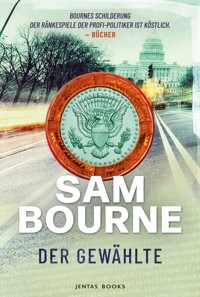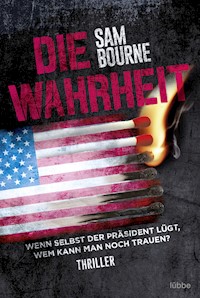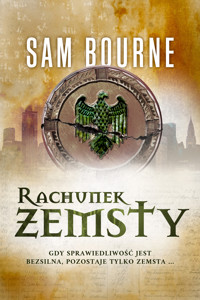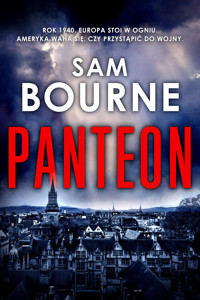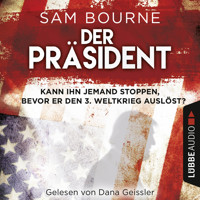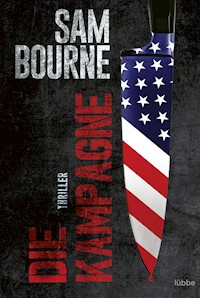
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Maggie-Costello-Reihe
- Sprache: Deutsch
Als die hochkarätige Anwältin Natasha Winthrop eines Nachts in ihrem Haus überfallen und fast vergewaltigt wird, kommt es zum Kampf und sie tötet ihren Angreifer. Zunächst sieht es klar nach Notwehr aus, doch dann gibt es Unstimmigkeiten in Winthrops Bericht. Winthrop behauptet, Opfer einer Verschwörung zu sein, und beauftragt die Fallermittlerin Maggie Costello, herauszufinden, wer dahintersteckt. Aber als sie in Natasha Winthrops Leben nach Indizien gräbt, stößt sie auf Lücken im Lebenslauf. Ist Winthrop doch nicht, wer sie zu sein vorgibt?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 543
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber den AutorTitelImpressumWidmungMONTAGKAPITEL 1KAPITEL 2KAPITEL 3KAPITEL 4KAPITEL 5KAPITEL 6KAPITEL 7KAPITEL 8KAPITEL 9KAPITEL 10KAPITEL 11DIENSTAGKAPITEL 12KAPITEL 13KAPITEL 14KAPITEL 15KAPITEL 16KAPITEL 17MITTWOCHKAPITEL 18KAPITEL 19KAPITEL 20KAPITEL 21DONNERSTAGKAPITEL 22KAPITEL 23KAPITEL 24KAPITEL 25KAPITEL 26KAPITEL 27KAPITEL 28KAPITEL 29KAPITEL 30FREITAGKAPITEL 31KAPITEL 32KAPITEL 33KAPITEL 34KAPITEL 35KAPITEL 36KAPITEL 37KAPITEL 38KAPITEL 39SAMSTAGKAPITEL 40KAPITEL 41KAPITEL 42KAPITEL 43KAPITEL 44KAPITEL 45KAPITEL 46KAPITEL 47MONTAGKAPITEL 48DANKSAGUNGENÜber dieses Buch
Band 3 der Reihe »Maggie-Costello-Reihe«
Als die hochkarätige Anwältin Natasha Winthrop eines Nachts in ihrem Haus überfallen und fast vergewaltigt wird, kommt es zum Kampf und sie tötet ihren Angreifer. Zunächst sieht es klar nach Notwehr aus, doch dann gibt es Unstimmigkeiten in Winthrops Bericht. Winthrop behauptet, Opfer einer Verschwörung zu sein, und beauftragt die Fallermittlerin Maggie Costello, herauszufinden, wer dahintersteckt. Aber als sie in Natasha Winthrops Leben nach Indizien gräbt, stößt sie auf Lücken im Lebenslauf. Ist Winthrop doch nicht, wer sie zu sein vorgibt?
Über den Autor
Sam Bourne ist das Pseudonym des preisgekrönten britischen Journalisten Jonathan Freedland. Nach Stationen u. a. bei der BBC, der Washington Post, der New York Times, Newsweek und der Los Angeles Times, arbeitet er heute überwiegend als Redakteur und Kolumnist beim Guardian. Er schreibt regelmäßige Beiträge für die New York Times Review of Books und den Jewish Chronicle. Zudem präsentiert er die wöchentliche Radiosendung The Long View bei BBC Radio 4. Freedland ist Autor diverser Sachbücher und Thriller. Mit seinem Thrillerdebüt Die Gerechten war er monatelang Nummer 1 der Sunday-Times-Bestsellerliste mit über einer halben Million verkaufter Exemplare.
SAM BOURNE
DIEKAMPAGNE
THRILLER
Aus dem Englischen vonDietmar Schmidt
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2020 by Jonathan Freedland
Titel der englischen Originalausgabe: »To Kill a Man«
Originalverlag: Quercus Editions Ltd., an Hachette UK company
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Dr. Frank Weinreich, Bochum
Titelillustration: © jocic/shutterstock
Umschlaggestaltung: Manuela Städele-Monverdeunter Verwendung eines Designs von kid-ethic Images
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-0971-2
luebbe.de
lesejury.de
Für Sarah – die Frau in meinem Leben
MONTAG
KAPITEL 1
Washington, D. C.
Später sagte sie der Polizei, ihr sei sofort klar gewesen, dass es ein Mann war. Der Schall der Schritte unmittelbar vor Mitternacht und dieser dumpfe Tritt hätten keinen Raum für Zweifel gelassen, dass ein Mann in ihrem Haus war.
Fast den ganzen Abend habe sie in ein Dokument vertieft am Schreibtisch gesessen. Sie erläuterte, es habe sich um ein »Abschlussmemorandum für den Ausschuss« gehandelt, und nannte in ihrer offiziellen Aussage den offiziellen Namen sowohl des Falles als auch des Komitees. Nicht, dass dies nötig gewesen wäre. Die Kriminalbeamten wussten, wer sie war. Während der Anhörungen, die im Fernsehen übertragen wurden und das Land in Bann schlugen, hatte sie als Chefberaterin für den Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses gearbeitet. Im Anschluss an die Sendungen hatte sie sich vor laufender Kamera den Medien gestellt und war im Zuge dessen zu einer Art Kultfigur geworden: In Washington und in den TV-Kabelnetzen hatte Natasha Winthrop es zu Prominenz gebracht. Nun wurde gemunkelt, sie könnte für ein hohes Amt kandidieren. Vielleicht sogar für das höchste.
Der Polizei teilte sie Dinge mit, die weniger bekannt waren: dass sie zwar für Menschen, die den gegenwärtigen Präsidenten verabscheuten, zu einer Heldin geworden sei, gleichzeitig aber bei denen, die den Mann vergötterten, ebenso extreme Reaktionen hervorrufe. Sie zeigte den Detectives einige Tweets, die an sie gerichtet worden waren, darunter zwei, die im Lauf des gleichen Tages eingetroffen waren: Du sollst verrecken, du Fotze!, lautete der eine; Hey, du Nutte, du lebst ja immer noch!, der andere.
An Geräusche in der Nacht sei sie gewöhnt, sagte sie den Kriminalbeamten. Ihr Haus in Georgetown stamme aus der Kolonialzeit und ächze und knarre vor Erinnerungen. Aber dieses Geräusch, zusammen mit dem leiseren, das darauf folgte, habe keinen Raum für Zweifel gelassen. Das zweite Geräusch wirkte vorsichtiger. Der Mann schien bedacht, den Fehler, Lärm verursacht zu haben, nicht zu wiederholen. In dem sorgfältigen Versuch, die eigene Anwesenheit zu verbergen, verriet sich eine bewusste menschliche Entscheidung – der Polizei gegenüber drückte sie sich allerdings anders aus. Das zweite Geräusch war auch näher gewesen. Und offensichtlich, ohne jeden Hauch eines Zweifels, stammte es von einem Mann.
Ihrer Aussage nach verstrichen nur wenige Sekunden, bis ein Mann vor ihr in der Tür zu ihrem Arbeitszimmer im Erdgeschoss stand. Sie sagte den Detectives, dass er innezuhalten schien, als schätzte er die Situation ein. Er war ganz in Schwarz gekleidet: Schuhe, dunkle Jeans, enge Winterjacke. Eine Skimaske bedeckte sein Gesicht, nur die Augen waren zu sehen. Er habe sie taxiert, fuhr sie fort, und sie habe sein Starren erwidert. Vermutlich dauerte es nicht länger als eine Sekunde, aber das Verschränken ihrer Blicke erschien ihr endlos. Er musterte sie lange, als suchte er nach etwas.
Sie wollte sich bewegen, konnte es aber nicht. Wie erstarrt war sie, ihre Arme und Beine ebenso wie ihre Kehle. Und was in dieser Sekunde am seltsamsten war: Er wirkte genauso erstarrt. Irgendwie gelähmt. Zwei Menschen starrten einander an und standen der Leere gegenüber.
Aber der Moment ging vorüber. Mit zwei raschen Schritten kam er ins Zimmer. Es waren sehr entschlossene Schritte, als käme er, um etwas abzuholen. Sie sagte der Polizei, dass sie einen flüchtigen Augenblick überlegt habe, ob es sich um einen Raubüberfall handle. Ob er hier sei, um eine ihrer Akten zu stehlen. Oder eher ihren Laptop. Angesichts ihrer Arbeit wäre das kaum erstaunlich: Eine Vielzahl von Menschen hätte gern erfahren, was sie wusste.
Sowohl in ihrem ersten, inoffiziellen Gespräch mit einem Polizeibeamten als auch in ihrer unterzeichneten Aussage erwähnte sie, dass sie auf diese Möglichkeit vorbereitet gewesen sei. Nach dem Einbruch in der Kanzlei hatte sie Panikknöpfe einbauen lassen, die mit einer privaten Wachschutzfirma verbunden waren; zwei davon: einen am Bett und einen in der Küche. Aber keinen im Arbeitszimmer. Um Alarm zu schlagen, musste sie an dem Mann vorbei und den Raum verlassen.
Doch bevor sie Gelegenheit erhielt, sich auch nur zu bewegen, war er bei ihr, schlug ihr mit der flachen Hand gegen die linke Schulter, und schon lag sie am Boden. Und er war auf ihr. Sie sagte den Detectives, die Bewegung sei ihr eingeübt vorgekommen, eine Überwältigungstaktik. In diesem Moment habe sie gedacht: Das macht er nicht zum ersten Mal.
Sofort zerrte er an ihren Kleidern. Eine Hand blieb an ihrer Schulter, mit der anderen öffnete er ihren Gürtel und den Reißverschluss ihrer Hose. Sie versuchte, sich wegzudrehen, aber es gelang ihr nicht: Er war zu kräftig für sie.
Sie beschrieb, wie er sie mit den Knien am Boden festhielt; das eine hatte so hart gegen ihre Hüfte gedrückt, dass sie einen Knochenbruch befürchtete. Er war ihr so nahe, dass sie ihn riechen konnte. In seinen Kleidern hing die Feuchtigkeit von draußen, dieser Geruch von nassem Hund, der vom Regen durchtränkter Wolle anhaftet.
In ihrer Aussage beschrieb sie, dass er die ganze Zeit die Skimaske anbehielt, sodass sie nur seine Augen erkennen konnte. Sie hatte den Eindruck, dass er weder alt noch jung war, sondern irgendwo in der Mitte; vielleicht ein paar Jahre älter als sie. Achtunddreißig oder neununddreißig. Einmal verrutschte seine Maske, und sie glaubte zu sehen, dass er dunkle Haare hatte und seine Wangen stoppelig waren.
Später würde sie ihr Bestes tun, um zu beschreiben, was die Polizei stets als den »Kampf« bezeichnete, auch wenn ihr das Wort fehl am Platz erschien. Sie erinnerte sich, dass sie mehrmals die freie Hand, die rechte Hand, erhoben hatte, um ihm ins Gesicht zu schlagen. Nicht um ihm die Maske herunterzureißen, sondern um ihm wehzutun. Sie wusste noch, dass er das Gesicht verzog, als sie ihm die Fingernägel in den Hals bohrte. Sie kratzte ihn so fest, dass seine Haut aufriss. Zu spüren, wie das Gewebe unter ihren Nägeln nachgab, überraschte sie.
»Das ist gut«, hörte sie ihn murmeln. »Das gefällt mir.«
Bei diesen Worten, berichtete sie den Detectives, habe sie eine Welle der Übelkeit überrollt.
Sie versuchte den Bericht über das, was als Nächstes geschah, so kurz zu halten wie möglich, obwohl die Polizisten sämtliche Einzelheiten von ihr erfahren wollten. Wie er sie mit den Knien festhielt, sodass sie sich nicht rühren konnte, wie er ihr die Jeans herunterzog, wie sein Atem ihr ins Gesicht strömte. Wohin er seine Finger steckte. Wie viele. Was er tat.
Als sie zu erklären versuchte, wie sie reagiert hatte – als sie ihren Gedankenprozess erläutern wollte –, geriet sie ins Stottern. Gedanke sei nicht das passende Wort, es habe keinen Gedanken gegeben, mehr brachte sie nicht heraus. Nichts davon sei in ihrem Kopf abgelaufen. Ihr Körper habe ihr die Entscheidung abgenommen.
Sie hatte sich gewunden, um ihn abzuschütteln, und den Rücken gerade genug gewölbt, um sich vom Boden zu heben. (Sie sagte zu den Detectives, sie habe sich gefragt, ob er ihr die Bewegung bewusst gestattete, weil ihre Körper sich dadurch näher kamen und sie für ihn zugänglicher wurde. Dass er es für ein Zeichen irgendwelchen Einvernehmens gehalten oder es sogar – Gott behüte – genossen haben könnte, so als schmiegte sie sich an ihn. Schon der Gedanke widerte sie an. Doch zugleich war ihr dieser potenzielle Eindruck als nützlich erschienen.)
Sein Atem ging nun schwerer und schneller, seine Konzentration – und ja, sie war sich im Klaren, dass es ein merkwürdiges Wort war, aber genau dieser Begriff kam ihr in den Sinn –, seine Konzentration galt ganz seiner Invasion ihres Körpers. Er schien nicht darauf zu achten, was sie mit dem rechten Arm tat, der die Schreibtischplatte erreichen konnte. Er bemerkte nicht, dass sie sich mit den Fingern daran festkrallte und verzweifelt über die Fläche scharrte.
Schon bald gelangte sie mit den Fingern höher und fand die Kante ihres Laptops. Nun war sie fast am Ziel.
Von seiner überlegenen Kraft nach wie vor an Ort und Stelle gebannt, erreichte sie mit der Hand endlich, wonach sie suchte: das kühle, harte Metall des schwersten Gegenstands auf ihrem Schreibtisch. Er war nicht größer als eine Faust, eine kleine und nicht sonderlich bemerkenswerte Büste Ciceros. In ihrer Aussage erklärte sie, die Büste sei das Geschenk eines Ex-Freundes gewesen, während einer Dienstreise nach Rom in einem kitschigen Souvenirladen gekauft. (Für Natasha: Siehe, ein großer Jurist von gestern – für eine große Juristin von heute.)
Sie zögerte nicht, sie plante nicht. Ohne nachzudenken, ergriff sie die Büste, vergewisserte sich, dass sie ihr fest in der Hand lag, und senkte sie langsam, bis sie auf gleicher Höhe mit seiner Schläfe war. Er sah die Büste nicht. Er war zu sehr auf sich konzentriert.
Sie holte aus, verharrte eine Sekunde, und als wäre ihre Hand ein Katapultarm, schlug sie so schnell zu, wie sie nur konnte. Mit voller Wucht traf sie ihn seitlich am Schädel. Metall prallte gegen Knochen.
Das resultierende Geräusch war laut und erschien ihr doch leiser als die Stille, die darauf folgte: eine plötzliche Stille nach dem Lärm des Kampfes, dem Atmen, dem Winden und dem Schmerz, eine Stille, die den Raum und auch den Rest des Hauses füllte.
Sein Kopf sackte sofort nach vorn, sein Gesicht landete auf ihrem.
Ihre Haut wurde feucht und glitschig. Sie sagte der Polizei, zuerst habe sie angenommen, dass es sein Blut wäre.
Langsam öffnete sie die Hand, und die Büste entglitt ihren Fingern. Sie versuchte, sich unter ihm hervorzuwinden, aber er lag noch immer auf ihr, ein totes Gewicht. Ihr Gesicht wurde feuchter. Mit der freien Hand tupfte sie sich die Haut ab, und als sie ihre Finger anblickte, sah sie, dass die warme Feuchtigkeit wasserklar war. Der Polizei sagte sie, dass sie an einen Mordfall denken musste, den sie einige Jahre zuvor vor Gericht gebracht hatte. Daher wusste sie, um was es sich handelte: Liquor cerebrospinalis, Gehirnwasser. Noch wenige Sekunden zuvor hatte die Flüssigkeit das Gehirn des Mannes in seinem Schädel abgepolstert.
Jetzt war sie davon bedeckt. Ihrer Polizeiaussage zufolge war das der Augenblick, in dem sie begriff, dass der Mann tot war und sie ihn getötet hatte.
Sie sagte der Polizei, dass sie einige Mühe gehabt habe, seine Leiche von sich zu wälzen, dass sein Gewicht zuzunehmen schien, während das Fleisch reglos auf ihr lag. Sie hatte ihre Arme, ihre Knie, ihren Torso einsetzen müssen, bis endlich die Leiche von ihr herunterrollte und auf dem Rücken liegen blieb. Erst da sah sie den feuchten Fleck auf seinem Hosenboden und begriff, dass der Schließmuskel versagt hatte.
In ihrer schriftlichen Aussage erklärte Natasha Winthrop, dass sie nun erst die Skimaske abgezogen und dem Mann ins Gesicht geblickt habe. Sie fügte nicht hinzu, dass sie erst jetzt in vollem Umfang erfasste, was sie getan hatte.
KAPITEL 2
Washington, D. C.
»Maggie, wie zum Teufel geht es Ihnen?«
»Mir geht es gut, Senator. Mir geht es gut. Wie geht es Ihnen? Sind Sie okay?«
»Darauf können Sie wetten, Maggie! Darauf können Sie Ihr Leben verwetten. Kommen Sie. Nehmen Sie Platz. Gleich hier. Genau. Toll. Also, lassen Sie sich mal gut anschauen. Es ist eine Weile her, was?«
Maggie Costello merkte, wie ihr Kiefer und ihre Wangen den traditionellsten aller Washingtoner Gesichtsausdrücke bildeten: das eingefrorene Grinsen. Dass sie lächelte, wurde von ihr erwartet. Diese Verpflichtung schloss ostentative Dankbarkeit ein. Hier war sie und bekam einen Termin, ein Gespräch unter vier Augen, ein Frühstückstreffen – wenn auch ohne Frühstück – mit dem Spitzenkandidaten ihrer Partei für die US-Präsidentschaft, einem Mann, der auf der ganzen Welt anerkannt und in den USA (wenigstens auf ihrer Seite des politischen Spektrums) geliebt wurde. Siebzig Jahre war er alt und arbeitete schon fast ein halbes Jahrhundert in Washington. Senator Tom Harrison war eine lebende Legende.
Natürlich sollte sie dankbar sein: Der Mann mochte durchaus der nächste US-Präsident werden, und er hatte sie um ein Gespräch gebeten, nicht umgekehrt. Solch eine Konstellation war so selten, dass Maggie sie eigentlich genießen, sich in ihr sonnen sollte. Wäre Washington ein Dschungel gewesen, und bei Gott, hier herrschte hin und wieder durchaus die nötige feuchte Hitze, so war dies der kostbare Augenblick, in dem der Alpha-Gorilla vor ihr das Haupt neigte. Also ja, sie sollte verdammt noch mal lächeln.
Sie behielt das Grinsen bei, während Harrison sein Wunderwerk vollbrachte. Ohne auch nur einen Notizzettel vor sich zählte er die Glanzpunkte ihres Lebenslaufs auf: die Arbeit, die sie unter den letzten beiden Präsidenten für das Weiße Haus vollbracht hatte – bereitwillig für den einen, für den anderen alles andere als das. Jeden ihrer Erfolge erwähnte er, vor allem die Katastrophen, die sie abgewendet hatte, und das keineswegs, weil er glaubte, sie könnte etwa vergessen haben, was sie in den vergangenen paar Jahren so getrieben hatte. Allerdings gab es in dieser Stadt etliche Männer, die gegenüber einer Frau wie ihr bei der ersten Gelegenheit auf ihren eigenen Lebenslauf zu sprechen gekommen wären. Er ging die Liste nur deshalb durch, damit sie wusste, wie genau er ihre Leistungen kannte.
»Ich muss schon sagen, Maggie, Sie sind eine meiner Heldinnen. Und das ist mein Ernst.«
Er klopfte sich aufs Herz und schüttelte den Kopf, als wäre er von der Aufrichtigkeit seiner Empfindungen überwältigt. »Ich meine, was Sie bei dieser Geschichte mit den Bücherverbrennungen gemacht haben? Gottverdammt noch mal, das war schon was. Und ich will gar nicht davon anfangen, wie Sie den Präsidenten bloßgestellt haben und …«
»Danke, Senator!«
»Nein! Wir sollten Ihnen danken. Mein Gott, was Sie für Amerika getan haben. Für die ganze Welt! Das ist riesig, Maggie. Riesig, und das sage ich aus tiefstem Herzen.«
»Vielen Dank!«
»Aber – und ich hoffe, das freut Sie – ich will gar nicht über Ihre Feuerwehreinsätze reden, Ihr Troubleshooting, das Sie, verstehen Sie mich nicht falsch, so gut beherrschen. Niemand in dieser Stadt macht es besser. Niemand.« Er bedachte sie mit seinem längsten, offensten Blick. Am Ende war sie es, die wegsehen musste.
»Aber deswegen habe ich Sie nicht gerufen. Ich brauche keine Feuerwehr in meinem Team.« Mit jenem leisen Lachen in der Stimme, das jedem Amerikaner so vertraut war wie das Klingeln der eigenen Türglocke, fügte er hinzu: »Ich habe nicht vor, allzu viele Brände zu legen.«
»Okay.«
»Na ja, einigen will ich schon einheizen! Aber Sie wissen, was ich meine, Maggie. Denn«, und bei diesem Wort trat ein Singsang in seine Stimme, der die Rolle eines unhörbaren Trommelwirbels übernahm, »ich erinnere mich, was Sie ursprünglich in diese Stadt geführt hat.«
»Wirklich?« Sie unterdrückte den Drang hinzuzufügen: Ich nämlich nicht.
»Oh ja, Maggie. Ich bin schon lange dabei. Und ich erinnere mich, dass ein gewisser Bewohner des Oval Office Sie als Spezialistin für Außenpolitik eingestellt hat, korrigieren Sie mich, sollte ich mich irren. Sehen Sie …« – er tippte sich an die Schläfe –, »Sie sollten nicht glauben, was Sie in der New York Times lesen, diesen ganzen Bullshit von wegen ›Senator von vorgestern‹. Ich habe noch immer das beste Gedächtnis unseres Metiers. Ich bin schon so lange dabei, Maggie, dass ich noch Wörter wie Metier benutze, und deshalb weiß ich auch: In die Regierung geholt wurden Sie wegen Ihrer Erfolge im Nahen Osten. Maggie Costello, die Friedensstifterin.«
»Das ist lange her.«
»Nicht so sehr lange. Für eine Frau Ihres Alters ist noch nichts lange her. Wie alt sind Sie, dreiunddreißig? Vierunddreißig? Mein Stab sieht mich böse an. Wieso? Verstößt es mittlerweile schon gegen das Gesetz, das Alter einer Frau zu erwähnen? Jetzt ist es aber mal gut. Craig, holen Sie mir ein Soda oder so was. Maggie, irre ich mich?«
»In Bezug auf mein Alter oder auf Jerusalem?«
»Jerusalem. So etwas machen Sie doch, richtig? Diplomatie, Schlichtungen, NGO-Hintergrund, Vereinte Nationen? Das ist Ihr Ding.«
»War es.«
»Ich fange damit an, weil wir einen Riesenhaufen Mist werden beseitigen müssen, sobald wir diese Meute in die Wüste geschickt haben, das können Sie mir glauben. Und damit meine ich M-I-S-T in Großbuchstaben. Was diese Leute auf der ganzen Welt angerichtet haben, bei unseren Freunden, bei unseren Verbündeten? Ich brauche Ihnen das nicht zu erklären. Sie lesen Zeitung, Sie wissen Bescheid. Süßer Jesus, Sie wissen es.«
Obwohl sie es nicht wollte, spürte Maggie, wie ihr schwindlig wurde, als strömte ihr ein warmer Nebel in den Kopf, der gleich davonschweben könnte.
Dass jemand in ihr etwas anderes als eine Krisenmanagerin sah, hatte sie so lange nicht mehr erlebt, dass sie kaum wusste, was sie antworten sollte. Sicher, genau das hatte sie immer gewollt: als eine Person mit Erfahrung betrachtet zu werden, statt kaum mehr denn nur eine bessere Notrufnummer zu sein.
»Also denken Sie an das National Security Council, ist das richtig?« Sie bemühte sich, in ruhigem Ton zu sprechen. »Auch wenn wir natürlich nichts als gegeben betrachten – aber wenn Sie gewinnen, entweder Außenministerium oder NSC?«
»Wie Sie sagen, wir betrachten nichts als gegeben, Maggie. Gar nichts. Wir messen nicht die Fenster aus, bevor wir ins Weiße Haus eingezogen sind. Das ist eine Regel. Selbstzufriedenheit bringt einen um in diesem Spiel. Sie bringt einen um. Wir nehmen nichts als gegeben hin, bis meine Hand auf der Bibel liegt und ich den Eid ablege – und nicht einmal dann! Ellen rollt jetzt meinetwegen mit den Augen. Tut mir leid, Maggie. Einige von ihnen haben es schon vorher gehört. Aber es ist mir ernst damit. Keine Selbstzufriedenheit.«
»Sicher. Aber dem nationalen Sicherheitsteam anzugehören?«
»Wie bitte?«
»Ich. Meine Rolle. Dass ich dem nationalen Sicherheitsteam angehören werde.«
»So sehe ich Sie, Maggie. Sie sind zäh. Das sagen alle. So sind wir eben, was, Maggie? Irische Kämpfernaturen. Mein Urgroßvater mütterlicherseits. Donegal. Habe ich Ihnen gesagt, dass ich vor ein paar Jahren dort war, als ich dem Ausschuss für Internationale Beziehungen vorsaß? Sie haben den roten Teppich ausgerollt, das kann ich Ihnen sagen. ›Der verlorene Sohn kehrt heim.‹ Macht man das für Sie auch, wenn Sie nach Hause kommen? Natürlich macht man das. Sie sind ein Rockstar. Tun Sie bloß nicht bescheiden.«
Maggie zögerte, ein Innehalten, das ihr vertraut war. Einerseits wollte sie nicht auf dem Punkt herumreiten, wollte nicht pedantisch oder als öde Wortklauberin erscheinen oder als zu anspruchsvoll. Andererseits erkannte sie die ausweichende Antwort eines Politikers, wenn sie eine hörte.
So sehe ich Sie bedeutete nicht das Gleiche wie Ja.
»Also ist das ein Ja? Designiertes Mitglied im nationalen Sicherheitsteam?«
Harrison seufzte leise, aber er fasste sich schnell und blitzte sie mit seinen blendend weißen Zähnen an. Er hatte sie anscheinend kürzlich frisch bleichen lassen, zweifellos wegen des anstehenden Wahlkampfs. »Schauen Sie, am liebsten würde ich Ihnen so viel Spielraum geben wie möglich. Freie Hand.« Er legte das ganze Gesicht in Falten. »Ich möchte Sie nicht mit einem engen kleinen Titel festlegen. Ihnen Grenzen setzen. Dazu sind Sie zu groß.«
Sie lächelte und rief sich ins Bewusstsein, dass in Washington ein Kompliment nur mit großer Vorsicht angenommen werden sollte. Fast immer handelte es sich um ein Ablenkungsmanöver oder einen Trostpreis, ein Zeichen, dass man das eigentliche Ziel verfehlt hatte.
»Sie wollen, dass ich für andere Dinge frei bin.«
»Ich möchte, dass Sie während des ganzen Wahlkampfs Autorität haben.«
»Falls uns irgendetwas um die Ohren fliegt.«
»Genau. Sie haben es begriffen.«
»Also Troubleshooterin.«
»Ja! Ich meine, nein. Ganz und gar nicht.«
»Es ist okay. Wenn es Ihnen darum geht, brauchen Sie es nur zu sagen.«
»Nein, verstehen Sie mich nicht falsch. So meine ich das nicht … aber andererseits … Sehen Sie, jetzt haben Sie mich ganz durcheinandergebracht. Ich wette, das hören Sie von vielen, hm? Nein, im Ernst, Maggie. Ich schätze Ihre Erfahrung auf dem Gebiet der Außenpolitik. Wirklich. Aber wenn wir in Turbulenzen geraten – und ich habe nicht vor, es so weit kommen zu lassen, glauben Sie mir –, aber wenn wir unruhige Luftmassen durchfliegen müssen, dann möchte ich mich gern an den Navigationsoffizier meines Vertrauens wenden können. Und das könnten dann sehr gut Sie sein, Maggie. Ich sage Ihnen nur, was Sie schon wissen. Sprechen Sie mit jedem in der Stadt, und er wird es Ihnen sagen: ›Wenn man in die Grube fällt, dann will man Maggie Costello an seiner Seite haben – denn, bei Gott, sie holt einen da wieder raus.‹«
Danach ging es um den Stand des Wettlaufs zum Amt; er habe sich bereits die wichtigsten Unterstützer gesichert, und jetzt sähen die Dinge, klopf auf Holz, schon sehr gut aus. Er vergewisserte sich, dass sie trotz ihrer irischen Herkunft im Besitz der vollen US-Bürgerrechte war. Maggie bestätigte es. Ja, sie sei bereits vor Jahren eingebürgert worden und habe vom FBI die Ermächtigung erhalten, für die vorherigen Regierungen zu arbeiten. Daher sollte es kein Problem sein, auch für die nächste tätig zu sein. Beide lächelten sie über das Selbstvertrauen – natürlich ohne Selbstgefälligkeit – dieser Aussage.
Maggie fiel auf, dass der zukünftige Präsident kein einziges Mal über seine Vision für das Land in den nächsten vier Jahren sprach oder programmatische Grundsätze andeutete, weder innen- noch außenpolitischer Art. Dem am nächsten kam noch die Bemerkung, dass dem Nachfolger des amtierenden Präsidenten, wer immer das sei, umfangreiche Aufräumarbeiten bevorstünden. Er müsste das Chaos beseitigen, das der Amtsinhaber verursacht habe und täglich noch verursache. Angesichts der verheerenden letzten Jahre erschien Maggie dieser Ansatz als ausreichend. Allein den angerichteten Schaden zu reparieren war eine Herkulesaufgabe.
Mitarbeiter gingen während des ganzen Gesprächs ein und aus, aber nun blieb jemand mit angespannter Miene an der Tür stehen, die besagte: Jetzt meine ich es ernst – Sie müssen langsam fertig werden. Harrison stand auf, unterdrückte ein leises Ächzen wegen der Anstrengung, schüttelte Maggie die Hand und ging zur Tür. Maggie hatte sich gebückt und in die Handtasche gegriffen, als sie zusammenfuhr, denn sie spürte zwei Hände auf ihren Schultern, die sie leicht nach hinten zogen. Im nächsten Moment atmete ihr jemand ins Ohr, und Harrison flüsterte: »Kann es nicht erwarten, Sie an Bord zu nehmen.«
Unwillkürlich erstarrte sie, und genauso instinktiv zog sie den Hintern ein, als wollte sie verhindern, dass er sie dort kniff oder schlug. Nichts geschah, aber ihr Körper war darauf vorbereitet. Als sie über ihre Schulter sah, war der Politiker schon zur Tür heraus, umgeben von einer Schar aus Mitarbeitern, darunter, wie sie nun bemerkte, mehrere Frauen, von denen wenigstens zwei noch in den Zwanzigern waren.
Kann es nicht erwarten, Sie an Bord zu nehmen. In gewisser Weise eine unschuldige Bemerkung, wie ein männlicher Boss sie machte, um zukünftigen Angestellten zu schmeicheln; egal ob Mann oder Frau. Hinzukommen, dem Team angehören, in die Gang eintreten. Aber es auf diese Weise zu sagen, geflüstert, ins Ohr gehaucht, hatte einen anderen Beiklang. Einen, der in etwa auf Folgendes hinauslief: Kann es nicht erwarten, Sie zu nehmen.
Bei diesem Tonfall, und weil die Bemerkung sich nur an sie gerichtet hatte, absichtlich außer Hörweite der übrigen Teamangehörigen, klang sogar das »an Bord« irgendwie sexuell, als wäre es ein Euphemismus für etwas anderes. An Bord, am Bett, im Bett. Kann es nicht erwarten, Sie zu nehmen.
Die Gedanken galoppierten im Wettlauf, während sie erstarrt im Besprechungsraum stand. Ihr Gesicht war heiß; sie war rot geworden.
Im nächsten Moment überfiel Maggie die Erkenntnis, dass sie nichts gesagt hatte – dass sie stumm dagestanden, kein einziges Wort, nicht einmal einen Laut des Protests herausgebracht hatte. Mit dem Begreifen kam Wut. Nicht primär auf ihn, den möglichen, ja wahrscheinlichen nächsten US-Präsidenten, sondern auf sich selbst. Wie konnte es sein, dass sie nichts sagte? Wieso hatte sie ihm erlaubt, sie so übergriffig anzufassen, sie fast zu massieren? Was für ein Beispiel hatte sie damit den beiden jungen Frauen in seinem Gefolge gegeben? Hatte sie ihnen durch ihr Schweigen nicht gesagt, dass man nichts tun könne, dass Widerstand unmöglich sei, dass sie es einfach über sich ergehen lassen müssten? Wenn sogar Maggie Costello, eine anerkannte Mitspielerin des Washingtoner Geschehens mit wohlverdientem Ruf, nicht zurückschlagen konnte, welche Hoffnung hatten dann erst sie?
Als sie ihre Handtasche ergriffen hatte und zur Tür ging, setzte die Gegenreaktion ein: Vielleicht übertrieb sie es einfach. Es war eine freundliche Geste gewesen. Eine kleine Schultermassage, schwerlich das Ende der Welt. Und er ist ein alter Mann aus einer anderen Zeit. Als er aufwuchs, waren Männer eben so; niemand hat ihnen je gesagt, dass sie sich falsch verhielten. Außerdem mögen die Leute freundliche, menschliche Politiker, nicht wahr? Beschweren wir uns nicht ständig, wenn sie zu roboterhaft sind, zu sehr Manager, zu schulmeisterlich? Was er getan hat, unterscheidet sich nicht von einem Schulterklopfen und einem ermutigenden Wort: Gut, Sie dabeizuhaben. Komm darüber hinweg.
Im Fahrstuhl nach unten ließ sie die beiden inneren Stimmen die Sache ausfechten, und als Maggie wieder draußen auf der Straße stand, bestand ihr Hauptgedanke in dem Unglauben, dass sie schon wieder diesen inneren Streit durchlitt. Wie oft hatte sie das während ihrer Karriere schon durchgemacht, im Laufe ihres Lebens? Eine kleine unbedeutende Geste oder Bemerkung, die einen aus dem Gleichgewicht brachte, sogar erschütterte, aber nicht so stark beeinträchtigte, dass man deswegen etwas unternahm. Diese Episode, die in der Grauzone blieb und einen ohne klare Vorstellung zurückließ, was zu tun war.
Sie winkte ein Taxi heran und wollte schon eine E-Mail an die Wahlkampfleitung schicken, in der sie dankend ablehnte. Doch sie überlegte es sich. Vorschnell: Wenn sie das tat, würden sie annehmen, dass sie damit auf das reagierte, was gerade geschehen war. Allein daraus schon würde sich etwas entwickeln. Im Augenblick wollte sie aber nicht, dass sich etwas daraus entwickelte. Nicht zuletzt, weil Tom Harrison vielleicht die Wahl gewann und sie weiterhin in dieser Stadt zu Mittag essen wollte.
Stattdessen öffnete sie eine WhatsApp-Nachricht von ihrer Schwester, eingetroffen vor fast einer Stunde, als sie noch in der Sitzung war.
Darin stand nur: Wow! Angehängt war ein Videoclip, den Maggie schon kannte, denn seit Ende vergangener Woche wurde er wie verrückt geteilt. Aber dass Liz ihn an sie weitergeben wollte, weckte dennoch Maggies Interesse. Obwohl sie es Liz niemals ins Gesicht gesagt hätte, diente ihre Schwester ihr als einköpfige weibliche Fokusgruppe, als verlässliche Sprecherin für die wirkliche Welt. Als Lehrerin und Mutter zweier Kinder, die in Atlanta wohnte, hatte Liz das politische Tagesgeschäft nie kennengelernt, geschweige denn zu ihrer Existenz gemacht. Dieser Umstand hatte in Maggies Kopf ein Arbeitsprinzip erschaffen, das ihr mittlerweile wie ein politisches Naturgesetz erschien: Wenn etwas – die Botschaft eines Kandidaten oder ein politischer Skandal – Liz erreicht hatte, dann wusste jeder im Land davon. Dann war es wirklich zu den Menschen durchgedrungen.
Maggie klickte das Video an, zum vierten Mal. Sie wollte es mit den Augen ihrer Schwester betrachten und war neugierig, was Liz darin gesehen hatte. Bereits zwei Millionen Mal, informierte das Smartphone sie, war der zweiundvierzigsekündige Videoclip aufgerufen worden. Er zeigte eine Frau Mitte dreißig mit kurzen dunklen Haaren und zwingenden grünen Augen. Maggie las die Kommentare, die darunter gepostet waren, einschließlich dem eines Journalisten, der zu den Ersten gehört hatte, die das Video teilten, mit diesen Worten:
Wenn unsere Politik kaputt ist, und das ist sie, müssen wir uns vielleicht woanders umschauen als bei der konventionellen Politik und den konventionellen Politikern. Vielleicht wird es Zeit, uns jemanden zu suchen, der frisch und unbefleckt ist. Jemanden, der andere inspiriert und ein echtes menschliches Wesen ist. Jemanden wie Natasha Winthrop.
KAPITEL 3
Washington, D. C., einige Stunden zuvor
Nachdem sie den Notruf gewählt hatte, rührte Natasha Winthrop sich kaum. Minute um Minute stand sie in ihrem Arbeitszimmer und starrte auf den reglosen Körper auf dem Fußboden. Sein Anblick lähmte sie.
Ihr Entsetzen erschien ihr jetzt womöglich größer, als es gewesen war, während er noch lebte. Da hatte sie wenigstens noch unter Adrenalin gestanden. Jetzt sank der Pegel und hinterließ blanke Furcht. Sie konnte den Blick nicht von dem Mann zu ihren Füßen nehmen, nicht von dessen weit offen stehenden Augen. Das war das Merkwürdigste: Sie war allein im Haus, aber nicht ganz allein. Sie war mit ihm hier.
Die Stimme der Vernunft, die innere Stimme, der sie gewöhnlich am meisten vertraute, sagte ihr, dass »er« nun ein »Es« sei. Dass seine Leiche keine Gefahr mehr darstelle, dass sie ihr kein Leid zufügen konnte. Aber sie hörte nicht auf diese Stimme. Sie konnte sie kaum hören. Die Stimme wurde übertönt von der nackten Angst, die durch ihre Adern pumpte.
Die Angst setzte sich aus mehreren Komponenten zusammen. Angst vor einem Leichnam, ganz gewiss. Wenn sie mehr Strafrecht behandelt hätte, dachte sie, mehr Mordfälle bearbeitet, hätte sie sich vielleicht schon vor Jahren an solch einen Anblick gewöhnt. Aber für sie war allein die Gegenwart eines Toten absolut entsetzlich. Hinzu kam die urtümliche Angst vor einem Eindringling im eigenen Haus, gleich hier im selben Zimmer. Diese Angst war nicht abgeflaut, bloß weil der Einbrecher tot war. Nach wie vor beherrschte sie die Angst vor dem, was er ihr antun wollte, was er ihr angetan hatte. Sein Gesicht war noch immer da. Sie konnte es ansehen.
Zweimal stellte sie sich vor, wie er erneut die Oberhand gewinnen würde, als wäre sein regloser Zustand etwas Vorübergehendes, als könnte er sich aufrappeln und weitermachen. Vielleicht war es bloß ein Trick, damit sie in ihrer Wachsamkeit nachließ. Vielleicht verschaffte es ihm einen zusätzlichen Kick, sich totzustellen.
Auf seltsame Weise glaubte sie nicht, dass sie ihn getötet hatte. Er war ein kräftiger, gewalttätiger Mann. Monströs war er. Dass sie ihn besiegt haben sollte, leuchtete ihr nicht ein. Sicher, sie war fit: Sie konnte ohne große Schwierigkeiten zehn Kilometer rennen. Sie war relativ hochgewachsen.
Aber die Vorstellung, dass sie einen Mann wie ihn überwältigt haben sollte – einen Mann wie ihn in die Knie gezwungen und getötet … Wie sollte so etwas möglich sein? Dafür musste es eine andere Erklärung geben; eine abweichende Tatsache, die ihr nur nicht bekannt war.
Stundenlang blieb sie gelähmt, wie sie war; zumindest kam es ihr so vor. Sie bewegte sich erst, als ihr bewusst wurde, dass ihre Bluse nass war, weil er seine Spuren auf ihr hinterlassen hatte. Sie empfand den unbändigen Drang, das Kleidungsstück auszuziehen, sich auf der Stelle davon zu befreien. Sie knöpfte die Bluse auf und streifte sie ab.
Da schaltete sich die Stimme der Vernunft, die Juristenstimme, ein und befahl ihr, innezuhalten. Sie musste bleiben, wie sie war. Sie durfte nicht die geringste Kleinigkeit ändern. Die Polizei musste die Bluse an ihr vorfinden, unverfälscht … kontaminiert. Sie musste den Polizisten zeigen, was geschehen war. Die Bluse war Beweismaterial. Eine Spur.
Eine Erinnerung stieg in ihr auf, die Erinnerung an eine Kollegin, die vor einer Gruppe von Anwältinnen einen Vortrag über Vergewaltigungsfälle gehalten hatte und später zu einer Freundin geworden war. Sie hatte ausgeführt, dass zahlreiche Vergewaltiger sexuelle Funktionsstörungen an den Tag legten. Entweder könnten sie keine Erektion bekommen, und wenn doch, neigten sie zu vorzeitigem Samenerguss.
»Das Seltsame ist, dass es ihnen offenbar egal ist«, hatte ihre Freundin der Gruppe erklärt, die gebannt zuhörte. »Für sie ist die Penetration nicht das Wichtigste.« Der große Kick kam für solche Leute anscheinend erst später, wenn sie sich vor Augen führten, was sie getan hatten, und masturbierten: Insbesondere genossen sie dabei die Ängste, die ihr Opfer ausgestanden hatte. Diese Angst war, was sie erregte. Natasha schauderte es bei der Erinnerung an den Vortrag.
Und dann kam er, der laute dumpfe Schlag. Ein einzelnes Geräusch. Hier ist noch jemand, dachte sie. Sie rührte sich nicht. Sie wartete auf ein zweites Geräusch, das Knarren einer Bohle über ihr, die ihr die Richtung verriet, in die der zweite Einbrecher ging. Dann wüsste sie sicher, wer hier war und wie nah er war.
Als es ertönte, war das Geräusch deutlich und konstant. Wiederholte sich dreimal. Aber es kam aus der falschen Richtung. Es schien von draußen zu kommen.
Sie brauchte einen langen Augenblick – zehn, fünfzehn Sekunden –, um zu begreifen, dass sie gehört hatte, wie jemand an die Tür klopfte. Erst als ihr das, mit einem Bruchteil der normalen Geschwindigkeit, bewusst geworden war, vernahm sie das Klopfen erneut. Und eine Stimme. »Miss Winthorpe? Miss Winthorpe, hören Sie mich? Hier ist die Polizei.«
Da sank ihr Adrenalinspiegel noch weiter. Bis hierhin, begriff sie, hatte sie sich in einem Zustand erhöhter Aufmerksamkeit befunden und noch die kleinste Kleinigkeit wahrgenommen. Sie sah sich als ein Tier, bei dem sich jedes einzelne Haar seines Fells aufgestellt hatte, dessen Nüstern zuckten, bei dem jede Nervenendung auf das leiseste Geräusch, den schwächsten Geruch oder das geringfügigste Gefahrensignal achtete. Jetzt aber, wo noch jemand im Haus war – um ihr zu helfen –, ließ ihre Wachsamkeit nach und gestattete dem Adrenalinpegel abzusacken. Die Folge war völlige Erschöpfung.
Sie sah zu, wie eine Vielzahl unterschiedlicher Leute eintraf und das Haus immer voller wurde. Sie konnte ihre Namen nicht aufnehmen, und wie immer hatten sie Schwierigkeiten mit ihrem Namen. »Ich heiße Winthrop«, hörte sie sich mehrmals sagen. »Nicht Winthorpe. Winthrop.«
Was ihr jedoch auffiel, von Anfang an: eine Unschlüssigkeit in ihren Gesichtern, die ihr verriet, dass die Situation vom kriminalistischen Standpunkt her unangenehm kompliziert war. Sie sah es an den beiden Streifenbeamtinnen, die zuerst ans Haus kamen: zwei junge Frauen, eine Afroamerikanerin und eine Latina, beide schwer bewaffnet. Sie schienen unsicher, wie sie Natasha ansprechen sollten. Sollten sie den mitfühlenden Tonfall anschlagen, den sie zweifellos in der Ausbildung lernten und welcher Situationen vorbehalten war, in denen sie es mit Opfern von sexualisierter Gewalt, von Vergewaltigung zu tun hatten? Sollten sie Natasha hinsetzen, ihr eine Tasse Kaffee machen und sie bei der Hand nehmen? Oder sollten sie formell und vorsichtig bleiben, denn immerhin hatten sie es mit einer Frau zu tun, die für eine Leiche auf dem Fußboden verantwortlich war?
Sie lösten das Dilemma, indem sie so gut wie nichts sagten. Jedenfalls nicht zu Natasha. Stattdessen sprachen sie in ihre Funkgeräte, redeten mit »Dispatch« und einer Vielzahl anderer Stimmen, die aus dem Rauschen und Knistern drangen.
Sie beobachteten sie aber: Sie stellten sicher, dass sie nichts anrührte und nirgendwohin ging.
Nicht lange, und im Haus wimmelte es von Menschen. Manche trugen volle forensische Ausstattung: Latexhandschuhe und Schuhüberzieher aus Papier. Als gingen sie gleich in den OP. Natasha wurde aus dem Arbeitszimmer geführt. Aber die Leiche – er – blieb dort zurück.
Unter den verschiedenen Detectives und vorgesetzten Streifenbeamten war eine Frau, deren alleinige Aufgabe darin bestand, sich um Natasha zu kümmern.
Sie hieß Sandra und stellte sich als Betreuerin vor, aber jemand anders bezeichnete sie als Sexual Offences Investigative Techniques Officer, eine Spezialistin für die Untersuchung von Sexualstraftaten. Sandra war tüchtig und effizient, hatte aber eine angemessen weiche Stimme und erklärte, was geschehen musste, einen Schritt nach dem anderen. Oft beendete sie einen Satz mit »Können Sie das für mich tun?« oder »Ist das für Sie in Ordnung, Natasha?«.
Als Erstes brachte Sandra sie ins Schlafzimmer, damit sie sich umziehen konnte, langsam und sehr vorsichtig. Sowie Natasha ein Kleidungsstück ablegte, nahm Sandra es entgegen und steckte es in seinen eigenen Plastikbeutel mit Druckverschluss. Sie trug dabei Latexhandschuhe und erläuterte, dass jedes einzelne Stück einen winzigen Fleck mit DNA aufweisen könnte, mit dem man den »Angreifer« identifizieren würde.
Sie benutzte dieses Wort. Allmählich dämmerte es Natasha, dass der Tatort des Vergewaltigungsversuchs an ihr nicht das Arbeitszimmer im Erdgeschoss war – der Schauplatz des Verbrechens war vielmehr ihr eigener Körper.
Normalerweise hätte die Vorstellung, sich vor einer Fremden auszuziehen – und zwar vollständig –, Natasha aus der Fassung gebracht. (Allerdings nicht so sehr wie manch andere Frau: Wenn man sich einmal in einem Internat in Massachusetts das Zimmer mit fünf anderen Mädchen geteilt hat, stellt Privatsphäre ein eher relatives Konzept dar.) Sie war jedoch zu betäubt, um sich zu widersetzen.
Einmal fragte Natasha, ob sie das Bad benutzen dürfe.
»Ich weiß, dass das wirklich schwierig ist, aber es wäre besser, wenn Sie noch ein wenig einhalten würden, bis ein Arzt Sie untersucht hat«, sagte Sandra. »Schaffen Sie das für mich?«
Sandra redete mit ihr, als wäre Natasha erst sieben. Normalerweise hätte sie die Polizistin dafür heruntergeputzt. Jetzt aber tat Natasha, was ihr gesagt wurde, langsam und benommen. Als hätte sie an sich selbst den Schalter auf »Energiesparmodus« umgelegt.
Am Ende wurde sie, nun in einer sackartigen Jogginghose und einer weiten Fleecejacke, nach unten geführt. Das Erdgeschoss war unvertraut: Bereiche waren mit Band abgesperrt, allerorts fuhrwerkten Beamte in weißen Kriminaltechnikeranzügen, und über allem lag das Geknister von Polizeifunkgeräten. Natasha setzte sich auf den Platz, den Sandra ihr zuwies.
Sie konnte nicht sagen, wie viel Zeit verstrich. Es konnten Minuten, es mochten Stunden gewesen sein. Sie merkte, dass ihre Bewegungen sich genauso verlangsamt hatten wie ihre Auffassung dessen, was um sie herum vorging. Sie fühlte sich gedämpft. Trotzdem fiel ihr eines ins Auge.
Sie beobachtete zwei Polizeibeamte – eine der beiden Frauen, die zuerst eingetroffen waren, und einen höheren Detective – in ein Gespräch vertieft.
Sie erstattete ihm Bericht und las aus ihrem Notizbuch vor. Der Detective hörte ihr aufmerksam zu und nickte dabei.
Vielleicht lag es an ihrem Beruf, aber Natasha verstand, Situationen wie diese einzuordnen. Vor Gericht war es immer nützlich, wenn man merkte, ob jemand etwas hörte, das ihm neu oder für ihn heikel war. Und genau das sah sie jetzt. Augenblicklich, ganz ungeachtet dessen, wie benebelt ihr Gehirn vom Schock war, sah sie, dass dieses Gespräch zwischen den beiden Polizeibeamten keine Routineangelegenheit darstellte.
Die junge Polizistin berichtete ihrem Vorgesetzten etwas Wichtiges und Erstaunliches. So viel stand beiden ins Gesicht geschrieben. In den Augen des Detectives zeigte sich zuerst Überraschung, dann Interesse, schließlich eine Art Genugtuung, als hätten sich seine Vermutungen in einem entscheidenden Punkt als richtig erwiesen.
In diesem Moment war Natasha sicher, dass die Polizei etwas gefunden hatte. Und ohne zu wissen, wie oder wieso oder worum es sich handelte, wusste sie, dass es bei den Ermittlern den Verdacht erweckt hatte, sie habe ihnen nicht die ganze Geschichte erzählt.
KAPITEL 4
Washington, D. C., Präsidium, Metropolitan Police Department Columbia
Der 7-Uhr-45-Besprechung saß der Mann vor, der allgemein – bei seinen Kritikern, Kollegen und vielleicht sogar im engsten Familienkreis – als Ratface bekannt war. Sein offizieller Titel lautete Assistant Chief of Police of the Metropolitan Police Department for Washington, D. C. (Investigative Services), aber jeder im Raum nannte ihn Ratface. Der Spitzname besaß weder eine verborgene Bedeutung, noch spielte er auf etwas an; er war wörtlich gemeint: Der Assistant Chief hatte ein Gesicht wie eine Ratte.
Gewöhnlich war die Besprechung langweilig, eine Vorlesestunde. Die sieben Distriktleiter des Departments brachten die Kollegen auf den aktuellen Stand zu laufenden Ermittlungen und neuen Fällen, die sich im Lauf der Nacht ergeben hatten. Als wäre die Aufstellung von Fällen eine Einkaufsliste, betete jeder der sieben sie mit einer Monotonie herunter, die andeutete, jeder einzelne Stichpunkt sei Routinesache und erfordere keine weitere Diskussion. Die Sitzung diente der Kontrolle ihrer Arbeit, und naturgemäß legten es alle Teilnehmer darauf an, ihre Arbeit so wenig Kontrolle auszusetzen wie möglich.
Idealerweise gar keiner.
Die Leiterin des Vierten Distrikts hatte ihre Liste gerade abgearbeitet und verkündet, die Untersuchung des mutmaßlichen Brandanschlags auf ein Gemeindezentrum, durchgeführt mit den Kollegen vom Fire and Emergency Medical Services Department, gehe »in gewohntem Tempo« voran – was bedeutete, dass keine Fortschritte erzielt wurden –, als ihr Amtskollege vom Zweiten Distrikt, welcher Georgetown einschloss, sich räusperte.
Ratface nahm es zum Anlass, mit dem Stuhl nach vorn zu rücken. Lautstark.
Er beugte sich vor, seine Körpersprache verriet besonderes Interesse. Der Distriktleiter sah auf, bemerkte die Bewegung, griff nach einem Kuli und kritzelte etwas auf seine Liste. 7-Uhr-45-Veteranen vermuteten, dass er hastig seine Reihenfolge angepasst hatte.
Entsprechend begann er: »Georgetown: mutmaßlicher Vergewaltigungsversuch an weiblicher Weißer, sechsunddreißig, der zum Tod des Angreifers führte. Opfer wurde in der Nacht medizinischer Untersuchung unterzogen und wird heute Morgen vernommen. Dupont Circle: Straßenraub mit gefährlicher Körperverletzung durch Messer–«
»Moment.« Ratface vereitelte den Versuch, zum nächsten Punkt überzugehen. »Könnten wir bitte den Namen des Opfers erfahren?«
Widerstrebend antwortete der Bezirksleiter: »Natasha Winthrop.«
Der Raum quittierte diese Neuigkeit mit einer Mischung aus Keuchen, einem Pfiff und der Erklärung eines älteren Beamten: »Fuck Jesus!«
»Den vollständigen Bericht bitte«, sagte Ratface.
Eine kurze Schilderung der nächtlichen Ereignisse folgte, untermalt von einigem ungläubigen Kopfschütteln sowohl über die Vorstellung, dass eine junge Anwältin einen Mann mit bloßen Händen getötet haben sollte, als auch die Tatsache, dass fragliche Anwältin auf bestem Weg war, zur landesweiten Berühmtheit zu werden.
»Wer leitet die Ermittlungen?«, fragte Ratface. Zur Antwort erhielt er: Da der Vorfall sich erst vor wenigen Stunden ereignet hatte, konnte das Morddezernat noch nicht übernehmen. Zwei Beamte des zuständigen Distrikts bearbeiteten den Fall, unterstützt von einer Spezialistin für Sexualverbrechen.
Ratface verzog das Gesicht. Er biss auf seinen Kugelschreiber und starrte in die Runde, während er, wie seine Kollegen annahmen, innerlich abwog, was seinem Ehrgeiz, Polizeichef der Landeshauptstadt zu werden, nützte und was nicht. Die gleichen Abwägungen, die er zu jeder Minute eines jeden Arbeitstages traf, an Abenden und an Wochenenden. Schließlich ergriff er das Wort.
»Wie wir alle wissen, ist diese Person sehr bekannt. Jeder einzelne Aspekt unserer Arbeit wird genauestens beobachtet werden. Presse, soziale Netzwerke. Die feministische Gemeinde im Besonderen wird sehr rasch mit einer Bewertung zur Hand sein, wie wir einen Vergewaltigungsfall untersuchen.«
»Ein falscher Schritt, und wir haben das OPC am Hals«, warf ein Kollege ein (vielleicht als Auflehnung gegen die Zimperlichkeit von »feministische Gemeinde«). Natasha Winthrop hatte mehrere Fälle vertreten, in die das Office of Police Complaints involviert war, das sich bei Beschwerden gegen die Polizei einschaltete. Das Nicken, das auf die Bemerkung folgte, deutete an, dass der Kollege nicht unrecht hatte. Natasha war einmal die Anwältin der Wahl gewesen für jene Personen, denen von der Polizei etwas angehängt wurde, die verprügelt oder sogar getötet worden waren. Jeder im Raum begriff: Es wäre nicht sonderlich schlau, einer Natasha Winthrop etwas anzuhängen.
Ratface kaute wieder an seinem Kuli, dann erteilte er einen Befehl: »Die ermittelnden Beamten geben die Ermittlungen ab. Der Fall muss auf Distriktleiterebene untersucht werden. Täglicher Bericht direkt an mich.«
KAPITEL 5
Washington, D. C., einige Stunden zuvor
Natasha Winthrop rühmte sich ihres Richtungssinns, ihres räumlichen Bewusstseins und ihres Gedächtnisses für Orientierungspunkte. Gemeinsam sorgten sie dafür, dass sie sich nur selten verlief. Aber jetzt hatten sie sie im Stich gelassen.
Zuerst sagte sie sich, es liege daran, dass es dunkel war oder sie sich in einem unvertrauten Teil der Stadt befand; im Südwestquadranten, den sie kaum kannte. Vielleicht kam es auch daher, weil sie nicht selbst fuhr, sondern Passagierin war und neben der wachsamen Sandra auf dem Rücksitz eines Polizeiwagens saß. Aber hin und wieder bahnte sich die wahrscheinlichere Erklärung einen Weg durch ihre Gedanken: Vor nicht allzu langer Zeit war sie einem gewalttätigen sexuellen Übergriff zum Opfer gefallen und hatte einen Mann getötet. Kein Wunder, dass sie keine Ahnung hatte, wo sie nun war.
Nur eines fiel ihr ins Auge, während sie leere Straßen durchquerten: die Schilder, die zum »Hospital« wiesen. Sie hätte nicht zu sagen gewusst, welches Krankenhaus gemeint war, aber dorthin waren sie unterwegs: zum »Hospital«. Nachdem sie es erreicht hatten, fuhren sie an der Hauptpforte vorbei und parkten vor einem unbeschilderten Seiteneingang in einem abseits gelegenen Nebenflügel.
Vor langer Zeit hatte sie Orte wie diesen besucht; damals, als sie noch solche Fälle vertrat, wenngleich es nicht viele gewesen waren. Sie erkannte den gleichen heldenhaften Versuch, so zu tun, als ginge es um etwas anderes, und die Stimmung aufzulockern: Blumendrucke an den Wänden, kleine Potpourri-Beutel mit wohlriechenden Pflanzenteilen. Die vergebliche Anstrengung, so zu tun, als wäre man zu einer Massage gekommen und nicht zu einer forensischen Untersuchung, als wären sie im Wellnessbereich eines Hotels und nicht in einer gerichtsmedizinischen Einrichtung.
Sandra brachte sie in ein Zimmer, das sie als Vorbereitungsraum bezeichnete. Zwei Stühle standen einander gegenüber, dazwischen ein niedriger Couchtisch. Natasha blickte sich um, an den Wänden noch mehr nichtssagende Kunst. Sie bemerkte, dass alles plastikbeschichtet war: Sogar die Sitzflächen waren leicht zu reinigen. Der Raum war steril, dazu angelegt, jegliche Kontamination von Beweismaterial zu verhüten.
Und das Beweismaterial waren erneut Natasha und ihr Körper.
Sandra verließ den Raum in einen Korridor, aber sie war noch immer zu hören. Natasha konnte nicht verstehen, was sie sagte, aber sie hörte Sandras Stimme und immer wieder kurze Antworten von einer anderen Frau. Sie flüsterten nicht, aber unverkennbar tauschten sie mit gedämpfter Lautstärke vertrauliche Informationen aus.
Wies sie die Ärztin ein, die die Untersuchung vornehmen sollte? Oder sprachen sie über das, was immer die Polizei im Haus entdeckt hatte, das mit keiner Silbe erwähnte Belastungsmaterial? Natasha bemerkte die gleiche Unsicherheit, die sie schon zuvor empfunden hatte: Diese Leute wussten nicht, ob man sie wie das Opfer eines gewalttätigen sexuellen Übergriffs oder wie die Verdächtige in einem Mordfall behandeln sollte.
Es dauerte nicht lange, und die Ärztin kam herein – mittellange grau melierte Haare; freundliches Gesicht – und erklärte den Ablauf. Sie werde Natasha am ganzen Körper untersuchen. Der Vorgang werde einige Zeit beanspruchen, weil sie sichergehen müsse, dass sie nichts übersah. Und dass Natasha sich melden möge, wenn irgendetwas ihr unangenehm war; sie würden dann eine Pause einlegen. Sie betonte, dass sie als Patientin hier das Sagen habe und nichts geschehen würde, von dem Natasha nicht wollte, dass es geschah.
Natasha begriff durchaus, was die Ärztin tat – fast sah sie die entsprechende Seite im Handbuch vor sich, die Polizei und medizinisches Personal davor warnte, die Opfer einer zweiten Tortur zu unterziehen. Sie fragte sich aber, ob sie bei ihr wohl besonders sorgsam vorgingen. Unter »Beruf« hatte sie immerhin nur das eine Wort »Anwältin« angegeben.
Natasha legte sich auf die Untersuchungsliege, schloss die Augen und sagte sich, dass es auch nicht anders wäre als bei ihrer Gynäkologin. Sie ließ die Ärztin tun, was sie tun musste: Abstriche vornehmen, mustern, studieren, sondieren. Sie merkte genau, wann die Frau innehielt, wann sie einen Augenblick lang zögerte. Was hatte sie gesehen? Einen Kratzer? Einen Daumenabdruck, wo der Mann Natasha eine Quetschung zugefügt hatte?
Natasha behielt die Augen geschlossen, solange die Untersuchung ablief, was Stunden dauerte, wie ihr schien. Während die Ärztin arbeitete, schickte sie sich fort, eine Technik, die sie vor langer Zeit erlernt hatte. Der Trick bestand darin, sich in den Himmel zu heben, über dem Moment zu schweben und sich davon abzutrennen: ein selbst herbeigeführtes außerkörperliches Erlebnis. Leicht war es nicht.
Irgendwann war die Untersuchung beendet. Man bot Natasha an, sie zu einer Freundin zu fahren oder »hier in der Einrichtung« zu bleiben und zu duschen. In ihr eigenes Haus zurückzukehren sei »zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich, Ma’am«. Das Haus sei ein Tatort, den sie nicht verändern wollten.
Natasha murmelte etwas von »wieder aufs Pferd steigen«, denn sie sorgte sich, dass sie in dem Haus nie wieder schlafen wollte, wenn sie zu lange fernblieb. Doch die Beamtin sah sie ausdruckslos an und wartete, dass sie sich für eine der beiden Wahlmöglichkeiten entschied.
Natasha sagte, sie würde bleiben und sich duschen, »und zwar sofort, bitte«. Seit es geschehen war, juckte es sie, sich zu säubern: Sie spürte seine … Flüssigkeit noch immer auf ihrer Haut, oder wenigstens kam es ihr so vor. Sie wollte das Zeug endlich los sein.
Sie duschte ausgiebig, aber es schenkte ihr weder Behagen noch Erleichterung. So heftig sie sich abschrubbte, nie hatte sie das Gefühl, sauber zu werden. Sie hörte erst auf, als das warme Wasser versiegte.
Auf einer harten, schmalen Matratze, die sehr an die Untersuchungsliege erinnerte, schlief sie zwei Stunden lang erschöpft und ruhelos. Sie bekam keine Albträume, an die sie sich erinnerte. Stattdessen schreckte sie ungefähr alle zwanzig Minuten hoch; einmal heftig keuchend. Bei jedem Aufwachen überfiel sie die frische Erinnerung an das, was vor wenigen Stunden geschehen war. Einen Sekundenbruchteil lang hoffte sie, alles wäre nur ein Irrtum – dass sie es sich nur eingebildet hätte. Diese Hoffnung verflog jedoch genauso schnell, wie sie gekommen war, verscheucht von der Erkenntnis, dass sie keineswegs geträumt hatte, sondern dass ihr Erlebnis Wirklichkeit war.
Immer wieder trat ihr ein Bild vor Augen. Ungebeten sah sie den gerade erst Verstorbenen vor sich. Seine feuchte Kleidung. Das Gesicht.
Einige Stunden später hörte sie von draußen mehr Geflüster. Innerhalb weniger Minuten fand sich Natasha Winthrop in einem Vernehmungsraum wieder. Sie saß zwei Detectives gegenüber, einem Mann und einer Frau. Die Frau – weiß, Ende vierzig, dunkle Haare, an den Wurzeln grau – stellte sich als Marcia Chester vor. Ihr Gesicht war faltig und schien von sehr feinem Staub besetzt; Grundierung vielleicht, die sie am Vortag aufgetragen hatte. Sie wirkte müde, aber auf eine Weise, die nahelegte, dass ihre Erschöpfung struktureller Art war: ein Leben, geprägt von harter Arbeit und ständigem Stress. Natasha kannte viele Frauen wie sie; sie zeigte ein Lächeln, von dem sie hoffte, dass es Empathie und Solidarität von einer Frau zur anderen signalisierte. Die Kriminalbeamtin erwiderte es nicht, sondern blätterte in dem Aktenordner, der offen vor ihr auf dem Schreibtisch lag.
Der Mann war jünger: schwarz, Brille, aber eher Bücherwurm als Hipster. Er stellte sich als Adrian Allen vor.
Chester begann, was bedeutete, dass sie die Vorgesetzte war. Sie bat Natasha, ihren Namen zu nennen, ihr Geburtsdatum, ihre Adresse. Die Befragung werde aufgezeichnet, sagte sie.
»Können Sie uns schildern, was sich in der vergangenen Nacht an Ihrer Privatanschrift ereignet hat?«
Vielleicht war es die Anforderung, dass man ihr eine direkte Frage stellte, was sie an ihren Berufsalltag erinnerte und aufweckte. Bei diesem Ersuchen jedenfalls räusperte sich Natasha und legte den Gang ein. Sie zwang sich, die Trägheit abzuschütteln, die ihre Entkörperlichung vorhin hinterlassen hatte. So genau und klar sie konnte, beschrieb sie, was sich ereignet hatte. Sie sprach in selbstbewusstem Ton; sie wusste, was die befragenden Beamten wollten, und war entschlossen, eine gute, nützliche Zeugin zu sein.
Sie war nicht mehr gedämpft.
Ihr half dabei, dass sie genau wusste, wie frustrierend gewöhnliche Bürger sein konnten, wenn sie eine rechtlich relevante Aussage machten. Die Leute wiederholten sich, blieben vage, ließen entscheidende Punkte aus, schwadronierten über Unwesentliches, irrten sich, was die zeitliche Abfolge betraf. Natasha Winthrop wollte der Polizei zeigen, dass sie so nicht war, sondern genauso professionell wie die Beamten, die sie vernahmen.
Aber als sie zu dem Moment kam, in dem sie den Angreifer in der Tür entdeckte, versagte ihr die Stimme. Sie begann zu zittern. Und der Klang ihrer eigenen unsteten Stimme schien einen Schalter umzulegen. Als sie zu Ende erzählt hatte, waren ihre Wangen feucht. Sie griff nach einem Papiertaschentuch, das vor ihr auf dem Tisch lag.
»Können wir einen Schritt zurückgehen?« Das war der Mann.
»Ja.«
»Sie sagen, er sei um Mitternacht in ihrer Tür erschienen?«
»Ja, ungefähr.«
»Sie sind sich nicht sicher?«
»Doch, ich bin mir sicher. Ich erinnere mich an die Uhr auf dem Computerbildschirm. Sie zeigte dreiundzwanzig Uhr neunundfünfzig.«
»Also sind Sie sich sicher.« Das sagte die Frau.
»Ja. Ich bin mir sicher.«
»Warum sagten Sie dann ›ungefähr‹?«
»Ich meinte, ich weiß nicht die genaue Minute, als er in der Tür erschien. Aber ich habe auf die Uhr gesehen, als ich das erste Geräusch im Haus hörte. Und das kann nur eine oder zwei Minuten vorher gewesen sein.«
»Gut.« Chester blätterte auf eine andere Seite in ihrem Aktenordner. »Sie haben eine Kette an der Haustür, richtig?«
»Das stimmt.«
»Aber sie war nicht gerissen.«
»Entschuldigung?«
»Sie war nicht gerissen. Sehen Sie?« Sie zeigte Natasha ein Foto, eine Nahaufnahme von ihrer Haustür, an der die Kette herunterhing wie immer. »Sie ist ganz.«
»Ich hatte sie nicht vorgelegt.«
»Okay«, sagte Allen, als wollte er weitergehen.
»Warum nicht?« Chester war noch nicht zufrieden.
»Ich hatte noch nicht abgeschlossen.«
»Aber es war Mitternacht. Ist das bei Ihnen normal, mitten in der Nacht allein im Haus, ohne die Haustür abzuschließen?«
»Es war nicht mitten in der Nacht. Es war am Abend.«
»Sie sagten, es war Mitternacht.«
»Ich meine, es war Abend gewesen. Ich hatte den Abend durchgearbeitet. Der Abend wäre zu Ende gewesen, sobald ich meine Arbeit beendet hätte. Dann wollte ich abschließen, das Licht ausschalten und zu Bett gehen.«
»Wenn Sie es so sagen.«
»Ich sage es so. Worauf wollen Sie hinaus?«
Allen ergriff das Wort. »Auf gar nichts, Ms Winthrop. Wir versuchen nur, uns ein klares Bild zu verschaffen, ohne dass Fragen offenbleiben.« Er lächelte.
Chester fuhr fort: »Sie haben an dem Abend niemanden erwartet?«
»Nein.«
»Vielleicht Ihren Partner?«
»Nein.« Natasha zögerte, unsicher, wie viel sie preisgeben wollte. »Ich bin Single.«
»Es ist also nicht so, dass Sie die Kette deshalb nicht vorgelegt hatten, weil Sie noch jemanden erwarteten, der vorbeikommen wollte?«
»Nein.«
Chester schlug eine andere Seite auf, als wäre sie unbeeindruckt oder zumindest desinteressiert. Natasha suchte instinktiv ein freundliches Gesicht und schaute zu Allen hinüber. Er schenkte ihr ein gezwungenes Lächeln.
»Also gut«, sagte Chester, als wäre sie bereit, einen anderen Ansatz zu versuchen. »Und der Mann, der Sie angriff – Sie sind sich absolut sicher, dass Sie ihn vorher noch nie gesehen haben?«
»Ich sagte Ihnen schon, er trug eine Maske. Ich habe sein Gesicht nicht gesehen, bevor es vorbei war.«
»Sicher. Aber als Sie es sahen, sahen Sie es da tatsächlich zum ersten Mal?«
»Absolut.«
»Sie kannten den Mann gar nicht?«
»Nein.«
»Sie hatten nicht erwartet, dass er vorbeikommt?«
Bei dieser Frage erhielt Natashas Entschlossenheit, eine ruhige, tüchtige Zeugin und genauso professionell zu sein wie diese Frau, einen Riss.
»›Vorbeikommt‹? Vorbeikommt. Ist Ihnen eigentlich klar, was mir passiert ist? Der Mann hat versucht, mich zu vergewaltigen. Bei Ihnen klingt es, als hätten wir ein Kaffeekränzchen abgehalten.«
»Bitte, Ms Winthrop.« Allen schaltete sich ein. »Meine Kollegin und ich wollen sichergehen, dass wir alles bis aufs i-Tüpfelchen genau verstanden haben. Wir sind nur gründlich.«
»Und Ihnen ist Gründlichkeit doch wichtig, oder?«, fragte Chester.
»Was?«
»Wir haben mit Ihren Nachbarn gesprochen.« Das war eine Feststellung, keine Frage.
»Ja?«
Allen warf ein: »Alle waren sehr besorgt um Sie, das können Sie sich wohl vorstellen.«
»Aber wissen Sie, was seltsam war? Was jedenfalls mir seltsam vorkam?« Chester fixierte Natasha für einen langen Moment, gab ihr Gelegenheit zu antworten, die Andeutung eines Lächelns im Gesicht.
»Nein, das weiß ich nicht. Was?«
»Keiner von ihnen hat einen Schrei gehört.«
»Wie bitte?«
»Keiner von ihnen hat irgendetwas gehört, um genau zu sein. Nichts von einem Einbruch. Das ist okay. Er kann ein Profi gewesen sein und ist in Ihr Haus gelangt, ohne viel Lärm zu verursachen. Ein guter Einbrecher schafft das ohne Weiteres. Aber sie haben auch nichts von Ihnen gehört. Keinen Mucks.«
Der männliche Detective sah Natasha weiterhin an, das Gesicht noch freundlich – oder wenigstens freundlicher als das von Chester –, aber er unternahm nichts, um seine Kollegin zu zügeln. Natasha war sich bewusst, dass er sie prüfend musterte, ihre Reaktion einschätzte, ihre Mimik deutete.
Chester fuhr fort: »Und es war seltsam warm gestern Nacht, nicht wahr. Richtig verrückt für diese Jahreszeit. Wir hatten sogar die Klimaanlage hochgestellt. Und Sie hatten das Fenster geöffnet. In Ihrem häuslichen Arbeitszimmer, meine ich. So eine Nacht war das.« Sie schaute ihren Kollegen an, als suchte sie seine Zustimmung für diese These. »Wenn Sie also einen Laut von sich gegeben hätten, müsste jemand es gehört haben. Die Nachbarn, nicht wahr? Den Schrei einer Frau.«
»Ich bin sicher, ich habe … Ich wollte, aber ich konnte nicht …«
»Ich verstehe Sie«, sagte Allen.
»Nur, man sollte doch glauben, wenn ein fremder Mann einfach so aus dem Nichts in Ihrer Tür erscheint und dort steht – in Ihrem häuslichen Arbeitszimmer –, na, die meisten Frauen, die ich kenne, würden aus vollem Hals aufschreien, meinen Sie nicht auch, Detective Allen?«
»Aber ich …«, versuchte Natasha einzuwerfen.
»Ich meine, das hat man doch nicht in der Hand, oder? Man ist einfach überrascht.«
»Ich sagte es doch schon. Ich war so erschrocken, ich konnte nicht schreien. Ich meine, ich habe bestimmt gekeucht, aber nicht …«
»Das ist der Grund, weshalb ich nachfrage, ein bisschen aus heiterem Himmel vielleicht. Also war es womöglich doch jemand, den Sie kannten?«
»Nein, so war es nicht. Ich hatte ihn noch nie zuvor gesehen.«
»Kein einziges Mal? Nie und nimmer?«
Wieso es ausgerechnet diese Redewendung war, die eine Reaktion bewirkte, konnte Natasha nicht sagen. Aber die Herablassung in diesen drei Wörtern, dieser kindermärchenhaften Formel – nie und nimmer –, brachte sie wieder zu sich selbst zurück.
Zu ihrer Professionalität.
»Was Sie hier andeuten, ist ungeheuerlich. Völlig inakzeptabel. Ich bin einem entsetzlichen Verbrechen zum Opfer gefallen. Ich habe mich gegen einen Vergewaltigungsversuch verteidigt.«
Nun war es Allen, der antwortete. »Niemand deutet hier etwas an, Ms Winthrop. Keineswegs.«
»Ach nein? Indem Sie mir unterstellen, ich hätte den …«
»Wir unterstellen nichts«, entgegnete er. »Wir fragen.«
»Sie fragen, nachdem ich bereits mehrmals erklärt habe, um genau zu sein …«
»Wir versuchen nur, uns absolut sicher zu sein, was die Fakten anbetrifft. Jede Einzelheit genau durchzugehen.«
Als Nebenbemerkung fügte Chester mit einem sarkastischen Blick hinzu: »Alle Regeln und Verfahrensvorschriften zu beachten.«
Schweigen setzte ein, während Natasha verarbeitete, was diese Frau eben gesagt hatte, und Allen vielleicht das Gleiche tat. Natasha begriff. Sie sah Chester an.
»Haben wir eventuell ein Problem miteinander?«
»Keineswegs.«
»Liegt es an meiner beruflichen Arbeit?«
»Kehren wir zur vergangenen Nacht zurück. Sie sagten …«
»Liegt es daran? Geht es hier um das Komitee? Oder wollen Sie ausdrücken, dass Sie meine frühere Beteiligung an Beschwerdeverfahren gegen die Polizei missbilligen? Geht es darum?«
»Sie sagten, der Angreifer sei ein Mann, den Sie nie zuvor …«
»Moment. Ich glaube, wir sollten diese Sache klären. Nur weil ich Personen vertreten habe, die durch polizeiliches Fehlverhalten aufge–«
»Ms Winthrop.« Allen mischte sich wieder ein. »Bitte. Lassen Sie mich Ihnen versichern, dass meine Kollegin und ich nur so gründlich zu arbeiten versuchen, wie wir können. Sie wollte nichts anderes sagen. Nur dass wir alles gründlich und ordnungsgemäß durchführen wollen.«
Und damit, da war Natasha sich sicher, warf er seiner Vorgesetzten einen Blick zu, nein, funkelte sie eher an; teils tadelnd, teils beschwörend. Laut ausgesprochen hätte der Blick bedeutet: Ich dachte, wir hätten uns abgesprochen.
Wieder herrschte Schweigen. Allen war sich im Klaren, auch wenn Chester es nicht begriffen hatte, dass sie einer Anwältin gegenübersaßen, die normalerweise über Leichen ging. Sie durften nicht riskieren, dass sie behauptete, bei der Untersuchung ihres Falles wäre auch nur ein Funke von Voreingenommenheit im Spiel gewesen.