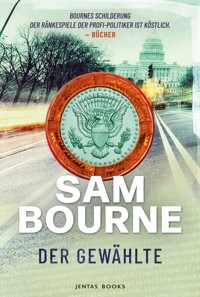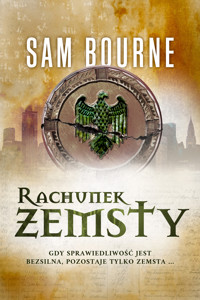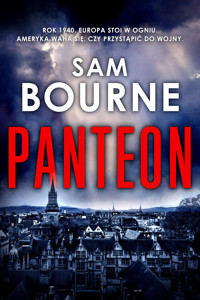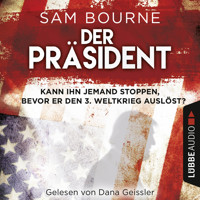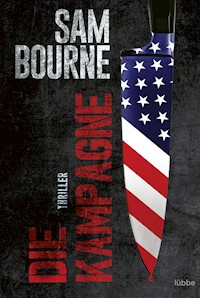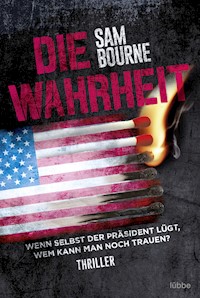
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Maggie-Costello-Reihe
- Sprache: Deutsch
Sie wollen die Wahrheit selbst auslöschen, jegliches Zeugnis der grausamsten Menschheitsverbrechen der Geschichte. Berühmte Bibliotheken gehen in Flammen auf, Historiker werden ermordet und Zeitzeugen verschwinden spurlos. Maggie Costello, Ex-Mitarbeiterin des Weißen Hauses, hatte sich eigentlich eine Auszeit verordnet. Doch dann stolpert sie über Hinweise auf die Hintermänner. Sie gräbt tiefer und begibt sich damit direkt ins Visier der Verschwörer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 545
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber den AutorTitelImpressumWidmungMONTAGKAPITEL EINSKAPITEL ZWEIKAPITEL DREIKAPITEL VIERKAPITEL FÜNFKAPITEL SECHSKAPITEL SIEBENKAPITEL ACHTKAPITEL NEUNKAPITEL ZEHNKAPITEL ELFDIENSTAGKAPITEL ZWÖLFKAPITEL DREIZEHNKAPITEL VIERZEHNKAPITEL FÜNFZEHNKAPITEL SECHZEHNKAPITEL SIEBZEHNKAPITEL ACHTZEHNMITTWOCHKAPITEL NEUNZEHNKAPITEL ZWANZIGKAPITEL EINUNDZWANZIGKAPITEL ZWEIUNDZWANZIGKAPITEL DREIUNDZWANZIGKAPITEL VIERUNDZWANZIGKAPITEL FÜNFUNDZWANZIGKAPITEL SECHSUNDZWANZIGKAPITEL SIEBENUNDZWANZIGKAPITEL ACHTUNDZWANZIGKAPITEL NEUNUNDZWANZIGKAPITEL DREISSIGKAPITEL EINUNDDREISSIGKAPITEL ZWEIUNDDREISSIGKAPITEL DREIUNDDREISSIGDONNERSTAGKAPITEL VIERUNDDREISSIGKAPITEL FÜNFUNDDREISSIGKAPITEL SECHSUNDDREISSIGKAPITEL SIEBENUNDDREISSIGFREITAGKAPITEL ACHTUNDDREISSIGKAPITEL NEUNUNDDREISSIGKAPITEL VIERZIGKAPITEL EINUNDVIERZIGKAPITEL ZWEIUNDVIERZIGKAPITEL DREIUNDVIERZIGKAPITEL VIERUNDVIERZIGKAPITEL FÜNFUNDVIERZIGKAPITEL SECHSUNDVIERZIGKAPITEL SIEBENUNDVIERZIGKAPITEL ACHTUNDVIERZIGKAPITEL NEUNUNDVIERZIGSAMSTAGKAPITEL FÜNFZIGKAPITEL EINUNDFÜNFZIGKAPITEL ZWEIUNDFÜNFZIGKAPITEL DREIUNDFÜNFZIGKAPITEL VIERUNDFÜNFZIGKAPITEL FÜNFUNDFÜNFZIGDANKSAGUNGENÜber dieses Buch
Sie wollen die Wahrheit selbst auslöschen, jegliches Zeugnis der grausamsten Menschheitsverbrechen der Geschichte. Berühmte Bibliotheken gehen in Flammen auf, Historiker werden ermordet und Zeitzeugen verschwinden spurlos. Maggie Costello, Ex-Mitarbeiterin des Weißen Hauses, hatte sich eigentlich eine Auszeit verordnet. Doch dann stolpert sie über Hinweise auf die Hintermänner. Sie gräbt tiefer und begibt sich damit direkt ins Visier der Verschwörer.
Über den Autor
Sam Bourne ist das Pseudonym des preisgekrönten britischen Journalisten Jonathan Freedland. Nach Stationen u. a. bei der BBC, der Washington Post, der New York Times, Newsweek und der Los Angeles Times, arbeitet er heute überwiegend als Redakteur und Kolumnist beim Guardian. Er schreibt regelmäßige Beiträge für die New York Times Review of Books und den Jewish Chronicle. Zudem präsentiert er die wöchentliche Radiosendung The Long View bei BBC Radio 4. Freedland ist Autor diverser Sachbücher und Thriller. Mit seinem Thrillerdebüt Die Gerechten war er monatelang Nummer 1 der Sunday-Times-Bestsellerliste mit über einer halben Million verkaufter Exemplare.
SAM BOURNE
DIEWAHRHEIT
wenn selbst der präsident lügt,wem kann man noch trauen?
Roman
Aus dem Englischen vonAxel Merz
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2019 by Jonathan Freedland
Titel der englischen Originalausgabe: »To Kill The Truth«
Originalverlag: Quercus Editions Ltd., an Hachette UK company
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2020 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Dr. Frank Weinreich, Bochum
Titelillustration: © Nataliia K / shutterstock.com; timquo/shutterstock.com; Haoka/shutterstock.com; vata/shutterstock.com
Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-8609-7
www.luebbe.de
www.lesejury.de
Für Jonny GellerAlter Freund und Meisteragent.Das ist unser zehntes gemeinsames Buch, also ist dieses für dich.
MONTAG
KAPITEL EINS
Charlottesville, Virginia, 02:40 Uhr morgens
Die Vergangenheit war gegenwärtig. Zu dieser späten Stunde konnte er spüren, dass sie ihn wie Rauch umhüllte.
Normalerweise, wenn er lehrte und vor einem Auditorium voller Studenten stand, fühlte sich Geschichte so an, wie das Wort klang: fern und staubig, selbst für ihn. Das Gleiche galt in der Bibliothek, umgeben von Menschen. Auch dort blieben die Ereignisse von einst jenseits des Horizonts, unerreichbar.
Aber hier, allein in diesem Raum, in den frühen Morgenstunden, fielen die Jahre weg. Er hatte Vorkehrungen getroffen, um sicherzustellen, dass die Moderne nicht eindrang: Das Telefon war stillgelegt, der Computer schlief. Er war allein mit den Dokumenten, die sich hoch auf seinem Schreibtisch stapelten. Obwohl es zu dunkel war, um ihn jetzt zu sehen, lag draußen der Rasen, das Herzstück des Gründungscampus der University of Virginia hier in Charlottesville; ein Wunderwerk der Landschaftsgestaltung, entworfen von Thomas Jefferson persönlich. Nach fast drei Jahrzehnten in der Geschichtsabteilung missgönnte niemand Professor Russell Aikman dies Büro mit seiner perfekten Aussicht. Selbst in der Dunkelheit verringerte das bloße Wissen, dass der Rasen dort war, gleich auf der anderen Seite des Fensters, die Kluft zwischen ihm und dem Amerika der Jahrhunderte zuvor.
Aber es waren die Dokumente selbst, untersucht in der Einsamkeit, die Aikman in die Vergangenheit transportierten. Es waren keine Originale, also gab es nichts Sinnliches an diesem Akt der Magie. Es war nicht der Geruch oder die Berührung des Papiers, die ihn durch die Zeit zurückfallen ließen, obwohl er die Kraft einer solchen physischen Verbindung kannte. Er hatte im Laufe seiner Karriere genau die Pergamente berührt, auf die beispielsweise George Washington, Alexander Hamilton oder, zufällig, Jefferson mit den harten Federn ihrer Kiele gekratzt und gemalt hatten. Er hatte diese seltsame Verwandtschaft mit den Vorfahren gespürt, die manchmal durch die Fingerspitzen fließt, das Gefühl, dass sowohl man selbst als auch sie dieses Objekt berührt hatten und dass man die physische Präsenz der anderen über Generationen hinweg irgendwie spüren konnte. Doch die Verbindung, die er in diesen späten Nächten empfand, war nicht physischer Natur.
Nein. Die Faszination, die sie auf ihn ausübten, rührte allein von ihren Worten her. Für Aikman war das Lesen eines Satzes, niedergeschrieben vor mehr als zweihundert Jahren, wie eine Verbindung mit dem Geist eines längst verstorbenen Mitmenschen, der ihn in seine Gedanken ließ. Während er über das Wunder dieser Empfindung nachdachte, stellte er sich die Bilder aus den frühen Tagen der Raumfahrt in seiner Jugend vor, wenn ein amerikanisches Schiff an sein sowjetisches Gegenstück andockte. Zwei Individuen, die eine große Distanz überwunden hatten, streckten die Hände aus und berührten einander.
Er spürte es in jener Nacht, als er sich in den Text auf seinem Schreibtisch hineinbohrte. Er verlor sich in den Worten wie ein Taucher, der tiefer und tiefer in das dunkle Wasser sinkt. Erst als er das Geräusch vernahm, schoss er nach oben und durchbrach die Oberfläche und kehrte zurück in die Gegenwart.
Er richtete sich kerzengerade auf, wachsam wie ein Hase, und sein Kopf zuckte von links nach rechts. Was war das? In der Nacht gab es gelegentlich Geräusche in dem alten Bau: ein Rumpeln der Heizung, ein Erzittern der Klimaanlage, je nach Jahreszeit. Aber das hier war anders. Direkter. Es klang wie ein Knarren, draußen auf dem Gang.
»Hallo?« Er fühlte sich albern, als er rief, doch er tat es erneut. »Hallo? Ist da jemand?«
Keine Antwort. Natürlich nicht.
Er sah nach unten auf die Blätter auf seinem Schreibtisch, als ob sie von jemand anderem hingelegt worden wären. Er hatte gar nicht bemerkt, wie viel er in dieser Nacht bereits geschrieben hatte – drei separate Blätter seines gelben Blocks, dazu Dutzende von Haftnotizen. Nach all den Jahren stellte ihn der Prozess immer noch vor Rätsel, wie sich diese Brocken von hingekritzelten Halbgedanken im Laufe der Zeit stetig in etwas verwandelten, das man Geschichte nannte.
Er fand die Stelle wieder, etwa zwei Drittel durch dieses Tagebuch eines konföderierten Soldaten hindurch. Ein Ehepaar in Richmond hatte es Monate zuvor in einem Stapel Kisten gefunden, die sie aus ihrem neu erworbenen Bauernhaus aus dem 19. Jahrhundert entfernen wollten. Tatsächlich war es ihre vierzehnjährige Tochter gewesen, die es entdeckt hatte – ein Bündel von Blättern mit wenig, das darauf hindeutete, es könnte sich um ein Tagebuch handeln. Als sie die Verweise auf die Schlacht las, dachte sie, die zerbröckelnden Seiten gingen auf den Vietnamkrieg zurück. Es dauerte eine Weile, bis die Familie begriff, was sie da entdeckt hatte. Doch sobald sie –
Da war es wieder. Unverkennbar diesmal. Das Knarren eines menschlichen Fußes auf einer Diele, kein Zweifel.
Aikman sprang auf, schob sich um seinen Schreibtisch herum und ging zur Tür. Er spürte, wie ihm schwindlig wurde und die Farben verschwammen. Er war zu schnell aufgestanden.
Als er die Tür öffnete, war nichts zu sehen. Der Gang lag in Dunkelheit. Er trat vor und klatschte in die Hände. Er sagte sich, dass er das tat, um die bewegungsempfindliche Beleuchtung zu aktivieren. Dass der Lärm die Stille brach und ihm die Sicherheit seiner eigenen Präsenz gab, war eine unbeabsichtigte Nebenwirkung.
»Hallo?«, fragte er noch einmal und spähte den Gang voller Fakultätsbüros entlang, während sich seine Augen an das grelle Licht anpassten. »Mr. Warner, sind Sie das?«
Stille.
»Brauchen Sie etwas? Soll ich jemanden für Sie rufen?«
Er suchte die Türen seiner Kollegen ab, allesamt geschlossen. Im Licht nahm er zur Kenntnis, welche Türen nicht beschriftet waren und welche entweder mit Autoaufklebern für längst vergessene, besiegte liberale Kandidaten verziert waren oder mit einem Formular, an einem Klemmbrett befestigt, auf dem die Büro- und Sprechzeiten für einen Besuch vermerkt waren, zusammen mit baumelndem Kugelschreiber an einer Schnur für diejenigen, die einen Termin buchen wollten. Wie altmodisch, dachte Aikman über das, was einst als modern und innovativ gegolten hatte. Heute erledigte die junge Fakultät all das längst online. Er sah zu seiner eigenen, mit nichts als seinem Namensschild geschmückten Tür.
Ein letzter Versuch, und er würde wieder reingehen. Vielleicht konnte ein sanfterer Ansatz seinen brillanten, aber gestörten Studenten aus dem Schatten locken. »Adam, wenn ich Sie ins Krankenhaus bringen soll, kann ich das tun. Sagen Sie nur ein Wort. Sie müssen nicht mitten in der Nach–«
Er wurde mitten im Wort abgeschnitten. Das Licht war ausgegangen, die automatische Zeit abgelaufen, und die plötzliche Dunkelheit überraschte ihn. Er überlegte, es wieder einzuschalten, indem er mit den Armen herumfuchtelte, besann sich jedoch eines Besseren. Er wandte sich um und kehrte in sein Büro zurück. Die Tür hinter ihm schwang in Richtung Schloss, ohne es je zu treffen.
Langsamer als früher hatte Russell Aikman sich gerade erst wieder in seinen Stuhl gesetzt, als sich die Tür erneut öffnete. Als er aufblickte, konnte er das Gesicht seines Besuchers kaum erkennen. Das Licht der auf die Papiere gerichteten Schreibtischlampe reichte nicht bis zum Eingang des Raums. Vielleicht blinzelte er, doch falls er es tat, war es nur für den Bruchteil einer Sekunde.
War es ausreichend lang, um zu sehen, wie der Eindringling eine winzige Bewegung machte – ein kleines Heben der Augenbraue –, die als Anstoß für den Arm zu dienen schien, der nach oben fuhr, bis er den kerzengerade hielt, und die Hand unverrückbar auf die Stelle zwischen den Augen ihres Opfers zielte? Hatte Russell Aikman noch die Zeit, um zu begreifen, was geschah, um zu verstehen, dass dies die allerletzte Sekunde seines Lebens war? Wusste er, dass seine eigene Gegenwart in diesem Moment für immer in die Vergangenheit sank?
KAPITEL ZWEI
Washington, D. C., 12:05 Uhr mittags
Maggie Costello wand sich zum fünften Mal in ebenso vielen Minuten auf ihrem Sitz und versuchte angestrengt, sich zu konzentrieren. Es war nicht so, dass das Spektakel, das sich auf der Bühne entfaltete, nicht fesselnd gewesen wäre. Das war es durchaus. Die Argumente, die in diesem voll besetzten Hörsaal der Universität auf dem Parkett hin und her gingen, waren überzeugend. Aber es fiel ihr trotzdem schwer, konzentriert zu bleiben. Der Lärm draußen war einfach zu groß.
Sie konnte die Sprechgesänge hören; wie alle. Sie hatten sie gehört, als sie hereingekommen waren: zwei Armeen von Demonstranten, die sich einander gegenüberstanden, von einer dünnen, überforderten Reihe von Campuspolizisten, verstärkt durch Beamte des MPD, Washingtons eigener Metropolitan Police, in zwei Blöcke zu beiden Seiten des Zugangs zum Auditorium getrennt.
Auf der einen Seite waren die Studenten, unterstützt von Freunden, die aus New York, Philadelphia und von noch weiter her angereist waren. Sie waren jung und unübersehbar vielfältig: Latino-Frauen, schwarze Männer – einer von ihnen trug falsche Handschellen um die Gelenke, durch eine Kette mit einem Kragen um den Hals verbunden – und viele weiße Demonstranten, in Regenbogenfahnen gehüllt, mit tätowierten Armen und mehrfach gepiercten Gesichtern. Ihr lautester, hartnäckigster Kampfruf: »Keine Plattform für Rassisten« und, passend für den heutigen Tag, »Sklaverei ist Realität!«.
Ihnen gegenüber standen Reihen weißer Männer in einer inoffiziellen Uniform aus beigefarbenen Chinos und weißen (manchmal auch schwarzen) Poloshirts. Die meisten trugen Schilde, einige rechteckig, geformt wie die von der Bereitschaftspolizei, andere rund wie die von Comic-Helden favorisierten. Sie waren mit einer Vielzahl von Mustern verziert, die Maggie nur schwer identifizieren konnte. Natürlich erkannte sie das Eiserne Kreuz, übernommen und adaptiert vom Dritten Reich, und die Konföderiertenflagge des alten Südens. Aber der Rest der Dreiecke und Kreuze war ihr neu: Es schien sich um Varianten des Swastika-Motivs zu handeln, die auf ein altes nordisches Muster hindeuteten. Mehrere waren in einem ausgeprägten Weiß-Rot gehalten, den Farben der christlichen Kreuzzüge. Zuerst hatte Maggie, die aus nur wenigen Metern Entfernung zusah, versucht, jedes einzelne zu entschlüsseln; einige hatte sie auf ihrem Handy nachgeschlagen. Aber es gab so viele, dass sie nach einer Weile zu einem verschwommenen Bild verschmolzen.
Die Sprechchöre der zweiten Gruppe waren direkter. »Blut und Boden« war ein beliebter Refrain, genauso wie »Ihr werdet uns nicht verdrängen«, oft abgewandelt zu »Juden werden uns nicht verdrängen«. Aber der eine, den Maggie am deutlichsten vernahm und der speziell auf dieses Ereignis zugeschnitten zu sein schien, lautete: »Keine Ahnung, mir egal / Nichts passiert, nichts zu seh’n.«
Sie konnte sie selbst jetzt noch hören, auf ihrem Platz in der hintersten Reihe des Hörsaals. Sie waren gedämpft, aber unmissverständlich, obwohl sie aufeinanderprallten und sich gegenseitig überlagerten. Manchmal wurden die Worte durch das perkussive Trommeln von Stöcken gegen Schilde übertönt, und in Abständen verschmolzen die Sprechgesänge zu einem Crescendo, einem kollektiven, anschwellenden Geräusch, welches signalisierte, vermutete Maggie zumindest, dass die beiden Seiten aufeinandergeprallt waren.
Von den drei Rednern auf der Bühne, die improvisiert in einer Talkshowformation um einen niedrigen runden Tisch mit drei Gläsern Wasser saßen, schien nur einer vom Lärm draußen unbeeindruckt. Sein Name war Rob Staat, und er war der Grund für die Proteste. Er war zum Mediensprecher und Verteidiger von William Keane bestellt worden, dem berüchtigten, selbst ernannten Historiker, der zu einem Helden der amerikanischen und zunehmend globalen extremen Rechten geworden war. Keane stand derzeit im Mittelpunkt dessen, was die Medien unvermeidlich als den »Prozess des Jahrhunderts« feierten.
Keane, das mussten selbst seine Feinde einräumen, war eine schwülstig-charismatische Gestalt in seinen weißen Anzügen und seinem Beharren auf Südstaaten-Umgangsformen von gestern – alles »Ja, Ma’am« und »Nein, Sir’ee«. Der Mittdreißiger Rob Staat war nicht mehr als ein blasser Ersatz. Doch dank eines ständigen Beinahelächelns, das auf seinen Lippen spielte und sich jeden Moment zu einem ausgewachsenen Grinsen zu entwickeln drohte, schaffte er es mühelos, Maggies Abneigung zu wecken.
Gegenüber Staat saß Jonathan Baum, ein Wissenschaftler von der historischen Fakultät Georgetown. Normalerweise ein solider und methodischer Redner, war er im Augenblick sichtlich entnervt. Er griff häufig nach seinem Wasserglas, und das Mikrofon an seinem Revers fing das hörbare Schlucken auf, während er trank. Auf seinem Schoß lag ein dicker Ordner, den er durchstöberte, während Staat redete, als suche er nach einem Dokument, das die Angelegenheit ein für alle Mal regelte. Wann immer von draußen das rhythmische Schlagen der Stöcke gegen die Schilde wieder aufgenommen wurde, sah er erschrocken hoch.
Zwischen den beiden saß Pamela Bentham, Erbin jener Familie, die diesen Saal zusammen mit dem sich daran anschließenden neu gegründeten Bentham Center für Freie Rede gestiftet hatte. Abgesehen von ein paar einleitenden Bemerkungen hatte sie fast nichts gesagt und gab sich damit zufrieden, dass die beiden Antagonisten das Verfahren dominierten, während sie eine einstudierte Neutralität beibehielt. Maggie beobachtete die Frau – Mitte fünfzig, teure Frisur, mit einer Brille, deren Notwendigkeit Maggie infrage stellte –, wie sie sich jeweils dem Mann zuwandte, der gerade redete, und jeden Punkt mit einem aufmerksamen Nicken begleitete. Sie arbeitete hart daran, das Chaos draußen zu ignorieren, doch Maggie sah, dass eine Bentham-Hand die andere gepackt hielt, als müsste sie sie am Zittern hindern.
In gewisser Weise war es beeindruckend. Nicht so sehr der Vorsitz, sondern die Entschlossenheit. Diese Bentham-Frau hatte ihren Mund dort, wo ihr Geld war, sie tauchte persönlich auf, anstatt sich mit einer bloßen Spende zufriedenzugeben, um sicherzustellen, dass diese Debatte stattfand. Und das trotz des Drucks, den die Universität ausgeübt hatte, um sie zu verhindern. Alles, um das Recht auf freie Meinungsäußerung durchzusetzen.
Die meisten Institutionen würden – und hatten es auch getan – vor dem Keane-Prozess davonlaufen. Er konnte nur Ärger bringen. Maggie war überzeugt, dass den Granden der Universität das Herz in die Hose gerutscht war, als Bentham vorgeschlagen hatte, auf dem Campus darüber zu diskutieren. Der Ort war einfach zu unsicher.
Und doch gab es keinen Zweifel an der Wichtigkeit dieser Auseinandersetzung. Die Amerikaner waren von dem Prozess gepackt, und viele der Kabelnetze brachten lange Strecken des Verfahrens live. Das war zum Teil Keane und seinen Possen im Gerichtssaal zu verdanken, doch es lag auch an dem, was auf dem Spiel stand.
Keane hatte die afroamerikanische Schriftstellerin Susan Liston wegen Verleumdung verklagt, weil sie ihn in einem Buch über die Alt-Rights, eine rechtsextreme Gruppe in den USA, als »Sklavereileugner« bezeichnet hatte. Sein Fall, der vor dem Bundesgericht in Richmond verhandelt wurde, war eigentlich ganz einfach. Er konnte kein Sklavereileugner sein, weil es nichts zu leugnen gab. Schwarze waren in den Vereinigten Staaten nie Sklaven gewesen.
Staat wiederholte wie ein Papagei die Argumente Keanes, die gleichen, die alle Anwesenden hundertmal zuvor aus dessen Mund über sich ergehen lassen hatten. Die Aussagen der Sklaven wären unzuverlässig; die Aussagen der Sklavenhalter wären unzuverlässig. Er benutzte oft das Wort »Mythos«, bemerkte Maggie, als wäre es eine Ein-Wort-Widerlegung oder gar ein Schimpfwort. »Mythos«, sagte auch Staat jetzt erneut, zum x-ten Mal.
Maggie blickte sich im Hörsaal um. Die ersten Reihen waren voller Journalisten, ebenso wie die Sitze im hinteren Teil, wo auch sie saß. Die gesamte rückwärtige Wand des Saals war ein Dickicht von Stativen und Fernsehkameras. Was den Rest des Publikums betraf, so war es eine Mischung aus hochkarätigen Persönlichkeiten der Universität, insbesondere jenen, die mit dem Bentham Center in Verbindung standen und zweifellos daran interessiert waren, sich bei ihrer Schirmherrin dankbar zu zeigen, sowie handverlesenen Doktoranden. Es schien, dass die Verantwortlichen nicht das Risiko eingehen wollten, Studenten einzulassen, bei denen die Gefahr bestand, dass sie Transparente hochhielten, Staat mit aggressiven Zwischenrufen störten oder die Bühne stürmten. (Offensichtlich hatte das Center für Freie Rede entschieden, dass die freie Rede ihre Grenzen hatte.)
Während Staat sich auf einen Streit über die Natur der Verleumdung einließ, wunderte sich Maggie über den Grund ihres Hierseins: War sie als Doktorandin eingeladen oder als wichtige Persönlichkeit? Sie hatte nie wirklich über ihren Status an dieser Institution nachgedacht. Nun, es reichte, dass sie hier war.
Nach dem Weißen Haus und allem, was passiert war, brauchte sie eine Chance zum Nachdenken – und das, so hatte sie sich gesagt, war schließlich das, wofür Universitäten da waren. Liz hatte Maggie angebettelt, zu ihr nach Atlanta zu kommen und bei ihr, ihrem Mann und ihren Kindern zu leben – »Wenn du wirklich einen sauberen Schnitt machen willst, musst du diesen Sumpf von einer Stadt hinter dir lassen!« –, und Maggie hatte es in Betracht gezogen, das hatte sie wirklich. Doch sieben Tage bei ihrer Schwester hatten gereicht, um festzustellen, dass es niemals funktionieren würde. Zu viel Familie, zu viel Kontrolle.
Sie brauchte ihr eigenes Revier, und nach dem größten Teil eines Jahrzehnts war dieses Revier nun einmal Washington, D. C. Sie würde der Stadt niemals mit dem Wort »Zuhause« schmeicheln. Das war bis heute Dublin geblieben. Doch Maggie kannte sich in Washington aus, und das war fürs Erste genug.
Dennoch war es unbestreitbar, dass sie eine Pause brauchte. Das Schreiben von Essays und die Teilnahme an Seminaren fühlten sich wie eine gute Abwechslung an. Wenn sie hier mit einer Krise konfrontiert wurde, führte dies möglicherweise zu einer verpassten Vorlesung und nicht zu einem nuklearen Feuerwerk und dem Ende der Welt. »Warum ist die akademische Politik so bösartig?«, ging der alte Witz. »Weil der Einsatz so gering ist.« Und das war Maggie durchaus recht.
Die mittägliche Debatte über den Keane-Prozess, bei der der potenzielle Aufstand draußen vor den verschlossenen Türen stattfand, war das, was Politik am nächsten kam, seit sie die Verwaltung verlassen hatte. Die Anspannung im Saal – die Baum und Bentham deutlich zusetzte, wenn schon nicht Staat, der sie sogar zu genießen schien – hinterließ kaum eine Delle in Maggies zentralem Nervensystem. Sie hatte viel Schlimmeres durchgemacht. Trotzdem war es eine Erinnerung an das Leben, das sie hinter sich gelassen hatte, und sie spürte die ersten ungebetenen Schübe von Adrenalin.
Wie eine trockene Alkoholikerin, die einen Besuch in einer Bar riskiert hatte, verfluchte sie nun ihren eigenen Leichtsinn. Sie hätte nie herkommen dürfen. Sie hätte in der Bibliothek oder zu Hause in ihrer Wohnung bleiben sollen. Das Studium der Geschichte hatte ihre Flucht vor alledem sein sollen, ihre Oase der Ruhe und Gelassenheit, fernab vom politischen Kampf. Herzukommen war ein Fehler gewesen, eine unnötige –
Von draußen kam ein hämmerndes Geräusch. Mehrere Köpfe drehten sich im Saal; Baum auf dem Podium schien zu erstarren. War das ein Ansturm auf die Tür? Hatte eine der beiden Fraktionen nach vorne gedrängt und versuchte nun, den Saal zu stürmen? Maggie wartete ab. War das das Geräusch von Glasscherben oder ein Schrei? Sie war sich nicht sicher. Stattdessen kam es zu einem Wiederaufleben des Gesangs, lauter und wütender jetzt. »Keine Ahnung, mir egal / Nichts passiert, nichts zu seh’n.«
War dies der Lärm von Keanes Unterstützern – weißen Rassisten, Neonazis und Klansleuten – hoch oben auf einer Woge des Triumphs? Oder alternativ der selbstgerechte Rausch der Opferrolle? Jubelten sie über einen erfolgreichen Angriff auf das Gebäude oder randalierten sie, weil sie von ihren Gegnern unfair angegriffen worden waren? Maggie lauschte aufmerksam, doch es war schwer zu sagen.
Auf dem Podium drängte Bentham die Anwesenden, sich zu beruhigen. »Genau aus diesem Grund, meine Damen und Herren, ist dieses Zentrum so wichtig. Wie Sie mit eigenen Augen sehen und mit eigenen Ohren hören können, ist die Bedrohung der Meinungsfreiheit in diesem Land eine Realität. Aber unsere Zukunft hängt davon ab, dass wir offen miteinander reden können, wie schwierig das Thema auch sein mag. Deshalb …«
Maggie sah, dass Benthams Hände wieder zitterten. Baum starrte zu den Türen auf der Rückseite des Saals, als befürchtete er jeden Moment eine Massenpanik. Viele im Publikum folgten seinem Beispiel und drehten sich um. Staat saß von alledem völlig unbeeindruckt und mit breitem Grinsen im Auge des Hurrikans.
Ein plötzliches Vibrieren ließ Maggie zusammenzucken. Ihr Herz klopfte wild, als sie das Telefon aus der Tasche zog. Eine SMS von Donna Morrison, einer ehemaligen Kollegin aus der Zeit von Maggies erstem, zufriedenstellenderem Engagement im Weißen Haus. Morrisons Antwort auf den Irrsinn der jüngsten Ereignisse war gewesen, aus dem Schatten zu treten, das Hinterzimmer zu verlassen und selbst für ein Amt zu kandidieren. Sie hatte Geschichte geschrieben – die erste schwarze Frau, die zur Gouverneurin von Virginia gewählt worden war.
Die Botschaft war typisch Donna: direkt auf den Punkt gebracht.
Ich brauche Ihre Hilfe.
Maggie steckte das Telefon wieder ein. Sie hatte keinen Mangel an Stellenangeboten. Es gab alte Freunde und Menschen, von denen sie noch nie gehört hatte, die sie ständig bedrängten, in die Politik zurückzukehren, um bei dieser oder jener Krise zu helfen. Sie erzählten stets eine Version der gleichen alten Geschichte. »Sie sind die beste Problemlöserin im Geschäft, Maggie – und ich stecke in Schwierigkeiten.«
Es war schmeichelhaft, doch Maggies Entscheidung war getroffen. Sie brauchte eine Pause. Oder, wie sie jedem sagte, der sie einstellen wollte: Sie musste raus, und der beste Weg, draußen zu bleiben, war, nicht wieder reinzukommen.
Das Telefon vibrierte erneut.
Seufzend zog sie es hervor, während sie im Geiste bereits ihre Antwort formulierte: »Danke, aber nein danke.«
Sie las die Nachricht und stieß ein erschrockenes Ächzen aus.
Ein Mann ist tot, Maggie. Ich brauche Sie.
KAPITEL DREI
Richmond, Virginia, 14:30 Uhr nachmittags
»Möchten Sie ein Cookie?«
Maggie schüttelte den Kopf, aber nicht, weil sie keinen der untertassengroßen Schokoladensplitter-Kekse wollte, die auf dem Teller vor ihr lagen. Vielmehr war sie lange genug in Washington gewesen, dass zumindest einige der Sitten ihre Spuren hinterlassen hatten. Wenn die Dessertkarte kam, bestellte man stets nur Kaffee oder Tee. Beim Mittagessen war lediglich eine Flasche Mineralwasser vonnöten. Und in einem Meeting waren sämtliche Snacks abzulehnen. Maggie hatte mit den ersten beiden Bräuchen Schwierigkeiten gehabt, doch sie war dem dritten erlegen. Inzwischen sah sie die kleinen Obstplatten oder Schalen voller M&Ms auf den Konferenztischen in Washington nicht mehr als Geste der Höflichkeit, sondern als eine Art Test, und obendrein einen schlecht versteckten.
»Hab sie selbst gebacken.«
»Sie machen Witze. Sie sind die Gouverneurin von Virginia. Sie haben unmöglich Zeit für so etwas.«
»O doch, die habe ich.« Donna Morrison blickte zur Tür und vergewisserte sich, dass niemand hereinkam. »Ich bin die menopausale Gouverneurin von Virginia, und ich fühle mich, als hätte ich seit der Bush-Administration keine Nacht mehr durchgeschlafen.« Als sie Maggies Reaktion sah, fügte sie hinzu: »Was sollte ich denn sonst zwischen zwei und vier Uhr morgens tun? Es gibt nur eine begrenzte Anzahl Stunden, die ein Mädchen sich Fox ansehen kann.«
Maggie merkte, wie sie grinste. Es war ein breites, offenes Grinsen, und ihr wurde klar, wie lange es her war, dass sie so gelächelt hatte. Obwohl es nicht ungewöhnlich gewesen war damals, erinnerte sie sich gut an ihre Treffen mit Donna, die das Planungsteam des Präsidenten leitete, dem sie beide so stolz gedient hatten. Donna war warmherzig und einladend und lachte gern und häufig. Wie sie es in der Washingtoner Politikmühle so weit hatte bringen können, war für viele in der Stadt ein Rätsel, einschließlich, wie es schien, für Donna selbst. Aber es gab viele wie sie in dieser Regierung, gute Leute, ausgewählt von einem Präsidenten, der sich gerne damit rühmte, dass nur die Besten für ihn arbeiten durften.
»So«, sagte die Gouverneurin, indem sie auf dem Sofa gegenüber von Maggie Platz nahm und ihren Rock glättete. »Wie ich bereits schrieb, ist ein Mann tot«, brachte sie das Gespräch gleich auf den Punkt.
»Ja.«
Als sie Donnas Nachricht erhalten hatte, hatte Maggie sich für einen kurzen Moment gefragt, ob die Gouverneurin sich auf die Ereignisse vor dem Auditorium in Georgetown bezog. Vielleicht war der Tumult draußen, dieses hämmernde Geräusch, das alle im Saal gehört hatten, ein Mann gewesen, der von Demonstranten zu Tode geprügelt wurde. Vielleicht hatte die Polizei die Gouverneurin alarmiert, und sie hatte sofort Maggie angeschrieben.
Ein flüchtiger Blick auf Twitter hatte ihr gezeigt, dass der Todesfall, von dem ihre alte Freundin geschrieben hatte, näher an der Heimat und innerhalb der Staatsgrenzen lag. Kurz nach acht Uhr heute Morgen hatte eine Reinigungskraft der UVA, der University of Virginia, Charlottesville, das langjährige Mitglied der historischen Fakultät Professor Russell Aikman tot in seinem Büro entdeckt. Er hatte über seinem Schreibtisch gelegen, sein Gehirn über die antiken Karten verspritzt, die seine Bürowände schmückten. Aus diesem Grund saß Maggie nun der neuen Gouverneurin von Virginia gegenüber und kämpfte gegen den Drang, sich einen Schokoladenkeks zu nehmen.
»Die erste Frage, die ich gestellt habe, Maggie, war …«
»War es Selbstmord?«
»Und sie sagten Nein. Schon nach einer Stunde hatten sie Selbstmord völlig ausgeschlossen. Ballistik und was weiß ich nicht alles.«
»Und das war nicht, was Sie hören wollten.«
»Verdammt richtig. Ich habe förmlich gebetet, dass man mir sagt, er hätte sich selbst das Leben genommen. Ich meine, es wäre schrecklich gewesen für seine Familie, keine Frage. Einfach schrecklich. Nicht, dass das hier viel besser wäre. Aber wenigstens könnten wir vermeiden …«
»All das hier vermeiden«, sagte Maggie und deutete auf das Telefon. Die Tweets waren beinahe im gleichen Moment rausgegangen – als die Nachricht von Aikmans Tod verkündet worden war und kurz nachdem die Debatte zwischen Rob Staat und Jonathan Baum begonnen hatte.
Ein konservativer Talkshow-Gastgeber hatte sich frühzeitig eingeschaltet. »Denkmäler einzureißen ist eine Sache. Ein Menschenleben zu nehmen eine ganze andere.« #RussellAikmanRIP
Die andere Seite hatte keine Zeit verschwendet. Ein Tweet von einer Frau, die sich als Aktivistin von #Pullthemdown zu erkennen gab, der Kampagne zur Beseitigung sämtlicher Denkmäler aus der Konföderiertenzeit, hatte einen Tweet gepostet, der von vielen geteilt worden war. »Russell Aikman hat über die Geschichte der Sklaverei geschrieben. Heute wurde er von jenen zum Schweigen gebracht, die die Wahrheit nicht ertragen. Aber« #TheTruthLives
»So ist es.« Donnas Lächeln war verschwunden. »Beide Seiten beanspruchen Aikman als einen Märtyrer für ihre Sache und geben der jeweils anderen die Schuld.«
»So sind die Dinge heutzutage«, sagte Maggie. Sie war sich plötzlich ihrer Stimme und ihres irischen Akzents gewahr und hatte Sorge, sie könnte zu distanziert klingen – die selbstgefällige Ausländerin, die voller Mitleid auf das Irrenhaus blickt, in das sich die amerikanische Nation zusehends verwandelte. Keine von beiden musste den Namen des Mannes aussprechen, dem sie die Schuld daran gaben.
»Ich weiß. Aber es wird noch schlimmer, Maggie. Angenommen, eine der beiden Gruppen steckt tatsächlich hinter Aikmans Tod. Angenommen, es war so. Das wäre eine ganz neue Stufe der Eskalation. Das sind dann nicht mehr nur Talk-Gäste, die im Fernsehen aufeinander losgehen oder einander bei Facebook beleidigen. Das ist …«
Maggie sah, wie Donna die Worte ausgingen. Trotz all des volkstümelnden Geredes von selbst gebackenen Keksen und allem, sah Donna Morrison ausgemergelt aus, verzehrt von Besorgnis.
»Denken Sie, es könnte sich ausbreiten?«
»Ich sage Ihnen, was mich um den Schlaf bringt, Maggie.« Sie korrigierte sich selbst: »Noch mehr als sonst. Das Urteil im Keane-Prozess ist für diese Woche geplant. Höchstwahrscheinlich Freitag.«
»Der Keane-Prozess? Der Kerl ist verrückt. Es ist ein Werbegag. Er kann auf keinen Fall …«
»Das ist nicht, was ich höre. Darauf soll ich mich nicht vorbereiten.«
»Sie machen Witze.«
»Die Verteidigung sagt, dass die Zeichen nicht gut stehen. Sie denkt, es gibt Gründe, dass Keane gewinnen könnte.«
»Das ist lächerlich. Er hat bereits gesagt …«
»Hören Sie, Maggie. Sie sind kein Anwalt, und ich bin es auch nicht. Ich gebe nur den Rat weiter, den ich erhalten habe. Keane könnte dieses Ding gewinnen, und sei es nur aufgrund einer Formsache.«
»Jesus Christus.«
»Stellen Sie sich vor, was dann passiert, Maggie. Ein Gericht im Süden der Vereinigten Staaten erklärt, dass es keine Sklaverei gegeben hat. Sie sind zu jung, um sich an die Unruhen wegen Rodney King zu erinnern, aber ich nicht. Ganz Los Angeles ist damals explodiert, weil die weiße Polizei einen Schwarzen halb zu Tode geprügelt hat und damit durchgekommen ist. Das hier wäre hundertmal schlimmer. Tausendmal. Ich sage Ihnen, Maggie, es würde nicht nur zu einem Aufstand führen. Es würde einen Bürgerkrieg auslösen.«
»Besonders, wenn sich die beiden Seiten bereits gegenseitig umbringen.«
»Genau. Denken Sie darüber nach, Maggie. Wenn wir hier in eine Todesspirale geraten, mit Morden und Vergeltungsmorden, Rache und alldem – dann wird dieses Urteil am Freitag wirken, als würde man ein Fass Benzin in ein Feuer gießen, das bereits außer Kontrolle zu geraten droht.« Sie hielt für einen Moment inne. »Und sie sind jetzt schon wütend.«
Maggie furchte fragend die Stirn.
»Eine Schwarze sitzt in der Villa des Gouverneurs in Richmond, Virginia. Der Hauptstadt der Konföderation.«
Maggie seufzte. »Ich verstehe, Gouverneurin, das tue ich wirklich …«
»Für Sie Donna, Maggie.«
»… aber ich kann nicht. Ich kann einfach nicht. Ich bin raus aus der Sache. Ich bin …«
»Maggie. Wissen Sie, wie der Präsident – unser Präsident – Sie immer genannt hat?« Sie wartete nicht auf eine Antwort. »Seine oberste Problemlöserin.«
»Donna, bitte. Tun Sie das nicht.«
»›Zeigt Maggie Costello eine Krise, irgendeine Krise …‹« Sie imitierte seine Stimme und machte sogar einen halbwegs ordentlichen Job. »›Sie geht der Sache auf den Grund. Und dann löst sie das Problem.‹ Das hat er stets gesagt.«
»Er war ein sehr großzügiger Mann.«
»Großzügig, von wegen! Er nannte die Dinge, wie sie waren. Kein falsches Lob aus seinem Mund.«
»Ich bin weitergezogen.«
»Weitergezogen? Sie machen irgendein dämliches Hippie-Aussteiger-Studium!«
»Ich nehme mir etwas Zeit, um wieder …«
»Was? Den Kopf wieder klar zu kriegen? Hören Sie, ich verstehe das. Ich verstehe das wirklich. Im Augenblick wünsche ich mir selbst nichts mehr als eine lange Pause. Scheiße! Und Sie haben eine Menge durchgemacht. Ich meine, sehr oft. Wir wissen alle, was im Weißen Haus passiert ist. Sie haben Unglaubliches geleistet. Die Nation schuldet Ihnen eine Menge.«
»Sie müssen mir nicht schmeicheln, Donna.«
»Nein? Dann sagen Sie mir, was ich tun muss. Ich meine es ernst. Sagen Sie mir, was zum Teufel ich tun muss, damit Sie mir helfen, um dieser Aikman-Sache auf den Grund zu gehen und sie zu beenden, bevor sie außer Kontrolle gerät. Weil ich glaube, dass sonst in meinem Staat ein Rassenkrieg ausbrechen wird, und ich habe Angst, dass er das ganze Land verschlingt.«
Maggie starrte zu Boden. Sie wagte nicht, der Gouverneurin ins Auge zu sehen. Sie wusste, was das mit ihrer Entschlossenheit tun würde.
»Ich brauche mein Leben zurück«, sagte sie endlich.
»Ich weiß, dass Sie das brauchen«, sagte Donna leise. »Und sobald das hier erledigt ist, werden und müssen Sie Ihr Leben zurückkriegen. Aber im Moment sind Sie die einzige Person, die helfen kann. Bitte, Maggie.«
Eine lange Pause entstand, die schließlich von Maggie gebrochen wurde. »Sie kriegen eine Woche«, sagte sie und stand auf. »Nicht mehr.«
Die Gouverneurin nahm ihre Hand und umschloss sie fest. »Wir haben keine Woche, Maggie. Uns bleiben weniger als fünf Tage.«
KAPITEL VIER
Northern Virginia, 15:40 Uhr nachmittags
Sie war froh über die einstündige Fahrt im herbstlichen Sonnenschein entlang der I-64 nach Charlottesville. Sie würde die Zeit nutzen, um den Kopf freizubekommen und etwas auszuarbeiten, das einer Strategie ähnelte. Unter blauem Himmel und Bäumen, die in glitzernden Schattierungen von Rot, Rotbraun und Gold vorbeiglitten, würde sie alles durchgehen, was sie wusste, und ebenso die größere und wichtigere Kategorie der Dinge, die sie nicht wusste.
Sie war dabei, in Gedanken eine Liste der bekannten Unbekannten über Russell Aikman zu erstellen, als der vermeintlich alternative Musiksender im Radio vom Geräusch ihres klingelnden Telefons unterbrochen wurde. Der Bildschirm im Armaturenbrett verriet, dass es ihre Schwester Liz war.
»Was ist los?«
»Nun ja, auch dir ein Hallo, Maggie. Mir geht es großartig, vielen Dank, dass du gefragt hast.«
»Aber es ist mitten am Tag. Du rufst sonst nur abends an.«
»Verdammt, Mags. Ich rufe meine große Schwester an, weil mir danach ist. Warum hast du so einen großen Stock im Arsch?«
Maggie musste lächeln. »Also ist alles in Ordnung? Du und die Jungs, alles okay?«
»Alles großartig hier im sonnigen Georgia. Wie geht es der malariaverseuchten Hauptstadt?«
»Alles wie immer.« Bei Liz war Maggies Instinkt stets, sich zurückzuhalten mit dem, was sie wusste. Nicht aus Gründen der Verschwiegenheitspflicht, obwohl sie damit immer vorsichtig war. Aber es war einfach sinnlos, Liz in Angst und Schrecken zu versetzen. Ihre Schwester konnte ohnehin nichts tun. Wozu sollte es also nutzen?
»›Alles wie immer‹, heh? Nun, ich für meinen Teil habe gerade eine Veränderung in meinem Leben vorgenommen.«
»Oh nein, sag mir nicht, dass etwas mit dir und Paul nicht stimmt.«
»Nein! Wie zum Teufel kommst du darauf?«
»Hast du eine Affäre?«
»Nein, Miss Margaret Costello, ich habe keine Affäre.«
»Also, was ist es dann? Was ist das für eine große ›Veränderung‹«?
Es gab eine Schweigeminute, und dann: »Ich will es dir jetzt nicht sagen.«
»Ach, komm schon, Liz.«
»Nein, du wirst sicher enttäuscht sein.«
»Sei nicht so. Sag’s mir.«
»Ich will nicht.«
»Bitte, Liz. Bitte!«
»Du bist manchmal eine richtige Kuh, weißt du das?«
»Ich weiß. Ich bin eine richtige Kuh. Jetzt mach schon. Sag es mir.«
»In Ordnung. Ich sehe jetzt jemanden.«
»Du hast also doch eine Affäre.«
»Nein. Ich sehe jemanden. Wie ich dir gesagt habe. Du weißt schon, ein Therapeut.«
»Oh. Du musst unbedingt daran arbeiten, wie du so was ankündigst.«
»Ich hatte gerade meine dritte Sitzung.«
»Wirklich? Gerade eben?«
»Ja.«
»Und wie war es?«
»Es war eigentlich großartig. Wirklich großartig. Ich habe geredet und geredet.«
»Ja, das kann ich mir irgendwie vorstellen.«
»Ich meine, wirklich geredet. Wir sind in die Tiefe gegangen.«
»Wow. Wie ist sie so?«
»Es ist eigentlich ein Er. Yves.«
»Yves?«
»Yves Lamarche. Er ist Franzose.«
»Klingt attraktiv.«
»Ist er irgendwie auch. Nicht, dass das relevant wäre.«
»Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist?«
»Sicher. Warum sollte es das nicht sein?«
»Du weißt schon, all das Zeug von wegen Projektion und so.«
»Jetzt sagst du wieder solche Worte. Ich ignoriere das. Ich ignoriere dich. Ich denke, es könnte wirklich gut für mich sein. Wirklich klärend. Yves sagt, dass …«
»Was hat es geklärt?«
»Ich werde jetzt nicht darauf eingehen. Außerdem haben wir gerade erst angefangen. Er sagt, es gibt viel zu tun.«
»Ich wette, dass er das sagt.«
»Was soll das heißen?«
»Nichts. Ignorier mich.«
»Nein, was meinst du damit: ›Ich wette, dass er das sagt‹?«
»Nur, dass er das alles nicht gratis macht, oder?«
»Ich werde dich und deine zynische, negative Energie ignorieren. Die Sache ist die, Maggie, ich wette, du würdest wirklich davon profitieren, das auch zu tun.«
»Was? Einen Therapeuten aufsuchen?«
»Sag das nicht so, als wäre es das Verrückteste überhaupt.«
»Und warum sollte ich das tun?«
»Weil es helfen könnte. Vielleicht findest du heraus, warum du immer wieder herumspringst und dich nie wirklich an einem Ort niederlässt.«
»Ich habe in Washington gelebt …«
»Niemals einem einzigen Mann verpflichtet sein willst …«
»Oh, jetzt geht das wieder los?«
»Komm schon, sag mir nicht, dass du dir nicht selbst die Frage stellst.«
»Ich kann es nicht vermeiden, mir die Frage zu stellen, wann immer ich mit dir rede, oder? Du redest über nichts anderes.«
»Ich meine es ernst. Vielleicht würde es dir helfen. Heute hat Yves gesagt, dass wir bis zum Anfang zurückgehen werden. Über die Quarry Street reden, übers Erwachsenwerden, alles.«
»Du erinnerst dich nicht daran, oder?«
»An einiges schon. Vieles ist verschwommen. Jedenfalls, wie gesagt: Es ist noch früh. Aber im Ernst, Mags. Ich wette, du würdest es …«
»Hör zu, Liz, ich muss auflegen.«
»In Ordnung, so ist das eben.«
»Nein, ist es nicht. Ich muss einfach nur auflegen. Es ist mitten am Arbeitstag.«
Stille am anderen Ende.
»Wir reden später, ja?«
»In Ordnung. Und pass auf dich auf, okay? Ich hab nur eine Schwester.«
Es dauerte weitere zwanzig Minuten, bis Maggie das Charlottesville Police Department erreichte, einen niedrigen, roten Ziegelkasten neben einem mehrstöckigen Parkhaus. Das Büro des Gouverneurs hatte vorab angerufen, also wurde sie bereits von Ed Grimes, dem Polizeichef, erwartet. Er führte sie in sein Büro, dessen Rückwand übersät war von verschiedenen Abzeichen, Trophäen und einem aufgesetzten Leitbild: Der Schutz der Freiheit und Sicherheit der Menschen von Charlottesville ist unser Ziel.
Der Chief trug Uniform und war einst Streifenpolizist gewesen, doch hätte sie dies nicht vorher gewusst, Maggie hätte es nie erraten. Grimes hatte den gepeinigten Gesichtsausdruck eines Bürokraten, die weiße Haut war im Bürolicht nur noch mehr verblasst. Er nahm seinen Platz hinter dem Schreibtisch ein, und Maggie begriff sofort, dass er in der Defensive war, nervös, weil ihm die Gouverneurin über die Schulter schaute.
»Danke, dass Sie mich empfangen«, begann Maggie und schenkte ihm ihr herzlichstes Lächeln. »Wir hören großartige Dinge über alles, was Sie hier tun.«
»Okay.«
»Die Gouverneurin ist sehr daran interessiert, über den Fall Aikman auf dem Laufenden gehalten zu werden.«
»In Ordnung.«
»Welche Richtungen Sie bei der Untersuchung einschlagen.«
»Mm-hm.«
»Was für Spuren haben Sie?«
Der Chief sah sie über den Tisch hinweg an und schwieg. Hätte er ein Blatt Karten gehalten, er hätte es flach gegen die Brust gedrückt.
Maggie versuchte es erneut, diesmal direkter. »Also. Welche Spuren verfolgen Sie?«
»Nun, wir stehen erst am Anfang unserer Ermittlungen, Miss Costello.«
Maggie unterdrückte den Drang, ihn zu korrigieren. Sie nickte ermutigend, bevor sie erkannte, dass der Polizeichef nicht vorhatte, mehr zu sagen.
»Und in welche Richtung schauen Sie, Sir?«
»Wir suchen nach dem Schuldigen.«
Maggie beugte sich vor. »Hören Sie, ich mache das schon lange genug, um zu wissen, dass das Letzte, was ein Morddezernat braucht, jemand von oben ist, der daherkommt und sich in Ihre Zuständigkeit einmischt. Ich verstehe das. Aber ich verspreche Ihnen, es liegt in Ihrem Interesse, mir hier zu helfen.«
Er schenkte ihr ein schmallippiges Lächeln, das Maggie augenblicklich das Blut in die Halsvenen schickte. Herablassung. Maggie hatte dieses Lächeln zehntausend Mal gesehen.
»Inwiefern liegt es in meinem Interesse, Miss Costello?«
»Wenn Sie mir helfen, werde ich das der Gouverneurin dieses Staates berichten. Und wenn Sie es nicht tun, dann werde ich das ebenfalls berichten.« Sie lächelte süß und ließ den unausgesprochenen Gedanken in der Luft hängen: Große Politiker konnten kleinen Politikern – wie zum Beispiel dem Polizeichef einer Stadt von der Größe Charlottesvilles – das Leben ziemlich schwer machen, wenn sie es darauf anlegten.
Schließlich griff der Chief nach einem Stift am oberen Rand einer Kladde und rückte die Brille auf dem Nasenrücken zurecht. Er räusperte sich, als wollte er ein formelles Briefing abhalten.
»Wie Sie wissen, macht Charlottesville in jüngerer Zeit eine schwierige Phase durch, insbesondere mit Aktivisten der sogenannten Alt-Rights und ihren Gegnern von ganz linksaußen.«
Maggie schwieg abwartend.
»In dieser Stadt gibt es eine besonders aktive Zelle der Bewegung Black Lives Matter, die sich auf den Campus der Universität konzentriert. Wir glauben, dass Prof. Aikmans Mörder wahrscheinlich aus diesem Kreis kommt.«
»Was bringt Sie auf diesen Gedanken?«
»Zum einen haben die Studenten einen leichten Zugang zu dem Gebäude, in dem der Professor tot aufgefunden wurde. Die Tür zu diesem Gebäude ist durch ein Zahlenschloss gesichert. Nicht jeder kann die öffnen. Man muss die Kombination kennen. Was Dutzende von Studenten tun.«
»Obwohl es sicher auch andere gibt, die sie kennen.«
»Zweitens gab es einen Zusammenstoß zwischen Professor Aikman und der Führung von Black Lives Matter. Vor allem mit zwei Leuten.«
»Einen Zusammenstoß? Inwiefern?«
Jetzt griff Grimes unter seine Kladde und zog die Kopie eines Briefes hervor, die er Maggie reichte.
Sie überflog den Inhalt nur, doch die Schlüsselstellen sprangen hervor:
Als farbige Studenten schreiben wir, um unsere tiefe Besorgnis über ein Muster der Benotungen auszudrücken, das wir für ungerecht halten … spiegelt nicht die Eigenartigkeit unserer Erfahrungen wider … kann nur vermuten, wenn nicht voreingenommen, dann unsensibel … Probleme gehen weiter als in diesem speziellen Fall … Mangel an Diversität auf höchster Fakultätsebene …
»Sie wollen damit andeuten, dass Russell Aikman von Aktivisten von Black Lives Matter getötet wurde, weil er ihnen schlechte Noten gab? Abgesehen davon ist dieser Brief an die gesamte historische Fakultät gerichtet, nicht nur an Aikman.«
»Da ist auch das hier.« Er schob ein weiteres Blatt Papier über den Schreibtisch. Es war eine Petition. »Wir, die Unterzeichner …« Oben und darunter eine lange Liste von Namen, allesamt Professoren der einen oder anderen Fachrichtung. Sie überflog die Unterschriften und suchte vergeblich nach der von Aikman.
»Aber er hat das nicht unterschrieben.«
»Ganz recht.«
Erst jetzt warf Maggie einen genaueren Blick auf die Präambel, der »Wir, die Unterzeichner« ihren guten Namen geliehen hatten. Sie stammte aus dem Vorjahr und forderte die Hochschulleitung auf, zu bestätigen, dass der Präsident der Vereinigten Staaten unter keinen Umständen eingeladen werden sollte, den Campus zu besuchen. Es hatte im ganzen Land ähnliche Bemühungen gegeben, normalerweise von den Studenten vorangetrieben, während die Fakultäten hinterhergehinkt waren. Doch Aikman hatte sich offensichtlich geweigert, seine ihm zugedachte Rolle zu spielen.
»Ist es das?«, fragte Maggie und klang unbeeindruckt, obwohl ihre Entschlossenheit wankte.
»Nein. Da ist noch etwas. Das Standbild.« Grimes produzierte einen dritten Beleg, ein Foto der Bronzestatue von Robert E. Lee, dem leitenden General der Konföderation, auf seinem Pferd. Mensch und Tier waren längst grün vor Oxidation. Das Denkmal war immer ein Wahrzeichen von Charlottesville gewesen, doch der Streit um seine Entfernung hatte jüngst eine neue Dimension angenommen. Gerade noch sichtbar an der Basis des Standbilds, obwohl durch hektische Reinigungsbemühungen stark ausgebleicht, waren Worte in Sprühfarbe zu erkennen: »Black Lives Matter.«
»Was hat das mit Aikman zu tun?«
»Eine Menge Leute an der Universität wollen, dass diese Statue verschwindet. Viele von Aikmans Studenten.«
»Und er war der Meinung, sie sollte bleiben.«
»Jepp. Er sagte, man könne die Geschichte nicht auslöschen.«
Maggie nahm das Foto und betrachtete es aufmerksam. Nur ein Mann auf einem Pferd, aus Bronze. Doch seine Präsenz in einer Stadt mit einer großen schwarzen Bevölkerung war zu einer nationalen Wunde geworden. Und Aikman hatte auf der Seite der Vergangenheit gegen die Zukunft gestanden – oder zumindest hatten die Aktivisten das so gesehen.
»Betrachten Sie es aus meiner Sicht, Miss Costello. Sie hatten die Mittel, und sie hatten Zugang zu diesem Gebäude. Und sie hatten ein Motiv, mehrere Motive genau genommen.« Er deutete auf den Dreierpack Papierkram. »Wir suchen lediglich nach der Person, die abgedrückt hat.«
KAPITEL FÜNF
Gerichtssaal 73, Richmond, Virginia, 11:45 Uhr mittags
»Ich gehe davon aus, dass Euer Ehren das Beweisstück 223 vor sich hat? Ich möchte, dass im Protokoll festgehalten wird, dass ich ein Buch mit dem Titel Twelve Years a Slave – Zwölf Jahre ein Sklave als Beweis aufgenommen habe.«
»So angeordnet.«
William Keane ging in dem kleinen, aber entscheidenden Bereich zwischen Richter, Jury und Zeugenstand auf und ab wie ein Panther, der sein Terrain patrouilliert. In den letzten Wochen war es ihm in dieser Arena immer bequemer geworden. Er fühlte sich wie ein Prediger in seiner Kanzel oder ein Werfer auf seinem Hügel. Hier dirigierte er entweder mit seiner Stimme, seinen Armen oder den Händen – und manchmal auch mit allen zusammen – das Gericht. Viel Tinte war über die Frage vergossen worden, ob sein fehlender juristischer Hintergrund ein Vorteil war, der ihn vor dem unflexiblen, abgestandenen Jargon – der Muttersprache aller professionellen Anwälte – bewahrte. Oder ob seine Rhetorik einfach ein weiterer Beweis für seine phänomenalen Fähigkeiten war. Dieser Mann, der noch nie einen Tag vor Gericht verbracht hatte, bis er in diesem Prozess für seine eigene Sache eintrat, war Tag für Tag der Star. Er war ein Naturtalent.
»Wie das Gericht weiß, nähern wir uns dem Tag der Entscheidung. Bald wird dieses Verfahren zu Ende gehen. Wir werden endlich in der Lage sein, diesen Ort zu verlassen und wieder in die Zivilisation einzutreten.« Er wandte sich mit einem wohlwollenden, konspirativen Lächeln an die Geschworenen und senkte die Stimme: »Was für eine Erleichterung, hm?«
Laut, sodass ihn jeder verstehen konnte, redete er weiter: »An diesem Punkt wird es die Aufgabe dieses Gerichts sein, sein feierliches Urteil zu fällen und zu entscheiden, ob ich von der Angeklagten verleumdet wurde, als sie mich einen ›Sklavereileugner‹ genannt hat.«
Ein Teil davon war einfach sein Aufzug. Keane hatte verstanden, dass ein Gerichtssaal ein Theater war und dass das Erscheinungsbild einen wesentlichen Bestandteil jeder Rolle darstellte. Der Südstaaten-Gentleman im weißen Anzug war genauso klischeehaft wie der englische Peer in Nadelstreifen, und genau aus diesem Grund funktionierte es. Der Anblick löste einen tief sitzenden Reflex des Wiedererkennens aus.
Abgesehen davon wusste Keane, dass er nicht übertreiben durfte. Es gab keine Bolo-Krawatte und keinen Zehn-Gallonen-Hut. Der Look war weniger Boss Hogg und mehr Atticus Finch. Er wollte Südstaaten-Würde und intellektuelle Kompetenz vermitteln, zugleich ebenbürtig wie auch im Kontrast zu den arroganten Eliten der Ivy League auf der anderen Seite.
»Meine Damen und Herren Geschworenen, Sie haben viele Stunden lang fachkundige, oft obskure, ja sogar arkane Aussagen über sich ergehen lassen. Doch jetzt bitte ich Sie, über einen Text nachzudenken, von dem ich annehme, dass Sie ihn gut zu kennen glauben. Das Buch wurde sogar zu einem Hollywood-Film verarbeitet.« Er grinste spitzbübisch, als wollte er der Jury ein Schmankerl anbieten. »Wir reden über das hier!«
Mit einer schwungvollen Bewegung holte er ein ramponiertes altes Buch hervor und hielt es in die Höhe. »Ich vermute, einige von Ihnen haben den Film gesehen. Ich sage nicht, dass er Ihnen gefallen hat. Wie kann ein anständiger Mensch auch eine solche Litanei des Schreckens genießen?« Er senkte den Blick zu Boden und schüttelte theatralisch den Kopf, als beklagte er die schiere Scheußlichkeit von alledem.
»Aber viele von Ihnen werden eine Vorstellung von der Zeit haben, die meine Gegner nach diesem Film ›das Zeitalter der Sklaverei‹ nennen. Es hat Sie geformt. Es ist tief in Ihre Seele gelangt. Und aus diesem Grund rufe ich als meine letzte Zeugin für heute Professor Andrea Barker auf.«
Ein Marschall führte eine weiße Frau Mitte dreißig in den Zeugenstand. Sie trug einen Hosenanzug und hatte eine exklusive Langhaarfrisur. Die Geschworenen hatten eine ganze Reihe schüchterner, nervöser Akademiker im Zeugenstand gesehen, doch die Art und Weise, wie diese Frau lächelte und Keanes Blick hielt, deutete darauf hin, dass er nun endlich auf jemand Ebenbürtigen getroffen war.
Sie hob die rechte Hand, legte sie auf die Bibel und sagte den Eid auf. Sie nannte ihren Namen und verkündete mit einer starken, klaren Stimme, dass sie am Wellesley College Geschichte unterrichte.
»Und das ist ein privates Frauen-College für freie Künste in Massachusetts, stimmt das?« Keane achtete peinlich genau darauf, die Worte sehr deutlich und betont auszusprechen, damit sein zwölfköpfiges Publikum das Signal nicht verpassen konnte, das jedes einzelne von ihnen übermittelte. Wenn er einem bestimmten Wort besonderes Gewicht beimaß, dann vielleicht »freie«. Oder auch »Frauen«, was er wie »lesbisch« auszusprechen schien.
»Sie haben speziell über dieses Buch geschrieben, Zwölf Jahre ein Sklave, ist das richtig?«
»Das ist richtig.«
»Sie sind also eine Expertin.«
»Ich vermute, das trifft zu.«
»Nun, wir fühlen uns geehrt, Sie hier unten bei uns in Old Virginia begrüßen zu dürfen. Danke, dass Sie den ganzen Weg von Massachusetts bis hierher gekommen sind. Ich hoffe, man hat Ihnen ein herzliches Südstaaten-Willkommen entboten.«
Die Frau bewegte sich unruhig im Zeugenstand, während sie überlegte, wie sie reagieren sollte. War dies eine Anspielung auf die gewaltige Menschenmenge, die von der Polizei gegenüber dem Gerichtsgebäude im Zaum gehalten wurde, aufgeteilt in zwei unversöhnliche Lager, die sich von morgens bis abends ihre Parolen zubrüllten? Oder hatte er es tatsächlich ernst gemeint?
»Danke sehr«, sagte sie schließlich.
»Wir danken Ihnen. Lassen Sie mich mit einer einfachen Frage beginnen, Professor Barker. Wer ist der Autor von Zwölf Jahre ein Sklave?«
»Das war Solomon Northup, ein freier Mann, der in Louisiana gekidnappt und in die Sklaverei verkauft wurde.«
»Ich weiß, das ist der Name, der auf dem Einband steht. Aber ich frage Sie, wer hat dieses Buch geschrieben? Wer hat Stift und Papier zur Hand genommen und die Sätze verfasst, die auf diesen gedruckten Seiten stehen?«
»Nun ja, ein Buch wie dieses ist eindeutig …«
»Darf ich Ihre Erinnerung auffrischen? Euer Ehren, und hier zitiere ich aus Professor Barkers überregional gelobtem Aufsatz, Die Erlösung des Solomon Northup. In dem fraglichen Abschnitt berichtet sie uns von einem berühmten New Yorker Politiker – einem liberalen sogenannten Abolitionisten –, und sie schreibt, dass dieser Politiker ›einen Anwalt und Dichter, David Wilson, gefragt hat, ob er bereit sei, Solomon Northup zu interviewen und seine Geschichte in ein Buch zu verwandeln‹. Dieser David Wilson – ich zitiere immer noch Professor Barker – hat ›die Chance ergriffen‹. Und dann schreiben Sie weiter, Professor – das sind Ihre genauen Worte: ›So wurde Zwölf Jahre ein Sklave nicht einmal von Salomon Northup selbst geschrieben, sondern von einem weißen Amanuensis.‹«
»Was ich dort meinte, ist …«
»Oh, Sie kommen noch dran, keine Sorge. Aber ich bin noch nicht fertig mit dem Zitat. Ihr nächster Satz lautet: ›Wilsons Urheberschaft der Erzählung hat lange Zeit Zweifel an ihrer Authentizität geweckt.‹ Meine Güte, Professor. Was schreiben Sie da? ›Zweifel an ihrer Authentizität?‹ Zwölf Jahre ein Sklave? Dieses Buch ist die heilige Schrift der Sklavenindustrie, nicht wahr? Und dann kommen Sie …«, Keane wandte sich von seiner Zeugin ab und der Jury zu, »… eine Professorin der freien Künste von oben in Massachusetts …«, er genoss jede einzelne Silbe, »… und räumen ein, dass es Zweifel an der Authentizität des Buches gibt.«
»Das tue ich überhaupt nicht. Der Kontext ist …«
»Ich bin ein einfacher Mann, Frau Professor. Ich lese lediglich die Worte, die Sie aufgeschrieben haben. Schwarz auf weiß.«
»Einspruch. Es hat keinen Sinn, eine Zeugin zu befragen, wenn der Kläger sich weigert, die Zeugin antworten zu lassen.«
»Stattgegeben.«
»Lassen Sie mich weitermachen, Euer Ehren. Onkel Toms Hütte. Wie würden Sie dieses Buch beschreiben, Professor Barker?«
»Ich verstehe nicht?«
»Was für eine Art von Buch ist es?«
»Ein Roman.«
»Ein Roman. Fiktion. Erfunden. Ist das richtig?«
»Aber die Geschichte basiert offensichtlich auf …«
»Ist es ein Roman oder nicht?«
»Das ist es.«
»Und er erschien ein Jahr vor Zwölf Jahre ein Sklave, stimmt das?«
»Ja.«
»Und können Sie dem Gericht verraten, was die Autorin von Onkel Toms Hütte über Solomon Northups Buch gesagt hat? Was sie über Zwölf Jahre ein Sklave gesagt hat?«
»Nun ja, ich habe nicht den genauen Wortlaut …«
»Keine Sorge, Professor Barker. Ich habe die genauen Worte hier. Die Worte von Harriet Beecher Stowe, der Autorin von Onkel Toms Hütte, als sie Zwölf Jahre ein Sklave ein Jahr nach dem Erscheinen ihres eigenen Romans gelesen hatte. Hier ist, was sie gesagt hat: ›Es ist ein wirklich unglaublicher Zufall, dass dieser Mann zu einer Plantage im Red River Land gebracht wurde, jener gleichen Region, in der der Schauplatz von Toms Gefangenschaft lag; und sein Bericht über diese Plantage, die Lebensweise dort sowie einige Vorfälle, die er beschreibt, bilden eine auffällige Parallele zu meiner Geschichte.‹ Was sagen Sie dazu, Professor Barker?«
»Nun, ich würde sagen, sie hat in Northups Bericht eine weitere Bestätigung für ihren Roman gefunden.«
»Oder Solomon Northup hat einen Roman – eine erfundene Geschichte – kopiert, um eine eigene Geschichte daraus zu machen.«
»Nein, das würde bedeuten …«
»Aber das haben Sie selbst geschrieben. Ich zitiere Ihre Arbeit noch einmal. ›Sklavenerzählungen waren nie dazu gedacht, eine unvoreingenommene Sichtweise zu vermitteln … sie enthalten Ungenauigkeiten, Verzerrungen und Ausschmückungen.‹ Nicht meine Worte, meine Damen und Herren, sondern die Worte von Professor Barker vom Wellesley College, Massachusetts: ›Ungenauigkeiten, Verzerrungen und Ausschmückungen.‹«
»Sie verdrehen meine Worte.«
»Tue ich das? Verdrehe ich sie so sehr wie Solomon Northup? Oder machen Ihnen ›Ungenauigkeiten, Verzerrungen und Ausschmückungen‹ nichts aus, solange sie einer gerechten Sache dienen?«
»Einspruch. Er belästigt die Zeugin.«
»Stattgegeben. Mr. Keane, ich warne Sie nicht noch einmal.«
»Ich bin beinahe fertig, Euer Ehren. Ich habe nur noch eine letzte Passage aus Professor Barkers Papier, die meiner Meinung nach zitiert werden sollte. Es ist der Kernpunkt ihrer Argumentation. Sie sagt ihren Lesern, sie sollen sich nicht auf einen ›falschen Standard von Authentizität‹ einlassen. Lassen wir uns nicht darauf ein, Leute! Was zählt, ist ›Northups Stimme, nicht seine Fakten; diese Stimme ist es, die Zwölf Jahre ein Sklave so dauerhaft macht‹.
Wann sagen wir so etwas, meine Damen und Herren? Wann sagen wir: ›Oh, es sind nicht die Fakten, die zählen, es ist die Stimme, es ist das Gefühl?‹ Wann sagen wir das? Wir sagen es, wenn wir einen Film gesehen haben oder eine Fernsehsendung oder ein Märchen gelesen haben. Das sagen wir über Fiktionen. Weil es das ist.
Zwölf Jahre ein Sklave hat all diese Oscars gewonnen und war ein Filmhit, und das ist in Ordnung. Wissen Sie, warum? Weil so etwas in Filme gehört. Ins Land der Fantasie. Hollywood. Die Traumfabrik. La La Land. Dort gehört es hin. Weil Zwölf Jahre ein Sklave Fiktion ist. Genau wie diese ganze Sklavereigeschichte Fiktion ist, von Anfang bis Ende. Jeder Peitschenhieb, jede Fessel am Handgelenk, jede Kette am Knöchel, das alles ist ein Märchen, dazu bestimmt, weiße Menschen zu Ogern und Hexen und Schwarze zu Engeln zu machen. Erfunden von oben bis unten. Und bald, schon sehr bald, meine Damen und Herren Geschworenen, werden Sie Gelegenheit haben, dies zu bestätigen.
Keine weiteren Fragen, Euer Ehren.«
KAPITEL SECHS
Charlottesville, Virginia, 17:25 Uhr nachmittags
Die herbstliche Dämmerung hatte bereits eingesetzt, als Maggie aus dem Police Department von Charlottesville kam. Es war dunkel genug, um selbst von hier aus die brennenden Kerzen auf der anderen Straßenseite erkennen zu können. Zuerst dachte sie, es wäre eine Art Display, dazu gedacht, Kundschaft in das Tin Whistle Pub gegenüber dem Polizeigebäude zu locken. Doch als sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, sah sie, dass die Kerzen in Wirklichkeit von einer kleinen Gruppe von Leuten gehalten wurden, die sich zusammendrängten wie Sternsinger an den Straßenecken im Dublin ihrer Jugend.
Nur, dass die Gruppe nicht aus ältlichen irischen Damen mit lila Haaren bestand, sondern aus einer Mischung schwarzer und weißer Aktivisten, keiner von ihnen älter als dreißig. Sie murmelten eine Melodie – es mochte »Amazing Grace« sein –, und drei oder vier trugen Spruchbänder. Hope Not Hate, stand auf einem, Hoffnung statt Hass. Nein zu Bigotterie, erklärte ein anderes.
Maggie näherte sich, um einen besseren Blick zu erhaschen. Sie trat zu zwei Reportern, beide mit Notizbüchern, die die Worte des mutmaßlichen Anführers der Gruppe aufschrieben: ein kräftiger, bärtiger Afroamerikaner, der sie beide überragte.
»Oh, das sind wir gewöhnt, Leute«, sagte er soeben. »Immer, wenn in dieser Stadt irgendwas passiert, sind wir die Schuldigen. Immer. Aber diesmal nicht. Diesmal lassen wir das nicht auf uns sitzen. Auf gar keinen Fall.«
»Die Polizei berichtet, dass es eine Geschichte andauernder Feindschaft zwischen den Aktivisten von Black Lives Matter und Professor Aikman gab«, sagte die Reporterin. Ihre Haare waren so blond und steif, dass Maggie sich unwillkürlich nach einer Kamera umsah.
»Schon klar, Schwester. Ich weiß, was die Polizei sagt. Sie sagt es dir, sie sagen es uns. Ins Gesicht. All das Gerede, ›Russell Aikman war euer Gegner‹. Das ist Schwachsinn. Hast du mich verstanden?«
»Stimmt es nicht, dass er in der Denkmaldebatte auf der anderen Seite stand?«
Der große Schwarze grinste. »Viele Menschen in der Stadt stehen in dieser Debatte auf der anderen Seite. Viele Leute im Land. Denkst du, wir fangen deswegen an, die alle umzubringen?«
»Was ist mit dem Zugang zum Gebäude?«
»Eine Menge Leute können da rein. Nicht nur Schwarze haben die Kombination.« Ohne seinen Vortrag zu unterbrechen, reichte er einer Frau, die vorbeikam und unablässig in ihr Telefon redete, ein Flugblatt.
Maggie sah ihren Moment gekommen. Sie hielt ihr Telefon im Reporter-Stil hoch, als wollte sie seine Antworten aufnehmen.
»Was wussten Sie bis gestern über Russell Aikman?«
»Das ist es ja gerade. Ich habe kaum was von ihm gehört. Das soll keine Respektlosigkeit gegenüber dem Kerl sein, aber er war einfach keiner der großen Spieler bei der ganzen Denkmaldebatte. Er hat nicht bei CNN die Klappe aufgerissen, wenn du weißt, was ich meine.«
»Er stand nicht auf der Liste Ihrer Feinde?«
»Lady, wir haben keine Liste mit Feinden. Nichts in der Art.«
»Aber wenn Sie eine hätten?«
»Wär er nicht drauf gewesen. Der Typ war nicht auf unserem Radar.«
Die beiden Reporter bedankten sich eilig und drehten ab. Maggie fragte sich, ob es etwas war, was er – oder vielleicht sie – gesagt hatte. Doch dann entdeckte sie den Polizeichef, der aus dem Department-Gebäude gegenüber trat. Sie wollten ihn mit ihren Fragen löchern.
Maggie wandte sich wieder an den Anführer. »Mister …?«, begann sie leise.
»Jewel. Mike Jewel. Nenn mich Mike, Schwester.«
»Mike, wer, glauben Sie, hat Russell Aikman ermordet?«
»Ich habe keinen Namen für dich, wenn du das meinst. Ich bin kein Detektiv. Allerdings haben die Bullen auch keinen Namen.« Er nickte in Richtung des Polizeichefs. »Aber es ist offensichtlich. Weiße Rassisten haben diesen Mann ermordet.«
»Warum ist das offensichtlich?«
»Hast du Aikmans Arbeiten gelesen? Hast du mal einen Blick auf das geworfen, was dieser Typ so veröffentlicht hat?«
Maggie schüttelte den Kopf.
Jewel zog sein Smartphone heraus und wischte direkt zu einem Tab, den er anscheinend zu diesem Zweck offen gehalten hatte. »Hier. Sieh dir das an.«
Er hielt das Handy in einem Winkel hoch, der es Maggie schwer machte, das Display abzulesen. Es schien sich um einen Artikel in einer wissenschaftlichen Zeitschrift zu handeln, in dem ein Buch Aikmans besprochen wurde. Der Titel lautete Die Bedeutung von Zwangsarbeit und freier Arbeit in der Wirtschaft des Staates Virginia zwischen 1680 und 1820.
»Ich bin mir nicht sicher, was ich sehe …«
Jewel nahm das Smartphone herunter. »Sieh mal, dieser Professor ist Zeile für Zeile durch das Archiv gegangen. Er hat die genaue Anzahl von Sklaven ausgerechnet, die auf jedem Grundbesitz und jeder größeren Plantage gehalten wurden, einschließlich Monticello und Mount Vernon.« Ohne den Blick von Maggie abzuwenden, zog er einen neuen Flyer von seinem Stapel und gab ihn einem Teenager.
»Ich verstehe.«
»Er hat nicht nur herausgefunden, wie viele Sklaven Thomas Jefferson und George Washington gehalten haben. Er hat sogar herausgefunden, wie viele unter ihrer Aufsicht gestorben sind. Aikman hat diese Arbeit erledigt, verstehst du, was ich meine?«
»Ich denke, ja.«
»Aber er hat nicht bei den großen Namen aufgehört. Er ist die Aufzeichnungen durchgegangen – Testamente, Auktionsbücher, Schiffsmanifeste – das komplette Archiv. Ich meine, der Typ war unerbittlich. Er hat immer weiter gemacht, bis er die genaue Zahl der Sklaven ermittelt hatte, die jede der großen Familien in Virginia gehalten hat. Er hatte es raus. Hieb- und stichfest, Schwester.«
»Und diese Familien …«
»Sie sind immer noch da. Das ist der springende Punkt. Sie sind noch da. Das alles ist noch nicht so lange her, Schwester. Die riesigen Plantagenvermögen, die Namen – sie sind nie verschwunden.«
»Und Sie denken, einer von ihnen wollte Russell Aikman zum Schweigen bringen.«