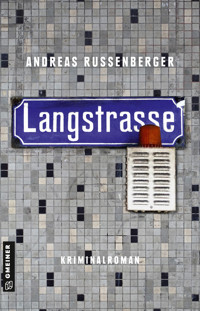Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Sie ist die mächtigste Frau Deutschlands. Die erste sozialdemokratische Kanzlerin. Und sie hat sich geschworen, ein Vermächtnis zu erfüllen! Eigentlich war Helena von Eschenbach, die bisherige Chefin einer Stiftung, eine Außenseiterin unter den Kanzleramtsanwärtern. Doch dann wirbelten Skandale ihre Konkurrenten kurz vor der Wahl vom Kandidatenkarussell. Zur Begeisterung von Wählern und Wirtschaft stößt die Kanzlerin ein gigantisches nationales Aufbauprogramm an. Dafür stellt sie in einem Akt beispiellosen Mäzenatentums das milliardenschwere Vermögen ihrer Stiftung in den Dienst des Gemeinwohls. Deren Wurzeln reichen zurück in die düsteren 1940er Kriegsjahre und sind verflochten mit dem Aufstieg eines angesehenen Zürcher Bankhauses. Doch von Eschenbachs "Pro Deutschland"-Kurs kommt ins Schleudern, als sie auch noch den Ausstieg aus dem Euro fordert. Die Koalitionspartner kündigen das Regierungsbündnis auf. Es kommt zu Neuwahlen. Von Eschenbach gelingt triumphal die Wiederwahl - auch, weil ihr entscheidende Prozentpunkte zufallen, als am Vorabend der Wahl ein Attentat auf sie verübt wird. Manipulativ, instinktsicher und skrupellos bedient sich die charismatische Kanzlerin fortan der politischen Schalthebel. Als einige ihrer Widersacher auf mysteriöse Weise ums Leben kommen, beginnt Alexander Isenschmid, Spross der mit der Stiftung verquickten Bankiersfamilie und enger Vertrauter von Eschenbachs, zu recherchieren. Damit bringt er sich und sein Umfeld in tödliche Gefahr... Andreas Russenberger ist ein spannender Politikthriller mit hochaktuellen Bezügen gelungen - schwarzer Humor und bissige Satire inbegriffen!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 321
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über den Autor:
Andreas Russenberger, geboren 1968, studierte Geschichte und Politologie in Zürich. Nach weiteren Diplomen an der Universität St. Gallen und der Stanford University (USA) arbeitete er viele Jahre als leitender Managing Director für einen globalen Finanzkonzern. Er lebt mit seiner Familie am Zürichsee. Die Kanzlerin ist sein erster Roman.
Mehr Informationen über den Autor finden Sie unter:www.andreas-russenberger.ch
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 1
Berlin, 30. April 1945
Obersturmbannführer Funke bewegte sich im Schutze der Reichskanzlei in Richtung Führerbunker. Er war mit zwei jungen SS-Soldaten und einem Gefreiten der Wehrmacht unterwegs. Der Gefreite trug eine schmutzige, verschlissene Uniform. Sein Kopf war bis auf die Augenpartie von einem blutverschmierten Verband verhüllt. Die beiden Soldaten waren groß und kräftig, dennoch stand ihnen die Angst ins Gesicht geschrieben. Bei jedem Granateinschlag zuckten sie zusammen. Ihre Ausrüstung war aber tadellos: saubere Uniformen, gebürstete Stiefel, polierte Maschinengewehre, Pistolen und Munitionsgürtel. In den letzten Kriegstagen war dies die Ausnahme, nicht die Regel.
Funke schaute vorsichtig in alle Richtungen und dirigierte die Gruppe zielstrebig vorwärts. Seine schwarze Uniform war gepflegt und saß perfekt. Wachsam prüfte er die Umgebung. Er hatte im Verlaufe des Krieges gelernt in größter Gefahr ruhig und besonnen zu bleiben. Die Soldaten bewegten sich so nahe wie möglich bei ihm und suchten seinen Schutz.
Das kleine Grüppchen war von einem großen Konvoi der Waffen-SS zur Reichskanzlei gebracht worden. Die Fahrzeuge – mehrere Panzer und leichtere Militärfahrzeuge – waren zwischen den Ruinen in Deckung gegangen, nachdem Funke und die drei anderen Männer ausgestiegen waren. Eine Eskorte von rund fünfzig Infanteristen bildete schützend einen Kreis um die Fahrzeuge. Schwere Maschinengewehre und Panzerfäuste ragten drohend in die Luft. Die Soldaten waren von Funke instruiert worden, die Stellung bis zu seiner Rückkehr zu halten.
Die Reichskanzlei war seit einigen Tagen in Reichweite russischer Geschütze. Rings um das Verwaltungsgebäude herrschte Weltuntergang. Immer wieder schlugen Granaten der Stalinorgeln ein und ließen den Boden erzittern. Das Gelände war übersät von Kratern. Beißender Rauch lag in der Luft, dazu der Geruch nach Chlor und Verbranntem. In der Ferne stotterten deutsche Flakgeschütze, die verzweifelt Widerstand zu leisten versuchten. Dazwischen immer wieder Lärm von Panzern, Maschinenpistolen und das Schreien von Verwundeten.
»So eine verdammte Sauerei«, sagte Funke.
Die deutschen Truppen waren in Auflösung begriffen. Man kontrollierte nicht einmal mehr das Gebiet der Hauptstadt. Funke wusste, dass der Krieg unwiderruflich verloren war. Wer jetzt noch an den Endsieg glaubte, musste ein völliger Trottel sein. Die einzige Frage war nur noch, wann die Russen das Zentrum erreichen würden. Sie kämpften bereits am Potsdamer Platz, nur einige Hundert Meter von der Reichskanzlei entfernt. Die Wehrmacht, SS-Einheiten und das letzte kümmerliche Aufgebot aus viel zu Alten und viel zu Jungen folgten Hitlers Ruf, die Hauptstadt bis zum letzten Mann zu verteidigen. Ihre Barrikaden aus Gerümpel – alten Lastwagen, Pflastersteinen, Möbeln und Matratzen – stellten für Stalins Panzer kein ernsthaftes Hindernis dar. Die Geschwindigkeit und Gewalt des russischen Vormarsches war beeindruckend. Es existierte keine Front mehr, die den Namen verdiente.
Auf der anderen Seite der Reichskanzlei detonierten in diesem Moment mehrere Geschosse und fällten einen Baum, der sofort zu brennen begann. Der Lärm und das Pfeifen kurz vor dem Einschlag waren ohrenbetäubend.
»Runter!«, brüllte der Obersturmbannführer. Seine Begleiter gingen zu Boden wie Bahnschranken. Obwohl Funke äußerlich abgeklärt wirkte, trieb ihn die Ungeduld. Er hatte mit diesem Chaos gerechnet, aber nun lief ihm die Zeit davon. Er verscheuchte die negativen Gedanken und versuchte sich auf diejenigen Schritte seiner Mission zu konzentrieren, die er beeinflussen konnte. Wenn alles gut ginge, würde der Krieg in Kürze zu Ende und Hitler Geschichte sein.
Sie waren noch gut fünfzig Meter vom Eingang des Führerbunkers entfernt. Rechts davon ragte einsam eine Schießscharte aus dem Boden. Sie schien verwaist, aber Funke war sich sicher, dass ein Maschinengewehr auf sie gerichtet war.
»Hoffentlich behalten die Jungs die Nerven«, sagte er halblaut, mehr zu sich selbst als zu seinen Begleitern. Er hatte an der Front mehrmals erlebt, wie Soldaten unter Stress die eigenen Kameraden ins Sperrfeuer nahmen. Er sah an der Seitenwand der Reichskanzlei hoch. Die Scheiben waren durch die Druckwellen zerstört worden. Nur noch schwarze Löcher, alles rußgeschwärzt. Der Anblick erinnerte an einen zahnlosen Mund.
Funke sah ungeduldig zum Bunker hinüber. Der Eingang war in ein stabiles rechteckiges Betongehäuse integriert – ohne Insignien oder sonstigen Pomp, mit dem sich das Dritte Reich sonst so gern schmückte. Kaum zu glauben, dass sich hier momentan fast die gesamte Führung des Reiches aufhielt. Er bemerkte die zwei SS-Wachen des Führerbegleitkommandos, die den Bunkereingang bewachten und sich tief in die Deckung zurückzogen.
Nachdem der Artilleriebeschuss abgeflacht war, erhoben sich Funke und seine Begleiter und klopften sich den Staub von den Uniformen.
»Wir warten noch ein paar Minuten«, befahl Funke. Sein Körper schmerzte überall, obwohl er mit Medikamenten vollgepumpt war. Vor allem seine alte Schulterverletzung verursachte ein pulsierendes Stechen. Er hatte in den vergangenen Tagen nur wenige Stunden Schlaf gefunden. Die tiefen schwarzen Augenringe erinnerten an die Tarnbemalung eines Scharfschützen.
Die Tür zum Führerbunker öffnete sich nun und eine Handvoll hochrangige Militärs hastete davon. Sie hatten es eilig. Funke konnte es ihnen nicht verdenken. Kurze Zeit später erschien der Führer selbst am Eingang. Tief gebeugt drückte er sich an die massive Wand. Sein Gesicht war eingefallen und grau, die Augen gerötet, dunkle Tränensäcke verstärkten den desolaten Eindruck. Die linke Hand, ja der ganze linke Arm zitterte.
Sie rannten rasch los. Funke und seine kleine Truppe grüßten förmlich.
»Wir haben die gewünschte Person bei uns und sind zum Rapport bereit.« Funke schrie gegen den Lärm an. Hitler quittierte mit einem schwachen Nicken. Die Uniform zeigte Anzeichen von Schmutz und Verwahrlosung. Funke ärgerte sich darüber. Der Soldatenkodex verbat ihm jedoch eine Bloßstellung seines Vorgesetzten. Stattdessen mahnte er zur Eile. »Wir müssen zum Rapport in Ihre Privaträume. Die Front bricht überall zusammen. Die Zeit wird knapp!«
Die Wachen wagten nur einen verstohlenen Blick in ihre Richtung. Hitler ging unsicher ein paar Schritte hin und her. Funke blickte hastig auf seine Armbanduhr. Schließlich schlurfte der Führer zurück und verschwand hinter der massiven Schutztür. Grußlos trat die Leibstandarte zur Seite. Funke spürte die Zornesröte in seinem Gesicht ob dieser Respektlosigkeit. Er sparte sich die Standpauke. Die armen Kerle würden sowieso nicht mehr lange zu leben haben. Er drückte einem der beiden seine angebrochene Packung Zigaretten in die Hand.
Sie schritten durch die riesige Anlage zu Hitlers Privaträumen. Der Führerbunker war ein gewaltiger Bau. Rund fünf Meter unter der Erde befanden sich mehr als zwei Dutzend Räume, verteilt über zwei Ebenen, mit Ausgängen in die Hauptgebäude und einem Notausgang in den Garten der Reichskanzlei. Vier dieser fünf Meter waren Stahlbeton. Das Problem dieser bombensicheren und tiefen Eingrabung war, dass man unter den Grundwasserspiegel gelangt war. Dauernd musste Wasser aus dem Bunker gepumpt werden und der Lärm des dafür benötigten Dieselgenerators war unerträglich. Für Funke war es ein Rätsel, wie man es hier mehr als ein paar Stunden aushalten konnte. Kein Wunder, dass alle Bewohner des Bunkers auffälliges Verhalten an den Tag legten und langsam durchdrehten.
Sie kamen nur langsam voran. Dutzende Menschen begegneten ihnen auf dem Weg durch die Betonflure: Sekretärinnen, Soldaten der Leibstandarte, Funker, Küchenpersonal. Ein eigenartiges Gemisch aus Resignation, Euphorie, Angst und Freude über das baldige Ende lag in der Luft. Es wurde geraucht, getrunken, geredet, gelacht, geweint, telefoniert, herumgesessen und umhergehastet. Vor seinen privaten Räumen beschied Hitler der Gruppe zu warten und schloss die Tür hinter sich. Funke öffnete eine neue Packung Zigaretten. Rauchend warteten sie auf weitere Anweisungen.
Funke bemerkte Hitlers Adjutanten. »Warten Sie kurz«, rief er und eilte zu ihm.
»Obersturmbannführer, schön, Sie lebend wiederzusehen«, grüßte ihn der Adjutant. »Gibt es Neuigkeiten von der Front?«
»Keine positiven. Ich habe einen Soldaten der Armee Wenck bei mir. Er soll Hitler rapportieren – es wird ihm keine Freude bereiten. Es wird keinen Entlastungsangriff mehr geben. Die Kacke steht uns bis zum Hals.«
Der Adjutant schüttelte resigniert den Kopf. Sein Körper schrumpfte in sich zusammen. »Dann ist alles verloren.«
»Mann, reißen Sie sich zusammen. Wenn wir schon draufgehen, dann wenigstens aufrecht. Ich nehme an, Sie haben den letzten Wunsch des Führers nicht vergessen.«
Der junge Mann drückte gehorsam sein Kreuz durch, schaute sich vorsichtig um und antwortete leise. »Er hat sich heute von seinen engsten Mitarbeitern verabschiedet. Sein Testament ist verfasst und er hat die Braun noch offiziell geheiratet. Eben hat er die Generäle übel beschimpft und alle rausgejagt. Er hat schon vor einigen Tagen Selbstmordpläne geäußert. Eine Phiole Zyankali und einen Schuss in den Kopf. Anschließend müsse ich ihn und Eva Br… Hitler verbrennen. Das ist alles ein totaler Albtraum.«
Funke legte ihm eine Hand auf die Schulter. »In und um Berlin bricht die Verteidigungsfront gerade zusammen. Ich rate Ihnen, die vom Führer gewünschten Vorbereitungen zu treffen. Er und seine Frau dürfen den Russen weder tot noch lebendig in die Hände fallen. Haben wir uns verstanden?«
Der Adjutant schlug die Hacken zusammen und machte sich an die Arbeit. Funke blickte wieder auf seine Uhr – jede Minute zählte. Resolut klopfte er an die massive Tür zu Hitlers privaten Räumen und befahl den beiden SS-Soldaten oben auf ihn zu warten.
Kurz darauf wurde die Türe geöffnet und Funke stieß den verletzten Gefreiten in den Raum.
Als die beiden das Zimmer rund fünfzehn Minuten später wieder verließen, fielen sie im allgemeinen Durcheinander nicht auf. Sie bewegten sich zügig über den Notausgang ins Freie. Dort war Hitlers Adjutant gerade dabei, im Schutz einer massiven Betonwand eine tiefe Grube auszuheben. Mehrere Benzinkanister standen bereit. Funke nickte ihm kurz zu und winkte die beiden SS-Soldaten heran. Zusammen eilte die kleine Vierergruppe auf die Wilhelmstraße, wo sich der schlagkräftige Konvoi sofort sammelte und in Bewegung setzte.
***
Seit Wochen gab es in Berlin keine Zeitungen mehr. Abgesehen von den Gerüchten und Nachrichten, die man auf der Straße aufschnappte, waren die Informationen spärlich. Als vor einigen Tagen die ersten Granaten in Berlin einschlugen, richteten sie unter den Passanten ein grausiges Blutbad an. Das Chaos in der Stadt weitete sich seitdem im Minutentakt aus. Zwischendurch keimte inmitten der Trümmer Hoffnung auf. Einmal wollte der Führer eine Wunderwaffe zur Hand haben. Ein andermal war die Rede, dass sich die Amerikaner an die Seite Deutschlands stellen würden, um den Vormarsch der Sowjets zu stoppen. Mit Flugblättern wurden Durchhalteparolen an die apathische Bevölkerung verteilt.
Die Realität war eine andere. Die junge Frau sah Einheiten von Hitlerjungen und Pensionären, die mit altertümlichen Gewehren ohne passende Munition an ihr vorbei in den sicheren Tod zogen. In schrottreifen Verkehrsbussen wurden sie an die Front verfrachtet. Russische Granaten oder Tiefflieger rieben die meisten von ihnen schon auf dem Weg dorthin auf. Dazwischen versprengte Einheiten der Waffen-SS, die betrunken und ausgelassen das Ende feierten, angetrieben durch eine verzweifelte, aber immer noch fanatische Energie. Der Krieg dauerte noch an, weit über sein eigentliches Ende hinaus.
Es war unmöglich geworden, aus der Stadt zu gelangen. Sie hatte seit Tagen nichts mehr von ihren Eltern gehört und machte sich kaum mehr Hoffnung, ihren Vater und ihre Mutter lebend wiederzusehen. Da die feindlichen Soldaten von allen Seiten in die Stadt drängten, war sie auf ihrer Flucht unbewusst ins Zentrum gelangt. Gerade bewegte sie sich vom Brandenburger Tor in Richtung der Reichskanzlei. Es brannte überall lichterloh, und Asche legte sich wie eine Decke über die Stadt. Ganze Straßenzüge waren ausgebrannt, von den Häusern standen nur noch Teile der Mauern, die wie warnende Finger in die Luft ragten. Die Augen der jungen Frau schmerzten und ihre Zunge fühlte sich unangenehm pelzig an.
Dann sah sie den gut bewachten Konvoi. In hohem Tempo bog er von der Wilhelmstraße ab. Die Panzer trugen SS-Abzeichen und bildeten eine Raute um ein gepanzertes Fahrzeug, das in ihrem Schutz nur undeutlich zu erkennen war. Eine kleine Einheit der Waffen-SS sicherte die Straße – gut ausgerüstet, organisiert und kampfbereit. Erst jetzt bemerkte die Frau, dass die breite Hauptstraße vollständig geräumt und von Hindernissen befreit war. Einige Soldaten füllten Granatkrater mit Schutt auf und stampften diesen fest. Als der Konvoi herangebraust kam, wurden eilig zwei kleine Jagdmaschinen aus einem betonierten und gut getarnten Unterstand geschoben. In der vorderen Maschine saß bereits ein Pilot. Flugzeuge! Mitten in der Stadt auf einer der letzten gesicherten Straßen! Sie schöpfte Hoffnung. Vielleicht gab es auch noch Platz für sie?
Der Konvoi hielt neben den startbereiten Maschinen an. Konzentriert sicherten die Soldaten die Umgebung. Ein Schuss löste sich. Dem Panzerfahrzeug entstiegen zwei Personen. Ein hoher Militär in schwarzer Uniform und ein einfacher Landser, der eine schwere Kopfverletzung zu haben schien. Beide stiegen rasch in die zweite Maschine. Sofort wurden die Propeller angeworfen.
Jetzt rollten die Panzer in hohem Tempo die von den Trümmern befreite Straße hinauf und begannen aus vollen Rohren zu schießen. Die Infanteristen folgten ihnen und schossen jeden nieder, dem sie begegneten. Es war ein Selbstmordkommando, aber die Soldaten zögerten keine Sekunde.
Kaum waren die Maschinen in der Luft, schaltete die erste die Positionslichter an und zog gegen Norden. Der Feind nahm sie mit seiner weit vorgerückten Bodenartillerie sofort unter Beschuss. Ein Treffer ließ die Maschine schlingern, bevor sie mit einem deutlich hörbaren Knall einen knappen Kilometer entfernt in die Ruinen stürzte. Die zweite Maschine schwenkte in Richtung Süden ab und verschwand dank dem Ablenkungsmanöver unbemerkt im dichten Rauch.
Atemlos erreichte die junge Frau die zurückgebliebenen Soldaten. »Bitte helft mir hier rauszukommen. Ich will den Russen nicht lebendig in die Hände fallen!«
Ihr Wunsch ging in Erfüllung. Die zurückgebliebene SS-Einheit wusste zwar nicht, in welchem wichtigen Auftrag Obersturmbannführer Funke unterwegs war, doch sein letzter Befehl, alle Zeugen dieses Ereignisses zu liquidieren, war unmissverständlich gewesen. Kurze Zeit später wurde die ganze Einheit von der russischen Armee zerrieben.
Kapitel 2
Beeil dich, Alexander, ich will nicht zu spät kommen!«
Martina Prandner saß auf dem Rücksitz des schweren Geländewagens und steckte ihr Mobiltelefon ungeduldig zurück in ihre kleine Handtasche. Alexander blickte aus dem Küchenfenster. Der Regen prasselte schwer auf das schwarze Wagendach unten auf der Straße. Er liebte den Berliner Regen. Besonders wenn er von Norden kam. Die Tropfen aus der Ostsee waren kühl und salzig. Alexander bewohnte die Dach-Maisonette-Wohnung im eleganten Mehrfamilienhaus. Er musste sich nun sputen. Das betont lang gezogene »Alexander« verhieß in der Regel wenig Gutes und rief manche Jugenderinnerung in ihm wach.
Er ging zurück ins Badezimmer und machte sich rasch fertig. Beim dritten Versuch stimmte endlich die Länge seiner Krawatte – schön bündig mit der Gürtelschnalle. Er würgte den obersten Knopf seines Hemdes zu und betrachtete sich zufrieden im Spiegel. Gut gelaunt zerzauste er sein volles dunkles Haar und löschte das Licht. Alexander eilte die fünf Stockwerke über die Treppe hinab. Der klassische Fahrstuhl des denkmalgeschützten Gebäudes war eine optische Augenweide, aber definitiv zu langsam für heute. Mit der einen Hand am Geländer nahm er zwei Stufen auf einmal. Seine Lederschuhe hallten laut im Treppenhaus. Aus einer der Wohnungen quittierte ein Hund den ungewohnten Lärm mit tiefem Bellen. Vor dem Haus wartete der Fahrer mit einem Regenschirm in der Hand und geleitete Alexander zum Wagen. Dieser setzte sich rasch auf den geräumigen Platz neben Martina. Im Innern roch es nach frischem Leder und dezentem Parfum – Grapefruit mit einer Prise Puderzucker. Endlich, schienen ihm Martinas Augen zu sagen. Der Fahrer startete den Motor und der Wagen verschwand rasch in die einbrechende Dämmerung.
»Du siehst toll aus.« Alexander wollte seine Begleiterin keineswegs milde stimmen – das Kompliment war ernst gemeint. Martina trug ihre dunkelblonden Haare wie immer bei offiziellen Anlässen streng nach hinten gebunden. Ihre gleichmäßigen Gesichtszüge und die großen blauen Augen wurden dadurch noch deutlicher hervorgehoben. Sie war nur dezent geschminkt. Das kleine Muttermal über ihrem linken Mundwinkel verlieh ihrem Gesicht etwas Besonderes. Martina trug einen schwarzen Hosenanzug, perfekt auf ihren schlanken Körper geschnitten. Alexander hoffte insgeheim, dass sie heute High Heels tragen würde, was ihre Figur jeweils noch mehr betonte.
Martinas Stimmung hatte sich leicht gebessert. Sie quittierte das Kompliment mit einem höflichen »Du auch«. Alexander blickte auf seine Uhr. Sie würden es auf jeden Fall rechtzeitig in die Zentrale der Sozialdemokratischen Partei schaffen. Es herrschte wenig Verkehr und der starke Achtzylindermotor brachte sie zügig voran. Alexander blickte aus dem Fenster auf die vorbeifliegende Gegend. Straßen, Häuser und Passanten waren durch den dichten Regen nur schemenhaft zu erkennen. Die Scheibenwischer schlugen von einer Seite zur anderen wie eine wild gewordene Pendeluhr. Alexander wandte sich an Martina, die gerade ihre Nachrichten auf dem Mobiltelefon durchging.
»Keine Angst, das kommt gut. Die letzten Umfragen waren verheißungsvoll.«
Martina verdrehte die Augen. »Umfragen! Wer verlässt sich denn heute noch auf so was?«
Alexander legte seine Hand auf ihren Arm. »Bist du nervös? Du zitterst ja wie die Symbole auf deinem Smartphone«, neckte er sie.
Mit gespielter Empörung zog Martina den Arm zurück. »Herr Isenschmid, es geht heute um nichts anderes als die Rettung meines geliebten Vaterlandes. Natürlich bin ich nervös.« Sie stieß ihn mit dem Ellbogen in die Seite.
Die Frontseiten aller Tageszeitungen hatten sich in den vergangenen Wochen mit Spekulationen über den Wahlausgang und mögliche Koalitionen zu übertreffen versucht. Die meisten Auguren sahen die Sozialdemokratische Partei leicht vorne. Die Konservativen kamen auf den zweiten Rang. Die restlichen Parteien vom linken und rechten Rand würden einige Prozentpunkte gewinnen oder verlieren. Unter dem Strich herrschte breiter Konsens darüber, dass die Sozialdemokraten aller Wahrscheinlichkeit nach mit der Regierungsbildung betraut würden. Vor einigen Monaten hätte dies noch niemand für möglich gehalten. Der Umschwung war mit der neuen Spitzenkandidatin der Sozialdemokraten gekommen. Geschickt verstand sie es, sowohl die eigenen Wähler als auch die generellen Sorgen breiter Bevölkerungsschichten anzusprechen. Kritische Presseartikel unterstellten ihr bisweilen populistische Tendenzen. Die unverbrauchte Spitzenpolitikerin war nie auf diese Kommentare eingegangen. Sie überzeugte stattdessen mit ihrer ungeheuren Präsenz und charismatischen Persönlichkeit. Ihre Beliebtheit reichte weit über die Parteigrenze hinaus.
Kurz vor halb sechs hielt der Wagen vor dem Willy-Brandt-Haus. Der heftige Platzregen war vorüber. Vor dem Gebäude herrschte ein munteres Treiben. Alle namhaften in- und ausländischen Fernsehstationen waren mit ihren Sendewagen vor Ort. Die Journalisten und Kameraleute versuchten mit Hochdruck, ihre Mikrofone und Stative in Position zu bringen. Die eingeladene Prominenz, Wahlhelfer und Parteimitglieder waren dabei, das Gebäude zu betreten. Alexander Isenschmid und Martina Prandner durften den VIP-Eingang benutzen und konnten so das Gedränge umgehen. Zu ihrer Überraschung gab es auch hier eine kleine Warteschlange, weil man einen Metalldetektor durchschreiten musste.
»Sieht aus wie auf dem Flughafen«, sagte Alexander kopfschüttelnd. Martina ging an der kleinen Kolonne vorbei und steuerte direkt auf den Eingang zu. Die Reklamationen der Wartenden überhörte sie gekonnt. Der Sicherheitsbeamte erkannte Martina sofort und ließ sie passieren. Der Metalldetektor sprach an, das spielte bei ihr aber keine Rolle. Alexander hatte sich hinten angestellt. Martina drehte sich um und winkte ihn heran. Peinlich berührt schlüpfte er durch die Kontrolle.
»Sind alle diese Vorkehrungen nötig?«, fragte er den Beamten. Es war der Sicherheitschef der vielleicht künftigen Kanzlerin.
»Leider ja, Herr Isenschmid. Es hat anonyme Drohungen gegeben. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden vom Generalsekretär persönlich angeordnet.«
»Ich kann mir jedenfalls keine bessere Sicherheitsschleuse vorstellen als Sie, Werner.«
Der Hüne in Uniform schmunzelte und zuckte mit den Schultern. Sein Nacken war so dick wie Alexanders Oberschenkel.
»Komm schon!« Martina drückte weiter aufs Tempo.
Alexander sah nochmals auf seine Uhr. »Es ist halb sechs. Kein Grund zur Eile. Die ersten Hochrechnungen flattern erst in dreißig Minuten über den Bildschirm. Wir hätten hinten anstehen können. Auf die paar Minuten wäre es nicht mehr angekommen.«
»VIP-Eingänge sind nicht dafür gemacht anzustehen. Die Leute dort mögen zwar wichtig sein, aber manche sind halt noch wichtiger.«
Martina war es gewohnt, zu bekommen, was sie wollte.
Kurz darauf betraten sie die große Halle. Die Stimmung im Saal war aufgeräumt. Es herrschte eine spürbare Vorfreude, gepaart mit einer elektrisierenden Ungewissheit. Im Hintergrund lief belanglose Popmusik. Zahlreiche Blicke fielen auf die beiden jungen Leute. Die Mehrheit der Anwesenden war elegant und gepflegt gekleidet. Viele trugen ein rotes Accessoire in Form eines Foulards oder einer Krawatte. Vereinzelt sah man auch rote Haare, was aber eher der statistischen Wahrscheinlichkeit als einem bewusst politischen Statement geschuldet war. Alexander nahm zwei Gläser Weißwein vom Tablett einer vorbeischwebenden Kellnerin und stieß mit Martina an.
»Auf Helena von Eschenbach.«
Martina prostete zurück. »Auf die künftige Kanzlerin!«
Sie trug tatsächlich die eleganten Schuhe. Ihre Absätze brachten sie auf Augenhöhe mit ihrem Begleiter, der immerhin einen Meter fünfundachtzig groß war. Die Beziehung von Alexander und Martina war speziell, wenn man überhaupt von einer Beziehung sprechen konnte. Sie arbeiteten beide für die wahrscheinlich einflussreichste Frau in Deutschland: Helena von Eschenbach, Spitzenkandidatin der Sozialdemokratischen Partei und eine der schillerndsten Persönlichkeiten des Landes.
Alexander Isenschmid, Spross einer wohlhabenden Zürcher Bankiersfamilie, betreute von Eschenbachs Stiftung und agierte zudem als deren persönlicher Finanzberater. Die Kundenbeziehung zwischen von Eschenbach und der Neuen Zürcher Bank war sehr alt und bedeutend. Von Eschenbach konnte auf ein Privatvermögen von mehreren Hundert Millionen Euro zurückgreifen. Die von ihr präsidierte Stiftung war über die Jahre dank Spenden und klugen Anlageentscheidungen noch bedeutender geworden. In der Öffentlichkeit kursierte eine Zahl von annähernd zehn Milliarden Euro. Ein Gerücht, das sogar untertrieben war.
Martina ihrerseits war von Eschenbachs persönliche Assistentin. Es wurde ihr ein ausgesprochen guter Draht zur Chefin nachgesagt. Diese sehe in ihr eine Art Ziehtochter (von Eschenbach war kinderlos geblieben). Man munkelte, dass von Eschenbach schon lange mit der Familie Prandner befreundet und Martina nur deshalb so einflussreich geworden sei. Martina selbst war früher als Investmentbankerin tätig gewesen und hatte auch dort schnell Karriere gemacht. Sie war dann von der Spitzenpolitikerin abgeworben worden. Seither galt sie als deren rechte Hand.
So kam es, dass eine ehemalige Investmentbankerin und ein Schweizer Bankierssohn zu den engsten Vertrauten von Eschenbachs geworden waren. Das erklärte auch die vielen Blicke – neidische und bewundernde zugleich.
Alexander bemerkte seinen besten Freund in der Menge und winkte ihm zu. Fröhlich gestikulierend gesellte sich dieser zu ihnen. Er umarmte Alexander und schüttelte Martina die Hand.
»Na, ihr beiden Hübschen, jetzt kommt gleich die Stunde der Wahrheit!«
Lorenz war wie immer voller Energie. Er trug einen verwaschenen Pullover, Jeans und Turnschuhe. Dank seinen Erfolgen konnte er sich diese Narrenfreiheit erlauben. Lorenz Wenger arbeitete im Büro des Generalsekretärs der Sozialdemokratischen Partei und war dort hoch geschätzt. Als studierter Informatiker koordinierte er den Wahlkampf in den sozialen Medien. Während andere Parteien noch viel Geld in die traditionelle Werbung investiert hatten, bearbeitete die Gruppe um den jungen Wenger systematisch den Markt mittels aller nur erdenklichen Applikationen, Tools und technischen Hilfsmitteln. Dieser Ansatz erwies sich als billiger, effizienter und hoffentlich auch erfolgreicher. Alexander bevorzugte zwar nach wie vor das gute alte Telefongespräch und schätzte die morgendliche Zeitungslektüre – begleitet von einer Tasse Kaffee. Was er aber verstand: Lorenz war ein absolutes Genie auf seinem Gebiet. Auch andere Parteien und sogar namhafte Konzerne hatten sich für ihn interessiert. Am Ende entschied von Eschenbach das Rennen für sich. Ihre Ziele waren ambitioniert und sie hatte sich persönlich um Lorenz bemüht.
Die Hintergrundmusik wurde nun durch die Ankündigung des Fernsehmoderators abgelöst. Unruhig drängte sich die Menge zusammen. Hinter einer kleinen Rednerbühne war eine riesige Leinwand montiert. Es wurde still im Raum. Alle drehten sich in die Richtung der Stimme.
»Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich aus dem Wahlstudio. In fünfzehn Sekunden erscheinen die ersten Hochrechnungen der diesjährigen Bundestagswahl.«
Der Zeiger auf dem Bildschirm beendete seine Runde. Dann war es so weit.
»Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass es sich hier um die erste Hochrechnung handelt und es im Verlaufe des Abends zu Veränderungen kommen kann. Gemäß unseren ersten Hochrechnungen kommt die konservative Regierungspartei auf … 28 Prozent.«
Ein gewaltiger Jubel hallte durch den mittlerweile bis zum Rand gefüllten Saal. Der Sprecher fuhr fort. »Die Sozialdemokratische Partei kommt gemäß unseren ersten Hochrechnungen auf …«, diesmal erschien ein roter Balken, der sich provozierend langsam nach oben bewegte, »32,5 Prozent.«
Nun gab es kein Halten mehr. Die anwesenden Politiker, Funktionäre und Anhänger fielen sich um den Hals. Die weiteren Resultate gingen im Freudentaumel unter. Es wurde gejubelt wie in einer Fußballarena. Mehrere Minuten lang konnte man sein eigenes Wort nicht verstehen. Alexander, Martina und Lorenz ließen sich von der Euphorie mitreisen. Martina wischte sich gar eine Freudenträne ab. Die kräftezehrende Zeit war nicht umsonst gewesen. Im Fernsehstudio wurden die ersten Analysen gemacht, was hier niemanden mehr zu interessieren schien. Die Menge skandierte den Namen der neuen Kanzlerin. Man wollte die Siegerinnenrede hören.
»Helena, Helena, Helena!«
Die Menge begann rhythmisch zu klatschen und zu stampfen. Das Gebäude vibrierte. Die Umfragen hatten sich bestätigt. Es gab eine klare Wahlsiegerin. Es wurde der überstrapazierte Song »We are the Champions« von Queen eingespielt. Die Masse sprang darauf an.
Nachdem einige Minuten vergangen waren (und auch noch »We will rock you« der gleichen Band bemüht wurde), bestieg eine attraktive Frau die Bühne. Der Applaus erreichte seinen Höhepunkt. Lachend und sichtlich erleichtert winkte die designierte Kanzlerin ins Publikum. Sie strömte eine unglaubliche Präsenz aus. Offiziell war sie Anfang sechzig, sah aber wesentlich jünger aus. Das gewellte blondgraue Haar war kurz geschnitten und leicht auf die Seite gescheitelt. Die wachen blaugrauen Augen leuchteten. Ihre Haut war glatt und völlig faltenfrei. An Ohren, Hals und Händen trug sie geschmackvollen – und offensichtlich sehr teuren Schmuck. Er wirkte bei ihr keineswegs protzig oder deplatziert, sondern wie für sie entworfen.
Ruhig stand sie hinter dem Mikrofon und wartete geduldig, bis Ruhe im Saal einkehrte. Sie wusste die Kraft der Stille zu schätzen. Dann begann sie zu sprechen.
»Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freunde. Unser erstes Ziel ist erreicht. Wir sind die wählerstärkste Partei in Deutschland geworden!«
Tosender Applaus brandete auf.
»Mein Dank heute Abend gilt euch allen: Ihr habt mich toll und aufopferungsvoll unterstützt. Unser aller Dank gilt aber vor allem den vielen Millionen Wählerinnen und Wählern, die uns heute ihre Stimme gegeben haben.«
Sie legte eine Pause ein und klatschte wie alle Anwesenden in die Hände. Dabei blickte die Politikerin dankend in die Kameras. Sie sprach mit klarer und fester Stimme.
»Unsere Wählerinnen und Wähler wollten einen Wechsel. Einen Wechsel hin zu Ehrlichkeit, mutigem, starkem Handeln und einer Politik, die sich endlich am Wohl der Menschen orientiert. Große Aufgaben stehen uns bevor. Ich werde nicht von unseren Versprechungen abweichen und keine faulen Kompromisse eingehen. Wir wollen nicht an die Macht um der Macht willen, sondern um diesem Land und seinen Bürgern zu dienen. Es ist an uns allen, das in uns gesetzte Vertrauen mit aller Kraft in die Tat umzusetzen. Morgen früh beginnt die Arbeit. Doch heute Abend, liebe Freunde, genießen wir den Augenblick. Ihr alle habt viel gegeben, lasst uns nun zusammen feiern!«
Mit diesen Worten begab sich Helena von Eschenbach in die Menschenmasse und wurde sofort von ihr aufgesogen. Sie besaß die ausgesprochene Fähigkeit, allen das Gefühl zu geben, wichtig zu sein und ernst genommen zu werden. Ihre unkomplizierte und zugängliche Art kam gut an. In der Sache konnte sie aber hart und unnachgiebig bleiben. Ihre langen Sitzungen waren legendär und die engsten Mitarbeiter fürchteten ihren scharfen Verstand. Niemand wagte es, unvorbereitet bei einer Besprechung zu erscheinen. Versuchte man bei ihr mit leeren Worthülsen durchzukommen, wurde man schnell eines Besseren belehrt. Bei Nachlässigkeit konnte sie harsch und verärgert reagieren.
Von Eschenbach hatte in verschiedenen Diskussionsrunden im Fernsehen ihre Kontrahenten wie biedere Gymnasiasten aussehen lassen. Ihr Stab sprach, natürlich nur hinter vorgehaltener Hand, vom »Doktor-Jekyll-und-Misses-Hyde-Syndrom«. Man wusste am Morgen jeweils nicht, ob man es mit der netten, zuvorkommenden und liebenswürdigen oder mit der aufbrausenden, unnachgiebigen und schroffen Chefin zu tun haben würde. Das hielt die Leute auf Trab. Alexander war sich sicher, dass Frau von Eschenbach genau das erreichen wollte. In der Partei war sie zu einem Star geworden. Man bewunderte ihre Stärke und Entscheidungsfreudigkeit. Dabei war sie alles andere als eine typische Politikerin: Eher zufällig wurde sie zur Spitzenkandidatin gekürt, nachdem ihre größten Konkurrenten wegen Skandalen vom Kandidatenkarussell gefallen waren. Von Eschenbach füllte das entstandene Machtvakuum rasch und kraftvoll aus. Geschickt besetzte sie die relevanten Themen und positionierte sich bis tief in die konservative Wählerschaft als geeignete Kandidatin. Ihr Pragmatismus wurde nicht von allen sozialdemokratischen Parteimitgliedern gleichermaßen geschätzt, aber der Erfolg gab von Eschenbach recht.
Nach einer halben Stunde war die künftige Kanzlerin zu Alexander, Martina und Lorenz durchgedrungen. Sie freute sich sichtlich, die bekannten Gesichter zu sehen.
»Mein Lieblingspaar und der Lorenz, unser Genie. Alexander, ich warte immer noch auf die Einladung zu eurer Hochzeit – warte lieber nicht zu lange. Martina wird in nächster Zeit viel um die Ohren haben!«
Alexander errötete bis über beide Ohren. Lorenz sprang für seinen Freund ein.
»Wir werden Ihnen eine elektronische Einladung zukommen lassen, Frau Kanzlerin.«
Martina ließ sich nichts anmerken. Sie kannte ihre Chefin.
Von Eschenbach lachte herzlich und die weißen Zähne kamen zum Vorschein. Ihre Kleidung war perfekt geschnitten und wie immer figurbetont. Das blaugrüne Deuxpièces war elegant und zeitlos zugleich. Lorenz behauptete mit großer Gewissheit, dass von Eschenbach bei ihrer Oberweite nachgeholfen habe. Alexander bemühte sich, ihr in die Augen zu blicken. Die Siegerin des heutigen Abends hatte nur wenig Zeit für Small Talk.
»Ich muss leider weiter, es gibt noch einige Hände zu schütteln. Martina und Alexander – kommt bitte morgen um acht Uhr zu mir ins Büro. Ich werde in meinem großen Fernsehinterview einige Dinge ankünden, die auch euch betreffen. Das könnt ihr einrichten, oder?«
Auf diese rhetorische Frage gab es nur eine Antwort. Kurz darauf war die glamouröse Frau in der Menschenmenge verschwunden, begleitet von einem Tross Reportern und Funktionären. Eine junge Reporterin wurde dabei von einem Kollegen – oder vielmehr Konkurrenten – dermaßen rüde zur Seite geschubst, dass sie das Gleichgewicht verlor und ihrerseits Alexander anrempelte. Dieser wollte gerade reklamieren, als er in das entschuldigend lächelnde Gesicht der jungen Frau blickte. Die kleine Lücke zwischen ihren Schneidezähnen verlieh ihr einen verschmitzten Ausdruck. Er nickte ihr schmunzelnd zu und schon war sie wieder verschwunden.
»Was für eine tolle Frau!« Martina, der das kleine Renkontre entgangen war, meinte natürlich von Eschenbach.
»Ihr zwei habt einen großen Stein bei ihr im Brett. Banker wussten ja schon immer, wie man sich einschleimt«, warf Lorenz scherzhaft in die Runde.
Alexander tippte seinem Freund mit dem Zeigefinger auf die Brust. »Langsam, langsam. Ich bin schließlich auch ein wichtiger Stiftungsleiter; mit einer zugegebenermaßen familiären Affinität zum Bankengeschäft.«
»Und ich erwarte mehr Respekt von einem zwielichtigen Hacker«, doppelte Martina nach. Lorenz wusste bei ihr nie, ob sie gerade einen Witz machte oder es ernst meinte. Momentan war sie jedoch tatsächlich guter Laune.
»So, Jungs, jetzt wird nicht mehr rumgestanden. Time for Networking!« Sie warf Alexander eine Kusshand zu und setzte ihre Worte in die Tat um.
»Da hast du dir echt eine harte Lady angelacht, Alex. Hoffentlich verspeist sie dich nicht einmal zum Frühstück.«
Alexander überhörte die feine Stichelei mit Nachsicht. Er wusste, dass Martina nicht beliebt war und wenige Freunde hatte – wenn überhaupt. Sie galt als arrogant, berechnend und äußerst ehrgeizig. Alexander fand sie jedenfalls sehr attraktiv. Zudem schätzte er es, wenn jemand seine Meinung geradeaus vertreten konnte. Seine Großmutter hätte er ihr aber nicht anvertraut.
»Keine Angst, Lori, ich habe alles im Griff. Komm, wir nehmen noch ein Glas Wein. Morgen müssen wir wieder ran an die Arbeit.«
Sie stießen beherzt an und tranken einen Schluck.
»Komm doch morgen Abend zum Essen. Wir könnten von Eschenbachs Fernsehinterview zusammen anschauen. Was meinst du?«, fragte Alexander.
»Bin dabei! Dann kannst du mir gleich noch erzählen, was es denn so Dringendes zu besprechen gab.«
Alexander schüttelte geheimnisvoll den Kopf. »Streng geheim. Tut mir echt leid.«
»Wenn man Freunde hat, braucht man ja bekanntlich keine Feinde mehr. Alex, ich mische mich jetzt auch unters gemeine Fußvolk. Vielleicht lerne ich ja noch eine hübsche Praktikantin kennen.«
»Genau. Bring sie morgen Abend mit. Dann kann ich mein Rating abgeben.«
Beim Weggehen drehte sich Lorenz noch einmal kurz um. »Übrigens – nur falls du weißt, wie man das Internet benutzt. Schau doch mal nach, was ›Lori‹ bedeutet, und nenne mich ab dann nur noch Lorenz. Bitte!«
»Geht in Ordnung. Ich frage vor dem Zubettgehen noch die gute SIRI. Die hat mir schon oft aus der Patsche geholfen. Also morgen um neunzehn Uhr. Und bring ausnahmsweise einen trinkbaren Wein mit.«
Lachend gingen sie auseinander. Alexander bewegte sich in der Folge kaum mehr als im Radius eines Bierdeckels. Parteimitglieder und hohe Funktionäre (oder solche, die es noch werden wollten) stießen mit Alexander auf das gute Resultat an und versuchten beiläufig mehr über die künftige Kanzlerin zu erfahren. Auch der Generalsekretär, Dieter Hildebrandt, gesellte sich zu ihm.
»Na, Alexander. Du ziehst ja heute Abend die Leute an wie das Licht die Motten.«
Alexander lachte. Er mochte den alten Brummbär. Hildebrandt war ein Charakterkopf. »Ich stehe nur in der Nähe der Bar, darum kommen alle hier vorbei.«
Der Sekretär sah müde aus. Es war ein langer und harter Wahlkampf gewesen. »Na, na. Nur nicht so bescheiden. Du und Martina, ihr seid über Nacht zu den begehrtesten Junggesellen der Hauptstadt geworden. Nimm dich in Acht vor all den Opportunisten hier. Da ist viel Futterneid mit im Spiel.«
Alexander sah dem gewieften Politiker in die intelligenten Augen. Er hatte anscheinend seit Längerem keine Zeit mehr gehabt, seine buschigen Augenbrauen zu stutzen, und hätte die Rolle des netten Großvaters in jeder Geschichte von Charles Dickens spielen können.
»Danke für den Tipp, Herr Hildebrandt. Ich kenne das noch von meiner Zeit bei der Neuen Zürcher Bank. Als Sohn des Hauses war ich auch ›Everybody’s Darling‹ – zumindest vordergründig. Mein Vorteil ist hier, dass ich keinerlei politische Ambitionen habe – als Ausländer keine haben kann. Das macht mich für alle andern zumindest ungefährlich.«
Der Generalsekretär klopfte ihm väterlich auf die Schultern. »Da hast du einen Punkt. Pass aber trotzdem auf. Das Licht zieht nicht nur Motten und Fliegen, sondern auch größere Raubtiere an.«
Die Resultate veränderten sich im Verlauf des Abends nur noch marginal. Von Eschenbach gab sich beim obligaten Interviewmarathon bescheiden. Professionell beantwortete sie die vielen Fragen, ohne auf die Details ihres Programmes einzugehen. Ab zweiundzwanzig Uhr wurde die Musik in der Parteizentrale aufgedreht und bis spät in die Nacht gefeiert. Vor allem die jungen Leute ließen es richtig krachen. Nicht nur die Lautstärke, sondern auch die Temperatur war merklich gestiegen. Martina hatte sich in der Zwischenzeit wieder zu Alexander gesellt. Sie war sogar etwas angetrunken und redselig geworden. Sie drückte sich beim Tanzen eng an ihn. Er spürte ihren Atem.
»Wer ist eigentlich deine Chefin?« Sie hielt ihren Mund eng an sein Ohr gedrückt. Ihre tiefe und sanfte Stimme verursachte eine kribbelnde Gänsehaut auf Alexanders Haut.
»Na die gleiche wie deine …«, antwortete er, den Kopf eng an den ihren gedrückt. Sie bewegten sich einige Zeit rhythmisch zur Musik.
»Na, dann erfüllen wir ihren Wunsch.« Martina schaute ihm in die Augen.
»Heiraten?« Alexander lachte.
»Nein, nein … fangen wir einen Schritt vorher an.«
Kurze Zeit später verließen sie zusammen die Parteizentrale und stiegen in eines der eierschalenfarbenen Taxis vor dem Eingang.
***
»Stell das iPad ab, Alex«, murrte Martina im Halbschlaf. Es war bereits zwei Uhr morgens. »Wir müssen morgen früh raus.«
Er antwortete nicht. Sie würde in wenigen Sekunden eingeschlafen sein. Alexander hob das Gerät an und senkte seinen Kopf. Er flüsterte ins Mikrofon. »SIRI, was bedeutet – ich buchstabiere – L, O, R, I?«
Kaum war die Frage formuliert, stand die Antwort auf dem Bildschirm: »Afrikanischer Halbaffe«.
Laut lachend schaltete Alexander das Gerät ab. Er legte eine Hand auf Martinas warmen und makellosen Rücken und schloss die Augen. Was für ein Tag … so durfte es weitergehen.
Kapitel 3
Helena von Eschenbach war am Tag nach ihrem großen Triumph wie üblich früh aufgestanden. Der Schlaf war kurz, aber erfrischend gewesen. Sie bewohnte ein größeres Zimmer im Berliner Ritz-Carlton-Hotel. »Größeres Zimmer« war die offizielle Beschreibung und eine krasse Untertreibung. In Wirklichkeit handelte es sich um eine extravagante Suite. Die Jahresmiete lag im siebenstelligen Bereich. Das Appartement im zwölften Stock überragte den Potsdamer Platz und den nahe gelegenen Tiergarten. Es erfüllte alle Wünsche und Anforderungen einer exponierten Persönlichkeit: schusssichere Scheiben, einen privaten Fahrstuhl, ein eigenes Telefonsystem, zeitgenössische Gemälde und Kunst, viel Marmor und edelste Materialen. Auf weitere vom Hotel angebotene Annehmlichkeiten wie den Zimmerbutler, eine persönliche Assistentin oder die Benutzung des hoteleigenen Bentleys verzichtete von Eschenbach – sie hatte eigenes Personal und bevorzugte eine andere Automarke.
Die Lage des Hotels war ideal. Es befand sich in Gehdistanz zum Reichstag, dem Bundeskanzleramt, dem Potsdamer Platz und dem Tiergartenpark. Hier pflegte von Eschenbach ausgiebige Spaziergänge zu machen. Meistens wurde sie von ihrem Sicherheitschef begleitet. Er war nur unwesentlich älter als sie und diente ihrer Familie schon, seit sie sich erinnern konnte. Seine Loyalität und Professionalität waren vorbildlich.
Nach einem kurzen Frühstück und der obligaten Morgenzigarette (dabei blieb es in der Regel auch) ließ sie sich von Werner in die nur wenige Minuten vom Hotel entfernte Parteizentrale an der Wilhelmstraße chauffieren. Etwas gelangweilt sah von Eschenbach aus dem Fenster ihres schwarzen Wagens mit dem Stern auf der Haube. Sie trug heute einen dunkelgrauen Hosenanzug und eine weiße Bluse. Es standen mühsame Tage vor ihr: Koalitionsverhandlungen mit selbstverliebten Politikern und endloses Debattieren. Was für eine Zeitverschwendung, dachte sie sich. Der Wert politischer Kompromisse wurde ihrer Meinung nach stark überschätzt. Es führte zum jetzigen Zeitpunkt leider kein Weg daran vorbei.
»Werner, fahr mich bitte rasch zum Checkpoint Charlie, bevor ich ins Büro muss.«
Der Checkpoint Charlie war einer der bekanntesten Grenzübergänge durch die ehemalige Berliner Mauer gewesen. Heute war nur noch eine unansehnliche Touristenattraktion übrig geblieben. Werner parkte den Wagen in einer Halteverbotszone und stellte die Warnlichter an.
Helena von Eschenbach stieg aus und atmete tief ein. Die Straßen waren zu früher Stunde fast menschenleer. Nur ein junges asiatisches Paar war bereits auf den Beinen und knipste eifrig ein Bild nach dem anderen. Von Eschenbach erinnerte sich, wie sie 1982 als Achtzehnjährige zusammen mit ihrer Mutter zum ersten Mal Berlin und diesen Ort besucht hatte. Seither waren fast vierzig Jahre vergangen. Von Eschenbach konnte es kaum glauben. Die Zeit war geflogen. Sie schüttelte die trüben Gedanken ab. Spontan bot sie dem asiatischen Pärchen an, ein Foto von ihnen zu machen. Lachend posierten sie Arm in Arm, unwissend, wer diese zuvorkommende Dame in Wirklichkeit war. Dann stieg von Eschenbach wieder in den Wagen und gab das Zeichen zur Weiterfahrt. Kurz darauf erreichten sie die Parteizentrale. Von Eschenbach betrat zügig das Gebäude. Es gab noch viel zu tun.
Alexander und Martina erschienen pünktlich um acht Uhr bei von Eschenbach. Diese empfing sie freundlich.