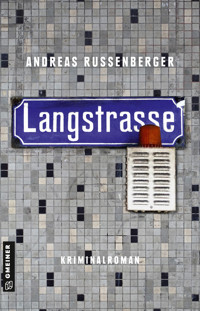Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Philipp Humboldt
- Sprache: Deutsch
Ein Fernsehkrimi wird in Zürich gedreht, unter anderem im Umfeld der Universität. Das Drehbuch basiert auf dem Bestseller von Literaturprofessor Martin Hegel. Nach Beendigung der Dreharbeiten verschwindet dessen Assistentin, und Hegel wird erpresst. Er soll Lösegeld bezahlen. Armand Muzaton, Leiter der Zürcher Kriminalpolizei, stößt auf ein undurchsichtiges Geflecht aus Abhängigkeiten und Lügen. Armand kann bei seinen Ermittlungen wieder auf die Hilfe seines Freundes Philipp Humboldt zählen, doch auch sie können die sich anbahnende Katastrophe nicht verhindern …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 246
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andreas Russenberger
Bellevue
Kriminalroman
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2024 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Satz: Julia Franze
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Andreas Russenberger
ISBN 978-3-7349-3082-9
Zitat
Seien Sie auf der Hut –
das Hirn ist eine Fälscherwerkstatt!
Erster Akt
Die tote Attrappe
Zürich, 4. August
Die Sonne brannte auf die hohe Glaskuppel über dem imposanten Lichthof der Universität Zürich. Die Luft war drückend wie in einem Gewächshaus. Zwei Tauben, die sich durch eine offene Luke ins Gebäude verirrt hatten, flatterten auf. Während des regulären Universitätsbetriebs herrschte unter dem opulenten Gewölbe ein konstantes Rauschen: Studierende trafen sich zum Lernen, zum Diskutieren oder auf eine Tasse Kaffee. Zahlreiche Freundschaften und Liebesbeziehungen fanden hier ihren Anfang – manche ihr Ende. Da die Semesterferien bereits begonnen hatten, war es heute ruhiger als üblich.
Vermeintlich.
In einem abgegrenzten Bereich stand eine Menschentraube. Zwei Frauen beugten sich diskutierend über ein Dokument, und Techniker hantierten mit Kameras. Es überraschte kaum, dass an einem der runden Tische vier junge Männer in eine Partie »Schieber« vertieft waren, denn das traditionelle Schweizer Kartenspiel erfreute sich im Lichthof großer Beliebtheit. Vermutlich handelte es sich um Studenten der Wirtschafts- oder Rechtswissenschaften. Trotz der Schwüle trugen sie akkurat gebügelte Hemden und lange Stoffhosen, während ihre Füße in weißen Sneakers steckten. Zweifellos waren sie dafür bestimmt, früher oder später in einer der in Zürich ansässigen Banken oder Anwaltskanzleien ihr Geld zu verdienen. Die vier beendeten ihre Runde, zählten die Punkte zusammen und vermerkten sie mit einem Kreidestift auf einer Schiefertafel. Dann mischte einer der Mitspieler sorgfältig die Karten und teilte erneut aus.
»Obenabe isch Trumpf«, verkündete der junge Mann rechts vom Kartengeber feierlich und legte ein Ass auf den Tisch. Seine Mitspieler kamen nicht mehr dazu, darauf zu reagieren. Plötzlich und ohne Vorwarnung fiel ein Körper wie aus dem Nichts krachend auf die Tischplatte. Kaffeetassen wurden zu Boden geschleudert und zerbrachen klirrend in ihre Einzelteile. Im Hintergrund ertönte ein lauter Schrei, der durch die weite Kuppel hallte. Einer der Studenten rannte in Panik einige Schritte davon, bevor er ungläubig die roten Spritzer auf seiner Kleidung betrachtete. Auch seine Kollegen waren aufgesprungen, einer presste sich die Hand vor den Mund, ein anderer griff sich an den Kopf und fand als Erster seine Sprache wieder.
»Das ist Professor Mummenthaler. Wir haben bei ihm die Ethikvorlesungen besucht. Mein Gott, er ist tot!«
Der vierte Student hielt nach wie vor seine Karten in der Hand und hob sie wie beim historischen Rütlischwur in die Höhe. »Das kann doch nicht wahr sein, ich hatte ein Traumblatt. Wir hätten gewonnen …« Offensichtlich stand er unter Schock.
Nun trat eine der beiden Frauen, die das Geschehen aufmerksam beobachtet hatten, an den Tisch. »Cut!«, rief sie laut und klatschte in die Hände. »Gut gemacht, Jungs. Noch eine kleine Szene zum Nachbessern und wir haben alles im Kasten.«
Die vier Laiendarsteller gingen zu einem anderen Tisch und die Kameras schwenkten in ihre Richtung.
Regina Meister, die Regisseurin und Chefin am Set, gab letzte Anweisungen und blickte dann verärgert auf ihre Armbanduhr. »Wo zum Teufel steckt Wellnitz denn wieder?«
In diesem Moment betrat ein gut aussehender Mittfünfziger den Lichthof und breitete jovial die Arme aus. »Habt ihr etwa ohne mich angefangen?«, rief er mit einem vorwurfsvollen Unterton der Crew zu.
Meister verdrehte die Augen. »Du bist zu spät, wieder einmal.« Ihre Stimme war kühl wie der Zürichsee im Winter.
»Der Hauptdarsteller ist nie zu spät. Er kommt, wann er kommt, und ist daher immer pünktlich«, entgegnete Hermann Wellnitz, der mit bürgerlichem Namen Anton Müller hieß. Aber für alle am Set, inklusive ihm selbst, war er nun mal Hauptkommissar Hermann Wellnitz. Sogar Restaurant- oder Theaterreservationen tätigte er ausschließlich unter dem Namen Wellnitz.
Meister strich sich eine Haarsträhne aus der Stirn und beließ es dabei. Bald wäre der Dreh beendet und sie Wellnitz los. »Also, es geht gleich los mit der letzten Aufnahme!«
Die vier Studenten hatten sich schon an einen Tisch gesetzt, der für die zu drehende Szene bereitstand, und die Kameralichter wechselten auf Rot. Wellnitz richtete seine Lederjacke und trat breitbeinig ins Bild. Er wirkte wie eine moderne Version von Schimanski, mit gegelten Haaren und solariumgebräuntem Teint.
»Was könnt ihr mir über diesen Mummenthaler erzählen?«, fragte Hermann Wellnitz in seiner Rolle als Hauptkommissar der Kriminalpolizei und setzte sich ebenfalls an den Tisch. Dann zog er eine Packung Marlboro Gold aus der Jackentasche und zündete sich eine Zigarette an.
»Hier darf man nicht rauchen«, belehrte ihn einer der Studenten.
Wellnitz lächelte schief und blies ihm den Rauch entgegen. »Werd mal nicht frech, Bürschchen. Oder willst du etwa behaupten, dass der Professor an einer Rauchvergiftung gestorben ist?«
»Cut!«, rief Regina Meister zum letzten Mal bei diesem Dreh. »Das war’s, Leute.«
Sofort entspannten sich die vier Laiendarsteller, und sie gaben sich die Ghettofaust. Ihr kurzer Auftritt in der nächsten Ausgabe des Schweizer »Sonntagskrimis« hatte ihnen sichtlich Spaß gemacht, ganz zu schweigen vom kleinen Nebenverdienst. Die Regisseurin bedankte sich persönlich bei ihnen und entließ sie in das wohlverdiente Wochenende.
Für die Filmcrew war die Arbeit indes noch nicht beendet. Das Team begann ohne Umschweife, den Tatort zu säubern. Die Körperattrappe wurde sorgsam in einer Kiste verstaut, die überall verteilte rote Farbe mit einem feuchten Lappen entfernt und die Scherben der zersprungenen Tassen akribisch aufgesammelt. Die Techniker bauten die Kameras und Mikrofone wortlos ab. Das koordinierte Vorgehen zeugte von Routine, jeder Handgriff dutzendfach durchgeführt. Der Film konnte nun geschnitten und die Szenen in die korrekte Abfolge gebracht werden. Die Zeit bis zur Ausstrahlung im Dezember würde ohne Schwierigkeiten für den letzten Feinschliff ausreichen.
Die Schweizer Produktionen des renommierten Sonntagskrimis, der auch in Deutschland und Österreich gedreht und ausgestrahlt wurde, hatten in der Vergangenheit nicht zu den Glanzlichtern der Reihe gehört. Daher lastete beträchtlicher Druck auf dem Produktionsteam und insbesondere auf der Regisseurin. Jetzt, nach Abschluss der Dreharbeiten, war sie sichtlich erleichtert. Regina Meister strahlte über das ganze Gesicht und atmete tief durch.
»Alle mal herhören! Wir räumen hier auf und fahren anschließend zurück ins Hotel. Um 19 Uhr treffen wir uns zum Abschlussessen im Restaurant Weisser Wind. Wenn ihr vorher noch Zeit habt, lade ich euch zu einem Drink an der Hotelbar ein!«
Die Mitteilung der Regisseurin kam an, und das Team legte einen Gang zu. Wellnitz schlenderte selbstsicher zu Meister hinüber, wahrscheinlich um sich das aus seiner Sicht wohlverdiente Lob abzuholen. Doch stattdessen gab es eine Standpauke.
»Du bist unmöglich, so macht das Arbeiten wirklich keinen Spaß«, sagte die Chefin. »Wann kapierst du endlich, dass ein Dreh Teamwork und kein Egotrip ist?«
Wellnitz setzte sein Filmlächeln auf und zündete sich eine weitere Zigarette an.
»Hier darf man nicht rauchen!«, bellte ihn Meister an.
»Du bist echt eine Spaßbremse«, entgegnete Wellnitz und verließ beleidigt das Universitätsgebäude.
Vom zweiten Stock aus betrachtete Rektorin Fries das Geschehen. Sie hatte sich im Wandelgang in den Schatten eines Rundbogens zurückgezogen und stützte sich mit einer Hand an der kühlen Sandsteinwand ab. Seichte Unterhaltung war nicht ihr Ding, aber die Aufmerksamkeit, die der Sonntagskrimi der Universität bringen würde, konnte sie gut gebrauchen – und die würde sie auch bekommen.
Das digitalisierte Hirn
Zürich, 4. August
»Das Drehbuch ist totaler Schwachsinn«, sagte Armand Muzaton, Leiter der Zürcher Kriminalpolizei, und nippte an seinem Negroni. Er saß gemeinsam mit Philipp Humboldt, seines Zeichens Bankprofessor an der Universität Zürich, vor der Odeon-Bar. Aufgrund seiner Nähe zum See war dieser Teil Zürichs an warmen Sommerabenden rappelvoll.
Die beiden Freunde waren zur Abschlussfeier der Filmcrew eingeladen worden. Regina Meister hatte sie um Hilfe bei dem Filmprojekt gebeten. Denn für die Aufnahmen in Zürich waren nicht nur Nervenstärke, sondern auch die richtigen Ansprechpartner gefragt. Und wer konnte da nützlicher sein als zwei bekannte Persönlichkeiten, die in der Vergangenheit bereits mehrere spektakuläre Fälle gelöst hatten? Armand hatte die Regisseurin bei einigen Szenen beraten, welche die Arbeit der hiesigen Polizei betrafen, während Philipp dafür gesorgt hatte, dass an der Universität gedreht werden durfte. Die Rektorin war von der Idee zunächst gar nicht begeistert gewesen, doch sie schuldete Philipp einen Gefallen als Gegenleistung für einige bedeutende Legate, die der Universität in der Vergangenheit dank ihres unkonventionellen Lieblingsprofessors zugeflossen waren.
»Ich finde die Handlung witzig«, widersprach Philipp und stellte das Bierglas auf den kleinen Tisch vor ihnen.
»Das kann nicht dein Ernst sein«, echauffierte sich Armand. »Ein amerikanischer Tech-Milliardär baut in Zürich einen gigantischen Quantencomputer, lässt sein Gehirn digitalisieren und treibt als elektronischer Verbrecher sein Unwesen im weltweiten Netz. Und nur durch das beherzte Eingreifen eines verwegenen Schönlings kann die Welt gerettet werden. Komm schon, das ist doch völliger Humbug! Ich bin überzeugt, dass der Film ein totaler Flop wird.«
Philipp grinste. »Ist da jemand eifersüchtig, weil der Hauptdarsteller besser aussieht als das Original?«
Armand versuchte vergeblich, eine ernste Miene aufzusetzen, und brach in lautes Gelächter aus. Die Leute an den angrenzenden Tischen drehten sich zu ihm um. Der Polizeihauptmann hob entschuldigend die Hände und sammelte sich wieder.
»Was die Frisur betrifft, könntest du tatsächlich recht haben«, erwiderte er und strich sich über den glatt rasierten Schädel.
Armand und Philipp verband eine lange Freundschaft. Sie hatten sich in einer für beide schwierigen Lebensphase kennengelernt. Armand war damals noch Priester gewesen und hatte Philipp zurück auf den richtigen Weg gebracht – nicht mit Gebeten, sondern dank seiner guten Menschenkenntnis. Philipp hatte im Gegenzug Armand aus den Händen der Engel und den Klauen der Teufel gerettet. Sie hatten daraufhin neue Wege eingeschlagen: Armand war zurück zur Polizei gegangen, und Philipp hatte von seinem CEO-Posten bei der Zürcher Investment Bank an die Universität gewechselt. Sie kannten die dunkle Seite des Lebens und hatten keine Geheimnisse voreinander.
»Nein, im Ernst. Ich finde die Grundidee des Filmes gar nicht so abwegig«, fuhr Philipp fort. »Der Mensch ist ständig auf der Suche nach etwas Höherem und Besserem. Was könnte also das nächste Ziel für jemanden sein, der schon alles hat? Vermutlich Unsterblichkeit und ewige Jugend. Der Bösewicht des Films ist ein narzisstischer Milliardär aus dem Silicon Valley, für ihn ist der Tod ein technisch lösbares Problem. Er betrachtet menschliches Handeln als mathematischen Algorithmus, nicht als Folge wertbasierter, bewusster Entscheidungen. Kannst du dir vorstellen, was ein solcher Mensch dafür tun würde, sein Bewusstsein in einen Computer zu übertragen und es so auf ewig zu bewahren? Alles!«
»Das mag sein, aber Fernsehkommissar Wellnitz geht mir so richtig auf den Senkel«, sagte Armand unmissverständlich.
»Denk dran, Toleranz ist gefragt, wenn es schmerzt«, erwiderte Philipp. Er spürte instinktiv, dass Armand etwas bewegte, das über den Schauspieler hinausging. Er ließ ihm Zeit, von sich aus darauf zu sprechen zu kommen. Eine Tram der Linie 4 knatterte in Richtung Bellevue, und ein junger Mann wippte mit einem aus der Zeit gefallenen Ghettoblaster auf der Schulter an ihnen vorbei. Eminem machte für einen Moment jegliche Konversation unmöglich. Philipp sprach die eingehenden Zeilen, die er aus seiner Jugend kannte, so gut wie möglich aus seinem Gedächtnis nach: »Look, if you had one shot … to seize everything you ever wanted … Would you capture it or just let it slip?«
Ein Malteser unter dem Nachbartisch quittierte den Lärm mit lautem Bellen. Als die Beats verebbt waren und sich der Hund beruhigt hatte, räusperte sich Armand.
»Mich ärgern vor allem die kitschigen Happy Ends in diesen Krimis. Hier die Guten, dort die Bösen, und am Ende siegt die Gerechtigkeit. Wir wissen beide, dass die Realität komplexer ist. Recht und Gerechtigkeit sind nicht immer dasselbe, die Guten können auch böse sein und die Bösen handeln manchmal aus guten Motiven. Ich frage mich sowieso, ob wir in der Vergangenheit immer die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Schlussendlich ändern wir eh nichts. Kaum haben wir einen Verbrecher erwischt, kriecht schon der nächste aus einem Loch.«
Philipp wusste genau, wovon sein Freund sprach. Durch ihr Leben führte ein dunkler Riss, den sie so gut wie möglich gekittet hatten, um nicht wieder in die Dunkelheit zu fallen.
»Wir haben getan, was wir tun mussten. Das wenige, was du ändern kannst, Armand, ist viel!«
»Vielleicht hast du recht«, erwiderte Armand und seine Miene entspannte sich etwas. »Aber in Zukunft gibt es nur noch Polizeiarbeit nach Dienst- und Gesetzbuch. Verbrecher sind Verbrecher – kein Raum mehr für eigene Interpretationen, auch wenn die Motive verständlich erscheinen. Sie werden eingebuchtet und der Justiz übergeben, Punkt! Verstehst du, was ich meine?«
»Das brauchst du mir nicht zu erklären. Bei der Aufklärung einiger deiner Fälle habe ich schließlich tatkräftig mitgewirkt«, sagte Philipp schmunzelnd.
»Na, da würde ich nicht übertreiben«, scherzte Armand. »Du bist allenfalls ein guter Dr. Watson. Die Rolle von Sherlock Holmes überlasse bitte mir.« Er fläzte sich behaglich in den Stuhl zurück und schlug seine langen Beine übereinander.
»Da habe ich die Angelegenheit mit der Bank von Werdenberg und die Ermordung der Generaldirektoren der Zürcher Investment Bank anders in Erinnerung«, entgegnete Philipp. Er spürte, wie ihm eine Schweißperle den Rücken hinunterlief, als würde ein kalter Finger über seine Haut streichen.
»Das Gedächtnis spielt einem manchmal die wildesten Streiche, mein Freund. Man sollte nicht immer glauben, was man denkt«, konterte Armand.
Philipp warf einen Blick auf seine Armbanduhr. »Lass uns ins Restaurant gehen. Es ist schon fünf nach sieben. Die Filmcrew wird sicher bereits am Tisch sitzen.«
»Dann auf ins Gefecht, ich bin am Verhungern«, sagte Armand.
Philipp sah ihn überrascht an. »Hast du nichts zu Mittag gegessen?«
»Natürlich«, erwiderte Armand. »Aber das ist schon eine Weile her.« Der Hauptmann stand auf und leerte gleichzeitig seinen Negroni in einem Zug.
Multitasking.
Der Kommissar
Zürich, 4. August
Als die beiden Freunde den kleinen Saal im ersten Stock des Restaurants Weisser Wind betraten, wurden sie von den Anwesenden mit einem großen Hallo begrüßt. Das Gebäude war im 15. Jahrhundert erbaut worden und hatte 300 Jahre später seinen Namen erhalten, in Anlehnung an den weißen Windhund des damals hier ansässigen Jägers. Das Restaurant war längst zu einer Institution in Zürich geworden. Neben seinen regulären Gästen beherbergte es eine Zunft sowie eine Studentenverbindung und hatte einen eigenen Theatersaal.
Es herrschte eine aufgeräumte Stimmung unter den Anwesenden. Auf einem langen Esstisch standen mehrere Flaschen Weißwein und Häppchen – oder das, was davon übrig geblieben war. Neben der Filmcrew waren auch Universitätsrektorin Fries, Martin Hegel und dessen Assistentin anwesend. Hegel war Germanistikprofessor an der Universität und der Autor des Bestsellers, der als Grundlage für die Verfilmung des neuesten Schweizer Sonntagskrimis gedient hatte.
Am Tisch waren noch zwei Plätze frei. Philipp schlängelte sich grinsend an Armand vorbei und setzte sich zwischen Fries und Hegel, sodass für den Polizeihauptmann nur der andere Stuhl blieb. Der dortige Tischnachbar, ein gebräunter Mann, winkte ihm enthusiastisch zu.
»Setzen Sie sich zu mir! Dann können wir fachsimpeln, von Kommissar zu Kommissar«, rief Wellnitz.
Armand stieß Philipp im Vorbeigehen den Ellbogen in die Seite und ergab sich seinem Schicksal.
Das konnte ja ein langer Abend werden.
Der Abend wurde tatsächlich lang – und vergnüglich. Selbst Rektorin Fries schien sich gut zu unterhalten. Sie diskutierte intensiv mit der Regisseurin über den Sinn und Unsinn von Kriminalromanen und -filmen, wobei Meister der Kritik der Rektorin geschickt auswich und ihr schmeichelte.
»Sie können sich gar nicht vorstellen, wie angenehm es war, an Ihrer Universität zu drehen. Ein wunderschöner Ort! Und die Gratisparkplätze für unsere Logistik, die großzügigen Maskenräume und erst das Essen, das Sie für uns bereitgestellt haben, ein Traum …«, schwärmte Regina Meister.
Die Rektorin lächelte geschmeichelt und wandte sich an Philipp. »Im Nachhinein bin ich froh, dass ich die Dreharbeiten an der Universität erlaubt habe. Das ist kostenlose Werbung für uns im gesamten deutschsprachigen Raum. Sonst hört man ja überall nur von der ETH.« Fries war es ein Dorn im Auge, dass von ihrer Warte aus die Eidgenössische Technische Hochschule der Universität in Bezug auf Renommee und Nobelpreise den Rang abgelaufen hatte.
»Ich habe ziemlich hartnäckig mit Ihnen verhandeln müssen und dabei alle meine Bonuspunkte für meine Verdienste um die Universität aufgebraucht«, entgegnete Philipp. Dass Fries sich außerdem eine namentliche Erwähnung im Abspann des Filmes gesichert hatte, erwähnte er höflicherweise nicht.
»Unsere Studierenden haben schon genug Flausen im Kopf, da wollte ich nicht zusätzlich durch die Dreharbeiten für Ablenkung sorgen. Ich konnte mit dem Kompromiss leben, die Szene mit dem Mord an diesem fiktiven Ethikprofessor in den Ferien zu drehen, praktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und Ihre Bonuspunkte, mein lieber Humboldt, sind nicht nur aufgebraucht, sondern tief ins Minus gerutscht. Ich werde sicher eine Gelegenheit finden, dies wieder auszugleichen.«
Fries mochte die feingliedrige Erscheinung eines Rehs haben, aber ihr Gedächtnis war das eines Elefanten. Philipp war sich sicher, dass sie diese Androhung früher oder später wahr machen würde. Zu diesem Zeitpunkt ahnte er jedoch nicht, wie bald und unter welchen tragischen Umständen dies geschehen würde.
Fries beließ es für den Moment dabei und widmete sich Regina Meister, um gemeinsam mit der Regisseurin in das Smartphone eines Kellners zu lächeln, der sich als Fan des Sonntagskrimis geoutet und um ein Foto gebeten hatte.
Philipp rückte seinen Stuhl leicht zu Martin Hegel, damit die beiden Damen exklusiv auf dem Schnappschuss verewigt werden konnten. Der angesehene Germanistikprofessor wirkte ein wenig deplatziert in der geselligen Runde. Als Einziger trug er Anzug und Krawatte – sein Markenzeichen. Auch das weiße Einstecktuch durfte nicht fehlen. Hegel war über 60 Jahre alt, doch er wirkte bedeutend jünger und sah blendend aus. Philipp hatte gehört, dass Hegel von seinen Studentinnen unter der Hand als »George Clooney der Literatur« bezeichnet wurde. Sein krauses Haar war immer noch dicht und dunkel. Philipp hatte den Verdacht, dass Hegel dabei etwas nachhalf.
»Wie bist du eigentlich dazu gekommen, einen Kriminalroman zu schreiben?«, fragte Philipp seinen Tischnachbarn.
Hegel zuckte leicht zusammen. »Entschuldigung, ich war mit den Gedanken gerade woanders. Wahrscheinlich wollte ich einfach meine angeheiratete Verwandtschaft ärgern. Ein Verbrechen hat mich dann endgültig inspiriert, eine solche Geschichte zu schreiben. Wie du vielleicht weißt, haben meine Schwiegereltern adlige Wurzeln und residieren in einer schlossähnlichen Villa in Mecklenburg: altes Geld, ein Stammbaum länger als der Ferienstau vor dem Gotthard, das volle Programm. Die Verwandtschaft meiner Frau deckt alle Präpositionen ab: von, mit, zu. Man darf sich davon nicht beeindrucken lassen, sonst wird man bei lebendigem Leib aufgefressen! Nun gut. Vor einer Weile gab es dort einen Einbruch. Es wurden nicht nur zahlreiche Wertgegenstände gestohlen, sondern meine Schwiegereltern wurden dabei auch verletzt. Ein Riesendrama für meine Frau Agathe. Ich habe alles stehen und liegen gelassen, um mit ihr in den Osten Deutschlands zu reisen. Wir sind durchgerast und haben nur einmal haltgemacht. Ihre Eltern mussten eine ganze Woche im Krankenhaus verbringen.«
»Von alldem wusste ich nichts. Das war sicher ein Schock für alle«, antwortete Philipp mitfühlend.
»Für meine Frau und ihre Eltern war es das bestimmt. Für mich war es eine Erleichterung«, entgegnete Hegel kühl und zupfte an seinem Einstecktuch.
»Erleichterung?«, fragte Philipp erstaunt.
»Meine Schwiegereltern haben Agathe immer übel genommen, dass sie einen aus ihrer Sicht mittellosen Universitätsprofessor geheiratet hat. Sie können mich nicht ausstehen. Literatur, so sind sie felsenfest überzeugt, ist eine brotlose Kunst und alle, die sich damit beschäftigen, sind Taugenichtse. Ich lasse sie in ihrem Glauben, denn ich ärgere mich prinzipiell nur über Dinge, die es wert sind. Ich habe schließlich Agathe geheiratet, nicht ihre Verwandtschaft«, sagte Hegel lächelnd. Trotz seiner distinguierten Art versprühte er einen gewissen Charme, dem man sich nur schwer entziehen konnte.
Der Literaturprofessor beendete seine Kunstpause und fuhr fort: »Wo war ich stehen geblieben? Ja genau, Agathe und ich haben uns in Berlin bei der Premierenlesung eines meiner Bücher kennengelernt, wir blieben in Kontakt und so hat das eine das andere ergeben. Aber ich bin in ihrer Familie weiterhin ein Fremdkörper. Zu wenig vermögend, nicht adelig. Daher empfand ich eine gewisse Genugtuung, als ich damals im Spital mitbekam, dass auch blaues Blut rot ist.«
Philipp wartete auf ein Lächeln von Hegel. Vergebens. Er meinte es ernst, todernst. Oder er kokettierte damit. Der Professor tunkte eine Ecke seiner Serviette ins Wasserglas und wischte sich damit über die Augen. Dann lehnte er sich leicht zu Philipp hinüber und senkte seine Stimme. »Jemand um uns herum benutzt wohl ein lächerlich billiges Rasierwasser. Meine Augen tränen schon den ganzen Abend.«
Philipp überlegte kurz, ob er darauf hinweisen sollte, dass dies nicht auf ihn zutraf. Doch glücklicherweise wurde das Gespräch von Fernsehkommissar Hermann Wellnitz unterbrochen, der begeistert von einer spektakulären Filmszene erzählte.
»Der Höhepunkt des Filmes ist zweifellos die Szene, in der ich mit einer Handgranate den verdammten Quantencomputer in die Luft sprenge. Bum und weg! Eine gewaltige Explosion – hollywoodreif!« Wellnitz geriet ins Schwärmen. »Die örtliche Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort, ebenso der Rettungsdienst. Ich habe mich selbstverständlich nicht durch einen Stuntman ersetzen lassen. Ehrensache! Du hättest dabei sein sollen, Armand. Das war Action pur!«
Wellnitz schenkte sich großzügig Rotwein nach.
Nur sich.
»Hast du nicht bereits genug getrunken, Hermann?«, erkundigte sich Rahel Studer, Hegels Assistentin, besorgt.
Der Schauspieler war anderer Meinung. »Mach dir keine Sorgen, Schätzchen. Wir Polizeibeamte sind harte Kerle«, erwiderte er grölend und klopfte Armand kumpelhaft auf die Schulter.
Philipp machte sich Sorgen – um Armand. Es brauchte einiges, um seinen Freund aus der Ruhe zu bringen, doch wehe dem, dem dies gelang. Der Hauptmann bewahrte jedoch seine Fassung, und seine Pranken blieben ruhig auf dem Tisch liegen. Armand war glücklicherweise weder schlecht gelaunt noch hungrig. Dafür schlagfertig. »Wenn wir Polizeibeamte wie Sie hätten, würden die Verbrecher ohne Zweifel freiwillig das Weite suchen«, brummte er.
Wellnitz entging die feine Ironie. Er nickte zufrieden und lehnte sich mit einem tiefen Seufzer im Stuhl zurück. Die langen Drehtage und der schwere Rotwein forderten ihren Tribut.
Regina Meister beendete den Abend, indem sie die Rechnung bestellte. Stühle wurden gerückt und Gläser geleert. Einige Crewmitglieder verließen schnell den Raum, um vor dem Restaurant eine Zigarette zu rauchen. Wellnitz bildete die Spitze. Nachdem der Kellner die Rechnung gebracht hatte, wandte sich die Regisseurin an ihre Tischnachbarn.
»Die Gesamtsumme beträgt 1.781 Franken. Wie viel Trinkgeld ist in Zürich üblich?«
Hegel meldete sich zu Wort. »Runden Sie auf den nächsten Hunderter auf. Das Gehalt ist ohnehin in der Rechnung enthalten. Die Gastwirte greifen den Gästen schon tief genug in die Tasche.«
Meister befolgte den Rat, und der Kellner bedankte sich höflich. Philipp ärgerte sich über Hegels Geiz, da der Service einwandfrei gewesen war und alle Extrawünsche professionell erfüllt worden waren. Als die letzte Gruppe das Restaurant verließ, drückte er dem Kellner unauffällig eine Hunderternote in die Hand und sagte: »Für Sie und das Personal, das uns heute Abend so exzellent bedient hat.«
Der Mann nahm den Schein diskret entgegen. »Vielen Dank, das ist sehr aufmerksam von Ihnen.«
»Wir haben zu danken«, erwiderte Philipp und folgte den anderen nach draußen.
Die Straßenbeleuchtung warf dunkle Schatten an die Wände, und für einen Moment wurden die Crewmitglieder zu Pantomimen. Wellnitz lehnte sich schwankend gegen seinen Schatten an der Hauswand und zündete sich eine Zigarette an. Nach einem tiefen Zug kramte er in seiner Jackentasche und holte den Autoschlüssel heraus, den ihm Hegels Assistentin sofort abnahm.
»Du wirst definitiv nicht mehr fahren. Du hast genug getrunken, Hermann«, sagte sie bestimmt.
Regina Meister, die gerade von Philipp Abschied nahm, hatte die Situation mitbekommen und reagierte prompt. »Wenn du betrunken ins Auto steigst, war das deine letzte Rolle. Ist das klar?«
»Und wie komme ich nach Hause?«, lallte Wellnitz. Er logierte nicht im Hotel wie der Rest des Teams, sondern hatte seit Jahren eine Wohnung im Zürcher Kreis 3. Dies war einer der Gründe, weshalb er sich in der Rolle so wohlfühlte. Der Leiter der hiesigen Kriminalpolizei, wenn er auch nur fiktiv war, würde ja wohl kaum in Hamburg oder Wien wohnen wie andere Schauspielkollegen. Wellnitz stemmte sich sowohl gegen die Wand als auch gegen die Ansage seiner Regisseurin. »Kannst du nicht ein Auge zudrücken?«
Meister blieb unnachgiebig. »Die Frage kannst du dir sparen!« Ihre Stimme hatte einen bedrohlichen Unterton angenommen.
»Wenn es Ihnen recht ist, Herr Hegel, werde ich Hermann nach Hause fahren. Ich wohne ganz in der Nähe, das macht mir keine Umstände«, schlug Rahel Studer vor.
Hegel nickte knapp und sah zu Wellnitz. Seine Züge hatten etwas Raubtierhaftes, als ob er ihn zum Nachtisch verspeisen wollte. Der vornehme Professor versuchte erst gar nicht, sein Missfallen über die Trunkenheit des Schauspielers zu verbergen. Philipp wunderte sich über das förmliche »Sie« der jungen Studer. Normalerweise duzte sich das akademische Personal an der Universität. Und warum musste Hegels Assistentin ihn überhaupt um seine Zustimmung bitten?
In diesem Moment öffnete sich ein Fenster, das auf die kleine Gasse führte. »Ruhe da unten, sonst rufe ich die Polizei!«, ertönte eine erboste Stimme.
»Die ist längst da«, gab Wellnitz zurück.
Nachdem sich alle verabschiedet hatten, spazierten Philipp und Armand gemeinsam in Richtung Bellevue. Armand wollte von dort aus die Tram nach Hause nehmen, und Philipp, der die öffentlichen Verkehrsmittel aufgrund unangenehmer Erfahrungen – betrunkene Sitznachbarn, Frauen, die ihn küssen wollten, von ihm aus der Straßenbahn geworfene Taschendiebe – wann immer möglich mied, hatte seinen Wagen im Opernparkhaus abgestellt.
»Noch auf einen Absacker?«, fragte Armand gut gelaunt. Er schien froh zu sein, dass er die schauspielernde Kommissarattrappe ohne Kollateralschaden losgeworden war.
»Heute lieber nicht, mein Freund. Ich muss morgen früh ins Appenzellerland fahren. Du weißt schon … Davids Bootcamp«, antwortete Philipp.
»Beginnt das morgen?«
»War das nicht deine Idee?«, fragte Philipp rhetorisch.
Armand zuckte unschuldig mit den Schultern. »Zwei Wochen frische Luft, Bewegung und klare Regeln. Das wird dem Kleinen guttun und den Eltern auch. Ein Kollege vom Revier hat seinen Sohn vor zwei Jahren dort hingeschickt. Er hatte nur Gutes zu berichten. Mach dir keine Sorgen, die werden Tag und Nacht ein Auge auf den jungen Humboldt haben.«
»Ich bin mir nicht sicher, ob eines reicht«, sagte Philipp nachdenklich. »Ich hoffe nur, dass David das Camp nicht komplett auf den Kopf stellt.«
Seine Sorge war nicht unbegründet.
Drei Silben
Appenzellerland, 5. August
»Nehmen Sie im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt.«
Philipp tat, wie ihm geheißen.
»Nach 300 Metern links abbiegen. Dann erreichen Sie Ihr Ziel.«
»Hör endlich auf, das Navi zu imitieren!«, bemerkte David mit einem mürrischen Blick in Richtung seiner Schwester. »Da vorne gibt es doch gar keine Abzweigung. Wenn Papa jetzt links abbiegt, landen wir im Fluss.«
»Sieh an, du kannst also doch noch sprechen«, neckte Michelle ihren kleinen Bruder. David hatte die ganze Fahrt über schmollend in einem Comic geblättert. Er war wenig begeistert von dem bevorstehenden Ferienlager mit fremden Kindern.
»Du bist wirklich eine …« David konnte den Satz nicht beenden.
»Es reicht!«, griff Philipp entschieden ein. »Michelle lag mit ihrer Schätzung gar nicht so daneben. Da vorne ist bereits das Gebäude.«
Philipps Frau Sophie versuchte die Stimmung im Auto zu heben. »Schaut doch mal, was für eine fantastische Aussicht wir haben. Man sieht die Berge gestochen scharf.« Ihre Worte waren keineswegs übertrieben. Die sanfte Hügellandschaft des Appenzellerlands lag hier in Brülisau wie gemalt vor ihnen. Mächtige Kühe mit Glocken um den Hals grasten auf den saftigen Wiesen, und dank des föhnigen Wetters schienen die Gipfel des Alpsteins zum Greifen nahe. Man spürte förmlich, wie die Natur atmete. Postkartenidylle.
Fast.
»Ich will nicht in das blöde Lager«, beklagte sich David. Seine Stimme zitterte.
»Ach komm, mein Großer, das wird mit Sicherheit ein Riesenspaß«, sagte Philipp so zuversichtlich wie möglich. Obwohl ihm sein Sohn oft das Leben schwer machte, liebte er ihn von ganzem Herzen.
»Warum freust du dich nicht auf zwei Wochen mit neuen Freunden an einem so schönen Ort?«, fragte Sophie sanft.
»Weil ihr mich loswerden wollt! Weil ihr Michelle lieber habt als mich! Weil ihr mich wegwerft wie einen Pappbecher!« David verschränkte die Arme vor der Brust und schob die Unterlippe nach vorn.
Philipp blickte überrascht in den Rückspiegel. »Wegwerfen wie einen Pappbecher?« Hatte sein Sohn das wirklich gesagt? Er überlegte, was er antworten sollte, doch Michelle kam ihm zuvor.
»Zumindest die Aussage, die mich betrifft, stimmt definitiv«, foppte sie ihren Bruder und erntete dafür einen strengen Blick ihrer Mutter.
Philipp setzte den Blinker und fuhr auf den Kiesweg, der zu einem stattlichen Anwesen mit weitläufigem Umschwung führte. Der Parkplatz war bereits gut gefüllt. Erwachsene luden Gepäckstücke aus, während Kinder neugierig die Umgebung erkundeten und ihre Lagergefährten der nächsten zwei Wochen musterten. Philipp parkte seinen kompakten Elektro-SUV zwischen einem Range Rover und einem Mercedes.
»Sie haben Ihr Ziel erreicht«, meldete sich Michelle aus dem Fond des Wagens.
Eine sportliche junge Frau begrüßte die Neuankömmlinge am Eingang des Hauptgebäudes. »Herzlich willkommen, Herr und Frau Humboldt. Wir freuen uns, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben, obwohl das Anwesen abgelegen ist.«
»Danke, das Navigationssystem hat uns gut geführt«, erwiderte Philipp.
Die Unbekannte stellte sich als Patrizia Neukomm vor, Co-Leiterin des Lagers, das sie gemeinsam mit ihrem Bruder Sascha führe. Das Anwesen sei seit einigen Jahren im Besitz ihrer Familie. Es sei der Wunsch ihres Vaters gewesen, die schönen Gebäude nicht nur für Seminare und Hochzeiten zu nutzen, sondern auch Aktivitäten für Kinder anzubieten. »Wir führen das Bootcamp bereits zum dritten Mal durch und möchten das Programm in Zukunft durch kostenlose Angebote erweitern. Aber wir sind uns da familienintern noch nicht einig geworden.«