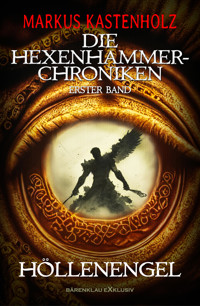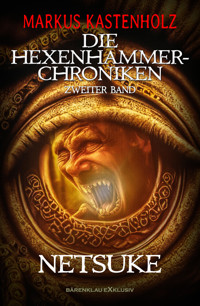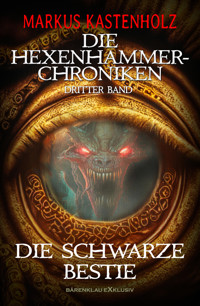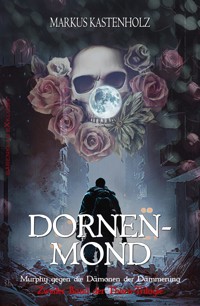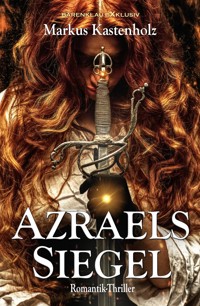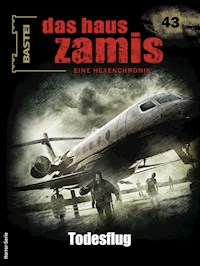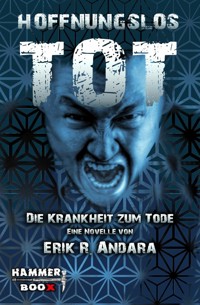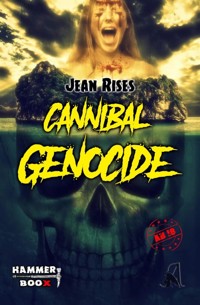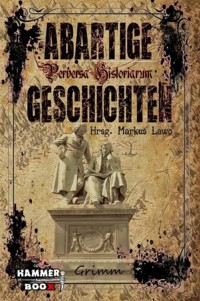3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Catherine Welch ist eine sogenannte »Wer-Katze«. Bei Vollmond muss sie sich in ein tigerähnliches Raubtier verwandeln– genau wie ihre Mutter, die bei Catherines Geburt starb.
Rund zwanzig Jahre später, nach dem Tod ihres Vaters, kehrt Catherine zurück. Sie will in ihrem Elternhaus vor allem mehr über ihre Mutter erfahren. Zur Seite steht ihr dabei James McKinley, der hiesige Arzt, der für sie so etwas wie ein Onkel ist. Als in der Gegend bei Vollmond ein Mann von einer Bestie ermordet wird, weiß Catherine: nicht sie ist die Täterin. Vielmehr spricht alles dafür, dass es ein Werwolf war …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Markus Kastenholz
Die
Katzenfrau
Unheimlicher Roman
Impressum
Copyright © by Authors/Bärenklau Exklusiv
Cover: © Werner Oeckl mit Bärenklau Exklusiv, 2023
Korrektorat: Bärenklau Exklusiv
Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang
Alle Rechte vorbehalten
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Die Katzenfrau
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
Weitere Romane von Markus Kastenholz sind erhältlich oder befinden sich in Vorbereitung
Das Buch
Catherine Welch ist eine sogenannte »Wer-Katze«. Bei Vollmond muss sie sich in ein tigerähnliches Raubtier verwandeln – genau wie ihre Mutter, die bei Catherines Geburt starb.
Rund zwanzig Jahre später, nach dem Tod ihres Vaters, kehrt Catherine zurück. Sie will in ihrem Elternhaus vor allem mehr über ihre Mutter erfahren. Zur Seite steht ihr dabei James McKinley, der hiesige Arzt, der für sie so etwas wie ein Onkel ist.
Als in der Gegend bei Vollmond ein Mann von einer Bestie ermordet wird, weiß Catherine: nicht sie ist die Täterin. Vielmehr spricht alles dafür, dass es ein Werwolf war …
***
Die Katzenfrau
1. Kapitel
Dr. McKinley wusste, er kam zu spät.
Vier Stunden waren seit dem Anruf seines besten Freundes, Roger Welch, vergangen. Sie kannten sich noch aus der Grundschule, aus der Zeit, bevor aus Roger der bekannte Schriftsteller geworden war, bei dem die Hollywood-Produzenten Schlange standen, um seine Bücher zu verfilmen.
»Komm’ so schnell wie möglich«, hatte Roger ihm gesagt und dabei ganz aufgeregt geklungen. »Es geht um Jenny.«
Seine Frau Jennifer. Sie war schwanger, im siebten Monat. Bisher war ihre Schwangerschaft reibungslos verlaufen.
»Schaffst du’s mit ihr bis ins Krankenhaus?«
»Ich glaube kaum, dass sie transportfähig ist.«
»Dann ruf’ ich einen Krankenwagen.«
»Nein, lass das. Kein Krankenwagen! Sie will ausdrücklich dich!«
Humorloses Lachen war McKinleys Antwort gewesen. »Roger, schau’ nach draußen. Da scheint grad die Welt unterzugehen ...«
»Ich bitte dich trotzdem, es zu versuchen. Sie hat ihre Gründe dafür.«
Natürlich war der Arzt trotzdem aufgebrochen. Das gebot ihm nicht nur der Hippokratische Eid, sondern noch mehr seine Freundschaft zu Roger.
Ein Fehler, wie er bald feststellte: Der Regen nahm beständig zu; der Sturm tobte, als wolle er sein Auto wegwehen, und das Laub der Bäume, das im Wind wirbelte, raubte ihm fast die Sicht. Hinzu kam die Dunkelheit der Nacht, die allmählich einbrach; die Scheinwerfer vermochten die Schwärze kaum zu durchdringen. Ihre Lichtkegel wurden aufgehalten von einer silbern schimmernden Wand aus dicken, klatschenden Tropfen.
Obwohl der Arzt nur Schritttempo gefahren war und es bis zu Rogers Haus mitten im Wald lediglich acht Meilen waren … er kam zu spät.
Irgendwann, etwa auf halber Strecke, war die Straße unterspült worden, fanden die Reifen keinen Halt mehr und der Wagen schlitterte geradewegs in den Graben hinein.
Sein Handy war tot, kein Empfang. Keine Chance, jemanden um Hilfe zu rufen. Er konnte nicht einmal Roger anrufen und ihm telefonisch Ratschläge geben, was er tun sollte, um seiner Frau zu helfen. Und was ihn selbst betraf, er konnte auch nicht den Wagen verlassen und auf eigene Faust versuchen, irgendwo jemanden aufzutreiben.
Draußen schien in den quälend langen Stunden, die seitdem vergangen waren, tatsächlich die Welt unterzugehen. Der Sturm rüttelte an seinem Wagen, donnerte andauernd dagegen und begehrte Einlass. Mehr als einmal hatte er das Gefühl, die Windschutzscheibe müsse bersten, sodass der Sturm auch ins Innere des Wagens vordringen konnte.
Dabei versuchte er sich nicht nur umzusehen, gelegentlich drückte er die Hupe und gab Not-Signale. Vergebens. Niemand war auf der Straße. Niemand war so verrückt, sich ausgerechnet jetzt nach draußen zu wagen.
Eher zufällig hatte ihn schließlich doch ein Wagen des Straßendienstes entdeckt, der die Strecke nach umgestürzten Bäumen absuchte. Für das Seilgewinde des Geländewagens war es ein Leichtes, das Auto des Arztes aus dem Graben zu ziehen. Keine Schäden daran außer verbogenem Blech.
Als McKinley schließlich, noch immer am ganzen Leib bebend, Rogers Haus erreichte, waren vier Stunden seit dem Telefonat vergangen. Ein Kloß tauchte in seinem Hals auf, als er am Tor den Sicherheitscode eingab und vor dem Haus parkte und ausstieg. Ein mächtiger Kloß, der in ihm das Gefühl hervorrief, jemand versuche ihn zu erdrosseln.
Der Sturm hatte inzwischen deutlich nachgelassen. Doch der Schaden war längst angerichtet. McKinley wusste, er kam viel zu spät.
Rogers Haus war groß und zweistöckig. Die Fassade bestand aus Holz und gab dem Gebäude ein urbanes Flair.
Sofort fiel ihm auf, es brannte Licht. Praktisch überall im Haus brannte das Licht. Es drang durch fast sämtliche der mannshohen Fenster nach draußen, wie ein schillernder Leuchtturm im Dunkel.
Er ging die drei Stufen zur Veranda nach oben, seine Arzttasche fest umklammert. Das Schlimmste stand jetzt unmittelbar bevor, doch er konnte einfach nicht kehrt machen.
Tief holte er Luft, dann läutete er.
Einmal, zweimal, dreimal …
Keine Reaktion. Niemand öffnete ihm.
Abermals drückte der Arzt die Klingel, und der Kloß in seinem Hals nahm noch weiter zu.
»Du bist zu spät, Jim.«
Zunächst hatte er gar nicht bemerkt, dass sich die Tür geöffnet hatte; seine Gedanken kreisten noch immer um den Orkan, den er soeben überlebt hatte.
Roger stand in der Tür: groß gewachsen, graues Haar, das er zu einem Pferdeschwanz gebunden hatte. Das Selbstbewusstsein, das er ansonsten wie einen Panzer um sich trug, existierte nicht länger. Seine ansonsten erhobenen Schultern waren nach unten gesackt, seine Stimme klang wie aus einer Gruft.
»Tut mir leid«, sagte der Arzt lakonisch. Ihm war klar, das war zu wenig. Andererseits hatte er sich nichts vorzuwerfen, er hatte keinen Fehler begangen, außer dem, helfen zu wollen.
Er wagte nicht zu fragen, was geschehen war.
Roger nahm ihm diese unangenehme Pflicht ab:
»Sie ist tot.«
»Jennifer?« Alles in ihm weigerte sich wahrzuhaben, was er da hörte. Keine Frage, eine Schwangerschaft barg Risiken. Jede Schwangerschaft barg die. Doch die von Jennifer Welch war völlig normal verlaufen für eine 28jährige Frau, deren erstes Kind es war. Vorbildlich geradezu; Dr. McKinley hatte sie ständig kontrolliert. Er wusste, wie sehr Roger sich auf sein erstes Kind freute. Wie jeder Vater. Und die späten Väter umso mehr.
»Ja, Jenny …«
Roger sah an sich hinab; der Arzt folgte seinem Blick – und erschrak! Erst jetzt entdeckte er das Blut an ihm. Viel Blut. Rogers Kleidung schien davon fast getränkt zu sein.
»Was ist passiert?«
Er war derart fassungslos, er wartete nicht die Antwort ab. Burschikos drängte er an seinem Freund vorbei ins Haus. Ihm war klar, Roger hatte nichts getan, das seiner Frau Schaden zufügte, dafür liebte er sie viel zu sehr. Trotzdem – er wollte Antworten. Nicht als Arzt, sondern als der Freund, der er war.
»Was ist passiert?«, wiederholte er, und seine Stimme überschlug sich fast vor Aufregung.
Roger konnte ihm nicht antworten. Er biss sich auf die Unterlippe, in seinen Augen schimmerte es feucht. Er setzte an … vergebens. Die Stimme versagte ihm.
Seufzend warf er die Haustür ins Schloss zurück und suchte händeringend nach dem perfekten Anfang. Dann:
»Du weißt, was ein Werwolf ist?«
McKinley fragte sich, was das sollte. Besonders in einer Situation wie dieser.
»Du sprichst von den Phantasiegestalten, über die du manchmal schreibst?«
Bitterkeit zuckte in Rogers Mundwinkeln. »Genau die meine ich.«
»Und? Was ist mit denen?«
»Ist dir aufgefallen, heute ist Vollmond?« Wütend ballte der Schriftsteller die Fäuste. »Ausgerechnet heute!«
Nein, das war ihm vor lauter Dunkelheit, Nässe und Sturm nicht aufgefallen. Noch immer hatte der Arzt keine Schimmer, worauf er hinauswollte. Noch immer erschloss sich ihm nicht der Sinn dieser Worte.
»Jenny ist …« Hart schluckte er. »… Sie war ein Wer-Wesen.«
Zunächst meinte McKinley, er habe sich verhört. Danach meinte er, Roger mache einen Scherz. Ein Scherz, jenseits des guten Geschmacks.
»Du willst mir weißmachen, Jennifer war ein Werwolf?«
»Nein, will ich nicht.« Er verzog keine Miene, befand sich in einem tiefen Schock-Zustand. »Sie war eine Wer-Katze.«
»Hör zu …« McKinley schüttelte den Kopf. Er hatte keine Ahnung, was in seinen Freund gefahren war. Vielleicht war er ja wirklich wahnsinnig geworden vor Kummer und vermochte nicht länger zu unterscheiden zwischen der Realität und seiner Phantasie. »Wenn du …«
Roger schien ihn gar nicht zu hören, war mit seinen Gedanken nicht im Hier und Jetzt. Er schob die Hände in die Hosentaschen und trottete in Richtung der Freitreppe.
»Wenn ich’s dir doch sage … Jenny war wirklich eine Wer-Katze. Es gibt übrigens auch Werwölfe. Und wenn du mir nicht glaubst, ich habe mit eigenen Augen einen gesehen. Und nein – ich spinne nicht. Ich hab auch nichts getrunken, obwohl mir grad danach ist. Wer-Katzen verwandeln sich wie Werwölfe bei Vollmond; sie nehmen Hybridgestalt an. Jenny war« – erneut ein schwermütiges Seufzen – »fürs Schreiben inspirierend und … mitunter sehr stimulierend.«
Der Arzt fragte sich, was er darauf erwidern sollte. Er wusste es nicht. Also hielt er vorsorglich den Mund.
»Uns beiden war klar, eine Schwangerschaft birgt Risiken«, meinte er niedergeschlagen. »Wenn das Kind ihre Veranlagung erbt und die Wehen bei Vollmond einsetzen … Wir haben wirklich darüber nachgedacht, aber wir meinten, wir seien zu pessimistisch.« Humorlos lachte er auf. »Jenny wollte es trotzdem so. Sie vertraute einfach darauf. Sie sagte immer, wir hätten so viel Glück gehabt, uns zu begegnen, dann würde auch das gut gehen.«
Erneut lachte er auf, obwohl ihm war alles andere als zum Lachen zumute war. Seine Glieder zitterten, und seine Knie wollten einknicken, um an Ort und Stelle liegen zu bleiben und zu sterben.
»Ich hab das Kind geholt«, knurrte er lethargisch. »Jenny wollte es auch das. Anderenfalls wären sie beide gestorben.«
»Du hast es … geholt?« Obwohl der Arzt bestenfalls einen verschwindend geringen Bruchteil von alldem verstand, er konnte sich nicht länger zurückhalten. »Was hast du getan?«
Er versuchte ein Lächeln, das ihm gründlich misslang:
»Es ist ein Mädchen.«
2. Kapitel
Der Arzt wusste, wo das Schlafzimmer lag. Oft genug hatte er hier Hausbesuche gemacht, vor allem in den letzten Monaten.
Doch selbst wenn er den Weg dorthin nicht gekannt hätte – man musste lediglich der Blutspur folgen. Roger hatte auf dem Weg zur Haustür eine unübersehbare Fährte hinterlassen.
McKinley stürmte an ihm vorbei nach oben.
Die Tür zum Schlafzimmer stand sperrangelweit offen. Auch hier brannte überall Licht. Leider. Alles war derart hell, dass nichts verborgen blieb. Keine Schatten, keine Düsternis, die sich gnädig darüberlegten und die Wahrheit kaschierte. Jedes morbide Detail wurde schonungslos dargelegt.
Jennifer lag in dem großen Doppelbett, wie erwartet.
Instinktiv schreckte der Arzt zurück, als er das viele Blut sah. Überall schien es sich zu befinden. Vor allem an ihr selbst. Roger hatte ihr die Bettdecke über den Körper gezogen. Vermutlich aus Selbstschutz, um nicht ständig sehen zu müssen, was geschehen war.
Die Bettdecke war durchgeblutet. Ebenso wie das Betttuch. Überall nur widerwärtig dunkelrotes, getrocknetes Blut.
Abwechselnd heiße und kalte Schauer jagten seinen Rücken hinauf, hinab und abermals hinauf. Aus einem Reflex heraus wollte sich der Arzt abwenden. Er hatte schon vieles gesehen; das kam mit seinem Beruf. Doch weder war er Metzger, noch Pathologe. Gewöhnen würde er sich nie daran.
Dennoch war das etwas in ihm, das ihn daran hinderte, wegzulaufen, sosehr auch jede Faser in ihm danach zu verlangen schien.
Mit langsamen, unbeholfenen Schritten betrat er das Schlafzimmer und ging in Richtung Bett. Hart schluckte er, als er das Betttuch von ihrem Gesicht hochhob.
Jennifer war tot, das erkannte er mit einem Blick, auch ohne ihre Wunde im unteren Bereich des Körpers in Augenschein zu nehmen. Dafür sorgte allein schon der Blutverlust.
Aber war es überhaupt Jennifer?