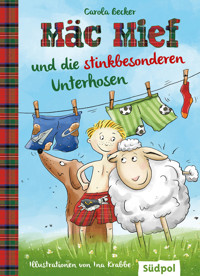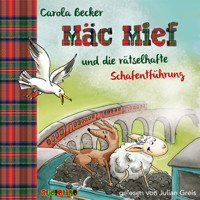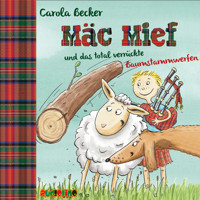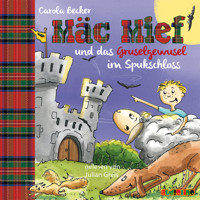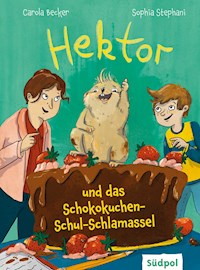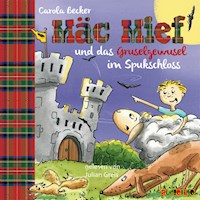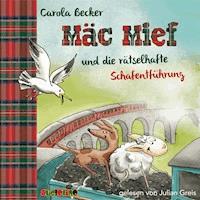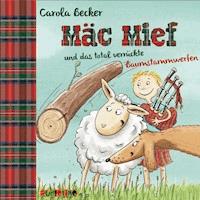Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Buch erzählt von gewaltsamen Verlusten und ihren historischen Hintergründen, von der Sehnsucht nach Daheim, von glücklichen Zufällen und der Kraft eines Miteinanders, das Fremdheit überwindet. Im Mittelpunkt steht die Familie der Autorin Carola Becker, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus Waldenburg in Niederschlesien in das Siegerland vertrieben wurde. Hier beginnt die Geschichte. Sie steht exemplarisch für die Schicksale von etwa zwölf Millionen Menschen aus den früheren deutschen Ostgebieten. Jeder Einzelne musste sich aus dem Nichts heraus ein neues Leben aufbauen. Seit den 1960er Jahren galt offiziell ihre Eingliederung in die westdeutsche Gesellschaft als erfolgreich beendet. Tatsächlich verschwanden die dunklen Schatten der gewaltsamen Entwurzelung im Privaten. Für eine versprengte frühere Gemeinschaft wurde der Schützenverein Waldenburg-Altwasser zu einem emotionalen Ankerpunkt. Aber der Verein war mehr als ein rückwärtsgewandter Ort der Erinnerungen; er war eine Brücke in die Zukunft. Denn es entstand ein Vereinsleben mit einer ganz eigenen Atmosphäre des Miteinanders über kulturelle Grenzen hinweg. In einer Mischung aus biografischer Erzählung und faktenreicher Dokumentation betrachtet Carola Becker die Thematik vielschichtig und aus einer Langzeitperspektive. Der lange Prozess des Heimischwerdens nach dem Zweiten Weltkrieg ist ein lehrreiches Kapitel der deutschen Geschichte. Wann sind die Entwurzelten wirklich angekommen? Welche Spuren hat das Erlebte in den Familien hinterlassen? Wodurch fördern oder behindern Politik, Gesellschaft und Interessenverbände den oft schwierigen Prozess einer gelungenen Integration? Diese Fragen haben eine hohe Aktualität, denn die gegenwärtigen Kriege vertreiben erneut Millionen Menschen aus ihrer Heimat. Das Buch gibt Antworten am Beispiel der Geschichte einer Familie und eines ungewöhnlichen Vereins.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 323
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Prolog
Entwurzelt
Irrfahrt ins Ungewisse.
Das vergessene Jahr.
Machtpolitik und Nationalsozialismus: Zerstörung und Neuordnung Europas.
Siegerland 1946 – eine Innenansicht.
Für immer verloren
Mit eigenen Augen.
Landeskundliche Notizen: Niederschlesien und das Waldenburger Bergland.
Altwasser: vom Heilbad zum Bergbauviertel.
Herkunft: vom Land in die Stadt.
Ostdeutsche Gutswirtschaft: Schloss Kuchendorf.
Vom Milchhändler zum Gastwirt: Elisenhöhe und das Hotel Sandberg.
Eigentum: Das Bergschlößchen in Waldenburg-Altwasser.
Existieren!
Die Vorgänger: „displaced persons“.
Raus aus dem Durchgangslager – wohin mit den Vertriebenen?
Hungern und Frieren– Kalter Winter 1946/47.
Alltagsgüter.
Das Siegerland als „Heimat“?
Selbstorganisation von Kultur, Erinnerungen und Interessenvertretungen.
Ein dünner Faden.
Dortmund – Kontaktbörse für die Waldenburger.
Anfangen
Freiheit und Anarchie.
Entnazifizierung.
Unternehmergeist in einer neuen Gründerzeit.
Jugend und Sport: ein Integrationsmotor.
Zukunftsstrahlen – aber Herkunft unbekannt.
Ein bisschen Siegerländer: Migration als Normalität.
Grandiose Überraschung: ein verlorenes Artefakt taucht auf -
Etablieren
Ein neues Zuhause: eigenes Grundstück in einer wachsenden Stadt.
Staatliche Unterstützung: Soforthilfe und Lastenausgleich.
Über weitere Hürden ans Ziel.
Ein kulturelles Daheim: Der Schützenverein Waldenburg-Altwasser lebt weiter
Schlesischer Schützenkönig im sauerländischen Iserlohn – Großes Medienereignis 1959.
Enge Bande werden besiegelt: Patenschaft und das zweite Nachkriegsschützenfest 1961.
„A ganz kleenes Foahnla bluuß“ – ein normales Vereinsleben beginnt.
Ein sicherer Tresor für die Kette.
Die Alten treten ab.
Selbstverständlichkeiten?
Die Ostfriesen kommen! – Freundschaften werden erweitert.
Würdevolles Jubiläum 1969: 75 Jahre Schützenverein Waldenburg-Altwasser.
Endgültige Normalität: eine neue Fahne 1970 und eine Vereinssatzung.
Gegenseitige Ehrungen und Geschenke.
Schießprogramm: Königs- und Legatschießen, Pokale und Preise.
„Denn mach mer oll’s asu wie hier, do sein mer ebenst nich mehr ‚wir‘!“ – Offenheit und Erinnerungen an daheim.
Bewegte Zeiten und das hundertjährige Jubiläum 1994.
Abschied mit Würde
Das letzte Waldenburger Königspaar: gebürtige Ostfriesen.
Verbleib des Nachlasses im Haus Schlesien, Königswinter.
Einzigartig?
Die Kette – weit mehr als ein Relikt.
Stille Enden
Lebensgeschichten schließen sich.
Spurenlos: Dortmund und der Patenschaftsarbeitskreis Waldenburger Bergland.
Epilog
Das Phänomen Vertreibung bleibt.
„Nicht in meinem Namen“ – zur Politik der Vertriebenenverbände.
Narrative zur Integration.
Danksagung
Literatur und Quellen
Prolog
Die Idee zu diesem Buch entstand, nachdem sich ein kleiner Verein aufgelöst hatte. Sorgfältig hatten die Verantwortlichen den Nachlass an ein Archiv gegeben. Das ist eher ungewöhnlich.
Ursprünglich wollte ich nur die schillernde Geschichte des aufgelösten Schützenvereins Waldenburg-Altwasser erzählen, der im Jahr 1894 in Niederschlesien gegründet worden war. Ein Mosaikstein deutscher Vor- und Nachkriegsgeschichte sollte nicht verloren gehen, denn fast alle Zeitzeugen sind inzwischen verstorben. Zu ihnen gehörten meine Großeltern, meine Eltern und weitere Familienangehörige. Sie waren im Mai 1946 im Rahmen der Operation swallow aus Waldenburg (heute Walbrzych, Polen) in die Britische Besatzungszone deportiert worden und hatten sich im Süden Westfalens, im Siegerland, ein neues Leben aufgebaut. Schnell zeigte sich, dass erst im Licht größerer Zusammenhänge die Bedeutung dieser schlesischen Schützengemeinschaft für das so schwierige Heimischwerden „fern der Heimat“ erkennbar würde. Zu diesen Kontexten gehören Nationalsozialismus und der Zweite Weltkrieg, die machtpolitischen Hintergründe der gewaltsamen Bevölkerungsverschiebungen in Osteuropa, aber auch das latente Offenhalten der Grenzfragen in der Zeit des sog. Kalten Krieges. All diese Erschütterungen und historischen Geschehnisse grundierten die ohnehin enormen Herausforderungen einer Integration in die westdeutsche Gesellschaft und spiegelten sich im Alltag der Protagonisten in mannigfaltigen Facetten wider. Die Recherchen führten mich zu den verzweigten Vorgeschichten der gewaltsamen, kriegsbedingten Brüche und ließen mich vieles entdecken, was mir bislang unbekannt war. Dort, wo es mir wichtig erschien, habe ich historische Sachverhalte eingebunden. Die Arbeit an diesem Buch hat auch meine eigenen Meinungen und Bilder zurechtgerückt.
Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich in die Heimat meiner Mutter gefahren. Waldenburg und Niederschlesien waren immer mein „erzähltes Zuhause“ – voller Geschichten und Mythen mit einer sehr starken Prägekraft, aber ein fremd gebliebenes Erbe. Mein reales Zuhause liegt im Siegerland. Erst meine Reise durch Niederschlesien verwandelte die überlieferte untergegangene Welt in gelebte Wirklichkeit. Mit eigenen Augen konnte ich mir ein Land erschließen, über das bislang immer ein Nebel der Erinnerungen anderer gelegen hatte. So geriet dieses Buch auch zu einer kleinen und heilsamen Reise durch manche Bürden meiner eigenen Vergangenheit.
Der lange Prozess des Heimischwerdens, den mehr als zehn Millionen Vertriebene und Geflüchtete durchlebten, ist ein lehrreiches Kapitel unserer Geschichte. Offiziell galt ihre Integration seit Anfang der 1960er Jahren als erfolgreich beendet. Die Menschen waren materiell versorgt und sozial eingegliedert am Arbeitsplatz oder durch Heirat. Tatsächlich verschwanden die dunklen Schatten der gewaltsamen Entwurzelung im Privaten und in kleinen Gemeinschaften wie dem Schützenverein Waldenburg-Altwasser. Er war für seine Mitglieder, so auch für meine Herkunftsfamilie, über viele Jahrzehnte ein kultureller und emotionaler Ankerpunkt, eine fast magische und sinngebende Kraftquelle, die mir immer etwas rätselhaft geblieben war. Beim Eintauchen in die alten Schriftstücke staunte ich darüber, mit welch starker Motivation und Hartnäckigkeit mein Großvater gemeinsam mit seinen Kameraden seit dem Jahr 1948 den Kreis der Schützenbrüder wieder zusammenbrachte, in einer Zeit voller Mangel und Unsicherheit. Sie entwickelten ihr kulturelles Kleinod zu einem allumfassenden Symbol für „derheeme“. Zusammen mit dem verlorenen Eigentum meiner Großeltern, dem Ausflugslokal Bergschlößchen in Waldenburg-Altwasser, bildete der Verein eine untrennbare Einheit. Sie war im neuen Zuhause, das sich meine Vorfahren im Siegerland geschaffen hatten, stets präsent.
Doch der Schützenverein war mehr als ein rückwärtsgewandter Ort der Erinnerungen; er war eine Brücke in die Zukunft. Von Beginn an haben sich die Waldenburger nicht als ostdeutsche „Heimatgruppe“ abgekapselt, sondern nach außen geöffnet. So entstand ein Vereinsleben mit einer ganz eigenen Atmosphäre des Miteinanders über kulturelle Grenzen hinweg. Der letzte Waldenburger Schützenkönig war ein „waschechter Ostfriese“. Die Geschichte des Vereins steht beispielhaft für verborgene Spuren eines langen und vielfach unterstützten Integrationsprozesses nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber vor dem Hintergrund des fehlenden Friedensvertrags und der Unwägbarkeiten des Kalten Krieges hat ein offener oder bisweilen diffuser politischer Subtext diesen in die Zukunft gerichteten Prozess immer wieder gebremst und belastet.
Ich bin im Jahr 1956 geboren und sozialisiert in einer Anerkennung der deutschen Schuld am verbrecherischen Naziregime und am Zweiten Weltkrieg mit seiner unvorstellbar vernichtenden Wucht. Nie wieder dürfen solche Exzesse zugelassen werden. Die organisierte Vertreibung und Enteignung meiner Vorfahren aus Niederschlesien mit all ihren emotionalen und materiellen Folgen war immer auch ein Streitpunkt in der Familie, ein Konflikt zwischen Generationen. Erst beim Schreiben konnte ich aufrichtig eine Perspektive der Betroffenen einnehmen und bislang verdunkelte Stellen ausleuchten. Die politischen Narrative, mit denen ich aufgewachsen bin, hatten stets wichtige menschliche Seiten der Vertreibung – Gefühle von Ohnmacht, das erlittene Unrecht und das so häufig mangelnde „Willkommen“ – unter einer auch bequemen Schutzschicht verborgen. Im vermeintlichen Aufrechnen von Schuld und Sühne gingen wichtige historische Fakten unter.
Als das Buch entstand, herrschte Krieg in der Ukraine. Das Land war von Russland angegriffen worden, viele Menschen suchten Schutz auch in Deutschland. Versorgung, Wohnraum, Sprache standen bei ihrer Aufnahme zunächst im Mittelpunkt. Wir werden konfrontiert mit Menschen, die Schreckliches erlebt haben, die ankommen müssen in der Fremde. Sie alle hinterlassen ihre Kulturen, ihre Sprache, ihr Land, ihre Familien und ihr soziales Umfeld. Hinter der Oberfläche des Materiellen verschwinden die vielschichtigen Herausforderungen, Heimat neu zu finden. Das gilt für alle Migranten. Zum gesellschaftlichen Miteinander gehört es, gegenseitig wenigstens eine kleine Vorstellung davon zu entwickeln, welche verdunkelten Tiefen sich hinter Migrationsgeschichten verbergen können. Wir alle sind gefordert, sonst verfestigt sich Fremdheit auf Gegenseitigkeit. Die Herausforderungen sind aktueller denn je.
Wieviel Zeit, Kraft und gegenseitige Bereitschaft in einem oft Jahrzehnte währenden Prozess hin zu einer gelungenen Integration, hin zu einem Überwachsen von Kriegserfahrungen erforderlich sind, ist mir am Ende dieses Buches sehr deutlich geworden. Entstanden ist eine verschlungene Geschichte von Verlusten und ihren historischen Hintergründen, von der Sehnsucht nach Daheim, von glücklichen Zufällen und der Kraft eines Miteinanders, das Fremdheit überwindet. Das Buch ist meiner Familie gewidmet.
Entwurzelt
Irrfahrt ins Ungewisse
Dienstag, 7. Mai 1946. Die Sonne scheint an diesem warmen Frühlingstag. Am Waldenburger Bahnhof Altwasser werden meine Großeltern mit ihrem damals zwölf Jahre alten Sohn gemeinsam mit weiteren Mitgliedern der Familie in den Viehwaggon eines Zuges verfrachtet. Ihre Tochter war nicht darunter. Ein klein wenig Handgepäck hatten sie bei sich. Das Ziel der bevorstehenden Fahrt kannten sie nicht. „In die britische Zone“, so hieß es wenig glaubwürdig. Misstrauen herrschte, denn das vergangene Jahr war angefüllt gewesen mit Gerüchten, spärlichen und widersprüchlichen Informationen über die Zukunft Niederschlesiens in einem sich neu ordnenden weltpolitischen Machtgefüge.
Ein Jahr zuvor, am 7./8. Mai 1945, hatte der Zweite Weltkrieg mit der bedingungslosen Kapitulation der Deutschen Wehrmacht sein Ende gefunden, Europa war in einem sechs Jahre währenden brutalen Kriegsgeschehen erschüttert worden, die Herrschaft des Nationalsozialismus war in sich zusammengebrochen. Vor allem das westliche Niederschlesien war bis zum Kriegsende ein Ort der Ruhe gewesen – soweit man davon in der Zeit des Nationalsozialismus überhaupt sprechen kann. Krieg und Zerstörungen fanden überwiegend in der Ferne statt. Das hatte sich schlagartig mit der Kapitulation geändert. In diesem ersten Nachkriegsjahr hatten meine Vorfahren in Waldenburg schwerste Nachbeben des Krieges erlebt. Nun wurden sie gezwungen, ihr bisheriges Leben endgültig zu verlassen – auf einer etwa viertägigen Irrfahrt ins Ungewisse. Erst langsam erahnten sie, dass der Zug nicht nach Osten fuhr, wie manch einer als Rache für die Gräueltaten des nationalsozialistischen Deutschlands befürchtete. Mein Onkel schreibt: „Wir fürchteten, Sibirien sei das Ziel – auch eine Folge der Nazi-Propaganda.“1 Der spärliche Schein der aufgehenden und untergehenden Sonne, die ihre Strahlen durch die Ritzen der Waggons schickte, brachte langsam Gewissheit: Es ging Richtung Westen. In Helmstedt wurde die Menschenfracht umgeladen und von den britischen Besatzern übernommen. Das Ziel ihrer Weiterfahrt war nach wie vor unbekannt. „Man kann sich heute nicht mehr vorstellen, welch ein Erlebnis es war, als in Helmstedt das Deutsche Rote Kreuz die Waggons öffnete und uns warmen Kaffee anbot. […] Es ging dann weiter ins Siegerland.“2
Abb. 1: Ein Transportzug der operation swallow.3
Samstag, 11. Mai 1946. Der Zug mit etwa vierzig Waggons fährt in den Hauptbahnhof Siegen ein. Zögerlich und verunsichert steigen ungefähr 1500 Menschen aus. Jeder bepackt mit einem eigenen und einmaligen Schicksal. Als anonyme Menge werden sie in ein Lager verbracht. Dem Elend in der Heimat waren sie entronnen, aber nicht aus eigenem Willen. Keine Flucht.4 Über einer vorsichtig aufkeimenden Hoffnung auf Frieden und Neuanfang lagen tiefe schwarze Schatten. In den Seelen vieler Vertriebener werden sie sich nie mehr wirklich aufhellen. Kaum jemand im Westen hatte damals eine Vorstellung davon, was die Vertriebenen im vergangenen Jahr erlebt hatten. Ins Nichts gezwungen, belastet mit schlimmsten Erniedrigungen, als Bittsteller vollkommen auf fremde Hilfe angewiesen, den Boden unter den Füßen weggezogen – so landeten die Vertriebenen im Westen. Auf dem tagelangen Transport fasste mein Onkel als Zwölfjähriger einen Entschluss, der sein weiteres Leben bestimmen sollte: „Ich erinnere mich gut, dass ich auf dieser Fahrt einen Plan für mich entwarf: Du musst dich körperlich stark machen. Du musst alles Wissen sammeln, was es gibt. Und du musst Geld (Kapital) sammeln, damit du stark und so ‚reich‘ wirst, wie deine Eltern einmal waren.“5 Ihr Eigentum hatten sie vollständig in Schlesien zurücklassen müssen. Kämpfertypen entstanden in dieser kurzen, aber immens prägenden Phase des Lebens. Als ganz wichtig stellte sich später das Lebensalter heraus, in dem die Betroffenen die Vertreibung erlebt hatten. Jeder hat seine ganz eigene Geschichte.
Die britischen Besatzungsbehörden machten präzise Vorgaben für den Ablauf nach der Ankunft im Westen. Es lag in ihrem eigenen Interesse, schnell und energisch „[…] die dringlichsten Probleme auf dem Weg zur Normalisierung der Lebensverhältnisse“ […]6 zu lösen. Chaotische Zustände zu verhindern, war eine zwingende Voraussetzung für den Aufbau einer demokratischen Gesellschaft – einem wesentlichen Ziel des Potsdamer Abkommens vom August 1945.7 Wie überall in der Britischen Besatzungszone wurden die Vertriebenen vom Siegener Bahnhof zügig zu einem Lager gefahren, in Siegen war es das Hauptdurchgangslager in der ehemaligen Kaserne Wellersberg. Dort sollten sie nur wenige Tage verbleiben und dann in der Region verteilt werden. Die Vertriebenen wurden entlaust, ärztlich untersucht und mit Nahrungsmitteln für ein paar Tage versorgt. Viele waren krank, ausgehungert, geschwächt, hatten Schreckliches erlebt. Glücklich, mit dem Leben davongekommen sein; aber entwurzelt und gedemütigt.
Abb. 2: Flüchtlings-Meldeschein Horst Ohnsorge; Vorder- und Rückseite.8
Für meine Familie war das Durchgangslager Wellersberg eine verschwiegene Station auf ihrem Weg in ein neues Leben; niemand hat je davon erzählt. Auch die Erlebnisse des letzten Jahres in ihrer Heimat und während des Abtransportes blieben weitgehend tabu. Ein dunkler Tunnel mit einem kleinen Lichtschein: Sie waren der Bedrohung eines Lebens unter kommunistischer Herrschaft in einem für sie fremden Staat Polen mit einer fremden Kultur entkommen. Ich bin sicher, dass meine Großeltern so empfunden haben. Faktisch war Schlesien schon nicht mehr Deutschland. Die Menschen wurden aus einem Land vertrieben, das die politische Führung eines wiedererstehenden polnischen Staates bereits seit mehr als einem Jahr als ihr eigenes Staatsgebiet betrachtete. Aussicht auf eine selbstbestimmte Gestaltung des Lebensalltags bestand nicht. Auch wenn diese Art einer erzwungenen „Rettung“ kein Trost war für die gewaltsame Entwurzelung und Enteignung, lag unter der Oberfläche des vollständigen Heimatverlustes ein Wert, der wichtiger ist: das individuelle und einmalige Leben an sich. Zügig wurde die Familie in Fellinghausen (heute Stadt Kreuztal, damals Amt Ferndorf) untergebracht.
Irgendwann in dieser Zeit vergrub jemand in Waldenburg-Altwasser eine Kette.
Das vergessene Jahr
Ein Krieg endet nicht an einem Tag. Auch wenn die öffentliche Erinnerungskultur ein Datum verlangt, das den entscheidenden Wendepunkt vom Kampfgeschehen in eine Friedenszeit markiert. Tatsächlich gibt es einen mehr oder weniger langen Übergangszeitraum. Im Schatten eines vermeintlichen Kriegsendes liegen zivile Opfer, Zerstörungen, Auflösung vertrauter Strukturen. Solche Nachbeben wirken noch über Jahrzehnte, bis in die Kinder- und Enkelgeneration hinein. Für viele Menschen lag nach den Kampfhandlungen des Zweiten Weltkrieges ein Leben in Frieden und Freiheit noch in weiter Ferne.
Bereits seit 1942 waren zahlreiche westliche Städte zum Ziel schwerster Bombardierungen durch die Alliierten geworden. Opfer war die Zivilbevölkerung, viele verließen ihr verwüstetes Zuhause, wurden in weniger umkämpfte Gebiete evakuiert. Die Landung der alliierten Streitkräfte in der Normandie (USA, Großbritannien und Kanada) am 6. Juni 1944 (dem sog. D-Day) markiert die endgültige militärische Wende im Kriegsverlauf. Schließlich nahm die US-amerikanische Armee Ende Oktober 1944 die erste deutsche Großstadt ein, Aachen, und rückte weiter vor. Ab Anfang April 1945 war der Krieg im Westen letztlich verloren, die Wehrmacht war in Auflösung. Städte, Dörfer und Landstriche wurden – teilweise nach heftigen Kämpfen – von den Siegern besetzt. Erst zu Kriegsende 1944/45 wurden die Stadt und der Landkreis Siegen massiv bombardiert. Doch die Überlebenden durften bleiben und wurden von der nationalsozialistischen Terrorherrschaft befreit.
Ganz anders waren Verlauf und Nachwirkungen des Krieges im Osten Europas. Hier gelang der sowjetischen Roten Armee Mitte des Jahres 1944 die völlige Zerschlagung der reichsdeutschen Heeresgruppe Mitte. Der Weg nach Westen war damit frei; zügig besetzte sowjetisches Militär die eroberten Gebiete in der heutigen Ukraine und in Weißrussland und vertrieb die Menschen in Richtung Westen. Die UdSSR hatte weitergehende Ziele: Es sollten Fakten geschaffen werden für eine Nachkriegsordnung mit einer deutlichen Erweiterung des kommunistischen russischen Machtbereiches nach Westen. Der Vormarsch Richtung Ostpreußen löste eine erste große Flüchtlingswelle der deutschen Bevölkerung aus. Weiter südlich eroberten die Rotarmisten Gebiet um Gebiet. Am 12. Januar 1945 brach der russische Angriff in Richtung Schlesien los. Die Konzentrationslager wurden befreit, als erstes das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau Ende Januar 1945. Die eroberten Orte übergaben die sowjetischen Besatzer unmittelbar nach ihrem Einmarsch an den polnischen Staat. Genauer: an eine „Polnische Provisorische Regierung der Nationalen Einheit“, welche die kommunistische Sowjetunion bereits am 1. Januar 1945 als vorläufige Regierung Polens anerkannt bzw. etabliert hatte. Die eroberten Regionen standen nun unter „polnischer Verwaltung“. Nach heftigen Bombardierungen fiel Breslau am 6. Mai schließlich in die Hände der Roten Armee. Danach rückte sie weiter in den Westen Niederschlesiens vor.
Erst an seinem Endpunkt kamen die Kriegshandlungen nach Waldenburg. Die Bergbau- und Industriestadt war von Zerstörungen und Bombenangriffen vollständig verschont geblieben. Die Nationalsozialisten hatten in den vergangenen Jahren insbesondere Niederschlesien zum „Luftschutzkeller Deutschlands“ gemacht, einem für Auslagerungen und Evakuierungen bevorzugten Gebiet.9 Die Kriegshandlungen fanden an den Fronten im Osten und Westen statt, die Bomber flogen nach Breslau oder in die Industriegebiete Oberschlesiens. Es hatte Einquartierungen von Verbänden der Wehrmacht gegeben, auch im Bergschlößchen, dem Lokal meiner Großeltern in Waldenburg-Altwasser. Nun rückte die Front näher, Kanonendonner war zu hören. Der erste Räumungsbefehl für Waldenburg erging am 6. Mai 1945 durch die deutsche Verwaltung. Chaotische Zustände waren die Folge. Die Fluchtrouten waren bereits völlig verstopft, viele Menschen kehrten wieder um. Dann, am 8. Mai 1945 gegen 16.30 Uhr, rückte die Rote Armee in Waldenburg ein. Polnische Miliz begann sofort mit systematischen Räumungen.
Im Osten Europas fand seit dem Vorrücken der Sowjetischen Armee eine der größten erzwungenen Bevölkerungsverschiebungen in der europäischen Geschichte statt. Das Hitler-Regime und der vom Deutschen Reich zu verantwortende Zweite Weltkrieg schufen Möglichkeiten für eine machtpolitisch angetriebene Ordnung neuer Staatsgrenzen. Eingewoben in die chaotischer werdenden Kriegshandlungen war bereits die spätere Spaltung Europas in zwei Systemblöcke Ost und West. Betroffen von Vertreibungen waren nicht nur die früheren deutschen Ostgebiete,10 sondern ebenso Westteile der heutigen Ukraine, Weißrusslands, die baltischen Staaten und Gebiete in weiteren osteuropäischen Ländern. Die „ethnischen Bereinigungen“ waren von langer Hand vorbereitet und verbunden mit Gewalttaten gegenüber den Zivilbevölkerungen in unvorstellbarem Ausmaß; völkerrechtswidrige Verbrechen. Meine (westdeutsche) Generation hat sich vollkommen zu Recht seit den 1960er Jahre vorrangig mit den Verbrechen des Nazi-Regimes auseinandergesetzt und mit der Frage befasst, was wir aus dieser Geschichte lernen können, was wir selber beitragen können zur Gestaltung einer friedlichen Zukunft in Freiheit und Verantwortung. Aber es gab auch schwere Schuld auf anderen Seiten. Aus mannigfachen Gründen wurden und werden wichtige Teile der Kriegs- und Nachkriegsgeschichte verschwiegen, verkürzt oder ausgeblendet. Öffentlich und privat. In meiner Familie gehörte dazu die Frage: Was geschah eigentlich zwischen Mai 1945 und Mai 1946? Ich habe sie manchmal gestellt, aber nach wenigen Sätzen löste sie stets ein für mich rätselvolles Schweigen aus. Demütigungen und schambesetzte Erniedrigungen sprachen daraus.
Die historische Forschung ist zur Wahrheitsfindung über die Geschehnisse in diesem Zeitraum weitgehend auf individuelle, teilweise standardisierte Erfahrungsberichte angewiesen; sie liegen in breitem Umfang im Bundesarchiv11 (aber auch in anderen öffentlichen Archiven) vor und erlauben eine durchaus glaubhafte Dokumentation und Beurteilung der Ereignisse. Das Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte hat in den Jahren 1954 bis 1961 umfassendes Material in insgesamt fünf Bänden veröffentlicht.12 Im Jahr 1969 erteilte die Bundesregierung der „Großen Koalition“ dem Bundesarchiv den Auftrag, „[…] das ihm und anderen Stellen vorliegende Material über Verbrechen und Unmenschlichkeiten, die an Deutschen im Zuge der Vertreibung begangen worden sind, zusammenzustellen und auszuwerten.“13 Die von SPD/FDP geführten Bundesregierungen hielten den 1974 fertiggestellten Bericht unter Verschluss; er passte nicht zur eingeleiteten Entspannungspolitik. Nach seiner Amtsübernahme im Dezember 1982 hat Bundesinnenminister Dr. Friedrich Zimmermann den Bericht zur Veröffentlichung freigegeben, nachdem das Zurückhalten als „Verschlusssache“ wiederholt stark kritisiert worden war. In seinem Geleitwort schreibt Zimmermann: „Wie könnte Entspannung dauerhaft sein, wenn sie das Verschweigen oder die Verfälschung geschichtlicher Ereignisse in Kauf nimmt? […] Vorgänge solchen Ausmaßes dürfen nicht aus dem Bewusstsein eines Volkes verdrängt werden. Findet eine wissenschaftliche Aufarbeitung nicht statt, die sich von unbestechlicher Wahrheitsliebe leiten lässt, so entstehen verzerrte Bilder der Vergangenheit und entstellende Legenden. Damit ist niemandem gedient.“14 Das Bundesarchiv kommt zusammenfassend zu dem Ergebnis: „Opfer der Gewalttaten und Unmenschlichkeiten wurden nicht etwa bestimmte Personengruppen, sondern Deutsche aller Bevölkerungskreise. […] Die verübten Gewalttaten waren Ausdruck eines Vergeltungsdranges, aber auch blinder, von politischer Indoktrination noch gesteigerter Hassgefühle. Diese konnten sich auch in von niedrigsten Instinkten geleiteten Taten niederschlagen.“15 Beide Publikationen fanden so gut wie keinen Widerhall in der Bevölkerung und auch nicht im deutschen Bildungs- und Schulsystem. Medien haben das Thema erst nach 1990 aufgegriffen. Die „völkerrechtswidrigen Massenvergehen“, geleitet von einem „Vergeltungswillen für Unrechtstaten, die die polnische Bevölkerung während der deutschen Besatzungszeit [in Polen; Anm. d. Verf. ] erfahren hatte“,16 waren mit der dominierenden Aufarbeitung der großen deutschen Schuld – insbesondere des Holocaust – nicht vereinbar. Aber blinde Flecken in einem historischen Narrativ müssen ans Licht gebracht werden. Das ist kein Relativieren der deutschen Schuld – ein solcher Versuch liegt mir ausgesprochen fern –, sondern ein Vervollständigen unseres Bildes von der unsäglichen Brutalität sowie dem breiten machtpolitischen und ideologischen Geflecht des Zweiten Weltkrieges, eines jeden Krieges! Vieles wiederholt sich gegenwärtig in neuem Gewand.
Das „vergessene Jahr“ manifestierte sich in Niederschlesien vor allem nach dem 8. Mai 1945. Im Zuge der Eroberung explodierte die Rache für den extrem gewaltsam geführten Krieg Deutschlands. Von schlimmsten Verbrechen an der Zivilbevölkerung berichteten Flüchtlinge aus der Stadt Striegau im Kreis Schweidnitz, etwa 25 km nördlich von Waldenburg gelegen.17 Ein Zeitzeuge beurteilt das Inferno Striegaus: „Das ist keine Vergeltung mehr, nicht einmal Rache. Das ist Massenmord, der durch nichts zu entschuldigen, durch nichts zu rechtfertigen ist. Auch nicht, wenn es erst Auschwitz gab und dann Breslau, erst Groß-Rosen und dann Striegau.“18 Einen tiefen Einblick in die Geschehnisse innerhalb der Stadt Waldenburg geben die sehr detaillierten Tagebuchaufzeichnungen eines führenden Beamten der Stadtverwaltung, Alfred Riebisch. Er hat seine zwischen 1945 und 1946 täglich aufgeschriebenen Notizen im Jahr 1967 als Dokumentation veröffentlicht.19 Die Stadt gehörte zu den letzten, die besetzt wurden. Überall fanden russische Siegesfeiern statt, schreibt Riebisch über den Einmarsch der Eroberer, und führten zu Exzessen. „Sie drangen in die Wohnungen ein, requirierten nach Belieben, erbrachen alle Türen und Behältnisse und vergewaltigten Frauen in großer Zahl.“ Viele Bürger Waldenburgs hissten die weiße Fahne, ihre Furcht war angeheizt durch die Berichte aus Striegau und anderen Orten. „Ich war der Erste in unserer Familie, der in ‚Altwasser‘ einen realen ‚T 34‘ mit Mongolen in der Deckung des Panzers und mit ‚Kalaschnikows‘ im Anschlag zu Gesicht bekam. Zum Glück lähmte der Schreck mich nicht, denn durch Nazipropaganda glaubte man zu wissen, alle Russen sind ‚Bestien‘. Vom ‚Altwassertal‘ bis aufs Bergschlößchen bin ich vorher und nachher nie so ‚gerast‘! Meine Eltern versteckten daraufhin meine Schwester und ein weiteres Mädchen im Kokskeller […].“20
Das bedeutende Schloß Fürstenstein im Norden der Stadt Waldenburg wurde zerstört. „Ganz besonders arg war es in der Seitendorfer Siedlung und am Fuchsberg. Dort befand sich ein russisches Gefangenenlager. Die befreiten Russen hausten schrecklich unter der deutschen Bevölkerung […]. Erschreckend hoch ist die Zahl der Selbstmorde. Aus Waldenburg werden nahezu 300 gemeldet.“21 Hart traf es auch den nahegelegenen Stadtteil Altwasser, so schildert es der Chronist: „Die betroffene Bevölkerung hatte in Kellern, auf Böden und sogar auf Dächern Schutz gesucht.“ Panische Angst machte sich breit. Viele flüchteten sich in den selbst gewählten Tod. Auch meine Großmutter wollte sich und ihre Kinder umbringen. Aus Verzweiflung. Bald darauf verschaffte mein Großvater seiner Tochter und ihrer Freundin eine Möglichkeit, mit einem Zug in den Westen zu flüchten – ohne zu wissen, wohin. In der Hoffnung auf Unversehrtheit, aber in vollkommener Unsicherheit über jedes Danach. Erst im Jahr 1947 fand sich die Familie wieder, bis dahin fehlte jegliches Lebenszeichen.
Die russischen Besatzer plündern fast alle Geschäfte der Innenstadt Waldenburgs. Zahlreiche Wohnungen, deren Bewohner überstürzt geflüchtet waren, werden beschlagnahmt, auch ganze Viertel und Straßenzüge räumen die Besatzer. Riebisch schildert, dass die Bevölkerung zum Teil ins Freie flieht, in die Wälder und dort übernachtet, was zu weiteren Plünderungen in den verlassenen Wohnungen führt. Nach diesen ersten Tagen der Verwüstungen herrschten „Angst, Lähmung und Nahrungsmangel“, so berichtet mein Onkel.22 Eine der wenigen Erzählungen in meiner Familie bestätigen die Beobachtungen von Riebisch: Auffallend sei das freundliche Verhalten der Russen gegenüber den Kindern, schreibt er. Um ein kleines Baby hatte meine Familie größte Angst – und sie staunten ungläubig, als die eindringenden Russen mit Gewehr im Anschlag freundlich das Kind anlächelten. Dankbarkeit inmitten eines Lebens voller Schrecken. Das menschliche Gesicht eines Feindes.
Für die russischen Besatzer und die von ihnen geförderte polnische Verwaltung war schon vor Kriegsende unstrittig, dass aus Niederschlesien eine Wojewodschaft Polens würde. Ende Mai 1945 (also noch vor dem Potsdamer Abkommen vom August 1945) erklärte der russische Kommandant erstmalig offiziell, dass Waldenburg polnisch werden soll und die Übernahme der Stadtverwaltung durch polnische Kräfte unmittelbar bevorstehe. Die Ankündigung war verbunden mit der klaren Aussage, dass es sich nicht um eine Besetzung handele, sondern eine Einverleibung in das polnische Staatsgebiet. Eindeutige Worte gefolgt von Taten, aber kaum jemand konnte und wollte solches glauben. Das Unvorstellbare durfte nicht sein. Nach den Gewaltexzessen der russischen Eroberer begann ein Prozess der „Polonisierung“, ohne dass die Bevölkerung Klarheit über ihre eigene Zukunft erhielt. Am 25. Mai 1945 wird der erste polnische Bürgermeister eingesetzt. Die polnische Sprache wird zur Amtssprache erklärt. Die Stadtverwaltung heißt jetzt: „Der Regierungsbeauftragte der Republik Polen für die Stadt Waldenburg“, die Stadt erhält den Namen Walbrzych . Die neuen polnischen Verwaltungskräfte waren weder orts- noch sachkundig, so dass die deutsche Verwaltung parallel bestehen blieb. Sie musste nach Weisung der Polen arbeiten.
Ein ganzes Jahr lang erfahren die Waldenburger nun Rechtlosigkeit und Gewalt, Diebstähle und Plünderungen, Hunger, Überfälle und Vergewaltigungen, Ermordungen. Räumungsbefehle schüren die Unsicherheiten. Immer noch begehen viele Menschen Selbstmord oder verhungern, versuchen erfolglos eine Flucht, kehren zurück in eine in Auflösung begriffene Stadt. Ab dem Sommer 1945 nehmen Polen nun täglich mehr Besitz von der Stadt Waldenburg, viele Hundert neue Bürger kommen Tag um Tag und müssen untergebracht werden. Mehrfach werden die Bewohner gezwungen, ihre Häuser und Wohnungen zu verlassen, ihr Hab und Gut wird konfisziert. Fremde ziehen in ihr bisheriges Zuhause ein. „Das Verfahren ist sehr einfach: polnische Miliz holt deutsche Familien aus ihrer Wohnung heraus und setzt die Polen hinein. Die deutschen Familien dürfen nichts mitnehmen, keine Möbel, keine Kleidung, keine Wäsche. Wo sie wieder ein Obdach finden, ist ihre Sache. So werden die Deutschen von einem Obdach ins andere getrieben, und die Polen kommen in eingerichtete Wohnungen.“ Die deutschen Kinder haben keinen Schulunterricht; eine erste Schule wird für die polnischen Kinder eingerichtet. Der Hunger greift weiter um sich, Versorgungen werden immer schwieriger, überall kommt es zu „wilden Vertreibungen“. Riebisch schreibt: „Und über allem prangt noch immer von allen Anschlagtafeln der Aufruf Stalins, in welchem er dem deutschen Volk seine Freundschaft versichert und erklärt, daß die Regierungen zwar wechseln, daß aber das deutsche Volk immer bestehen bleiben wird.“
Kommunisten unter der deutschen Bevölkerung arbeiten mit polnischen Genossen zusammen. Verrat macht sich breit. Wechselnde Gerüchte über die Potsdamer Konferenz und deren Folgen durchziehen die ohnehin aussichtslose Stimmung. In den Alltag sickert eine fremde Kultur. Zahlreiche Maßnahmen „[…] laufen darauf hinaus, die deutsche Bevölkerung zu unterdrücken, zu verfolgen, sie auszuhungern und zum Abwandern ohne Hab und Gut zu zwingen.“ Polnische Verwaltung und Führung bestehen parallel zur russischen Besatzungsmacht: „Polen und Russen scheinen sich im Großen und Ganzen nicht gut zu sein,“ berichtet Riebisch. Von Schießereien ist die Rede. Dem Walten der polnischen Kräfte gegenüber den Deutschen lassen die russischen Besatzer jedoch freien Lauf. Ruhrbergleute polnischer Abstammung werden nach Waldenburg umgesiedelt. Als „Re-Emigranten“ wurden sie bezeichnet.23 Die aus dem Osten angesiedelten Polen waren im Bergbau völlig unerfahren, die Betriebe sollten aber weitergeführt werden.
Direkt nach Unterzeichnung des Potsdamer Abkommens verschärft sich der Prozess der „Polonisierung“. Russische Besatzer und polnische Verwaltung sowie Miliz setzen die Beschlüsse zügig um und besiegeln die Verschiebung der Westgrenzen Polens mit ihrem offensiven Handeln. Ende August 1945 werden alle Häuser von der polnischen Verwaltung verstaatlicht. „In den Wohnungen der Deutschen ist immer Aufregung. Jeder sitzt dauernd ‚auf dem Sprung‘, möglichst alles angezogen. Laufend werden Wohnungen geräumt, Möbel requiriert.“ Am 3. September 1945 wird die polnische Währung Zloty eingeführt. Passierscheine für Ausreisende müssen jetzt in polnischer Sprache ausgestellt werden. Ab Ende September 1945 müssen alle Deutschen, auch Kinder, eine weiße Armbinde tragen. So sind sie auf der Straße schon von Weitem gut zu erkennen. Gegen Ende des Jahres 1945 verschärft sich der Druck noch einmal. Täglich stranden etwa tausend neue polnische Bürger in Waldenburg. Sie kommen nicht nur aus den Gebieten im Osten, die gemäß den Potsdamer Beschlüssen nun zur Sowjetunion gehören, sondern auch aus Zentralpolen. Wilde Eroberungen, Plünderungen greifen um sich. „Unter der deutschen Bevölkerung herrscht jetzt eine richtige Psychose. Viele wollen unter allen Umständen weg, andere wollen unbedingt hierbleiben.“ Doch wie sollte ein freiwilliges „Abwandern aus dieser Misere“ gelingen? Wohin sollte man gehen und wie?
In den deutschen Ostgebieten lebten die Menschen fast ein Jahr lang nicht nur in Angst, sondern auch in völliger Unsicherheit darüber, zu welchem Staat sie künftig zählen würden, ob sie überhaupt in ihrer Heimat würden bleiben dürfen und wenn ja: wo und wie. Informationen über die Verhandlungen der Siegermächte drangen nur spärlich durch, waren widersprüchlich und von Gerüchten und Falschmeldungen durchzogen. Viele klammerten sich an die Hoffnung, dass die Einverleibung in einen kommunistischen polnischen Staat nicht von Dauer sein würde. Man setzte auf Friedensverhandlungen. Vergeblich. Erst ein Jahr nach der Kapitulation – Anfang des Jahres 1946 – wird der Bevölkerung Schlesiens zunehmend klarer, dass sie endgültig ihr Land verlassen muss. Immer mehr schimmern die Folgen der politisch seit Langem ausgehandelten Zukunft Niederschlesiens durch den chaotischen Alltag der verängstigten und verunsicherten Menschen. Meldungen über eine endgültige Ausweisung der Deutschen verdichten sich, zugleich nehmen Gewalt und Rechtlosigkeit zu. Wenn die Verhältnisse derart weiter fortschreiten, sind Evakuierungen nicht mehr nötig, notiert Riebisch, „[…] denn Polen schafft die Ausrottung auf kaltem Wege, nämlich durch Aushungerung und Wegnahme der Wohnungen.“ Er schreibt: „Anfang Januar 1946 wird das Standrecht verhängt, um Überfälle einzudämmen, trotzdem reißen Diebstähle und Überfälle nicht ab. So ereignet sich am 5. Januar 1946 ein schwerer Überfall in Altwasser. Gerüchte aller Art verdichten sich. In Dittersbach herrscht ein regelrechtes Bandenunwesen. Viele Ältere können nur noch betteln.“ Und er fügt hinzu: „Es ist kein Wunder, daß Menschen jetzt ihren Verstand verlieren.“ Ende Februar 1946 werden durch den Rundfunk Einzelheiten über die kommende Aussiedlung bekanntgegeben. Die „große Austreibung“ läuft an, unter dem Namen Operation swallow . Für viele Menschen wird es Zeit, aus diesem Elend herauszukommen. Sie sind physisch und psychisch am Ende. Leise Gefühle der Erlösung mischen sich in den tief schmerzenden Verlust der Heimat.
Polnische Geistliche begleiten die „Neubürger“ und sollen ihnen, die ja ebenfalls (zum Teil) zwangsweise umgesiedelt wurden, ein Ankommen in diesem für sie völlig fremden Land Schlesien erleichtern. Riebisch berichtet, ein Pfarrer habe gesagt: „Dieses herrliche Land hat uns Gott geschenkt.“ Zugleich müssen die Waldenburger ihr geliebtes Land verlassen.
Meine Vorfahren waren bereits vor vielen Monaten aus ihrem eigenen Wohnhaus und dem Ausflugslokal Bergschlößchen in Altwasser herausgeworfen worden. Es war nicht die letzte Zwangsräumung gewesen. Dreimal, so berichtet mein Onkel, erlebte er einen solchen gewaltsamen Rausschmiss, der jeweils begann „[…] mit dem Erscheinen polnischer Miliz und den Befehlen: ‚Raus, raus – und das bleibt hier!‘ Gemeint waren Habseligkeiten, die den Milizen ‚gefielen‘ und nicht vorher schon ‚eingesammelt‘ worden waren.“24 Für die nun endgültige, „geordnete“ Räumung und Vertreibung wurde im April 1946 in der Schule Waldenburg-Altwasser ein Sammellager eingerichtet. Dort mussten bis zu zweitausend Menschen auf ihren Weitertransport warten. Die Schule lag am Fuß eines Hanges und in Sichtweite zum Bergschlößchen. Nach Häusern und Straßengruppen führte die polnische „Repatriierungs-Kommission“ – bestehend aus polnischen Verwaltungsbeamten und Milizsoldaten – die Bewohner ab. Sie mussten innerhalb weniger Stunden ihre Wohnungen verlassen. Offiziell durfte jeder so viel mitnehmen, wie er tragen konnte, sowie persönlichen Schmuck und Uhren. Sie besaßen ohnehin kaum noch etwas. Verboten waren z.B. Fotoapparate, Sparkassenbücher, Devisen, Versicherungspolicen und mehr als fünfhundert Reichsmark an Bargeld. Viele nähten sich wichtige Dokumente in die Kleidung ein, oft ohne Erfolg.
Das Evakuierungslager wurde geleitet von Alfred Riebisch. Mitarbeiter der Verwaltung übernahmen die Registrierung, stellten die Transporte zusammen. Sie übergaben einem Transportleiter die Personenliste für jeden Zug. Soweit möglich, wurde den Menschen etwas Verpflegung mitgegeben. „Die Leute werden in Waggongruppen eingeteilt, die geschlossen in den einzelnen Klassenräumen untergebracht werden […]. Die Überfüllung bringt auch eine große Verschmutzung mit sich […]. Das Gepäck wird gewöhnlich streng kontrolliert. […] Verbotenes Geld und Sparkassenbücher werden konfisziert.“ Auch andere Gegenstände wurden bei mehreren Kontrollen aus dem wenigen Hab und Gut weggenommen – Wäsche, wichtige Dokumente und wertvolle Erinnerungsstücke.
Am 1. Mai 1946 verließ der erste Transport den Bahnhof Altwasser in Waldenburg, an jedem Tag fuhren Züge mit ca. 1500 Personen, der letzte am 13. Juni 1946. Gut vierzig Viehwaggons umfasste ein Zug, jeder gefüllt mit jeweils dreißig bis vierzig Menschen. Ein Zeitzeuge erzählt: „In verschiedenen Wagen wurde das Lied angestimmt: ‚Wir sehen uns wieder, mein Schlesierland!‘.“25 Ein anderer, damals dreizehn Jahre alt, erinnert sich: „Wir waren fest davon überzeugt, unsere Heimat bald wiederzusehen und unser von den Polen gestohlenes Eigentum wiederzubekommen.“26 Es herrschte Druck. Der Strom polnischer Umsiedler, „Repatrianten“, aus dem Osten schuf Fakten. Die Sowjetunion wollte zügig ihren Machtbereich sichern und in Polen ein kommunistisches System etablieren. Immer schneller wurden die Waldenburger aus ihren Wohnungen geworfen und abtransportiert. Die Kette der Bevölkerungsverschiebungen endete in den Auffanglagern im Westen. Hier stauten sich die Deportierten. „Nun gibt es nicht nur Hunger und Not, sondern auch noch die Krätze.“ In diesen sieben Wochen wurden insgesamt etwa 70.000 Menschen aus der Stadt und dem Landkreis Waldenburg deportiert. Nach britischen Schätzungen waren bis zum Ende der Aktion 1946/47 ca. 1,5 Mill. Deutsche von der Zwangsaussiedlung betroffen.27 Nicht jeder musste – oder durfte – gehen. Die polnische Verwaltung hielt Menschen zurück, die als Arbeitskräfte in Bergbau und Industrie oder zur Herstellung einer öffentlichen Ordnung und Versorgung dringend gebraucht wurden. Dazu gehörten Verwandte und Bekannte meiner Großeltern – darunter ein Arzt und enger Freund: Dr. Theo Langer. Er war Vorsitzender des Schützenvereins Waldenburg- Altwasser. Über ein Jahrzehnt später wird einer der Zurückgebliebenen zum Held einer kleinen Gemeinschaft Vertriebener aus Altwasser: Herbert Tschirner. Als Bergmann musste er in Waldenburg bleiben und durfte wie zahlreiche andere Schlesier als „Spätaussiedler“ erst viele Jahre später das für ihn fremde Land Polen verlassen.
Die Menschen in Schlesien hatten ein Lebensjahr hinter sich, in dem sie keinen auch noch so kleinen Aufbruch in eine mögliche Zukunft in Freiheit erfuhren – wie in den westlichen Besatzungszonen. Im Gegenteil: Sie durchlitten den gewaltsamen Anfang eines unumkehrbaren Untergangs ihres Landes und ihrer Kultur. Auch anders als die Bewohner der sowjetischen Besatzungszone, der späteren DDR, hatten sie allenfalls die Aussicht auf ein Leben in doppelter Fremde: nicht nur in einem kommunistischen Staat, sondern zugleich als Minderheit in einer fremden – polnischen – Kultur. Die Menschen fühlten sich „wie in einem großen Gefangenenlager“, schrieb Riebisch. Ihre Vertreibung schuf eine Endgültigkeit, die erst Jahrzehnte später als neue Realität begriffen werden konnte.
Wer schon vor vielen Monaten geflohen war, machte andere Erfahrungen. So hat meine Mutter all das nicht erlebt. Nach ihrer Flucht 1945 hatte sie Arbeit und Unterkunft gefunden auf einem Hof in Mesmerode, in der Gemeinde Wunstorf am Steinhuder Meer, Niedersachsen. In diesem „vergessenen Jahr“ lebte sie in einem landwirtschaftlichen Betrieb bei Menschen, die sie den Umständen entsprechend gut aufnahmen. Mit der Familie stand sie noch im hohen Alter in einem freundlichen Briefkontakt. Sie und ihre Freundin waren mit dem Leben davongekommen. Das Schicksal ihrer Familien in Waldenburg-Altwasser konnten sie nur erahnen, eine Kontaktaufnahme war nicht möglich. „Die Flucht meiner Schwester nach dem ‚Zusammenbruch‘ mit ihrer besten Freundin war für meine Eltern eine Dauerangst, bis wir 1947 ein Lebenszeichen aus dem ‚Hannoverschen‘ von ihr erhielten.“28 Die Arbeit in der Landwirtschaft entsprach ihren Neigungen, in ihrer Heimat hatte sie als junge Frau erste Schritte getan, um ihren Lebenstraum zu erfüllen. Obwohl sie aus der Stadt kam, zog es sie in ein Leben auf dem Land inmitten vieler Tiere, sie hatte eine Lehre auf einem Gut begonnen. Erst 1947, zwei Jahre nach ihrer Flucht aus Waldenburg, siedelte sie ins Siegerland – ohne zu ahnen, dass sie hier in der Landwirtschaft keine Zukunft finden würde. Das Zusammenkommen der versprengten Familie war in dieser Zeit oberstes Ziel und Basis der Hoffnung. Nun galt es, sich in Kreuztal irgendwie zurechtzufinden. Wohl kaum einer der neuen Nachbarn wusste um das Erlebte der Vertriebenen im „vergessenen Jahr“. Wollten sie es wissen?
Machtpolitik und Nationalsozialismus: Zerstörung und Neuordnung Europas
Welche politischen Ereignisse und Intentionen verbargen sich hinter all diesen Wirren? Die Bevölkerungsverschiebungen hatten eine sehr lange Vorgeschichte und betrafen den gesamten Osten Europas. Neben der Wiederherstellung eines polnischen Staates ging es ebenso um die Ausdehnung der kommunistischen Einflusssphäre Russlands nach Westen – mit einer Vergrößerung der ukrainischen Sowjetrepublik – und um die Ideologie einer „ethnischen Reinheit“ von Staatsvölkern.
Polen als Staatsgebilde – in der Frühen Neuzeit das größte in Europa – hat über Jahrhunderte hinweg eine äußert wechselhafte und leidvolle Geschichte erfahren müssen.29 In drei Schritten teilten sich die Mächte Preußen, Russland und Österreich im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts das ehemals polnisch-litauische Staatsgebiet untereinander auf: 1772 (1. Teilung), 1793 (2. Teilung) und 1795 (3. Teilung). Im Zuge des Wiener Kongresses (1815) entstand ein konstitutionelles Königreich Polen, das als „Kongreßpolen“ bezeichnet wird. Durch eine Personalunion mit dem Russischen Zarenreich schwanden die Rechte als eigenständiger Staat, so dass dieses Gebiet seit den späten 1860er Jahren als „Russisch-Polen“ oder „Weichselland“ in die Geschichte einging.
Abb. 3: Die drei Teilungen Polens. Das Staatsgebiet von 1772, zu dem Nieder- und Oberschlesien nicht gehörten, diente dem neuen Staat Polen nach dem Zweiten Weltkrieg als Referenz.30
Bei Eintritt in den Ersten Weltkrieg hatten die USA klargemacht, dass zu ihren Kriegszielen auch die Schaffung eines unabhängigen neuen Staates Polen gehört mit einem Zugang zur Ostsee. Federführend bei den Verhandlungen über neue Grenzen war der britische Außenminister Lord Curzon; die im Versailler Vertrag31 vereinbarte Grenze nach Osten wird seitdem die „Curzon-Linie“ genannt. Die ehemaligen preußischen Provinzen Westpreußen und Posen musste die junge Weimarer Republik abgeben. Der neue Staat Polen erlangte am 11. November 1918 seine Souveränität mit dem Ausrufen der „Zweiten Polnischen Republik“.
Während im Westen Europas die Waffen schwiegen und der Versailler Vertrag dem Ersten Weltkrieg ein Ende setzte, fanden im Osten die Kampfhandlungen bis 1921 eine vernichtungsvolle Fortführung. Nach der russischen Oktoberrevolution 1917 hatte der Zar abgedankt, das riesige Reich war in Auflösung. In der heutigen Ukraine entstand 1918 eine unabhängige Volksrepublik. Das Land wurde in den folgenden Jahren zum Hauptschauplatz des russischen Bürgerkrieges sowie des polnisch-sowjetischen Krieges von 1919 bis 1921.32 Der polnische Staat orientierte sich an den historischen Grenzen von 1772, also jenseits der Curzon-Linie, und betrachtete Teile der Westukraine (Galizien, Wolhynien) als sein eigenes Gebiet. Die Bolschewisten dagegen strebten nach Westen; sie verfolgten das Ziel einer Herrschaft über die gesamte Ukraine. Die heftigen Kriegshandlungen waren bestimmt von Streitigkeiten um die Staatenbildungen, um Grenzziehungen, aber auch um ethnische Vorherrschaft und um eine Etablierung des Kommunismus. Zum Nationalheld Polens wurde Marschall Jozef Pilsudski; ihm gelang es nicht nur, die wiedererlangte staatliche Souveränität gegen eine russische Vereinnahmung zu verteidigen, sondern zugleich Gebiete des polnischen Territoriums vor der 1. Teilung von 1772 einzunehmen. Im „Wunder an der Weichsel“ wurde die Rote Armee, die bis Warschau vorgedrungen war, bis etwa 250 km östlich der Curzon-Linie zurückgedrängt. Große Teile der westlichen Ukraine und von Weißrussland nahm die polnische Armee ein. Der Friedensvertrag von Riga am 18. März 1921 bestätigte diese Gebietsgewinne, doch der Friede war brüchig und „stellte in jeder Hinsicht eine gigantische Hypothek dar.“33