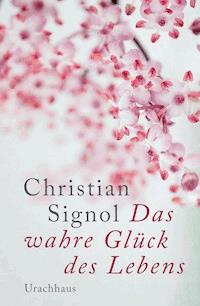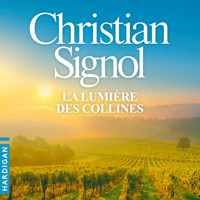Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Urachhaus
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Als der Bootsbauer Virgile und seine Frau Victoria im Mai 1942 gebeten werden, Flüchtlingen über den Fluss zu helfen, verändert sich das Leben des kinderlosen Paares von einem Tag auf den anderen. Sie nehmen die zehnjährige Sarah und den gleichaltrigen Élie bei sich auf und verstecken sie – vor den Deutschen wie vor den kollaborierenden Landsleuten. Christian Signol hat mit der ihm eigenen Eindringlichkeit den einfachen Menschen im Kampf gegen das Übel des Zweiten Weltkriegs ein Denkmal gesetzt. Einfühlsam und bewegend beschreibt er die Nöte und den herausragenden Mut des Paares Victoria und Virgile, die aus der ihnen begegnenden Not erkennen, dass es nur einen Weg für sie gibt: Sie müssen handeln!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 273
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christian Signol
Die Kinder der Gerechten
Aus dem Französischen von Corinna Tramm-Berger
Inhalt
Vorwort
Erster Teil
Eins
Zwei
Drei
Vier
Zweiter Teil
Fünf
Sechs
Sieben
Dritter Teil
Acht
Neun
Zehn
Elf
Epilog
Impressum
Weitere Bücher
Vorwort
Präsident Francois Hollande bezeichnete im Jahre 2012 die Gefangennahme, Internierung und Deportation der Juden als »Verbrechen, das in Frankreich von Frankreich verübt wurde«. Mir wäre die Formulierung »vom französischen Staat« lieber gewesen, der in der Tat all dieser abscheulichen Verbrechen schuldig ist, in keiner Weise aber mit dem Frankreich zu jener Zeit gleichgesetzt werden kann. Ich war zutiefst verletzt, ebenso wie ich von den Worten Jacques Chiracs 1995 verletzt war. Nicht meinetwegen, aber im Hinblick auf meine Eltern und Großeltern. Mein Vater engagierte sich während des gesamten Krieges gegen die Nazis, war als Fahnenflüchtiger bei der STO, dem »Pflichtarbeitsdienst«, da er nicht für Hitler arbeiten wollte, und später im Widerstand der Gruppen Veny, im Netz Buckmaster auf dem Kalksteinplateau des Lot. Meine Großeltern, die eine Bäckerei hatten, teilten an alle Flüchtlinge Brot aus: an Spanier, Juden, die Gestrandeten des Exodus. In meinem Heimatdorf wurde nicht ein Einziger denunziert.
Mein Frankreich trägt keine Schuld. Die Helden dieses Romans, an dem mir so viel liegt, Virgile und Victoria, ebenfalls nicht. Sie ähneln in vielem meinen Großeltern. Nicht äußerlich, sondern in ihrer natürlichen Güte und Vorurteilslosigkeit gegenüber wem auch immer und in ihrer Weigerung, das Unglück als gegeben hinzunehmen. Mein Frankreich ist das des Widerstands gegen die Barbarei der Nazis und das der großzügigen Menschlichkeit. Es ist das Frankreich der Demut, der Stille und des Mutes. Auf dieses Frankreich bin ich stolz und fühle mich als wachsamer Hüter der Erinnerung, auch wenn es weder ein Gesetz zum Gedenken noch eines zur Reue gibt.
Christian Signol
März 2012
Erster Teil
Eins
Die Mainacht roch nach Flieder und jungen Blättern, die sanft vom Wind gestreichelt wurden. Ein Mond aus Zucker beleuchtete den Weg, der geradeaus zwischen zwei Rosenhecken zum Fluss führte. Virgile hatte keine Angst. Doch er war ungeduldig, da er wissen wollte, was sich auf der anderen Seite befand. Er liebte die Nacht, sie war ihm vertraut und hatte für ihn nichts Bedrohliches. Im Gegenteil: Diese Welt ohne Menschen, wie unberührt, schien ihn zu seinen Ursprüngen zurückzuführen, sie war von jeglicher Gefahr reingewaschen, versunken im Frieden eines Lebens, das er in jeder Sekunde genießen wollte.
Ohne Eile ging er den Pfad entlang und erinnerte sich an den Abend der vorangegangenen Woche, als er gegen sieben Uhr nach Hause gekommen war und das Auto im Hof erblickt hatte. Sein Herz schlug schneller, als er den Wagen des Arztes erkannte. Er hätte ihn unter allen wiedererkannt, denn Dr.Dujaric war der Einzige, der so ein Auto besaß. Trotz der Hitze zu dieser Zeit Ende Mai, die schon die ersten Anzeichen des Sommers ankündigte, hatte Virgile seinen Schritt beschleunigt und sich über die Stirn gewischt. Als er gegen vier Uhr nachmittags weggegangen war, hatte sich seine Frau Victoria über nichts beklagt und keine Anzeichen gezeigt, ihn zurückhalten zu wollen. Doch vielleicht hatte sie sich aufgrund dieser ersten Hitze, die in diesen Tagen in den üppig wachsenden Bäumen und Wiesen festzuhängen schien, nicht wohlgefühlt.
Krank war Victoria niemals gewesen. Nichts konnte sie davon abhalten, so schien es ihm, morgens als Erste aufzustehen, sich um das Federvieh und den Garten zu kümmern und ihm in seiner Werkstatt zu helfen. Wenn es nötig wäre, würde sie sämtliche Tätigkeiten im Haus klaglos erledigen und alles mit dieser ihr eigenen positiven Energie angehen, die sie nie zu verlieren schien. Und dennoch wusste Virgile, dass sie in sich eine Wunde trug: Sie war zweiundvierzig Jahre alt und hatte bis jetzt keine Kinder bekommen können. Er hatte oft versucht, sie zu trösten, doch seine Worte konnten die Wunde nicht lindern, an der sie still litt. Und davon war er überzeugt: Es war wie eine offene Wunde.
Doch all dies war keine Erklärung für den Wagen des Arztes im Hof. Wieder spürte er, wie sein Herz schneller schlug. Und doch verlangsamte er seinen Schritt nicht und erreichte bald das Haus.
Mit Schwung öffnete er die Tür und hielt stumm inne, da er seine Frau ruhig an der einen Seite des Tisches sitzen sah und ihr gegenüber den Arzt, der sich bei seinem Anblick erhob.
»Komm schnell herein!«, sagte Victoria. »Du lässt uns in der Sonne braten!«
Virgile ging einen Schritt nach vorn, drückte dem Arzt die Hand und ließ sich erleichtert auf einen Stuhl fallen. Mit einem Kopfnicken deutete er einen Gruß an.
»Ihr habt mir Angst eingejagt.«
»Angst? Warum?«, fragte Victoria.
»Ich habe den Wagen gesehen und mich gefragt, was nicht in Ordnung ist. Ich dachte, du fühlst dich vielleicht nicht wohl.«
Victoria zuckte mit den Schultern, während der Arzt, ein Koloss mit einem Bürstenschnitt und großen hellen Augen, ihn ruhig ansah.
»Entschuldigen Sie. Sie haben recht, es ist nicht die übliche Zeit für einen Besuch bei Ihnen.« Dann fügte er hinzu: »Eigentlich habe ich Sie gesucht.«
»Aha?«
Virgile stellte keine weitere Frage, da Geduld die erste seiner Tugenden war. Neugierde war ihm ganz und gar fremd.
»Es geht um die Demarkationslinie«, fuhr der Arzt fort. »Sie haben doch eine Werkstatt ganz in der Nähe, nicht wahr?«
»Ja, genau.«
»Und einen Kahn am Ufer.«
»Ja, einen Kahn auch.«
Der Arzt schien nachzudenken, zögerte einige Sekunden, dann entschloss er sich, endlich fortzufahren.
»Also, ich habe gedacht, Sie würden mir vielleicht gern einen Gefallen tun, indem Sie ein paar Leuten helfen, die Demarkationslinie zu überqueren.«
Erstaunt schaute Virgile Victoria mit fragendem Blick an: Offensichtlich war sie bereits über das Vorhaben informiert, denn sie zeigte keinerlei Regung.
»Ich bin mir dessen bewusst«, sprach Dr.Dujaric weiter, »dass das gefährlich werden kann. Aber außer euch beiden gibt es niemanden, dem ich vertraue.«
Virgile wusste nicht, was er antworten sollte, da die Worte des Arztes nur langsam zu ihm durchdrangen.
»Man müsste sie bis nach Saint-Martial bringen. Dort würde jemand warten, der sich weiter um sie kümmert.«
»Aber um wen handelt es sich?«, brachte Virgile endlich heraus, als er die Sprache wiedergefunden hatte.
»Leute, die von der besetzten in die freie Zone gelangen müssen. Und glauben Sie mir, von denen gibt es viele.« Der Arzt begriff, dass er diesem Mann und dieser Frau, die er seit Jahren kannte und schätzte, ein bisschen Zeit geben musste, um sich an den Gedanken zu gewöhnen, illegale Schleuser zu werden. Schweigend beobachtete er sie. Victoria war dunkel, kräftig, mit dicken Haaren und tiefschwarzen Augen. Virgile war ebenfalls von kräftiger Statur, dabei aber eher rundlich. Er hatte fast eine Glatze, helle Augen, und sein Gesicht drückte die ganze Güte der Welt aus. Er strahlte eine tiefe Treuherzigkeit aus, die sicher auf seine Kindheit zurückzuführen war. Er besaß ein Grundvertrauen, das selbst der Krieg und die vielen Schwierigkeiten jener Zeit nicht hatten ins Wanken bringen können. »Nun?«, fragte der Arzt. »Was sagen Sie dazu?«
»Ich weiß nicht, ob ich das kann«, erwiderte Virgile.
»Was sagst du da?«, rief Victoria. »Es wäre nicht das erste Mal, dass du nachts mit dem Boot rausfährst. Du hast mir damit schon einige Sorgen bereitet.«
Virgile betrachtete beide eine Weile wortlos, dann seufzte er leise.
»Nun gut, wenn es denn sein muss.«
»Recht so!«, freute sich der Arzt und drückte Virgiles Hand. »Ich danke Ihnen.« Und an Victoria gewandt: »Ihnen auch, Victoria. Ich wusste, dass ich auf Sie zählen kann.«
Der Arzt trank sein Glas Nusslikör aus, bedankte sich noch einmal und erhob sich.
»Ich werde Sie einen Tag vorher benachrichtigen und Ihnen alle notwendigen Informationen geben. Sie werden sehen, es wird nicht kompliziert sein, schon gar nicht für jemanden, der den Fluss so gut kennt wie Sie.«
Er drückte Ihnen ein zweites Mal die Hand und eilte zu seinem Auto, das bald darauf mit lautem Geknatter am Ende des Weges verschwand. Virgile und Victoria standen sich gegenüber, eine ganze Weile unfähig, auch nur ein Wort zu sprechen. Dann brach Victoria das Schweigen.
»Das ist doch keine große Sache!« Der unbeteiligt klingende Ton, den sie offensichtlich anschlagen wollte, gelang ihr nicht vollkommen.
Virgile antwortete nicht. Er trat an das steinerne Spülbecken, goss ein wenig Wasser über seine Hände und warf es sich ins Gesicht. Er konnte die Freude nicht verbergen, die ihn angesichts der Aussicht auf einige zusätzliche Nächte auf dem Fluss überkam.
Acht Tage später kam der Arzt wieder und gab ihm die Anweisungen für die erste nächtliche Überfahrt: eine geheime Parole, die Zeit, die Anzahl der Leute und den Zielort. Virgile ließ sich all diese Informationen durch den Kopf gehen, ohne sich jedoch besonders von ihnen beunruhigen zu lassen: Er wusste, dass er sich auf Victoria verlassen konnte. Er widmete sich ganz seinem Vergnügen, die Nähe des Flusses zu spüren, dessen Pappeln er am Ufer in der Ferne erblickte. Ihre höchsten Blätter schimmerten im Mondlicht.
Er hatte keine Angst. Nein, nicht die geringste Furcht spürte er, bloß eine gewisse ungeduldige Erwartung, endlich wieder auf diesem Fluss zu fahren, den er so sehr liebte und auf dem er wegen seiner Arbeit, wenn es nach ihm ging, gar nicht oft genug sein konnte. Hinzu kam, dass Victoria Fische verabscheute. Er musste sie an die Nachbarn verschenken, und Angeln bedeutete in ihren Augen nichts als verlorene Zeit – Zeit, die Virgile zum Leidwesen seiner Frau und seiner Kunden, die oft lange auf ihre Bestellungen warten mussten, trotz seiner Bemühungen überhaupt nicht im Griff hatte.
Dieser Gedanke ärgerte ihn, er zuckte mit den Schultern und näherte sich der Stelle am Ufer, an der sein Kahn an einer Erle festgemacht war. Ehe er das Seil entknotete, lauschte er einen Moment lang. Alle seine Sinne waren geschärft, doch vom gegenüberliegenden Ufer kam nichts – nicht das leiseste Geräusch noch die kleinste Bewegung, nur das Rauschen der Eschen und Pappeln war zu hören. Der Wasserstand war nicht hoch: Es war lange her, dass die winterlichen Regenfälle zum über fünfhundert Kilometer entfernten Meer geflossen waren. Der Wasserstand war sogar so niedrig, dass die Gefahr bestand, zwischen zwei Sandbänken auf Grund zu laufen. Doch Virgile kannte die schmale Fahrrinne, die es den Schiffern ermöglichte, unbeschadet voranzukommen. Sie verlief in einer bestimmten Achse der Hauptströmung, die jetzt zu Beginn des Sommers nicht stark war.
Er stieg in den Kahn, griff nach dem Ruder und lauschte noch einmal einen Augenblick lang, während er sich mit einer Hand an einem Ast der Erle festhielt, um noch einen Moment länger am Ufer zu bleiben. Dann stützte er das äußerste Ende des Ruders gegen die ein Meter hohe Uferböschung, ließ den Ast los und stieß sich mit einer kräftigen Bewegung ab. Der Kahn entfernte sich mit dem Bug voran flussaufwärts, zunächst schnell, dann, ein wenig weiter weg, etwas langsamer, sobald er sich der Strömung gegenüber befand. Virgile war ganz seinen vertrauten Empfindungen hingegeben: Gleichzeitig nahm er das Wasser, die Bäume, den Mond und die Sterne wahr, die sich über das Tal zu ergießen schienen, und einen Moment lang vergaß er den Grund dafür, dass er sich nachts um zwei Uhr auf dem Fluss befand. Dann brachte ihn der Schatten einer Gestalt dort hinten auf der anderen Seite wieder zu seinem Auftrag zurück. Sie befand sich zwischen zwei Bäumen und hob sich im bleichen Mondlicht für einen kurzen Moment vor dem dunklen Hintergrund ab.
Der Arzt hatte gesagt: »Die deutsche Patrouille kommt gegen drei Uhr vorbei. Sie haben genug Zeit, selbst wenn die andere Seite sich verspätet. Wenn das so sein sollte, können Sie warten, aber nicht länger als eine Viertelstunde. Das müsste für alle als Sicherheitsspielraum genügen.«
Virgile musste sich also nicht beeilen. Doch je näher sich der Kahn auf das andere Ufer zubewegte, desto schneller spürte er sein Herz schlagen. Er war jetzt nur noch zehn Meter entfernt. Wieder bewegte sich eine Gestalt – zweifellos die eines Mannes. Jetzt hatte Virgile den Eindruck, als tauche eine zweite hinter der ersten auf, und das alarmierte ihn: Es war nur von einer Person die Rede gewesen. Er dachte an eine Falle, doch er war bereits zu nah, um umzukehren. Mit einem Ruderschlag drehte er den Kahn mit dem Bug zum Ufer, legte sanft zwischen einer Pappel und einer Esche an, die er am Vorabend entdeckt hatte, und wartete einige Sekunden. Das Ruder steckte im Sand – bereit, bei der kleinsten verdächtigen Bewegung zurückzuweichen. Dann näherte sich die Gestalt und sagte mit unsicherer Stimme: »Morgen, bei Tagesanbruch …«
Der Arzt hatte Virgile erklärt, dass diese drei Wörter aus einem Gedicht von Victor Hugo stammten: Morgen, bei Tagesanbruch, um die Stunde, wenn das Land hell wird …
Wie verabredet erwiderte Virgile: »… werde ich aufbrechen.«
Dann sagte er sofort: »Steigen Sie ein! Und setzen Sie sich mir gegenüber!«
Der Mann setzte einen Fuß ungeschickt an der äußersten Stelle des Kahns auf, sodass Virgile glaubte, es sei ein Mann aus der Stadt, dann ließ er das Boot ebenso ungeschickt schaukeln. Dennoch gelang es ihm nach einiger Zeit, sich hinzusetzen. Sofort stützte sich Virgile auf das Ruder und entfernte den Kahn vom Ufer.
»Danke!«, sagte der Mann, dessen breite Schultern imposant wirkten und der sehr aufgeregt schien.
»Machen Sie sich keine Sorgen. Es dauert nicht lange.«
Tatsächlich brauchten Sie nicht länger als fünf Minuten, um den Fluss zu überqueren und genau an der Stelle anzulegen, von der aus er losgefahren war. Er hatte den Kahn so gelenkt, dass er selber näher am Ufer war und als Erster den Fuß an Land setzte, denn er vertraute seinem Passagier nicht. Sobald er festen Boden unter den Füßen hatte, streckte er dem Mann die Hand entgegen und half ihm beim Aussteigen.
»Danke!«, wiederholte dieser und behielt die ausgestreckte Hand einen Moment lang in seiner Hand.
Virgile antwortete nicht. Der Arzt hatte ihm empfohlen, nicht zu viel zu reden. Auch hatte er darauf bestanden, dass es besser wäre, so wenig wie möglich zu wissen, für den Fall, dass es schlecht ausginge. Virgile hatte nicht recht verstanden, was er damit sagen wollte, doch er hatte nicht gewagt, Victoria um eine Erklärung zu bitten. Er vertäute das Seil und drehte sich um.
»Kommen Sie!«, sagte er einfach.
»Müssen wir weit laufen?«, fragte der Mann.
»Nicht einmal einen Kilometer.«
Virgile lief los und dachte an das, was der Arzt dargelegt hatte: »Es ist ein Gefangener, der aus Deutschland geflohen ist. Gehen Sie langsam, er ist erschöpft, aber nehmen Sie ihn nicht bei sich auf, es ist zu nah an der Demarkationslinie. Bringen Sie ihn nach Saint-Martial. Dort wird er den Rest der Nacht und den nächsten Tag bleiben. Erst in der folgenden Nacht wird er wieder aufbrechen.«
Virgile blieb stehen.
»Geht es?«
»Ja«, sagte der Mann, dessen schnelle Atmung seiner Antwort widersprach.
»Sie werden sich bald ausruhen können.«
Und Virgile machte sich wieder auf den Weg. Er achtete darauf, nicht zu schnell zu gehen, auch wenn die Furcht vor einer Patrouille ihn dazu antrieb, so bald wie möglich heimzukommen.
Mit all ihren Sinnen war Victoria auf der Lauer, an Schlaf war nicht zu denken. Sie war noch einmal aufgestanden und überwachte jetzt von ihrem Fenster aus den Weg, auf dem Virgile vor einer halben Stunde fortgegangen war. Sie machte sich Vorwürfe, diesen Auftrag für ihn angenommen zu haben, da sie doch wusste, wie unfähig ihr Mann war, auch nur der geringsten unvorhergesehenen Situation die Stirn zu bieten. Seit jeher vertraute er auf sie – eigentlich seit sie verheiratet waren. Aber es war vor allem eine Eigenart, die sie von ihrer ersten Begegnung an an ihn gebunden hatte: diese Fähigkeit, nirgendwo etwas Böses zu sehen, es sich in jedem Moment seines Lebens gut gehen zu lassen und ohne Weiteres jedem Menschen zu vertrauen. Und all dies mit einer Unschuld, ja Leichtsinnigkeit, die sie ganz verrückt machte, sobald er sein Universum verließ, auch wenn er nur mit dem Fahrrad nach Monestier auf der anderen Seite der Brücke fuhr, von wo er ihrer Meinung nach immer zu spät zurückkehrte.
Seit dem Waffenstillstand fuhr Virgile zum Glück nicht mehr dorthin, denn ihr Haus befand sich in der freien, das Dorf dagegen war in der besetzten Zone. Lange hatte Victoria insistiert, Virgile solle seine Werkstatt vom Fluss zum Haus hin verlegen, doch hatte er sich immer geweigert. Er rechtfertigte sich damit, dass diese Werkstatt von seinem Vater, von Beruf Tischler wie er selbst, gebaut worden war und er sie unmöglich abreißen könnte. Das war die einzige Verweigerung, die er ihr gegenüber durchgesetzt hatte. Eine Verweigerung, die ihm gleichzeitig eine für ihn wichtige Freiheit garantierte, auch wenn er dies niemals ausnutzte, wie sie zugeben musste.
Es war also Victoria, die im Dorf einkaufen ging, die die Straßensperre mit der Interzonenkarte der Grenzbewohner passierte. Zunächst kam der französische Posten, dann, nach etwa sechzig Metern, der Schlagbaum und das deutsche Wächterhäuschen. In diesem Mai 1941 war ihre anfängliche Furcht verschwunden, zumal sich seit April die Ausstellung der Passierscheine vereinfacht hatte und das Kommen und Gehen vom Land in den Ort wieder regelmäßiger stattfand.
Etwas bewegte sich in der Ferne bei der Hecke, doch es war nicht Virgiles Gestalt. Sie hätte ihn in der dunkelsten Nacht wiedererkannt, so vertraut war er ihr in der Art und Weise, wie er sich bewegte, wie er ein wenig auf den Zehenspitzen ging und die Arme leicht vom Körper abspreizte, genauso wie damals, als sie ihm in ihrer Jugend bei einem Fest in Monestier begegnet war: Ende August hatte unter den Lampions der Ball stattgefunden, nachdem man nach dem Blutbad des großen Krieges so lange darauf gewartet hatte, dass man sie wieder anzünden konnte. Sie hatte sich oft gefragt, wie sie mit diesem so schüchternen Mann hatte tanzen können, der sie angelächelt hatte, ohne sich zu trauen, sie aufzufordern, sodass sie sich als Erste erhoben und ihm eine Hand gereicht hatte, die er ergriffen und niemals mehr losgelassen hatte.
Ein Jahr später hatten sie bei ihr zu Hause in Labarrère geheiratet, einem Weiler zehn Kilometer von Monestier entfernt. Dort hatte sie als drittes von sieben Kindern ihren Eltern – Pachtbauern eines winzig kleinen Gutes von zehn Hektar – geholfen. Dann war sie zu Virgile in sein Haus mit dem Namen Sauvénie gezogen, weniger als zwei Kilometer von Monestier entfernt. Vor allem war es das Haus von Virgiles Vater. Die beiden Männer lebten allein, die Mutter war bei Virgiles Geburt gestorben. Sie waren Schreiner, da sie von ihrem Besitz nicht leben konnten: eine Wiese und ein kleines Feld, das an den Hof und einen Gemüsegarten grenzte. Die Wiese am Flussufer ermöglichte es ihnen, im Juni Heu zu ernten und eine Kuh zu besitzen, die sie in einem kleinen Stall gegenüber vom Haus liebevoll versorgten. Die Anwesenheit einer Frau hatte dieses Haus abseits der Welt sogleich erhellt.
Virgiles Vater Jean, der von allen aus dem Dorf nur Jeantillou genannt wurde, war ebenso liebenswert wie sein Sohn: ein sehr nachgiebiger Mann, der sich über jede Kleinigkeit freuen konnte und in der Lage war, sich beim Verfolgen eines Vogels zu verirren. Er vergaß die Aufträge für Möbel, Türen und Fenster, doch die Kunden wurden seiner nicht überdrüssig, so unmöglich war es, so einem Mann böse zu sein. Wenn er sich auf seine gutherzige Art entschuldigte, verwirrte es einen. Er war ebenso entwaffnend wie Virgile, dieser Sohn, dessen Geburt den Tod seiner geliebten Frau verursacht hatte.
Jean hatte eine Cousine gebeten, ihm in den ersten Monaten zu helfen, dann hatte er diesen Jungen, der ihm wie ein zwanzig Jahre jüngerer Zwilling ähnelte, allein aufgezogen. Er hatte ihn den Beruf des Schreiners gelehrt, und jeden Tag waren sie den Weg zur Werkstatt am Flussufer gegangen, wo sie mehr angelten als arbeiteten und niemals genug Geld verdienten, da Jean Schwierigkeiten hatte, seinen Lohn für die Schreineraufträge einzufordern. Viele in der Gegend hatten das begriffen und nutzten es aus, doch letztendlich bezahlten sie irgendwann im Verlauf von zwei bis drei Jahren ihre Schulden, da sie diesem Mann, der nicht fähig war, eine Rechnung auszustellen und seinen Kunden zu bringen, immer wieder begegneten.
Zum Glück hatte Victoria diese Situation geregelt, die die beiden ansonsten in unüberwindbare Schwierigkeiten gebracht hätte. Und eines Tages, als sie für Jean Papiere ausfüllte, hatte sie ihn gefragt, als hätte sie sich zum ersten Mal diese Frage gestellt: »Warum haben Sie Ihren Sohn Virgile genannt?«
»Der Vater meiner Frau hieß so«, hatte Jean verlegen geantwortet. »Ich habe nicht lang nachgedacht. Da sie gerade gestorben war, dachte ich, sie würde sich dort, wo sie nun war, vielleicht darüber freuen.«
Seitdem hatte man nie mehr darüber gesprochen. Sie hatte sich daran gewöhnt, bei diesen beiden Männern zu leben, die sie verehrten, und sie bemühte sich, sie so zu nehmen, wie sie waren: immer zufrieden mit sich selbst, gleichzeitig aber unfähig, auch nur das kleinste Versprechen zu halten. Immer hatten sie Holzspäne in den Haaren, und sie waren von krankhafter Gutmütigkeit, von der sie glaubten, sie wäre allgemein verbreitet.
Die Jahre waren vergangen, dann war Jean mit fünfundfünfzig Jahren plötzlich in seiner Werkstatt gestorben, wo er an jenem Morgen mit Virgile arbeitete. Er fiel zu Boden, ohne einen Laut von sich zu geben, mit dem Gesicht in das Sägemehl der Eichenbretter, die er gerade hobelte, und in seinem erstaunten Gesichtsausdruck war nicht der geringste Schmerz zu erkennen. Victoria hatte im Verlauf der folgenden Tage über Virgile wachen müssen, doch dann hatte die in ihm pulsierende Lebenskraft ihn wieder mit der Welt versöhnt, und sein Lächeln kehrte genauso schnell zurück, wie es zuvor verschwunden war. Von nun an half sie ihm gelegentlich in seiner Werkstatt, doch das war eher selten, denn mit seinen Händen war er so geschickt, wie er in seinen Beziehungen zur Außenwelt und ihren Menschen ungeschickt war.
Später hatte sie lange gehofft, ein Kind zu bekommen, doch waren ihre Hoffnungen immer wieder enttäuscht worden, bis sie es zuletzt aufgab. Manchmal fragte sie sich, ob nicht im Grunde Virgile ihr Kind sei. Sie zwang sich, nicht mehr daran zu denken, trotz dieser Wunde tief in ihr, in ihrem Bauch, in ihrem Herzen; der einzige wahre Schmerz in ihrem hellen und beschützten Leben an dem Ort mit Namen Sauvénie, nur knapp einen Kilometer vom Fluss entfernt, dem sie sich niemals näherte, da sie vor Wasser immer Angst gehabt hatte. Dies war übrigens auch der Grund dafür, dass sie Virgile in dieser Nacht nicht gefolgt war, aber sie hatte sich fest vorgenommen, ihn und den Mann auf der Straße nach Saint-Martial zu begleiten, einem Dorf, das vier Kilometer vom Haus entfernt an der Nationalstraße nach Périgueux lag.
Sie hatte sich also angezogen und spähte nun auf den Weg, der sich dort hinten im Mondlicht in Richtung Fluss entlangschlängelte. Doch nichts bewegte sich in dieser schönen Mainacht, nur manchmal die hohen Äste der Bäume.
Und wenn ihm ein Unglück zugestoßen wäre? Wenn er auf die Patrouille gestoßen wäre, von der der Arzt gesagt hatte, seit dem letzten Monat sei sie mit Hunden ausgestattet? Er hatte allerdings ergänzt, sie würden ihre Zeiten nie variieren: Um Mitternacht seien die Franzosen unterwegs, um drei Uhr die Deutschen.
Da sie nichts sah, stieg sie die Treppe hinunter und ging hinaus. Dann überquerte sie den Hof, nahm den Weg und entdeckte dreißig Meter vor sich zwei Gestalten, von denen ihr die Erstere vertraut war.
»Bist du es?«, fragte sie.
»Wer soll es sonst sein?«
Sie ging auf sie zu, begrüßte den Unbekannten, dann drehte sie sich um und ging voraus, wie um ihnen den Weg zu zeigen.
Eine halbe Stunde später brachen sie nach Saint-Martial auf und nahmen den Fußweg durch die Felder und Wiesen, denn weder Virgile noch Victoria konnten Auto fahren. Sie besaßen auch weder Pferd noch Karren, da sie keine Verwendung dafür hatten. Die Kunden holten ihre Bestellungen selbst ab, und in Monestier konnten sie alles einkaufen, was sie brauchten. Ohnehin wäre es nicht möglich gewesen, mit Illegalen die Nationalstraße zu benutzen. Es war zu gefährlich, der Arzt hatte auf diesen Punkt mehrmals und mit Nachdruck hingewiesen.
Im Haus hatten sie sich nicht lange aufgehalten und sich nur die Zeit genommen, eine Tasse Kaffee zu trinken, die der Mann unter Victorias inquisitorischem Blick genoss. Er war groß und mager, mit seltsamen grauen Augen, und sein kantiges Gesicht war von den im Verlauf seiner Flucht aus der Gefangenschaft erduldeten Prüfungen gezeichnet. Da er sich erneut bei seinen Gastgebern bedankte, glaubte Victoria sich befugt, ihn zu fragen, ob er von weit her käme.
»Aus Bayern«, hatte er geantwortet.
Und da dieses Wort ihr nichts zu sagen schien, erklärte er: »Das ist in Deutschland, im Süden des Landes.«
Er schien so erschöpft, dass sie keine weiteren Fragen zu stellen wagte. Auch Virgile trank Kaffee und lächelte bei dem Gedanken an seinen Ausflug auf dem Fluss. Jegliches Gefühl einer Gefahr hatte ihn verlassen.
»Wir brechen auf, wenn Sie es wollen«, hatte Victoria gesagt. »In einer Stunde werden Sie in Sicherheit sein.«
Der Mann hatte genickt und schnell seine Tasse geleert. Dann war er aufgestanden und hatte sich erneut mit rührender Aufrichtigkeit bedankt.
»Schon gut«, hatte Victoria entgegnet. »Wissen Sie, es kostet nichts, jemandem einen Gefallen zu tun, wenn es möglich ist.«
Und sie hatten sich auf den Weg gemacht und waren an einem Maisfeld entlang gegangen, dessen Blätter sich leicht bewegten. Victoria vorneweg mit der Lampe, die kaum nötig war, so sehr erhellte der Mond die Landschaft. Eine angespannte Stille herrschte, doch sie wurden immer ruhiger, je weiter sie sich vom Dorf und somit von der Demarkationslinie entfernten. Von Zeit zu Zeit drehte Victoria sich um und zeigte auf ein Hindernis, eine Wurzel oder einen Stein, über die sie hätten stolpern können. Dann ging sie ohne Eile mit gleichmäßigem Schritt weiter, sodass sie Saint-Martial in weniger als einer Stunde erreichten.
Ihre Anlaufstelle befand sich im letzten Haus auf der linken Seite des kleinen Dorfes. »Ein zweistöckiges Haus mit grünen Fensterläden«, hatte der Arzt gesagt. »Sie nehmen nicht die Treppe und gehen nicht in den ersten Stock. Klopfen Sie einfach dreimal an das Garagentor und sagen das Codewort: Victor. Sobald Ihre Begleitperson eingetreten ist, gehen Sie wieder zurück. Halten Sie sich nicht auf, es wird zu dieser Jahreszeit sehr früh hell.«
Am Eingang von Saint-Martial schlug ein Hund so laut an, dass Victoria den Schritt beschleunigte und die Hauptstraße verließ. Sie kannte das Dorf und seine Einwohner sehr gut, jedoch nicht die des Hauses, in dem sie erwartet wurden. Es wurde von Leuten bewohnt, die erst einige Jahre zuvor aus der Stadt hergezogen waren. Die Häuser erstreckten sich über dreihundert Meter hin, und nicht das kleinste Licht leuchtete hinter den Fenstern, was eher beruhigend war.
Als sie das Ende des Dorfes erreicht hatten, bemerkte Victoria, dass die Farbe der Fensterläden nicht zu erkennen war, doch es gab nur ein einziges zweistöckiges Haus auf der linken Seite. Sie zögerte nicht, die Straße zu überqueren und mit drei festen Schlägen an die Tür zu klopfen, die tatsächlich ein Garagentor zu sein schien. Nach einigen Sekunden vernahm sie drinnen Schritte und sagte das Codewort. Sofort wurde die Tür geöffnet, und sie trat zur Seite, um den Mann vorbeizulassen, der sie noch einmal umarmte und küsste. Dann drückte er Virgiles Hand, dankte erneut und verschwand im Haus.
Plötzlich fand sie sich allein mit ihrem Mann wieder und war ein wenig ratlos über die Leichtigkeit, mit der alles abgelaufen war – vor allem aber wegen der beiden Küsse auf ihren Wangen. Eine Form der Anerkennung, auf die sie überhaupt nicht gefasst gewesen war, denn sie war davon überzeugt, dass sie in keinster Weise ein Risiko eingegangen waren und ihnen keinerlei Verdienst zukam für das, was sie getan hatten.
»Komm, wir drehen wieder um!«, sagte sie.
Sie hakte sich bei Virgile ein, und nach wenigen Minuten hatten sie das Dorf hinter sich gelassen. Sie nahmen denselben Sandweg wie auf dem Hinweg, vorbei an großen Feldern und ausgedehnten Wiesen, die das Tal in mehr oder weniger grüne quadratische Flächen aufteilten. Nach einem Kilometer blieb sie plötzlich stehen und sagte zu Virgile mit einem Hauch von Schalkhaftigkeit: »Weißt du noch? Als wir uns kennengelernt haben, hast du mir nachts immer Komplimente gemacht.«
»Damals kannte ich dich noch nicht so gut. Aber heute weiß ich, mit wem ich es zu tun habe«, sagte er lachend.
»Und mit wem bitte?«
»Das behalte ich lieber für mich.«
»Warum?«
»Weil ich Angst habe, dass du dann nachts nicht mehr mit mir rausgehen willst.«
»Ah, dieser Mann!«, rief sie aus. »Was habe ich dem lieben Gott getan, dass er mir so einen Kerl geschickt hat?«
Sie gingen weiter, einer hinter dem anderen in der nun feuchten Nacht, durch das bisschen Tau, den der herannahende frühe Morgen über die Erde ausbreitete. Nicht ein Laut störte die Stille, nicht einmal die höchsten Zweige der Bäume wurden von einem Windhauch bewegt. Sie beeilten sich, in den Schutz ihres Hauses zu gelangen, nicht, weil sie sich in Gefahr wähnten, sondern weil sie dort das miteinander teilten, was sie schon immer gemeinsam hatten und was ihnen teuer war.
Als sie zu Hause waren, setzten sie sich, anstatt ins Bett zu gehen, an den Tisch. Gegenüber dem Tisch aus Kirschbaumholz, an dem sie ihre Mahlzeiten einnahmen, befand sich der offene Kamin, an dem Victoria in ihren verschiedenen Töpfen auf einem uralten Dreifuß kochte. An der linken Wand befanden sich in einem großen Büffet mit geschnitzten Türen Teller und Besteck und unten die Geschirr- und Handtücher. Rechts davon zeigte eine Pendeluhr aus lackiertem Holz die Zeit an.
Hinten, dem Kamin gegenüber, befand sich ein steinernes Spülbecken, das gleichzeitig als Waschbecken und Victoria zum Geschirrspülen diente. Gegenüber vom Büffet führte eine schlichte Treppe – die eher einer Hühnerleiter als einer richtigen Treppe glich – in den oberen Stock, wo sich zwei kleine Zimmer mit alten Holzbetten befanden.
Das war ihre vertraute Welt, ihr einziger Reichtum, zusammen mit der Scheune und der Werkstatt. Es verlieh ihnen die Überzeugung, in aller Freiheit und Sicherheit zu leben, zwischen Mauern, die niemandem etwas schuldeten, wenn nicht der Arbeit von Virgiles Vater und Virgile selber.
»Da sind wir!«, seufzte Victoria. »Siehst du, es war gar nicht nötig, sich Sorgen zu machen.«
»Ich habe mir keine Sorgen gemacht«, protestierte Virgile.
Sie lächelte.
»Mein Gefühl sagt mir, es war das erste, aber sicherlich nicht das letzte Mal.«
»Glaubst du?«
»Ich bin mir sicher. Es muss viele Leute geben, die auf die andere Seite wollen. Unter den Deutschen zu leben, ist nicht einfach, ich merke es, wenn ich nach Monestier gehe.«
»Man kann nicht sagen, dass sie uns bis jetzt sehr viel angetan hätten«, entgegnete Virgile.
»Natürlich! Du würdest es mit jedem aushalten! Du würdest sogar einem Wegelagerer vertrauen.«
Er zuckte mit den Schultern.
»Es wäre besser, wir gingen zu Bett. Morgen muss ich unbedingt die Tür von Mérillou fertigstellen.«
»Seit drei Monaten hätte sie zur Abholung bereit sein sollen«, bemerkte Victoria und konnte eine leichte Gereiztheit nicht unterdrücken.
»Ich weiß, ich weiß«, entgegnete Virgile, »und seit drei Monaten sagst du es mir jeden Morgen.«
Er erhob sich, ging zur Treppe, wartete einige Augenblicke, und ehe er den Fuß auf die erste Stufe setzte, sagte er: »Er sah ziemlich erschöpft aus, dieser arme Mann. Vielleicht hätten wir ihn über Nacht hierbehalten sollen.«
Victoria antwortete nicht. Nachdenklich nahm sie die auf dem Tisch stehen gelassenen Kaffeebecher und trug sie seufzend zum Spülbecken. Danach lief sie eine Weile wie untätig durch den Raum. Befriedigt dachte sie an die vielen Fremden, die ihr Haus künftig betreten und ein wenig von der Luft mitbringen würden, die man andernorts einatmete und die für sie mit all dem Zauber und all den Geheimnissen des Unbekannten erfüllt war.
Zwei
Eine undurchdringliche Hitze hatte sich über das Tal gelegt, als Virgile an diesem Sonntag Mitte August zur Uferböschung des Flusses gegangen war, um ein wenig Kühlung zu finden. Es war so heiß, dass er keine Kraft hatte, zu angeln. Mit dem Rücken lehnte er an einer Esche, hatte seinen Hut über die Augen gezogen und versuchte einzuschlafen, doch es gelang ihm nicht. Er fragte sich, wie es möglich war, dass er sich in der freien Zone befand, das Ufer auf der anderen Seite des Flusses aber in der besetzten Zone lag, auf deutschem Gebiet. Im Schutz des Laubes, halb im grünen Gras verborgen, hörte er das Murmeln des Wassers und konnte sich nicht mit dem Gedanken eines in zwei Teile gespaltenen Frankreich abfinden. Und er hätte es niemals geglaubt, wären da nicht diese deutschen Soldaten auf der Nationalstraße und der Brücke gewesen. Und nun von Zeit zu Zeit die Erinnerung an seine nächtliche Mission, bei der er den Flüchtling aus Bayern über den Fluss gebracht hatte.
Seitdem war Dr.Dujaric noch einmal zu ihnen gekommen, um sie zu fragen, ob sie bereit wären, es wieder zu tun. Victoria hatte ohne zu zögern ihr Einverständnis gegeben und Virgile nicht einmal nach seiner Meinung gefragt. Kurz und gut, Virgile wartete auf den nächsten Auftrag, denn da beim ersten Mal alles so unproblematisch verlaufen war, hatte er nicht das Gefühl, sich