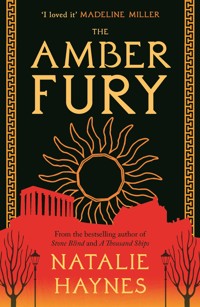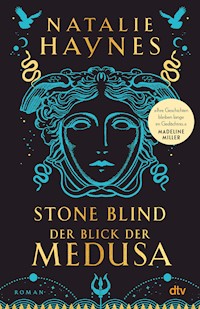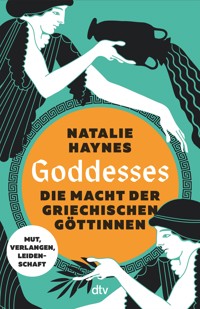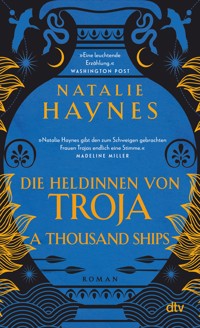10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jokaste & Ödipus – durch Blut verbunden, in Liebe vereint, vom Schicksal verdammt Eine spannende Nacherzählung des Mythos um Ödipus und Antigone aus der Perspektive zweier Frauenfiguren, die bisher oft übersehen wurden: Jocaste und Ismene enthüllen die antike Geschichte neu. Keiner kann dem Fluch entkommen, der auf dem König von Theben ruht: Er soll durch die Hand seines eigenen Sohnes sterben. Und so fordert er von seiner frischvermählten Ehefrau nur eines: eine Tochter. Doch die fünfzehnjährige Jokaste gebärt einen Sohn, ohne den Fluch zu kennen. Alle im Königspalast lassen sie glauben, ihr Baby wäre tot geboren, denn alle wollen dem Schicksal entgehen. Als der König stirbt, übernimmt Jokaste dessen Amt. An ihrer Seite der junge Ödipus, der Bote, der ihr vom Tod des Königs und seiner tragischen Rolle darin berichtet hat. Die beiden kommen sich näher und wissen nicht, dass sie mehr verbindet, als ihnen lieb ist – ein Fluch, der auch die nächste Generation nicht loslassen wird. - Das hat es noch nie gegeben: Natalie Haynes erzählt die Geschichten von Ödipus und Antigone aus der Perspektive zweier übersehener Frauenfiguren - Die Bestsellerautorin setzt ihren Trend mythologischer Retellings fort - Clever, fesselnd und berührend: Ein großartiges Lesevergnügen! »Ein leidenschaftlicher und fesselnder Bericht über eine berühmt-berüchtigte dysfunktionale Familie.« Madeline Miller
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 474
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Ein Fluch liegt auf dem König von Theben: Er soll durch die Hand seines eigenen Sohnes sterben. Und so fordert er von seiner frisch vermählten Ehefrau nur eines: eine Tochter. Doch die fünfzehnjährige Jokaste, die von all dem nichts weiß, gebärt ihm einen Sohn – vermeintlich eine Totgeburt.
Als der König bei der Jagd ums Leben kommt, übernimmt Jokaste dessen Herrschaft. An ihrer Seite der junge Ödipus, ein Bote aus Korinth, der ihr vom Tod ihres Ehemanns und seiner tragischen Rolle darin berichtet hat. Die beiden kommen sich näher und wissen nicht, dass sie mehr verbindet, als ihnen lieb ist – ein Unheil, das auch die nächste Generation nicht loslassen wird.
Eine packende und akribisch ausgearbeitete Neuinterpretation von zwei der wichtigsten Geschichten aller Zeiten.
Natalie Haynes
Die Kinder der Jokaste
Roman
Aus dem Englischen von Lena Kraus
Für Dan
ὁ γοῦν λόγος σοι πᾶς ὑπέρ κείνης ὅδε
Antigone, Sophokles
Anmerkung der Autorin
Die Menschen im alten Griechenland (Hellas) betrachteten sich selbst nicht als ›Graeci‹ (das Wort Graeci – Griechinnen und Griechen – ist eine spätere, römische Erfindung). Sie waren Héllēnes (Hellen und Helleninnen). Gegensätze schätzten sie sehr: Wenn sie zum Beispiel die ganze Welt beschreiben wollten, so geschah dies in einer Zweiteilung: hellenisch und nichthellenisch, oder freie und versklavte Menschen. Allerdings definierten sie sich wahrscheinlich noch stärker über die Stadtstaaten, in denen sie lebten. Theben hatte eine dichte mythische Geschichte, genau wie seine Umgebung: Überraschend viele Todesfälle in den griechischen Mythen ereigneten sich in der Nähe des Berges Kithairon, wo Aktaion in einen Hirsch verwandelt und von seinen eigenen Jagdhunden in Stücke gerissen wurde, oder wo Pentheus’ Mutter ihm wie eine rasende Mänade nach und nach sämtliche Gliedmaßen ausriss. Vielleicht ist die Moral dieser Geschichten, dass es auf dem Land gefährlicher sein kann als in der Stadt. Aber das ist nicht immer so.
Prolog
Der Mann schaute zu seinem Sohn hinüber, der am anderen Ende des Raumes zitternd auf einer harten Pritsche lag. Er machte einen Schritt auf den Jungen zu, wollte eine Decke fester um ihn wickeln, um das Frösteln zu vertreiben. Aber dann blieb er stehen, weil er seine Gliedmaßen nicht dazu bringen konnte, die Bewegungen zu wiederholen, die er am gestrigen Tag und am Tag davor so oft ausgeführt hatte. Er hatte seine Frau warmgehalten, als das Zittern sie schüttelte; ihr Körper war wie der Kopf einer Axt, der im Stamm einer dichten, schwarzen Tanne bebte. Und dann hatte er seine Tochter warmgehalten, bis auch sie der Krankheit erlag. Wie hatte das Waschweib sie noch genannt? Die Vergeltung.
Er spürte, wie sich seine rissigen Lippen zu einem freudlosen Lächeln formten. Was für eine Vergeltung stellte Theben sich da vor? Eine Strafe der Gottheiten für eine reale oder eingebildete Respektlosigkeit? Die Tempel hallten vom Klang der Gebete wider, Gebete und Opfergaben, die an sämtliche Gottheiten unter jedem erdenklichen ihrer vielen Namen gerichtet waren. Am häufigsten an Apollo. Um ihn nicht zu verärgern, sprach man ihn mit allen seiner vielen Namen an, einem nach dem anderen: Kynthios, Delphinios, Pythios, Sohn der Leto. Es war allgemein bekannt, dass seine Pfeile, mit denen er nie sein Ziel verfehlte, die Pest an ihren Spitzen trugen. Aber welchen Groll könnte der Schütze schon gegen die Tochter dieses Mannes hegen, die kaum mehr als ein Baby war? Oder gegen seine Frau, die unterwürfig zu jeder neuen Jahreszeit ihre Opfer dargebracht hatte? Der Gott konnte einfach nichts gegen sie haben, aber sie war trotzdem gestorben. Vor zwei Tagen hatte er ihren Leichnam selbst durch die Straßen getragen. Er hatte mit ihrem Gewicht gekämpft, nicht etwa, weil seine von Krankheit gezeichnete Frau schwer gewesen wäre – sie bestand nur noch aus Sehnen und Knochen, die Haut hing ihr lose von den Armen –, sondern weil die Pest dafür sorgte, dass er sich selbst kaum aufrecht halten konnte.
Am nächsten Tag seine Tochter hinauszutragen, war leichter gewesen.
Er schaute wieder zu Sophon herüber und sah, wie die Krämpfe seinen zehnjährigen Körper schüttelten. Er spürte eine Nässe unter seinem Auge und dachte einen Moment lang, dass er weinte. Aber als er die Hand wegnahm, sah er das rohe Scharlachrot frischen Blutes an seinen Fingerspitzen. Die Blasen waren also geplatzt. Er hatte gehört, dass manche Männer ihr Sehvermögen verloren. Ein paar Sekunden, nachdem er Apollo im Stillen verflucht hatte, murmelte er ein leises Gebet. Lass mich nicht erblinden. Ein blinder Mann würde seinem jungen Sohn kaum von Nutzen sein. Wenn der Junge überlebte, würde er nicht in der Lage sein, sich um einen blinden Bettler zu kümmern. Seine Gebete wurden kleiner: Bitte lass mir wenigstens ein Auge. Ein gutes Auge. Und – jetzt wuchsen sie wieder, ohne dass er es bemerkte – lass den Jungen leben.
Aber sollte er ihn wirklich so zittern lassen? Als das Zittern vor einem Tag ihn selbst heimgesucht hatte, hatten seine Zähne so sehr geklappert, dass er Angst hatte, er würde sich die Zunge durchbeißen. Er hielt inne, als ihm klar wurde, dass das nicht stimmte. An seine Zunge hatte er nicht gedacht, als das Fieber ihn schüttelte. Erst danach, als die Hitze gekommen war und er erschöpft auf dem Boden lag, hatte er sich gefragt, wie es sein konnte, dass er sich nicht verletzt hatte. Als das Zittern bei seiner Frau anfing, hatte er sie eingewickelt, und sie hatte ihre Tochter eingewickelt. Aber keine von beiden hatte überlebt. Er hatte alle Decken für sie verwendet, sodass keine übrig war, als der grausame Tanz ihn selbst einholte. Und doch war er – zumindest bis jetzt – am Leben. Vielleicht war das etwas, was er über die Vergeltung gelernt hatte: Sie blüht im Warmen auf. Vielleicht konnte sie vertrieben werden, wenn man ihr keine Wärme gab.
Der Junge stöhnte so leise, dass der Mann sich fragte, ob er Halluzinationen hatte. Aber er ging nicht zu ihm, und er wärmte ihn nicht auf.
Der Schütze würde sich nehmen, wen er wollte. Und doch hatte der Mann die Hoffnung – eine kleine, gebrochene Kreatur, wie ein Vogel –, dass er sich seine Beute anderswo suchen würde.
1Sechzig Jahre später
Ich hörte ihn nicht kommen. Ich war in dem alten Eislager, am hintersten Ende eines vergessenen Ganges, den seit Jahren niemand betreten hatte. Nicht, seitdem meine Eltern gestorben waren. Mein Vater liebte das Eis, das mit einer eisernen Spitze von dem Block geschabt wurde, der in diesem Raum mürrisch vor sich hin tropfte. Die dicken Wände schützten das Eis vor der Sonne, die immerfort auf die weißen Steinblöcke der Palastmauern schien.
Wie war es hierhergekommen? Ich flehte meinen Vater geradezu an, es mir zu sagen: Wo kam das Eis her? Er gab mir jedes Mal eine andere Antwort: Eine wütende Flussgottheit hatte eines Tages sämtliches Wasser in der Stadt zu Eis gefroren, und niemand hatte Zeit gehabt, diesen letzten Block aufzutauen. Es war ein Ei, zurückgelassen von einem riesigen, gefrorenen Vogel. Dann war es Thebens größter Schatz, und Banditen waren über die Meere gesegelt, um den Palast zu erobern und das goldene Vlies an sich zu reißen. Diese letzte Geschichte sorgte bei mir für Albträume von maskierten Männern, die eines der sieben Stadttore aufbrachen, auf die hohe Zitadelle kletterten und furchtlos unter den Berglöwen hindurchliefen, die in den steinernen Torbogen des Palastes eingemeißelt waren und mit den goldenen Steinen in den Augenhöhlen unsere Feinde abwehren sollten, bevor diese durch den Säulengang trampelten und in den Innenhof eindrangen, in dem wir lebten. Meine Mutter sagte meinem Vater, er solle aufhören, mir Angst zu machen. Als ich ihn das nächste Mal nach dem Eis fragte, nahm er mir also das heilige Versprechen ab, meiner Mutter nichts zu erzählen, bevor er erklärte, dass er es in einer Wette mit einem Titanen gewonnen hatte, der nun seinen Namen verfluchte. Ich sollte aber keine Angst haben, weil dieser Titan damit beschäftigt war, den Himmel auf seinen Schultern zu tragen.
Nachdem meine Eltern gestorben waren, ließ mein Onkel Kreon den Palast erweitern und umbauen. Der Bau müsse sicherer werden, sagte er, und eindrucksvoller. Er fügte Zimmer und ganze Etagen über dem Erdgeschoss hinzu, sodass mein Zuhause letztendlich jedes andere Bauwerk in der Stadt überragte. Der Palast lag auf dem höchsten Hügel und war jetzt auch noch das höchste Gebäude. Kreon hatte ebenfalls darauf bestanden, dass die königliche Residenz nicht mehr durchgehend für die Leute der Stadt geöffnet war, so, wie meine Mutter es immer gemocht hatte. Es müsse Abstand zwischen uns und ihnen geben; wir brauchten Türen, die nachts verriegelt werden konnten. Aus Erfahrungen musste gelernt werden.
Und während all diese Arbeiten von tüchtigen Sklaven fast lautlos ausgeführt wurden, beschloss mein Onkel, dass dieser Gang einfach dem Verfall überlassen werden konnte. Im Gegensatz zu meinem Vater interessierte ihn das Eis kein bisschen. Als die Bauarbeiten abgeschlossen waren, wurde dieser Raum nicht mehr genutzt – er war zu weit von der neuen Küche entfernt.
Aber er war der perfekte Ort, um zu lesen, wenn es so unglaublich heiß war. Das Licht fiel durch zwei schmale Schlitze herein, die sich ganz oben an den Nord- und Ostwänden befanden. Und wenn ich die Tür zu dem halboffenen Gang nicht ganz schloss, konnte ich die Pergamentrolle, die ich gestern aus dem Büro meines Lehrers mitgenommen hatte, leicht lesen. Ich würde sie zurückbringen, sobald ich damit fertig war, wie immer. Ihm machte das nichts aus, solange ich die Rolle genau an denselben Platz zurücklegte, wo ich sie auf seinen staubigen Regalen gefunden hatte. Ich hatte gelernt, wie ich den Staub von beiden Seiten zurück auf meine Fingerspuren pusten musste, um diese wieder unsichtbar zu machen. Seine Augen waren nicht mehr so scharf wie früher. Das Manuskript würde wieder an seinem Platz liegen, bevor mein Lehrer überhaupt bemerkte, dass es fort gewesen war.
In diesem Raum verlor ich oft jegliches Zeitgefühl, und genau das war einer seiner vielen Vorteile. Die langen Sommertage waren so heiß und so hell und so langweilig. Mein Onkel sagte immer, dass sich Mädchen in der ganzen Stadt – ja sogar in ganz Hellas – wünschten, an unserer Stelle zu sein. Aber sie stellten sich unser Leben bestimmt anders vor, als es tatsächlich war, denn niemand würde diese leeren Tage mögen. Ich sehnte mich danach, zum Hylike-See hinunterzugehen und dort mit den Fischen und den Fröschen zu schwimmen. Aber es gab niemanden, mit dem ich gehen konnte, und ich wusste, dass es meine Schwester ärgern würde, wenn ich die Mägde mitnahm. Was, wenn sie sie brauchte, weil sie ein anderes Kleid anziehen wollte, oder eine neue Frisur haben musste? Wir konnten nicht alle wie Barbaren im Palast herumlaufen, würde sie sagen, und das nicht zum ersten Mal. Ich konnte mir ihre trotzige Unterlippe schon vorstellen, weil sie sich über etwas ärgerte, das ich noch gar nicht getan hatte.
Das Licht fiel durch schmale Schlitze in das Eislager, sodass man leicht aus den Augen verlor, wo die Sonne gerade am Himmel stand. Normalerweise ging ich, wenn ich fertig gelesen hatte, oder wenn ich Hunger bekam, oder manchmal auch wenn ich Ani oder Eteo nach mir rufen hörte. Sie wussten, dass ich hier war, wenn ich mich nicht gerade im Innenhof befand oder Unterricht hatte. Aber an jenem Tag rief niemand nach mir. Im Sommer war es immer ruhig im Palast; alles Wichtige fand auf dem öffentlichen Platz vor dem Gebäude statt. Vielleicht stand ich deswegen auf und drückte meine schmerzenden Schultern an die kühle Steinwand hinter mir: Es war so still, dass ich wohl dachte, ich müsste dort sein, wo die anderen waren.
Ich hörte seine Schritte, glaube ich, aber ich hatte keine Angst. Er ging nicht wie jemand, der etwas zu verbergen hatte. Ich hörte seine Absätze auf dem harten Boden, ein gleichmäßiger, ruhiger Schritt. Es kam mir gar nicht in den Sinn, mir Sorgen zu machen. Trotzdem klemmte ich mir die Pergamentrolle unter den Arm und verdeckte sie mit dem leichten Mantel, den ich mir um die Schultern hängte, falls es mein Lehrer war. Aber eigentlich wusste ich, dass sein Gang anders klang: Er tritt auf dem rechten Fuß fester auf und zieht den linken leicht nach. »Eine alte Verletzung«, ist alles, was er dazu sagt, wenn man ihn danach fragt. Seine dunklen Augen blicken unter schweren Lidern hervor. Sie verändern sich, wenn er über etwas nicht reden möchte. Das Licht in ihnen erlischt und das Thema ist beendet.
Ich trat in den Gang hinaus und die Temperatur stieg unbarmherzig. Sogar in meinem dünnsten Mantel – blass-beigefarbener Stoff aus Flachs – war es hier draußen zu heiß. Ich wünschte, ich könnte eine einfache Tunika tragen, wie damals, als ich noch jünger war. Aber wenn mein Onkel mich in dieser einfachen Kleidung sehen würde, würde ich Ärger bekommen. Ich spürte den Schweiß hinter meinen Ohren und an meinem unteren Rücken. Fast hätte ich mich gleich wieder umgedreht und wäre zurück ins Eislager gegangen. Aber ich hatte beschlossen, nach meinen Geschwistern zu suchen, also ging ich weiter.
Mit dem Anstieg der Temperatur kamen weitere Erinnerungen an die Welt außerhalb des Palastes: Grashüpfer, die an den Mauern kratzen, flinke Spatzen, die in ihren Nestern plaudern. Normalerweise kehrt ein Mann mit einem langen Besen die Nester von den Wänden, weil ihr Morgengezwitscher meinen Onkel stört. Aber aus irgendeinem Grund hatte man sie dieses Jahr übersehen, und die Spatzen tschilpten vor sich hin, als freuten sie sich über ihre Begnadigung. Denn wenn die Adler sie hörten, würden sie ihre Küken verlieren.
Der Gang machte erst eine Biegung nach links und dann nach rechts, bevor er auf den Innenhof der königlichen Familie traf. Nach dem schattigen Dunkel des Ganges begannen meine Augen durch die plötzliche Helligkeit zu tränen. Ich blinzelte, sodass sie mir die Wangen hinunterliefen, und leckte mir dann die salzigen Tropfen von der Oberlippe. Ich merkte, dass ich Durst hatte – vielleicht hatte ich deshalb meinen kühlen Rückzugsort verlassen. Es musste Eteo gewesen sein, der den Gang entlanggelaufen war, um mich zu suchen. Obwohl er um diese Zeit bestimmt mit seinen Beratern beschäftigt war. Aber für Ani waren die Schritte viel zu lang gewesen, und ihre Schuhe hatten auch keine harten Ledersohlen, die beim Gehen auf den Steinboden klatschten.
Ich folgte dem Gang nach links und sah den Schatten eines Mannes auf dem Boden. Es war also nicht Eteo, denn dieser Mann trug einen langen Umhang, und Eteo hätte an einem Tag wie heute nur eine Tunika angezogen. Ich hörte ein seltsames, metallisches Geräusch, das ich nur halb wiedererkannte. Und dann bog ich um die zweite Ecke. Als er mich erblickte, erstarrte der Mann, als würde er einen Schreck unterdrücken. Ich hatte ihn gehört, er mich aber mit meinen bloßen Füßen offensichtlich nicht. Ich wollte ihn gerade begrüßen, als ich sah, dass sein Gesicht fast vollständig verdeckt war, wie bei den Banditen aus meinen Albträumen. Nur seine Augen waren zu sehen, den Rest hatte er mit dünnem, weißem Stoff verhüllt.
Ich drückte meinen Arm fester gegen meine linke Seite, um Sophons Pergamentrolle nicht fallen zu lassen. Hinter dem vermummten Mann konnte ich den Innenhof sehen, der aber leer war. Da war keine Spur von meinen Geschwistern, meinem Cousin oder meinem Onkel. Ich holte tief Luft und beschloss, an dem Mann vorbeizurennen. Ich bin die Zweitschnellste von uns allen: Ich bin viel größer als Ani, und Polyn – mein ältester Bruder – würde sich nie zu einem Wettrennen mit seiner kleinen Schwester herablassen, gegen ihn konnte ich also gar nicht gewinnen. Nur Eteo, mit seiner langen, schlanken Gestalt, war schneller als ich, auch wenn mein Onkel entsetzt wäre, wenn er jemals sehen würde, wie ich meine Tunika hochzog, damit sich meine Beine frei bewegen konnten. Und als Eteo mit Staatsangelegenheiten beschäftigt war, gab es niemanden mehr, den ich bitten konnte, mit mir irgendwo hinzugehen, wo genug Platz zum Sprinten war. Ich war also außer Übung, vertraute aber trotzdem auf meine Schnelligkeit. Wenn ich erst im Innenhof war, konnte ich Alarm schlagen, weil sich ein Fremder im Familienbereich befand. Die Sklaven mussten doch sicher irgendwo in der Nähe sein.
Ich presste die Zehen gegen den Steinboden unter meinen Füßen. Meine Sandalen hatte ich am Morgen vermutlich in meinem Zimmer vergessen: Noch etwas, worüber mein Onkel die Stirn runzeln würde, wenn er mich sehen könnte. Ich drängte vorwärts und hätte fast an dem Mann vorbeisprinten können, aber er trat plötzlich nach rechts, und ich stieß mit ihm zusammen. Ich spürte einen scharfen Stich unter meinen Rippen. Er hatte mir sicher das hölzerne Ende der Pergamentrolle in die Rippen gerammt. Ich verzog das Gesicht und sagte reflexartig: »Entschuldigung.«
Wir waren genau gleich groß, unsere Blicke begegneten sich einen Moment lang: Seine Augen waren wässrig grau, mit zwei braunen Flecken in der rechten Iris, die damit wie ein Vogelei aussah. Ich sollte weiter in Richtung Innenhof laufen, dachte ich, und dann auf der anderen Seite nach draußen, und weiter auf den nächsten Platz, wo meine Brüder und mein Onkel sein würden. Ich könnte Sophon das Manuskript zurückgeben und mich entschuldigen, weil ich es genommen hatte, ohne zu fragen. Es würde ihm nichts ausmachen. Doch während ich noch darüber nachdachte, kam mir der Gedanke, dass meine Beine mich vielleicht nicht bis zum zweiten Innenhof tragen würden. Ich stand in der prallen Sonne, aber mir war kalt. Der Mann schaute kurz an mir vorbei, obwohl hinter mir niemand war, dann sah er wieder mich an. Wortlos drehte er sich um und schritt von dannen. Ich dachte, dass ich mich vielleicht einen Moment lang auf den Boden setzen könnte, schaffte noch ein paar Schritte und fiel dann auf die Knie, kurz bevor ich den Innenhof erreichte. Ein Mädchen, das ich nicht erkannte – sicher die Tochter einer der Haussklavinnen –, kam mit einem Tablett aus einem der Schlafzimmer. Sie hörte das Geräusch, das ich beim Fallen gemacht hatte – das Klirren meines dicken, silbernen Armreifs, drehte sich um, schrie auf und ließ alles fallen. Hohle hölzerne Gegenstände, Becher vielleicht, oder Schüsseln. Ich hörte, wie sie auf den warmen, grauen Steinplatten klapperten. Ich zischte sie an, leise zu sein, aber sie war zu weit weg, und machte außerdem zu viel Lärm, um mich zu hören. Das Licht war so grell, dass ich am liebsten die Augen geschlossen hätte. Ich sah die Schatten der Vögel, die über den Hof flogen, konnte aber den Kopf nicht heben, um die Vögel selbst zu sehen.
Nach langer Zeit – vielleicht kam es mir aber auch nur lang vor – hörte ich Stimmen, die aber alle seltsam verzerrt klangen, als würde ich sie unter Wasser hören. Ich blinzelte, sah aber alles nur verschwommen: Da waren Wachen und Bedienstete, und dann meine Brüder, die alle auf mich zurannten. Sie schrien und riefen, das sah ich an ihren verzerrten Gesichtern – aber ich konnte sie kaum verstehen. Es klang wie: »Sie haben sie umgebracht.«
Wen umgebracht? Es gab nur noch eine Person in meiner Familie, die sie meinen könnten: meine Schwester Ani. Bitte nicht Ani, dachte ich. So viel wir auch streiten, ich kann sie nicht auch noch verlieren. Bitte nicht.
Das Letzte, woran ich mich erinnerte, war, dass ich auf Sophons Manuskript hinabschaute. Es war ruiniert, bedeckt von etwas Rotem, Klebrigem. Ich musste mich bei ihm entschuldigen. Es war nicht leicht zu ersetzen. Und dann wurde mir klar, dass sie natürlich mich meinten. Jemand hatte mich umgebracht.
2
Der Schmerz durchflutete ihren Körper, als wolle er sie zerreißen. Jokaste krallte sich am Laken unter ihr fest. Wenn sie nur etwas Luft in ihre Brust bekommen könnte, würde alles gut werden, das redete sie sich jedenfalls ein. Ihre Lungen fühlten sich an wie ein leerer Weinschlauch, den ein betrunkener Soldat mit seinen Stiefeln zertrampelte. Und doch konnte sie nicht lange genug mit dem Schreien aufhören, um Atem zu holen. Sie spürte, wie Teresa ihre Hand so festhielt, dass sie ihre Knochen zusammendrückte. Dieser neue Schmerz war so unerwartet, dass sie wie betäubt auf ihre zerquetschte Hand hinunterschaute.
»Einatmen«, sagte Teresa und zählte bis vier. »Und jetzt wieder aus.« Die beiden zählten die Atemzüge, zusammen und doch getrennt. Denn obwohl Jokaste auf die Hilfe der anderen Frau angewiesen war, wusste sie auch, dass wahrscheinlich Teresa schuld daran war, dass sie sterben würde, und das konnte sie nur schwer verzeihen.
*
Es war Teresas Idee gewesen, dass der alte König wieder heiraten sollte. In der Stadt war schon zu lange unklar, was die Zukunft bringen würde. Wenn der König starb, ohne einen Sohn zu haben (selbst eine Tochter wäre immerhin besser als nichts), was sollte dann aus den Menschen in Theben werden? Sie brauchten Stabilität. Es waren sich alle einig, dass die Stadt schon mehr als genug durchgemacht hatte, seit die Vergeltung sie Jahre zuvor heimgesucht hatte.
Und wie seltsam – so sagten die Leute, während sie ihren alltäglichen Arbeiten nachgingen –, dass der König in einem riesigen Palast mit Höflingen, Haushälterinnen, Wachen und Küchenpersonal lebte, aber ohne eine eigene Familie. Er war über vierzig, würde bald über fünfzig sein: Dass er am liebsten wochenlang mit seinen Männern in die Berge ritt, um mit kurzen Speeren und Netzen wilde Eber zu jagen, war nicht mehr so leicht verzeihlich, wie es einmal gewesen war.
Niemand hatte Jokaste gesagt, wie sie ausgewählt worden war. Es musste alles so schnell gegangen sein: In einem von rußigen Kerzen erleuchteten Raum hatte eine Gruppe von Männern das Los entscheiden lassen, wessen Tochter zur Königin werden würde. An einem Tag hatte Jokaste noch nichtsahnend zu Hause – beziehungsweise im Haus ihrer Eltern, wie sie es bald nennen würde – in den Frauengemächern gesessen. Fünf Tage später stand sie auf dem öffentlichen Hof des Palastes von Theben an einem Altar, der hastig der kuhäugigen Hera gewidmet worden war, und wurde vor den Augen einer Göttin, die ihre Gebete nie erhört hatte, von ihrem Vater an einen Mann, dem sie noch nie begegnet war, übergeben. Sie hatte keine Ahnung gehabt, dass ihr Vater sie schon so früh vermählen würde. Sie hatte gedacht, sie würde noch mindestens ein, zwei Jahre zu Hause verbringen. Sie war eine pflichtbewusste Tochter, die sorgfältig webte und sich in anderen Bereichen der Haushaltsführung übte, wie ihre Eltern es ihr ans Herz gelegt hatten. Sie würde eine gute Ehefrau abgeben. Aber doch sicher noch nicht jetzt.
Ihre Eltern hatten mit außergewöhnlich großer Eile agiert. Jokaste kam sich dumm vor: Sie hätte wissen müssen, wie sie sind. Wie hätten sie sonst die Vergeltung überleben sollen? Ihr Vater hatte eine einzigartige Begabung dafür, von Situationen zu profitieren, die einen weniger fähigen Mann zu Fall bringen würden. Er war sich seines Status stets bewusst: Er war reich, aber er hatte sich seinen Reichtum selbst verdient und nicht geerbt. Er hatte viel verdient und genug Sklaven gekauft, um ein großes Haus auf der Nordseite der Stadt zu bauen. Es war zwar nicht die vornehmste Straße (dafür war sie zu weit vom Palast entfernt), aber sie war luftig und das Haus war groß und aus Stein gebaut. Die Gemächer der Frauen lagen sicher hinter abweisenden Toren und seine Frau hatte Sklavinnen, die für sie webten, auch wenn sie selbst nach wie vor stolz darauf war, welch feine Stoffe sie eigenständig herstellen konnte.
Was am Verhalten ihres Vaters dieses Mal besonders schmerzte, war die Erkenntnis, dass Jokaste – seine einzige Tochter, sein erstgeborenes Kind – für ihn nichts weiter war als ein Problem, das er zu lösen hatte. Dass ihre Mutter sie nicht mochte, war eine Sache. Sie hatte nicht einmal versucht, ihre Abneigung gegenüber ihrer Tochter zu verbergen. Von ihrem Vater zurückgewiesen zu werden, nachdem er sie bisher immer über die Gleichgültigkeit ihrer Mutter hinweggetröstet und sie zu seinem Liebling erklärt hatte, das war etwas völlig anderes. Als Jokaste nach ihrer Hochzeit versuchte, ihn in Gedanken zu verteidigen, damit sie zumindest Teile ihrer Kindheit in guter Erinnerung behalten konnte, hielt sie es ihm zugute, dass wohl jeder Vater stolz darauf wäre, wenn seine Tochter den König heiratete. Sie wusste, dass er nicht an sie gedacht hatte, oder daran, was sie wollte. Doch welcher Mann würde sich schon die Chance auf eine eheliche Verbindung mit dem König entgehen lassen? Keiner. Aber er hätte wissen müssen, dass sie alles getan hätte, worum er sie bat, wenn er sie nur gebeten hätte. Stattdessen hatte er sie im Dunkeln gelassen. Die einzig mögliche Erklärung für diese Heimlichtuerei war, dass er genau wusste, wie sie sich fühlen würde, wenn sie es herausfand, und es machte sie traurig, dass ihm das egal gewesen war.
Er war ein wenig betrunken gewesen, als er in jener Nacht nach Hause gekommen war: Die Männer hatten ihren Wein zu stark getrunken. Wer auch immer der Meister der Traube gewesen war – sie in den Krater gegossen und mit zu wenig Wasser gemischt hatte –, hatte gewollt, dass alle betrunken waren, bevor die Flötistinnen eintrafen. Jokaste war dieser Euphemismus lieber als das Wort, das sie ihre Mutter zischen hörte: Huren. Doch jetzt hörte sie, wie ihr Vater ihrer Mutter etwas zuflüsterte, die darauf ein begeistertes Quietschen ausstieß, bevor die beiden zu Lachen anfingen. Wie kleine Kinder, dachte Jokaste verächtlich. Sie hörte, wie ihr Bruder im Schlaf vor sich hinmurmelte, und fragte sich, ob er aufwachen würde. Sie starrte ihn im Halbdunkel des Raumes an und konzentrierte sich darauf, dass er wieder einschlafen sollte. Er drehte sich zur Wand, sein Atem wieder tief und gleichmäßig. Sie bewegte leicht den Kopf und versuchte zu hören, was ihr Vater sagte, konnte aber die Worte nicht voneinander trennen.
Ob es einen Unterschied gemacht hätte, wenn sie ihn verstanden hätte? Hätte sie ihm widersprochen? Das tat sie ja, als sie es am nächsten Tag herausfand, und da hatte es auch keinen Zweck. Es war schon alles abgesprochen und geplant, es gab nichts, was sie dagegen tun könnte. Ob sie in der Nacht fortgelaufen wäre, wenn sie es eher gewusst hätte? Wo hätte sie hingehen können? Theben war keine Großstadt, und ihr Vater kannte dort alle. Ob sie wohl versucht hätte, ganz aus der Stadt zu entkommen? Aber wie hätte sie es durch alle sieben bewachten Tore schaffen sollen? Sie hatte sich innerhalb der Stadtmauern noch nie wie eine Gefangene gefühlt. Aber das hatte wohl nur daran gelegen, dass sie bisher noch nie entkommen wollte.
Und doch, als sie ihre Eltern am nächsten Tag fragte, worum es am Abend gegangen war, wünschte sie, sie hätte es früher gewusst. Ihr Vater lächelte genüsslich, legte langsam seine gelben Zähne frei, die am Zahnfleisch mittlerweile grau wurden.
»Ich habe den besten Deal meines Lebens abgeschlossen«, erklärte er ihr. »Und du wirst den König heiraten.«
Der zweite Satz passte so gar nicht zum ersten. Jokaste hatte gedacht, ihr Vater habe vielleicht einen neuen Handelspartner im Hinterland – wie man in Theben Böotien nennt –, gefunden, oder dass er ein Rhyton hervorholen würde, das er von einem Handelsschiff gekauft hatte: Ihr Vater liebte verzierte Trinkgefäße, je opulenter, desto besser. Sein liebstes war ein spitz zulaufendes Gefäß aus Bergkristall, mit kleinen Perlen aus geschliffenen grünen Edelsteinen, die mit Goldfäden zu einem Griff zusammengedreht waren.
Jokaste spürte, wie ihr Gesichtsausdruck sich veränderte, von freudig zu verwirrt.
»Wie meinst du das?«, fragte sie.
»König Laios braucht eine Frau«, erklärte ihre Mutter und setzte sich damit für immer der Verachtung ihrer Tochter aus. »Du hast großes Glück.« Ihr Vater nickte.
»Der König ist ein alter Mann«, sagte Jokaste. »Er ist bestimmt über fünfzig.«
»Also quasi halb tot.« Ihr Vater zog in einer Parodie der Belustigung die Augenbrauen hoch. »Er ist nur zehn Jahre älter als ich, oder so, du kleines Balg.«
»Aber warum sollte ich ihn dann heiraten?«, fuhr sie fort. »Und nicht jemanden, der nicht älter ist als mein Vater?«
»Manchmal«, seufzte ihre Mutter, »glaube ich, es macht dir Spaß, dich dumm zu stellen. Wirklich. Also, lass es mich dir so erklären, dass es sogar dein kleiner Bruder verstehen würde: Theben braucht einen mächtigen König. Laios wird älter, und die Leute werden langsam nervös. Was, wenn ihm etwas passiert, während er auf Reisen ist? Was dann? Die Älteren werden darum kämpfen, sein Nachfolger zu werden. Die Stadt könnte im Chaos versinken.« Sie legte ihrer Tochter die Hände auf die Schultern, neben den Knoten im Stoff ihrer Tunika. Ihre Fingernägel berührten Jokastes Haut. »Das darf nicht passieren«, sagte sie. »Der König braucht einen Sohn. Und davor braucht er eine Frau, und zwar eine junge, die auch regieren könnte, bis das Kind erwachsen ist, falls dem König selbst etwas passiert.« Sie rüttelte bei jedem zweiten Wort an Jokastes Schulter. »Und diese Frau wirst du sein, weil dein Vater schlau ist und Glück hatte, und genau deswegen habe ich ihn auch geheiratet. Verstehst du mich?«
Jokaste nickte, und ihre Mutter ließ sie los. »Das ist eine Ehre, du undankbare kleine Schlampe. Du wirst die Königin von Theben. Also lauf in den Tempel der Artemis und bringe ihr deine Puppe dar. Und mach das lieber ordentlich, damit sie dich nicht verflucht, wie du es eigentlich verdient hättest.«
Das Ritual hätte nur ein Teil von Jokastes Proaulia sein sollen – der Zeit zwischen Verlobung und Eheschließung, in der die Braut sich auf ihr neues Leben vorbereitet –, aber für mehr blieb ihr keine Zeit (und sie hatte auch nicht sonderlich viel Lust). Als Jokaste zur Welt gekommen war, hatte sie eine kleine Tonfigur bekommen, ein Amazonenmädchen mit bunt gemusterten Leggings und einer kurzen Tunika. Sie hatte so viel damit gespielt, dass die Farbe abgewetzt war. Nur hier und da waren ein paar grüne und rote Flecken von dem ehemaligen Farbenmeer übrig geblieben. Das linke Auge der Puppe war nach wie vor schwarz, aber die Farbe des rechten war gesprungen, sodass das blasse Orange des Terrakottas zum Vorschein gekommen war. Verheiratete Frauen durften keine Spielsachen besitzen: Jokaste musste die Puppe zum Tempel bringen, sie der Artemis darbringen, und die Göttin darum bitten, ihr die Stärke einer Kriegerin zu verleihen. Nachdem sie das Opfer vollzogen hatte, würde sie von nun an den Tempel der Hera besuchen. Artemis war nicht mehr für Jokaste zuständig, wenn sie erst verheiratet war.
Es war Tradition, dass Bekannte und Familie das Mädchen begleiteten, wenn sie der jungfräulichen Göttin ihre Puppe darbot. Es hätte eine Feier samt Festessen geben sollen, es hätte ein freudvoller Anlass sein sollen. Aber Jokastes Eltern waren zu wütend auf sie – und Jokaste auf ihre Eltern –, dass sie allein ging, abgesehen von dem Sklavenmädchen, das ihr mit einigen Schritten Abstand zu dem Tempel folgte, der sich nur ein paar Straßen weiter befand.
Sie steckte die Puppe in eine kleine, braune Ledertasche und lief zügig die staubige Straße entlang. Der Staub färbte ihre Füße und den Saum ihres Gewandes rot. Der Regen würde noch mindestens einen Monat auf sich warten lassen, und die spitz zulaufenden Akanthusblätter am Wegesrand begannen, in der Hitze zu welken. Jokaste hob ihren Rock ein bisschen höher und steckte ihn unter ihrem Gürtel fest, aber der missbilligende Blick einer alten Frau, die vor einem nahe gelegenen Haus die Straße fegte, sorgte dafür, dass sie errötete und den Rock wieder ganz zum staubigen Boden herabhängen ließ. Im Tempel würde es kühler sein, und als sie die Stufen zum Eingang hinaufstieg und zwischen den riesigen Säulen hindurchschritt, die die Vorderseite des Tempels säumten, war sie froh, der unbarmherzigen Mittagssonne zu entkommen. Sie wandte sich der Sklavin ihrer Mutter zu und sagte ihr, sie solle im Schatten der Säulenhalle auf sie warten.
Jokaste betrat den Tempel und blinzelte in die Dunkelheit, aber es war sonst niemand da. Sie nahm die Puppe aus der Tasche und ging zu der riesigen Artemisstatue – deren gelassenes Gesicht drückte eine milde Freude darüber aus, dass sie Pfeil und Bogen bei sich trug – und fühlte sich seltsam befangen. Sie wusste, sie sollte ein formelles Gebet sprechen, wenn sie der Göttin ihr Spielzeug überließ, aber ohne eine Priesterin, die ihr helfen konnte, fehlten Jokaste die Worte. Also legte sie ihre Puppe vorsichtig zu Füßen der göttlichen Statue, lehnte sie an den kalten Stein. Sie murmelte »Beschütze mich« und wandte sich zum Gehen. Als durch eines der Fenster das Sonnenlicht auf ihre Schulter fiel, bemerkte sie dort einen wütenden roten Striemen. Der Daumennagel ihrer Mutter hatte ihr die Haut aufgekratzt, und als sie den Arm hob, sah sie vier weitere Striemen – die Haut darum herum gerötet und entzündet – hinten über ihrem Schulterblatt.
Sie blieb stehen und kniete sich dann hin. Sie wollte nicht wieder nach Hause gehen, wo ihre Mutter in den Frauengemächern saß und Bosheit ausstrahlte. Ihr Bruder hatte Unterricht bei seinem Lehrer, und ihr Vater war sicher auf dem Marktplatz und ließ sich von rotgesichtigen Männern die Hand schütteln. Sie konnte die goldenen Ringe vor sich sehen, die die Finger ihres Vaters so einquetschten, dass sich deren Fleisch fett um das Metall wölbte. Für ihn war es ein sehr guter Tag.
Wie sie dort im Tempel auf dem Boden kniete, versuchte sie, sich vorzustellen, wie es wohl sein würde, im Palast zu leben, in der Zitadelle von Theben. Als sie jünger war, war sie ein paarmal für irgendwelche Feierlichkeiten dort gewesen. Sie versuchte, das Gebäude gedanklich von den Anlässen zu trennen, aber das war schwierig. Sie konnte sich an den erdrückenden Geruch nach verkohltem Fleisch erinnern, der sich mit Weihrauch und dem essigartigen Geschmack des Weins mischte. Sie hörte den Klamauk der Menge, in der alle aßen und tranken, so viel sie konnten, sah die Priesterinnen und Priester in ihren feierlichen Roben, die die Leute der Stadt bei ihren Opfergaben und Gebeten anleiteten. Sie hatte ein vages Bild von einem großen Innenhof im Kopf, aber an den Rest des Gebäudes konnte sie sich nicht erinnern: weder an Farbe noch Größe, nichts. Gab es dort Bäume? Sie hatte eine undeutliche Erinnerung daran, wie sie sich streckte, um mit den Fingerspitzen eine silbergraue Baumrinde zu berühren. Am wenigsten konnte sie sich aber den König in diesem Palast vorstellen. Sie versuchte, sich zu erinnern, ob er einen Bart hatte oder nicht, ob er dunkle oder helle Augen hatte, ob sein Haar schwarz war wie das der meisten Menschen in Theben, oder heller. Ob er dick oder dünn war, groß oder am Hals nach vorne gebeugt wie eine Schildkröte. Sie biss sich auf die Lippe, als ihr klar wurde, dass sein Haar sehr wahrscheinlich grau war, welche Farbe auch immer es einmal gehabt haben mochte. Vielleicht hatte er ja auch eine Glatze. Sie versuchte, den sauren Geschmack zu unterdrücken, der ihr in die Kehle stieg.
Jokaste schaute zur Statue der Artemis auf. Die Göttin saß ruhig und gelassen auf ihrem Thron, ihr Haar war an ihrem Hinterkopf zu ordentlichen Zöpfen geflochten. Sie hatte einen Bogen in der Hand und einen Köcher mit Pfeilen an ihrer Seite. Der Köcher war mit Rehen dekoriert, die zwischen Bäumen mit leuchtend grünen Blättern herumsprangen. »Bitte«, sagte Jokaste, schaute zu der Figur auf und griff nach dem kalten, steinernen Saum ihres Umhangs. »Mach, dass er mich nicht anfasst. Bitte.«
Sie starrte die aufgemalten Augen an, bekam aber keine Antwort. Zeus nickt, sagte man in Theben. Wenn er einer Bitte stattgibt, nickt er. Aber nickte Artemis auch? Vielleicht würde die Göttin verstehen, wie wichtig das hier war, wenn sie ihr direkt in die Augen starrte und kein einziges Mal blinzelte. Sie hielt durch, so lange sie konnte, aber irgendwann traten ihr Tränen in die Augen und sie schaffte es nicht länger, die Augen offen zu halten. Hatte sie sich eingebildet, dass sich der Kopf der Statue bewegt hatte? Sie wischte sich mit ihrer kleinen, blassen Hand die Tränen ab. »Danke«, flüsterte sie, nur für den Fall.
*
Am nächsten Tag kam die Schneiderin. Ihr graues Haar war nach hinten gekämmt, sodass das grelle Sonnenlicht jede Falte ihres zerknitterten, gebräunten Gesichts hervorhob. Sie hatte zwei Rollen Stoff mitgebracht, in zwei verschiedenen Rottönen. Jokaste fragte sich, ob ihre Mutter die Stoffe ausgesucht hatte. Der Chiton, der daraus genäht werden würde, würde für einen warmen Sommertag viel zu dick und schwer sein. Jokastes Meinung hatte jedenfalls niemanden interessiert. Aber sie fragte die Schneiderin nicht, falls es die einzigen Stoffe waren, die sie hatte. Vielleicht war den Färbern nicht genug Zeit geblieben, an einem neuen Stoff zu arbeiten. Außerdem war es eine unausgesprochene Regel in Theben, dass man sich über Notstände nicht beklagte. Alle wussten, dass der König und der Ältestenrat ihr Bestes taten, um die Versorgung der Stadt sicherzustellen. Aber mit den Sphinx in den Bergen – direkt vor den Mauern der Stadt, wie die Leute manchmal sagten – brauchte man sich nicht zu wundern, wenn die Versorgung ab und an unterbrochen wurde. Jokaste versuchte, sich nicht auszumalen, wie sie in dem safranfarbenen Stoff ausgesehen hätte, der ihr lieber gewesen wäre. Sie versuchte auch, nicht daran zu denken, wie sie jetzt stattdessen in einem blutfarbenen Kleid aussehen würde.
Wenigstens war der zweite Stoff – der für Umhang und Schleier – dünner und leichter, sodass sie zumindest etwas Luft bekommen würde. Sie sagte nichts und stand gehorsam auf dem kleinen, hölzernen Schemel, während die alte Frau den Stoff um ihre Taille legte und die Säume absteckte. Sie hielt die Nadeln zwischen ihren dünnen Lippen, die sich krampfhaft zusammenzogen, damit die Nadeln nicht hinausfielen. Wenn die Frau nach einer griff, blieb ihr Blick stets auf den Stoff gerichtet, und trotzdem kratzte sie sich kein einziges Mal.
Es war das erste Kleid, das speziell für Jokaste angefertigt wurde. All ihre anderen Kleider waren von einem anderen Mädchen getragen worden, bevor Jokaste sie bekommen hatte. Sie dachte darüber nach, wie viel Spaß sie bei dieser Anprobe gehabt hätte, wenn die Umstände andere gewesen wären, und sie nicht solche Angst vor dem gehabt hätte, was ihr bevorstand. Die Schneiderin tippte ihr Bein an. »Stell dich gerade hin«, sagte sie, »sonst wird der Saum schief.« Jokaste zog ihren Rippenbogen ein und schaute auf die gegenüberliegende Wand. Ihr Haus war für thebanische Verhältnisse recht groß, um einen kleinen Innenhof herum erbaut, in dem Kräuter und Blumen unter der sengenden Sonne ums Überleben kämpften. Doch in diesem Moment fühlte sie sich beengt, als würde das Haus sich schon jetzt darauf vorbereiten, sie auszustoßen.
Am nächsten Tag kam die alte Frau mit dem fertigen Kleid zurück. War sie die ganze Nacht auf gewesen, um es zu nähen? Jokaste schlüpfte hinein, und die gerunzelte Stirn der Schneiderin wurde ein bisschen glatter.
»Das geht«, sagte sie. »Denk an mich, wenn du das nächste Mal neue Kleider kaufst, in Ordnung?« Jokaste war das unangenehm. Es war das erste Mal, dass sie jemand behandelte, als besäße sie etwas, das andere begehrten.
»Wie habt Ihr das so schnell geschafft?«, fragte sie.
Die alte Frau zuckte die Achseln. »Ich musste«, sagte sie. »Du brauchst es ja morgen.«
*
Als Jokaste am Morgen ihres Hochzeitstages aufwachte, war sie sich nicht sicher, ob die Sonne schon aufgegangen war. Schwaches Licht drang durch den dicken Vorhang, der ihr Fenster verdeckte. Sie spähte daran vorbei, um zu sehen, wie früh es noch war, ohne ihren kleinen Bruder zu wecken. Der Himmel war blassgrau, und das Licht noch schwach. Es mussten sich in der Nacht Wolken über dem See gebildet haben, die die Sonne erst später durchdringen würde. Jokaste konnte die süßen Früchte der Mandelbäume vor dem Fenster riechen. Sie waren fast reif und würden bald gepflückt werden.
Sie legte sich wieder hin und versuchte herauszufinden, wie sie sich fühlte. Wenigstens würde es für ihre Reise durch die Stadt vergleichsweise kühl sein. Aber ihr war definitiv zu übel, um etwas zu essen, bevor sie ging. Sie hörte gedämpfte Geräusche aus dem Zimmer ihrer Mutter. Sie mussten heute früh aufbrechen, um sich auf den Weg zum Palast zu machen.
Jokaste blieb noch für fünf weitere Atemzüge still liegen, spürte das kühle Laken, das sich um ihre Knöchel und Waden schlang, das warme, weiche Kissen unter ihrem Kopf. Dann setzte sie sich auf und stellte ihre Füße leise auf den Boden, in der Hoffnung, noch ein bisschen länger für sich zu sein. Aber als sie sich zur Tür hinausschlich, stieß sie fast mit ihrer Mutter zusammen, die schon angefangen hatte, sich auf den Tag vorzubereiten, als es noch dunkel gewesen war. Ihr Haar war straff geflochten und dann in einem Stil gedreht, der früher einmal modisch gewesen war, und ihre Augen waren mit dicker, schwarzer Farbe umrandet. Ihre Mutter hatte es perfektioniert, mit Jokaste zu sprechen, ohne sie anzuschauen, also hatte Jokaste gelernt, dasselbe zu tun. Sie richtete ihren Blick stattdessen auf das weiße Kleid ihrer Mutter, das mit leuchtend blauem Garn gesäumt war. Der Rock war zu weit und stand unter dem dünnen Lederriemen, der das Kleid an der Taille ihrer Mutter zusammenhielt und ihre Hüften viel breiter aussehen ließ, ab. Doch Jokaste wusste, dass es sinnlos wäre, ihr anzubieten, es zu richten. Der Riemen war passend zu den Stickereien gefärbt worden, und hatte schon jetzt einen leichten Abdruck auf dem sonnengebleichten, weißen Stoff hinterlassen. Ihre Mutter würde rasend vor Wut sein, wenn sie das bemerkte. Vielleicht würde sie das ganze Kleid blau färben lassen, um den Abdruck zu verbergen.
»Wir müssen bald los«, sagte ihre Mutter. »Die Sklavinnen werden dir helfen, dich vorzeigbar zu machen.«
Jokaste nickte, sagte aber nichts. Die Dienstmägde ihrer Mutter hatten noch nie angeboten, ihr zur Hand zu gehen, weil sie wussten, dass ihre Mutter das nicht wollte. Der Morgen ihres Hochzeitstages war also das erste Mal, dass ihr jemand beim Ankleiden half, seit sie alt genug war, das selbst zu machen. Jokaste fand die harten, trockenen Hände der Frauen auf ihrer Haut unangenehm. Sie versuchte, nicht an die Berührungen des Königs zu denken, dessen Hände ebenfalls alt und trocken sein würden.
Wenig später trug sie ihr neues Kleid – eine einfache rote Tunika mit einem geflochtenen, braunen Gürtel an der Taille. Ihr dunkles Haar war noch offen. Das Rot ließ ihre blasse Haut noch blasser aussehen, aber die Schneiderin hatte die Stiche eng und gleichmäßig gesetzt. Falls sie bei Kerzenlicht mit dem Stoff gearbeitet hatte, hatte das ihre Nähkünste nicht beeinträchtigt. Und selbst Jokastes Mutter hatte einmal gesagt, dass ihre Tochter schöne Haut hatte, die nie von Unreinheiten entstellt oder von der Sonne gebräunt wurde. Die Magd zog Jokastes Haar nach hinten, formte es zu einem Knoten, drehte ihn dreimal und wickelte dann bunte Bänder darum, die die Frisur zusammenhielten. Anschließend steckte sie eine Nadel mit einer Spitze aus Silber und Elfenbein in den Knoten und verletzte dabei auch die Kopfhaut. Jokaste verzog das Gesicht, sah aber, dass die Frau wusste, was sie tat: Ihr Haar würde jetzt genau dort bleiben, wo es sein sollte.
Einen schrecklichen Moment lang dachte Jokaste, die Zofe würde ihre Augen so anmalen wie die ihrer Mutter, aber die Frau ersparte sich die Mühe und so griff Jokaste nach dem hübschen Aryballos, das ihr Vater ihrer Mutter vor Kurzem geschenkt hatte. Es hatte die Form eines Schafbockes, dessen Hörner sich wie Locken um seine Ohren ringelten. Sie tauchte die Finger in das nach Rosen duftende Olivenöl und steckte den Korken zurück in den geduldigen Kopf des Bockes. Gerade wollte sie das Gefäß wieder in das Ankleidezimmer ihrer Mutter zurückbringen, als sie es sich anders überlegte und das Fläschchen in die Tasche mit ihrer Kleidung und anderen Besitztümern legte.
Sie eilte zur Eingangshalle des Hauses, wo der Rest ihrer Familie auf sie wartete. Ihre Mutter musterte sie von oben bis unten und meinte, dass es so wohl gehen würde. Ungeduldig zeigte sie auf die Tür und scheuchte ihre Tochter hindurch. Jokaste schritt durch die verwitterte Holztür und betrachtete ein letztes Mal die winzigen Ritzen zwischen den Brettern, die nicht mehr ganz genau zusammenpassten. Sie hatte erwartet, tieftraurig zu sein, wenn sie zum letzten Mal ihr Zuhause verließ. Stattdessen empfand sie in diesem Moment fast nichts, außer vielleicht ein bisschen Schadenfreude bei dem Gedanken an den kleinen Terrakottaschafbock in ihrer Tasche.
*
Auf der anderen Seite der Stadt sah sie die hohe Stadtmauer, die sich über den Häusern erhob. Der Palast befand sich auf dem höchsten Hügel Thebens, wie ein Wachturm. Es war definitiv ein prächtiges Gebäude, aber es sah eher wie ein Tempel oder eine Schatzkammer aus. Beides gab es dort drinnen natürlich, doch Jokaste konnte sich schwer vorstellen, dass dort auch Menschen lebten, und unmöglich, sich vorzustellen, dass sie selbst dort leben würde. Ihr kleiner Bruder hüpfte von einem Bein aufs andere. Er war einerseits aufgeregt wegen des Ausflugs: Die Aussicht auf eine Zeremonie am anderen Ende der Stadt, auf ein Festessen und Tänze erfreuten sein fünfjähriges Herz über alle Maßen. Andererseits war ihm zunehmend unbehaglich, weil er nicht verstand, wie es sein konnte, dass seine Schwester nicht mehr mit ihm zusammenleben würde.
»Ich komme dich jeden Tag besuchen«, hatte er gesagt und ihr die Arme um den Hals geschlungen, als sie ihm erklärt hatte, dass sie nach der Hochzeit ausziehen würde. Sie hatte genickt und so getan, als ob sie ihm glaubte. Jokaste war überrascht, als sie die kleine Kutsche sah, die vor dem Haus wartete. Zwei widerspenstige Pferde waren davor gespannt. Ihr Bruder begutachtete sie misstrauisch, denn er hatte schon einmal versucht, eines zu streicheln.
»Eine angemessene Respektsbezeugung des Königs«, sagte ihr Vater.
»Das ist nicht die beste Kutsche, die er hat«, erwiderte ihre Mutter und begutachtete das Gespann wehmütig. Es sah ganz so aus, als hätte man im königlichen Haushalt vergessen, dass sie zu viert waren. Es würde eng hinter den dunklen Vorhängen werden, die von der hölzernen Decke herabhingen. Jokastes Vater sprach kurz mit dem Kutscher, dann banden sie neben der Tasche mit ihren Habseligkeiten eine Truhe aufs Dach: ihre Mitgift. Sie fragte sich, wie viel Gewicht die dicken Planken der Truhe ausmachten, und wie viel das Edelmetall darin. Würde es ihr erlaubt sein, den Schmuck zu tragen, oder würde er direkt in die Schatzkammer ihres Ehemannes wandern?
Sie stieg in die Kutsche und setzte sich ganz ans Ende der Sitzbank. Ihr Bruder rannte einmal um das Gespann herum, um sich ihr gegenüberzusetzen. Jokaste fühlte die Erleichterung wie einen Stich, als ihr Vater sich neben sie auf die schmale Bank quetschte: Wenigstens würde sie auf dem Weg nicht das Gesicht dieses Verräters sehen müssen. Ihre Mutter konnte sie viel leichter ignorieren. Sie stand kurz auf und zupfte ihr Kleid zurecht, wollte verhindern, dass die Rückseite zerknitterte, wenn sie sich wieder setzte. Aber der Kutscher hatte es eilig und trieb die Pferde zu einem Trab an, sodass sich die Kutsche ruckartig in Bewegung setzte, Jokaste auf ihren Sitz zurückfiel und ihr Bruder kichernd nach vorne in ihren Schoß purzelte.
Die vielen Schlaglöcher ließen ihre Zähne aufeinanderschlagen, während sie sich den Hügel hinabarbeiteten. Jokaste drehte sich der Magen um, und sie war jetzt froh, dass sie es nicht geschafft hatte, etwas zu essen. Selbst ihr Bruder – der sich beim Anblick der Kutsche so gefreut hatte – erkannte nun, da sie den niedrigsten Punkt erreicht hatten und langsam den Hügel in Richtung des Palastes hinaufkrochen, dass sie damit kaum schneller waren als zu Fuß. In Theben wurden Pferdegespanne normalerweise nur benutzt, um schwere Dinge durch die Stadt zu transportieren. Jokaste hoffte, dass man jetzt nicht von ihr erwartete, dass sie nur noch per Kutsche reiste. Zu Fuß konnte sie zumindest den tiefsten Furchen ausweichen, mochte der Boden auch noch so staubig sein. Die Kutsche holperte so heftig über eine weitere Vertiefung, dass Jokaste sich fragte, ob die Achse unter ihrer Sitzbank den Weg zum Palast überstehen würde. Sie hoffte fast, dass sie das nicht täte, dass eines der Räder brechen und hinter ihnen den Hügel hinabrollen würde, damit sie einen Grund hatten, auszusteigen und zu Fuß zu gehen. Aber es war erdrückend heiß, selbst jetzt, da sie die Vorhänge geöffnet hatten (ihre Mutter hatte letztendlich doch zugestimmt, nachdem ihr Bruder zweimal darum gebeten hatte).
Sie hatten den niedrigsten Teil der Stadt durchquert, wo immer ein reges Treiben herrschte, wenn es nicht gerade im Winter eine Überschwemmung gab. Heute schien es ungewöhnlich ruhig zu sein, obwohl Jokaste wusste, dass das Wasser längst versickert war. Als sie endlich den Fuß des Palasthügels erreichten, dachte sie, dass sie vielleicht ein paar der Gebäude wiedererkennen würde. Aber durch die Fenster einer schwankenden Kutsche sah alles anders aus als zu Fuß. Auch hier war alles wie ausgestorben, obwohl es doch jetzt sicher spät genug war, dass die Leute in der Stadt unterwegs waren. Aber viele Ladenfronten waren noch geschlossen, auch wenn gemalte Schilder erahnen ließen, dass die Essensbuden und Tavernen später geöffnet sein würden.
Je weiter ihre Kutsche den Hügel hinaufkroch, desto größer wurden die Gebäude. Endlich waren auch ein paar Menschen auf der Straße, auch wenn irgendetwas seltsam an ihnen war, das Jokaste nicht einordnen konnte. Letztendlich war es ihr Bruder, der verstand, was es war. »Guck mal«, sagte er, griff nach ihrem Handgelenk und zeigte mit dem Finger nach draußen. »Alle gehen in dieselbe Richtung. Ist das nicht komisch?« Da wurde ihr klar, dass er recht hatte: Ohne Ausnahme gingen alle bergauf. Je weiter sie fuhren, desto mehr Menschen waren auf der Straße. Männer und Frauen bahnten sich eilig ihren Weg durch die Menge und verliehen der Stadt einen zielstrebigen Eindruck.
Als der Kutscher die erschöpften Pferde zum Stehen brachte, brannte die Sonne hoch über ihnen am Himmel. Die morgendlichen Wolken waren verdunstet, genau, wie Jokaste gedacht hatte. Ihr Bruder schob die Finger am Vorhang vorbei und berührte das Dach, bevor er sie mit übertrieben schmerzverzerrtem Gesicht wieder zurückzog. Jokaste wäre am liebsten ausgestiegen und zu Fuß gegangen, egal, wie weit es noch war, aber ihre Mutter stieß ihr einen sorgfältig gefeilten Fingernagel in die Seite. »Warte hier, und lass deinen Bruder nicht raus«, sagte sie. Sie stieg mit Jokastes Vater, der nie eine Menschenmasse sah, ohne davorstehen zu wollen, (Was er ihnen wohl heute verkaufen konnte?), aus der Kutsche.
Aber die Menge hatte keine Augen für ihren Vater. Sie starrten an ihm vorbei auf die verdunkelten Fenster der Kutsche und versuchten, durch den Vorhang zu schauen, der wieder zugefallen war, als ihre Eltern ausgestiegen waren. Es dauerte einen Moment, bis Jokaste klar wurde, dass es noch etwas gab, was sie alle gemeinsam hatten: Sie trugen ihre besten Kleider. Zerrissene Umhänge waren geflickt, weiße Tuniken waren heller gebleicht worden als sonst. Jokaste stellte sich vor, wie die Kleidungsstücke auf den Steinen gelegen hatten und alle Farben von der grellen Mittagssonne aufgesogen worden waren. Die Riemen der Ledersandalen waren symmetrisch gebunden, Füße und Knöchel so gut es ging vom roten Staub befreit. Wer Schmuck trug, hatte ihn poliert: Dunkle Steine glänzten in hellem Metall. Die Leute, die die Kutsche anstarrten, waren nicht zufällig hier. Sie waren Hochzeitsgäste, es konnte nicht anders sein.
»Komm«, sagte sie zu ihrem Bruder und verdeckte ihr Gesicht mit dem Schleier, damit niemand ihr Unbescheidenheit vorwerfen konnte. »Nichts wie raus.« Seine Augen funkelten, als sie den Vorhang öffnete, damit er aussteigen konnte. Ihre Eltern waren in ein Gespräch mit einer kleinen Gruppe von Männern vertieft. Jokaste blinzelte im hellen Sonnenlicht und schaute sich um.
Sie standen direkt vor dem Palast, das sah sie jetzt, oben auf der Zitadelle. Sie hätte gerne ihre Arme und ihren Nacken gestreckt, die von der holprigen Reise ganz angespannt waren, aber unter den Blicken so vieler Leute traute sie sich nicht. Sie schaute auf die Straße zurück, die sie heraufgekommen waren. Ein holpriger Pfad bog von der Hauptstraße ab und führte um den großen Platz vor den Palasttoren – den Marktplatz von Theben – herum, wo sie jetzt standen. Es waren mehr Menschen hier versammelt, als sie je zuvor in ihrem Leben gesehen hatten, sogar bei Feierlichkeiten. Ihr Bruder, der normalerweise unbedingt sofort alles hören und sehen wollte, war plötzlich schüchtern.
Der Palast wirkte jetzt, da sie danebenstand, weniger imposant. Seine strahlende Perfektion war aus der Nähe betrachtet gar nicht so perfekt: Genau wie bei ihrer Puppe war die Farbe verblasst und stellenweise abgeblättert, und der Boden unter ihren Füßen hatte Risse. Aber das Gebäude war viel größer, als sie es in Erinnerung hatte. Sie sah es nicht vollständig, sondern konnte nur den Blick an seiner Vorderseite entlangwandern lassen, bis sich der Winkel veränderte und der Rest des Palastes aus dem Blickfeld verschwand. Die Rückseite musste am Hang liegen, vor den Olivenhainen und dem Wein, der auf dem steilen, felsigen Hang wuchs. Knorrige alte Apfelbäume säumten die Mauern. Im Inneren des Palastes mochten sie Schatten spenden, doch davor, wo die Menschen in der Sonne warteten, hatten ihre Wurzeln sich einen Weg durch die Oberfläche des Platzes gebahnt, sodass die Steinplatten noch unebener lagen und teilweise zerbrochen waren. Die dunklen Berge, die sich südlich von Theben hinter dem Palast zum Himmel erhoben, ließen das Gebäude noch kleiner aussehen. Jokaste war noch nie nah genug gewesen, um die einzelnen Nadelbäume an ihren hohen Hängen zu sehen: Sie waren zuvor immer nur ein dunkelgrüner Teppich gewesen.
Plötzlich hörte sie ein seltsames, widerhallendes Geräusch. Sie schaute zum Palast hinüber und sah, dass der Lärm von der Menschenmenge ausging. Einige hatten zu klatschen begonnen, und mehr und mehr beteiligten sich an diesem Applaus. Ihre Mutter drehte sich um, um zu sehen, was vor sich ging. Ihr Blick folgte dem der Menge, und sie sah, dass sich ihre Tochter dem Befehl, in der Kutsche zu bleiben, widersetzt hatte. Jokaste befürchtete kurz, dass ihre Mutter sie anschreien und vor all diesen Menschen bloßstellen würde. Dann wurde ihr klar, dass es diesen Gästen völlig egal war, was ihre Mutter dachte oder tat. Sie interessierten sich nur für Jokaste, und ihre Mutter konnte im Beisein der Menge nichts daran ändern. Jokaste schaute auf, blickte ihre Mutter einen Moment lang intensiv an, bevor sie sich zu den Fremden, die ihr Beifall klatschten, umdrehte, sie anlächelte und ihnen zuwinkte. Sie konnte nichts daran ändern, was ihre Eltern getan hatten. Aber sie würde nie wieder Angst vor ihnen haben.
*
Hinterher würde Jokaste so gut wie keine Erinnerung an ihren Gamos haben. Noch während die Hochzeit stattfand, verblassten die Erinnerungen daran auch schon wieder. Sie erinnerte sich nur an unwichtige Dinge: die dunklen Beeren, die von den Bäumen gefallen waren und mit ihrem violetten Saft den Boden befleckten; ein filigraner Haarschmuck aus gekräuseltem Gold, der mit blutroten Steinen besetzt war und im Haar einer verrunzelten alten Frau steckte, den Jokaste aber nur zu gerne selbst getragen hätte, sodass er im Kontrast zu ihrem dunklen Haar geglänzt hätte, statt mit den dünnen, weißen Strähnen der Frau zu konkurrieren; die Prozession der unverheirateten Mädchen mit den hellen, Krokus-gelben Bändern im Haar, die um sie herum tanzten, um ihre Ankunft zu feiern, und die dunklen, aufmerksamen Augen der gleichaltrigen Jungen, die jeden Schritt bewunderten, den die Mädchen machten; die deutlich spürbare Selbstzufriedenheit ihres Vaters; der Geruch nach verkohltem Fleisch, als der Priester seine andächtigen Opfergaben darbrachte; das Klirren der goldenen und silbernen Armreife ihrer Mutter, als sie sich theatralisch eine nicht existente Träne abwischte.
Aber der Gamos selbst, der Moment, in dem sie mit Laios vermählt wurde, der sie mit seinem schütteren weißen Haar und den buschigen Brauen an einen Fuchs erinnerte, der Moment, in dem man ihr zum Zeichen ihres neuen Status ein zierliches goldenes Diadem aufsetzte? An die Menschenmassen aus ganz Theben, die ihrer neuen Königin zujubelten, während die Priester in einem riesigen zeremoniellen Krater Wein und Wasser mischten? An den Geschmack des Weins, den sie und ihr Mann aus einer großen Kylix tranken, um ihren Bund vor den Gottheiten zu besiegeln? Daran erinnerte sich Jokaste nicht.
In den folgenden Jahren würde sie sich fragen, ob sie auf der Nordseite oder auf der Südseite des Hofes gestanden hatten; ob sie den Gottheiten am Hauptaltar oder an einem der kleineren Altäre Wein ausgegossen hatten; ob die Nachmittagssonne durch die Säulenhalle geschienen hatte, als der Tag sich dem Ende zuneigte, oder ob ein abendlicher Regenschauer über der Menschenmenge niedergegangen war. Jokaste würde nie sicher wissen, was in den vielen Stunden zwischen dem Moment, in dem sie aus der Kutsche gestiegen und durch die Palasttore geschritten war, und dem Moment, in dem sie in ihrem neuen Schlafgemach zum ersten Mal wieder allein war, wirklich passiert war.
*
Jokaste graute es den ganzen Tag über vor der Nacht. Sie wusste in etwa, was ihr Ehemann von ihr erwarten würde: Sie war nicht dumm – und auch nicht völlig naiv –, obwohl sie, abgesehen von ihrem Bruder, ohne Kontakt zu Jungen aufgewachsen war. Mädchen redeten schließlich miteinander. Jokaste hatte grundsätzlich nichts gegen diesen Teil der Ehe einzuwenden, sie hatte nur immer angenommen, dass der Mann, mit dem sie das Bett teilen würde, nicht so alt sein würde, dass bereits dicke, borstige Haare ohne Vorwarnung aus seiner Nase und seinen Ohren hervorschossen. Sie hatte eher an jemanden gedacht, dessen Haut im Licht der Nachmittagssonne golden glänzte, jemanden, der sich ohne ein ganzes Konzert aus Schnaufen und knackenden Gelenken bewegen konnte. Stattdessen konnte sie an fast nichts anderes denken als daran, wie abstoßend sie seinen Körper fand. Ihr Ehemann war alt, einer unter vielen alten Männern, die einander den ganzen Tag lang begeistert zugezwinkert oder sich gegenseitig den Ellbogen in die Seite gestoßen hatten und darüber lachten, wie unangenehm ihr die Situation offensichtlich war. Sie hasste sie alle.
Der Nachmittag wurde zum Abend, und das Fest ging weiter. Die alten Männer – darunter auch der König – tranken sehr viel Wein, den ihnen junge Sklaven in aufeinander abgestimmten, dunkelgrauen Tuniken einschenkten. Jokaste war hin und her gerissen: Sie hätte diesen Jungen, die die einzigen waren, die den Palast wirklich zu kennen schienen, gerne Fragen gestellt, wollte vor ihnen aber auch nicht dumm dastehen – schließlich waren sie jetzt ihre Sklaven. Sie fragte sich, ob sie selbstbewusster werden würde, wenn sie auch Wein trank. Aber allein der Gedanke an den sauren Geschmack ließ ihr die Galle hochkommen.