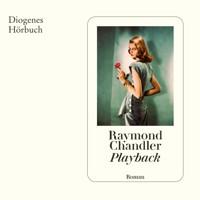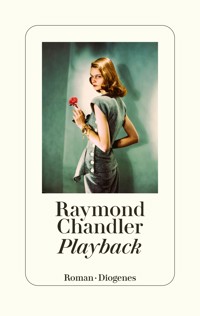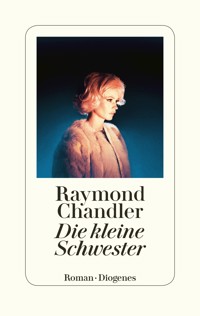
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Krimi
- Serie: Philip Marlowe
- Sprache: Deutsch
Orfamay Quest kommt aus der Provinz nach Los Angeles. Sie sorgt sich um ihren vermissten Bruder. Das ist die Version, die sie Privatdetektiv Philip Marlowe auftischt. Die Spur führt hinter die Kulissen von Hollywood, wo Orfamays große Schwester ein Leinwandstar ist. Marlowe gerät in eine Welt aus Gangstern und Glamour, Cops und Fedoras. Ein Meisterwerk mit wunderbarster Film-noir-Atmosphäre. Und gleichzeitig eine gnadenlose Entlarvung der Traumfabrik. Fortsetzung der Neuedition der ›Philip-Marlowe‹-Romane. Chandlers großer Hollywood-Roman in brillanter Neuübersetzung von Robin Detje. Mit einem Nachwort von Michael Connelly.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 384
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Raymond Chandler
Die kleine Schwester
Roman
Aus dem Amerikanischen von Robin Detje
Mit einem Nachwort von Michael Connelly
Diogenes
1
›Philip Marlowe … Ermittlungen‹ steht in schwarzen Buchstaben auf dem Riffelglas, und die Farbe blättert ab von der recht schäbigen Tür. Sie befindet sich am Ende eines recht schäbigen Flurs in der Sorte Haus, die modern war, als gerade das ganzgeflieste Badezimmer zum Grundpfeiler der Zivilisation erklärt wurde. Die Tür ist abgeschlossen, aber gleich daneben gibt es eine zweite mit der gleichen Aufschrift, die nicht abgeschlossen ist. Keiner zu Hause, nur ich und eine dicke Schmeißfliege – immer herein mit Ihnen! Aber nur, wenn Sie nicht aus Manhattan, Kansas kommen.
Es war einer dieser hellen, klaren sommerlichen Morgen, wie wir sie in Kalifornien im Vorfrühling kennen, bevor der Hochnebel kommt. Es regnet nicht mehr. Die Hügel sind noch grün, und vom Tal gegenüber den Hollywood Hills aus sieht man oben auf den Bergen den Schnee. Die Pelzgeschäfte machen Werbung für den Schlussverkauf, die auf sechzehnjährige Jungfrauen spezialisierten Freudenhäuser boomen. Und in Beverly Hills knospen die Jacaranda-Bäume.
Seit fünf Minuten war ich hinter der Schmeißfliege her und wartete, dass sie sich setzte. Sie wollte aber nicht. Sie wollte einfach ihre Schleifen fliegen und den Prolog des Bajazzo singen. Ich hielt die Fliegenklatsche hoch erhoben. Auf einer Schreibtischecke gab es einen sonnenbeschienenen Fleck, früher oder später würde sie dort landen. Aber als es so weit war, merkte ich es erst gar nicht. Das Brummen hatte aufgehört, und sie hockte einfach da. Und dann klingelte das Telefon.
Zentimeterweise arbeitete meine linke Hand sich zum Hörer vor. Langsam hob ich ab und sagte leise: »Bitte bleiben Sie einen Augenblick dran.« Ich legte den Hörer vorsichtig auf der braunen Schreibunterlage ab. Sie war noch da, schimmernd, blaugrün und verdorben. Ich atmete tief durch und schlug zu. Ihre Überreste segelten durchs halbe Zimmer auf den Teppich. Ich hob sie an dem einen Flügel, der heil geblieben war, auf und warf sie in den Papierkorb.
»Danke für Ihre Geduld«, sagte ich ins Telefon.
»Spricht dort Mr. Marlowe, der Detektiv?« Eine hohe, hastige Kleinmädchen-Stimme. Ja, hier sei Marlowe, der Detektiv, erklärte ich. »Was berechnen Sie für Ihre Dienste, Mr. Marlowe?«
»Kommt ganz darauf an, was ich tun soll.«
Die Stimme wurde ein wenig spitz. »Das kann ich Ihnen kaum am Telefon sagen. Die Angelegenheit ist – höchst vertraulich. Bevor ich meine Zeit verschwende und zu Ihnen ins Büro komme, müsste ich ungefähr wissen …«
»Vierzig Dollar am Tag plus Spesen. Es sei denn, die Sache lässt sich mit einer Pauschale regeln.«
»Das ist viel zu viel«, sagte die dünne Stimme. »Oh, das könnte Hunderte Dollar kosten, und ich habe nur ein kleines Gehalt und …«
»Wo sind Sie jetzt?«
»Oh, in einem Drugstore. Gleich neben dem Haus, in dem Sie Ihr Büro haben.«
»Die fünf Cent hätten Sie sich sparen können. Der Fahrstuhl kostet nichts.«
»Der … wie bitte?«
Ich wiederholte alles Wort für Wort. »Kommen Sie rauf und lassen Sie sich ansehen«, fügte ich hinzu. »Wenn Ihre Probleme mir gefallen, kann ich Ihnen ziemlich genau sagen …«
»Ich muss vorher mehr über Sie wissen«, sagte die dünne Stimme entschlossen. »Es ist eine sehr delikate Angelegenheit, höchst privat. Darüber kann ich nicht einfach mit jedem reden.«
»Wenn die Sache so delikat ist«, sagte ich, »brauchen Sie vielleicht eine Frau als Detektiv.«
»Mein Gott, ich hatte keine Ahnung, dass es so etwas gibt.« Pause. »Aber ich glaube nicht, dass eine Frau mir helfen könnte. Wissen Sie, Orrin hat in einer ganz schlimmen Gegend gewohnt, Mr. Marlowe. Ich fand sie jedenfalls schlimm. Der Verwalter des Fremdenheims ist ein wirklich unangenehmer Mensch. Er hatte eine Schnapsfahne. Trinken Sie, Mr. Marlowe?«
»Jetzt wo Sie es sagen …«
»Ich glaube, einen Detektiv, der Alkohol in irgendeiner Form zu sich nimmt, möchte ich lieber nicht beschäftigen. Ich bin sogar gegen Tabak.«
»Aber eine Orange darf ich mir schälen?«
Am anderen Ende der Leitung hörte ich es japsen. »Sie könnten wenigstens wie ein Gentleman reden«, sagte sie.
»Versuchen Sie es lieber im University Club«, sagte ich. »Da sollen noch welche rumlaufen, aber ich weiß nicht, ob man Sie ranlässt.« Ich legte auf.
Das war ein Schritt in die richtige Richtung, aber er ging nicht weit genug. Ich hätte abschließen und mich unter dem Schreibtisch verkriechen sollen.
2
Fünf Minuten später klingelte es an der Tür zu dem halben Büro, das ich als Wartezimmer nutze. Ich hörte die Tür gehen. Die Durchgangstür war nur angelehnt. Ich lauschte und folgerte, dass sich jemand im Büro geirrt hatte und wieder verschwunden war. Da klopfte es leise. Ein leises Hüsteln zum selben Zweck. Ich nahm die Füße vom Tisch, stand auf und ging nachsehen. Da war sie. Sie musste nicht erst den Mund aufmachen, ich wusste es auch so. Nie hätte jemand weniger nach Lady Macbeth aussehen können. Sie war ein kleines, braves adrettes Mädchen mit glatten braunen Haaren in steifer Frisur und einer randlosen Brille. Sie trug ein braunes Schneiderkostüm, und über der Schulter hing ihr eine jener klobigen Taschen, die an eine barmherzige Schwester denken ließen, mit dem Verbandszeug auf dem Weg zu den Verwundeten. Auf den glatten braunen Haaren saß ein ausrangierter Hut ihrer Mutter. Sie trug kein Make-up, keinen Lippenstift und keinen Schmuck. Mit der randlosen Brille sah sie nach Bibliothekarin aus.
»Das ist keine Art, mit Menschen am Telefon zu reden«, sagte sie streng. »Sie sollten sich schämen.«
»Ich lasse es mir nur nicht anmerken, aus lauter Stolz«, sagte ich. »Treten Sie ein.« Ich hielt ihr die Tür auf. Dann rückte ich ihr einen Stuhl zurecht.
Sie setzte sich auf die vordersten zwei Zentimeter der Stuhlkante. »Wenn ich so mit einem von Dr. Zugsmiths Patienten reden würde«, meinte sie, »wäre ich meine Stellung los. Er ist da sehr empfindlich – selbst bei den schwierigen Fällen.«
»Wie geht es dem alten Knaben? Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit ich damals vom Garagendach gefallen bin.«
Sie sah mich überrascht und sehr ernst an. »Aber Dr. Zugsmith können Sie unmöglich kennen.« Zwischen ihren Lippen ging die Spitze einer eher anämischen Zunge ins Leere.
»Ich kenne einen Dr. George Zugsmith«, sagte ich, »in Santa Rosa.«
»O nein. Hier geht es um Dr. Alfred Zugsmith in Manhattan. Manhattan, Kansas, wissen Sie, nicht Manhattan, New York.«
»Das muss ein anderer Dr. Zugsmith sein«, meinte ich. »Und Sie heißen?«
»Ich weiß noch nicht, ob ich Ihnen das verraten möchte.«
»Sind hier nur auf Schaufensterbummel, was?«
»So könnte man es nennen. Bevor ich meine Familienangelegenheiten vor einem völlig Fremden ausbreite, muss ich mir sicher sein, dass er mein Vertrauen verdient.«
»Hat Ihnen schon mal jemand gesagt, dass Sie ein steiler Zahn sind?«
Die Augen hinter den randlosen Gläsern blitzten. »Das will ich nicht hoffen.«
Ich griff nach meiner Pfeife und fing an, sie zu stopfen. »Hoffen ist das falsche Wort«, sagte ich. »Lassen Sie den Hut weg und besorgen Sie sich eine von diesen Katzenaugenbrillen mit buntem Gestell. Sie wissen schon, die mit den schrägstehenden Gläsern, irgendwie exotisch …«
»Das würde Dr. Zugsmith nie erlauben«, sagte sie schnell. Dann fragte sie: »Meinen Sie wirklich?« Wobei sie zart errötete.
Ich hielt ein Zündholz an die Pfeife und paffte Rauch über den Schreibtisch. Sie wich zurück.
»Wenn Sie mich engagieren«, sagte ich, »dann bin es ich, den Sie engagieren. So wie ich bin. Wenn Sie glauben, dass Sie in diesem Geschäft einen Laienprediger finden werden, sind Sie verrückt. Vorhin habe ich aufgelegt, aber Sie sind trotzdem raufgekommen. Sie brauchen also Hilfe. Was ist Ihr Name und Problem?«
Sie starrte mich einfach nur an.
»Hören Sie«, sagte ich. »Sie kommen aus Manhattan, Kansas. Das letzte Mal, als ich den Weltalmanach auswendig gelernt habe, war das ein kleiner Ort nicht weit von Topeka. Ungefähr zwölftausend Einwohner. Sie arbeiten für Dr. Alfred Zugsmith und suchen jemand namens Orrin. Manhattan ist eine Kleinstadt. Es kann nicht anders sein. In Kansas gibt es nur ein halbes Dutzend Orte, die es nicht sind. Ich weiß jetzt schon genug über Sie, um Ihre komplette Familiengeschichte auszuforschen.«
»Aber was hätten Sie denn davon?«, fragte sie erschrocken.
»Ich?«, sagte ich. »Nichts, und nichts liegt mir ferner. Ich habe die Geschichten der Menschen satt. Ich sitze hier nur, weil ich sonst nirgendwo hinkann. Ich will nicht arbeiten. Ich will überhaupt nichts.«
»Sie reden zu viel.«
»Ja«, sagte ich, »ich rede zu viel. Einsame Männer reden immer zu viel. Oder sie reden überhaupt nicht. Wollen wir zur Sache kommen? Sie sehen nicht aus wie die Sorte, die zu Privatdetektiven geht, vor allem nicht zu Privatdetektiven, die sie nicht kennt.«
»Das weiß ich«, sagte sie leise. »Und Orrin wäre fuchsteufelswild. Meine Mutter wäre mir auch sehr böse. Ich habe Ihren Namen aus dem Telefonbuch …«
»Nach welchem Prinzip?«, fragte ich. »Und mit geschlossenen oder offenen Augen?«
Sie starrte mich einen Moment lang an, als wäre ich verrückt. »Sieben und dreizehn«, sagte sie leise.
»Wie bitte?«
»Marlowe hat sieben Buchstaben«, sagte sie, »und Philip Marlowe hat dreizehn. Sieben und dreizehn sind zusammen …«
»Wie heißen Sie?«, knurrte ich beinahe.
»Orfamay Quest.« Sie kniff die Augen zusammen, wie am Rande der Tränen. Den Vornamen buchstabierte sie mir in einem Rutsch. »Ich wohne bei meiner Mutter«, fuhr sie fort und sprach immer schneller, als müsste sie mich nach Minuten bezahlen. »Mein Vater ist vor vier Jahren gestorben. Er war Arzt. Mein Bruder Orrin wollte auch Chirurg werden, sattelte aber nach zwei Jahren Medizin auf Ingenieurswesen um. Dann ist Orrin vor einem Jahr hierher gezogen, um für die Cal-Western Aircraft Company in Bay City zu arbeiten. Das wäre nicht nötig gewesen. Er war in Wichita in guter Stellung. Er wollte wohl einfach nach Kalifornien. So wie jeder.«
»Wie fast jeder«, sagte ich. »Wenn Sie schon diese randlose Brille tragen, könnten Sie wenigstens versuchen, ihr auch gerecht zu werden.«
Sie kicherte und malte mit der Fingerspitze einen Strich auf den Schreibtisch, mit gesenktem Blick. »Sie meinten diese Katzenaugenbrillen, mit denen man exotisch aussieht?«
»Genau. Nun zu Orrin. Wir haben ihn in Kalifornien, und zwar in Bay City. Was machen wir jetzt mit ihm?«
Sie dachte einen Augenblick nach und runzelte die Stirn. Dann blickte sie mich forschend an, und schließlich platzte es aus ihr heraus: »Es sah Orrin nicht ähnlich, uns nicht regelmäßig zu schreiben. Im letzten halben Jahr hat er Mutter nur zwei Mal und mir nur drei Mal geschrieben. Der letzte Brief liegt Monate zurück. Mutter und ich haben uns Sorgen gemacht. Weil ich gerade Urlaub habe, bin ich hergekommen und wollte ihn treffen. Er ist noch nie aus Kansas fort gewesen.« Sie unterbrach sich. »Machen Sie sich gar keine Notizen?«
Ich knurrte.
»Ich habe gedacht, Detektive schreiben immer alles in ein kleines Notizbuch.«
»Ich mache hier die Witze«, sagte ich. »Und Sie erzählen die Geschichte. Sie sind in Ihrem Urlaub hier raus gekommen. Und dann?«
»Ich hatte Orrin geschrieben, dass ich komme, aber keine Antwort erhalten. Aus Salt Lake City habe ich ihm ein Telegramm geschickt, darauf hat er auch nicht geantwortet. Also blieb mir nur, dahin zu fahren, wo er wohnte. Ein schrecklich langer Weg. Ich habe einen Bus genommen. Nach Bay City. Idaho Street Nr. 449.«
Sie hielt wieder inne, wiederholte die Adresse, und ich schrieb sie immer noch nicht auf. Ich saß einfach da und studierte ihre Brille, ihr weiches braunes Haar und den albernen kleinen Hut, die unlackierten Fingernägel und ihren Mund ohne Lippenstift und die Spitze der kleinen Zunge, die zwischen den blassen Lippen kam und ging.
»Vielleicht kennen Sie Bay City nicht, Mr. Marlowe.«
»Ha«, sagte ich. »Was ich über Bay City weiß, ist, dass ich mir jedes Mal einen neuen Kopf kaufen muss, wenn ich dort war. Soll ich Ihre Geschichte für Sie zu Ende erzählen?«
»W-w-wie bitte?« Sie riss die Augen so weit auf, dass es hinter den Brillengläsern hervor wirkte wie ein Aquarium für Tiefseefische.
»Er ist umgezogen«, sagte ich. »Sie wissen nicht, wohin. Und Sie fürchten, dass er in einem Penthouse oben in den Regency Towers in Sünde lebt, mit etwas, das einen langen Nerzmantel trägt und ein interessantes Parfüm.«
»Ach du liebe Güte!«
»Oder war das jetzt vulgär?«, fragte ich.
»Ich bitte Sie, Mr. Marlowe«, sagte sie schließlich, »das ist ganz und gar nicht, was ich von Orrin denke. Und wenn Orrin Sie so hören könnte, würde es Ihnen leidtun. Er kann richtig böse werden. Ich bin mir sicher, dass etwas vorgefallen ist. Es war ein ganz billiges Fremdenheim, der Verwalter gefiel mir nicht. Ein ganz schlimmer Mensch. Er sagte, Orrin sei vor ein paar Wochen ausgezogen, er wisse nicht, wohin, und es sei ihm auch egal, er wolle nichts als einen ordentlichen Schuss Gin. Ich weiß nicht, wie Orrin so ein Haus überhaupt betreten konnte.«
»Haben Sie ›Schuss‹ gesagt?«
Sie wurde rot. »Das hat der Verwalter gesagt. Ich gebe es nur wieder.«
»Na gut«, sagte ich. »Weiter.«
»Also, ich habe bei seinem Arbeitgeber angerufen. Der Cal-Western Company, wie gesagt. Die haben gemeint, er sei entlassen worden, wie viele andere auch, mehr wisse man nicht. Also bin ich aufs Postamt und habe gefragt, ob Orrin eine Nachsendeadresse hinterlassen habe. Und sie haben gesagt, darüber dürften sie mir keine Auskunft geben. Das sei gegen die Vorschriften. Also habe ich ihnen die Sache erklärt, und der Mann hat gesagt, wenn ich seine Schwester sei, würde er nachsehen. Er ist nachsehen gegangen und wiedergekommen und hat gesagt, nein. Orrin habe keine Nachsendeadresse hinterlassen. Da habe ich es ein bisschen mit der Angst zu tun bekommen. Er könnte ja einen Unfall gehabt haben oder so etwas.«
»Sind Sie nicht zur Polizei gegangen?«
»Das würde ich nicht wagen. Orrin würde mir das nie verzeihen. Er ist schon unter normalen Umständen schwierig. Unsere Familie …« Sie zögerte, und in ihren Augen blitzte etwas auf, was sie dort nicht haben wollte. Also fuhr sie atemlos fort: »Das ist keine Familie, die …«
»Hören Sie«, sagte ich matt, »ich meine ja nicht, dass der Junge jemandem die Brieftasche geklaut hat. Ich will sagen, dass er womöglich von einem Auto angefahren wurde und das Gedächtnis verloren hat oder so schwer verletzt ist, dass er nicht mehr sprechen kann.«
Sie blickte mir direkt in die Augen, nicht gerade bewundernd. »Wenn es das wäre, hätten wir davon gehört«, sagte sie. »Jeder hat etwas in den Taschen, womit man ihn identifizieren kann.«
»Manchmal hat man auch nur noch die Taschen.«
»Wollen Sie mir Angst machen, Mr. Marlowe?«
»Wenn ja, dann ist mir das noch nicht so recht gelungen. Was ist denn Ihrer Meinung nach passiert?«
Sie legte ihren schlanken Zeigefinger an die Lippen und berührte ihn ganz zart mit der Zungenspitze. »Wenn ich das wüsste, wäre ich wohl kaum zu Ihnen gekommen. Was würden Sie berechnen, um ihn zu finden?«
Ich schwieg einen langen Augenblick, dann sagte ich: »Sie meinen allein, ohne jemandem davon zu erzählen.«
»Ja. Allein, ohne jemandem davon zu erzählen.«
»Das kommt darauf an. Ich habe Ihnen meine Preise ja genannt.«
Sie klammerte sich mit den Händen an die Schreibtischkante, ganz fest. Ich hatte selten so viel affektiertes Getue erlebt. »Ich dachte, Sie sind Detektiv und könnten ihn sofort finden«, sagte sie. »Mehr als zwanzig Dollar kann ich mir auf keinen Fall leisten. Ich muss mein Essen hier bezahlen und das Hotel und den Zug zurück, und wissen Sie, das Hotel ist schrecklich teuer, und das Essen im Zug …«
»Wo sind Sie denn abgestiegen?«
»Das … das würde ich Ihnen lieber nicht sagen, wenn es Ihnen nichts ausmacht.«
»Warum nicht?«
»Es wäre mir einfach lieber. Ich habe schreckliche Angst vor Orrins Wutausbrüchen. Und, na, ich kann Sie ja immer anrufen, nicht?«
»Soso. Wovor haben Sie denn nun wirklich Angst, von Orrins Wutausbrüchen abgesehen, Miss Quest?« Ich hatte meine Pfeife ausgehen lassen. Ich zündete ein Streichholz an, hielt es an den Pfeifenkopf und beobachtete sie dabei.
»Ist Pfeiferauchen nicht eine besonders schmutzige Angewohnheit?«, fragte sie.
»Wahrscheinlich schon«, sagte ich. »Aber wenn ich es lassen soll, kostet das mehr als zwanzig Dollar. Weichen Sie meinen Fragen nicht aus.«
»So können Sie nicht mit mir reden«, flammte sie auf. »Pfeiferauchen ist eine schmutzige Angewohnheit. Mutter hat Vater nie erlaubt, im Haus zu rauchen, auch nicht in den letzten beiden Jahren nach seinem Schlaganfall. Manchmal saß er mit der leeren Pfeife im Mund da. Aber das war ihr auch nicht wirklich recht. Wir hatten hohe Schulden, und sie fand, sie könne ihm kein Geld für so nutzlose Dinge wie Tabak geben. Die Kirche habe es nötiger als er.«
»Langsam verstehe ich«, sagte ich. »In so einer Familie muss ja irgendeiner eine finstere Seite haben.«
Sie fuhr hoch und presste sich den Erste-Hilfe-Koffer an den Leib. »Ich mag Sie nicht«, sagte sie. »Ich glaube nicht, dass ich Sie beschäftigen werde. Falls Sie unterstellen wollen, dass Orrin etwas falsch gemacht hat, nun, ich kann Ihnen versichern, Orrin ist nicht das schwarze Schaf der Familie.«
Ich zuckte nicht mit der Wimper. Sie wirbelte herum, marschierte zur Tür und legte die Hand auf den Griff, dann wirbelte sie wieder herum, marschierte zurück und fing an zu weinen. Ich reagierte wie ein toter Fisch auf Lebendköder. Sie holte ihr Taschentuch heraus und tupfte sich die Augenwinkel.
»Und jetzt rufen Sie bestimmt die P-Polizei«, stammelte sie, »und in M-Manhattan steht dann alles in der Zeitung und sie schreiben b-böse Sachen über uns.«
»Das ist bestimmt nicht das, was Sie fürchten. Spielen Sie nicht auf meinen Gefühlen Klavier. Zeigen Sie mir lieber ein Foto von ihm.«
Eilig packte sie das Taschentuch weg und zog etwas anderes aus der Handtasche. Sie schob es über den Schreibtisch. Es war ein Umschlag. Dünn, aber dick genug für ein paar Schnappschüsse. Ich sah nicht hinein.
»Beschreiben Sie ihn mir so aus der Erinnerung, wie Sie ihn sehen«, sagte ich.
Sie konzentrierte sich. Was ihr Gelegenheit gab, die Brauen zu runzeln. »Letzten März ist er achtundzwanzig geworden. Er hat hellbraune Haare, viel heller als ich, seine Augen haben ein helleres Blau, und er kämmt sich die Haare aus der Stirn. Er ist sehr groß, über eins achtzig. Aber er wiegt nur dreiundsechzigeinhalb Kilo. Er ist eher hager. Früher hatte er einen kleinen blonden Schnurrbart, aber Mutter hat gesagt, dass er ihn abrasieren muss. Sie hat gesagt …«
»Lassen Sie mich raten. Der Pfarrer wollte sich mit den Stoppeln ein Kissen ausstopfen.«
»So können Sie über meine Mutter nicht reden«, japste sie, blass vor Zorn.
»Seien Sie doch nicht albern. Ich weiß nicht viel über Sie. Aber spielen Sie hier nicht das zarte Pflänzchen. Hat Orrin irgendwelche Erkennungsmerkmale, Leberflecke, Narben oder eine Tätowierung auf der Brust, Psalm 23 vielleicht? Sparen Sie sich das Erröten.«
»Also, Sie müssen mich doch nicht anschreien. Sehen Sie sich einfach das Foto an.«
»Bestimmt ist er auf dem Bild bekleidet. Doch Sie sind seine Schwester. Sie müssten so etwas wissen.«
»Nein, das hat er nicht«, sagte sie gepresst. »An der linken Hand hat er eine kleine Narbe, von einer Talgzyste.«
»Und seine Gewohnheiten? Was macht er zum Spaß – außer nicht rauchen, nicht trinken und nicht ausgehen?«
»Also – woher wissen Sie das?«
»Hat Ihre Mutter mir verraten.«
Sie lächelte. Langsam fragte ich mich, wie gerissen sie war. Sie hatte ebenmäßige weiße Zähne, ihr Zahnfleisch zeigte sie nicht. Tolle Nummer. »Sie sind lustig«, sagte sie. »Er liest viel und er hat eine sehr teure Kamera, mit der er heimlich Leute aufnimmt. Manchmal werden sie böse. Aber Orrin sagt, die Menschen sollen sich so sehen, wie sie wirklich sind.«
»Hoffentlich passiert ihm das nie«, sagte ich. »Was für eine Kamera?«
»Eine von diesen kleinen mit einem edlen Objektiv. Man kann bei fast jedem Licht knipsen. Eine Leica.«
Ich öffnete den Umschlag und holte ein paar gestochen scharfe Abzüge heraus. »Die sind aber mit einer anderen Kamera aufgenommen worden«, sagte ich.
»Ja. Die hat Philip gemacht, Philip Anderson. Ein Junge, mit dem ich eine Weile gegangen bin.« Sie unterbrach sich und seufzte. »Deshalb bin ich wohl hier gelandet, Mr. Marlowe. Einfach weil Sie auch Philip heißen.«
Ich sagte nur »Soso«, war aber seltsam gerührt. »Was ist aus Philip Anderson geworden?«
»Aber es geht doch um Orrin …«
»Ich weiß«, unterbrach ich sie. »Aber was ist aus Philip Anderson geworden?«
»Er ist noch immer daheim in Manhattan.« Sie wandte den Blick ab. »Mutter mag ihn nicht sehr. Sie wissen bestimmt, wie das ist.«
»Ja«, sagte ich. »Ich weiß, wie das ist. Weinen Sie ruhig. Ich nehme es Ihnen nicht übel. Ich bin selbst ein altes Tränentier.«
Ich sah mir die beiden Abzüge an. Auf dem einen hatte er den Blick gesenkt, der nützte mir nichts. Der andere war die gelungene Aufnahme eines hochgewachsenen, kantigen Knaben mit eng zusammenstehenden Augen, einem dünnen Mund und spitzem Kinn. Sein Gesichtsausdruck war wie erwartet. Wenn man vergessen hätte, sich die Schuhe abzutreten, würde er einem Bescheid stoßen. Ich legte die Fotos weg und suchte in Orfamay Quests Gesicht nach etwas, das entfernt an ihn erinnerte. Ich konnte nichts finden. Nicht den leisesten Hauch Familienähnlichkeit, was nichts heißen musste. Hat es noch nie.
»Also gut«, sagte ich. »Ich fahre hin und sehe mich mal um. Aber was mit ihm los ist, lässt sich nicht schwer erraten. Er ist in einer fremden Stadt. Eine Weile verdient er gutes Geld. Vielleicht mehr denn je. Er begegnet einer völlig anderen Sorte Mensch. Und diese Stadt – glauben Sie mir, ich kenne Bay City – ist wirklich nicht Manhattan, Kansas. Also ist er abgerutscht, und seine Familie soll nichts davon wissen. Er wird schon wieder auf die Beine kommen.«
Sie starrte mich einen Augenblick lang schweigend an, dann schüttelte sie den Kopf. »Nein. Orrin ist nicht der Typ dafür, Mr. Marlowe.«
»Jeder ist der Typ dafür«, sagte ich. »Besonders einer wie Orrin. Ein Frömmler aus der Provinz, dem sein Leben lang die Mutter im Nacken sitzt und der Priester die Hand hält. Hier draußen ist er einsam. Er hat Geld. Er möchte ein bisschen was Süßes, ein bisschen Licht, und zwar nicht von der Sorte, die durchs Kirchenfenster fällt. Nicht, dass ich gegen diese Sorte etwas hätte, aber er hatte davon ja schon genug.«
Sie nickte stumm.
»Also fängt er an, auf Risiko zu spielen«, fuhr ich fort, »aber er weiß nicht, wie man das macht. Dazu gehört auch Erfahrung. Er landet in einer Sackgasse, mit irgendeinem Flittchen, einer Flasche Schnaps und Schuldgefühlen, als hätte er dem Bischof die Hosen geklaut. Aber der Junge geht auf die neunundzwanzig zu, und wenn er hart drauf ist, dann ist das seine Sache. Irgendwann wird er schon jemanden finden, dem er die Schuld zuschieben kann.«
»Ich möchte Ihnen wirklich nicht glauben, Mr. Marlowe«, sagte sie gedehnt. »Schon um Mutters …«
»War nicht von zwanzig Dollar die Rede?«, unterbrach ich.
Sie sah geschockt aus. »Ich muss Sie jetzt schon bezahlen?«
»Wie würde man das in Manhattan, Kansas machen?«
»In Manhattan gibt es keine Privatdetektive. Nur die richtige Polizei. Glaube ich jedenfalls.«
Sie wühlte wieder in ihrem Werkzeugkasten und fischte ein rotes Portemonnaie heraus, mit ein paar Scheinen darin, jeder einzeln säuberlich gefaltet. Drei Fünfer und fünf Einer. Viel mehr schien da nicht zu sein. Sie hielt die Börse so, dass ich sehen konnte, wie leer sie war. Dann strich sie die Scheine auf dem Schreibtisch glatt, legte sie übereinander und schob sie mir herüber. Ganz langsam, ganz traurig, so als würde sie ihr Lieblingskätzchen ertränken.
»Ich schreibe Ihnen eine Quittung«, sagte ich.
»Ich brauche keine Quittung, Mr. Marlowe.«
»Ich aber. Namen und Anschrift wollen Sie mir nicht geben, ich hätte aber gerne etwas mit Ihrem Namen darauf.«
»Wozu?«
»Zum Beleg, dass ich Sie vertrete.« Ich holte den Quittungsblock heraus, schrieb die Quittung aus und hielt ihr den Block hin, damit sie die Durchschrift unterzeichnen konnte. Sie wollte nicht. Nach kurzem Zögern nahm sie den harten Bleistift und schrieb in säuberlicher Sekretärinnen-Handschrift ›Orfamay Quest‹ quer über die Durchschrift.
»Noch immer keine Anschrift?«, fragte ich.
»Lieber nicht.«
»Sie können mich jederzeit anrufen. Im Telefonbuch steht auch meine Privatnummer. Bristol Apartments, Apartment 428.«
»Besuchen werde ich Sie wohl kaum«, sagte sie kühl.
»Ich habe Sie auch noch nicht eingeladen«, sagte ich. »Wenn Sie mögen, rufen Sie mich gegen vier Uhr an. Dann weiß ich vielleicht mehr. Vielleicht aber auch nicht.«
Sie stand auf. »Ich hoffe, Mutter wird das nicht falsch finden«, sagte sie und spielte mit dem blassen Fingernagel an ihrer Lippe herum. »Dass ich hierhergekommen bin, meine ich.«
»Erzählen Sie mir einfach nichts mehr von all den Dingen, die Ihre Mutter missbilligt«, sagte ich. »Lassen Sie den Teil einfach aus.«
»Also wirklich!«
»Und sagen Sie nicht mehr ›Also wirklich‹.«
»Ich finde Sie widerlich«, sagte sie.
»Nein, das tun Sie nicht. Sie finden mich süß. Und ich finde Sie eine faszinierende kleine Lügnerin. Sie glauben doch nicht, dass ich das wegen der zwanzig Dollar mache, oder?«
Ganz abgebrüht sah sie mir direkt in die Augen. »Warum dann?«
Als ich nicht antwortete, setzte sie hinzu: »Weil es Frühling wird?«
Ich antwortete noch immer nicht. Sie wurde ein wenig rot. Dann kicherte sie.
Ich hatte nicht das Herz, ihr zu sagen, dass es reine Langeweile war. Vielleicht spielte der Frühling auch eine Rolle. Und etwas in ihrem Blick, das viel älter war als Manhattan, Kansas.
»Ich finde Sie sehr nett – wirklich«, sagte sie leise. Dann wandte sie sich rasch ab und rannte fast aus dem Büro. Ihre Schritte draußen im Flur erzeugten ein scharfes leises Klackern, wie Mutter vielleicht, wenn sie auf den Tisch trommelt, weil Vater sich ein zweites Stück Pastete zuschanzen will. Wo er doch kein Geld mehr hat. Wo er doch überhaupt nichts mehr hat. Bloß noch im Schaukelstuhl auf der Veranda sitzt, daheim in Manhattan, Kansas, die leere Pfeife im Mund. Auf der Veranda schaukelt, immer schön langsam, denn nach einem Schlaganfall muss man immer schön langsam machen. Und auf den nächsten warten. Mit der leeren Pfeife im Mund. Ohne Tabak. Nichts zu tun als Warten.
Ich steckte Orfamay Quests zwanzig schwer verdiente Dollar in einen Umschlag, schrieb ihren Namen darauf und warf ihn in die Schreibtischschublade. Mit so viel Geld in der Tasche wollte ich nicht in der Gegend herumlaufen.
3
Man kann sich in Bay City gut auskennen, ohne zu wissen, wo die Idaho Street ist. Und man kann sich ziemlich gut in der Idaho Street auskennen, ohne die Nr. 449 auf Anhieb zu finden. Das kaputte Pflaster davor war fast schon wieder zu Erde geworden. Der rissige Gehweg auf der anderen Straßenseite grenzte an den windschiefen Zaun eines Holzlagers. Ein Stück weiter verschwand ein Abstellgleis unter einem hohen, zugeketteten Holztor, das bestimmt seit zwanzig Jahren nicht mehr geöffnet worden war. Kleine Jungen hatten Tor und Zaun mit Kreide bemalt.
Die Nr. 449 hatte eine niedrige, ungestrichene Veranda, auf der fünf liederliche Schaukelstühle aus Holz und Flechtwerk herumlungerten, in Schach gehalten von Eisendrahtgittern und der feuchten Strandluft. Die rissigen grünen Jalousien vor den Fenstern im Erdgeschoss waren zu zwei Dritteln heruntergelassen. An der Eingangstür hing ein großes Schild mit der Aufschrift ›Keine Zimmer frei‹. Und das hing auch schon lange dort. Es war ausgeblichen und voller toter Fliegen. Die Tür öffnete sich auf einen langen Flur, nach einem Drittel führte eine Treppe nach oben. Rechts neben dem Eingang hing an einer Kette ein Kugelschreiber an einem Brett. Es gab einen Klingelknopf mit einem gelbschwarzen Schild darüber – ›Verwalter‹, gehalten von drei Reißzwecken unterschiedlicher Machart. An der Wand gegenüber hing ein Münzfernsprecher.
Ich drückte auf die Klingel. Irgendwo in der Nähe hörte man es läuten, aber nichts geschah. Ich klingelte wieder. Und wieder geschah das gleiche Nichts. Ich schlenderte bis vor eine Tür mit einem Metallschild daran – ›Verwalter‹. Ich klopfte. Dann trat ich dagegen. Meine Tritte schienen niemanden zu stören.
Ich ging wieder hinunter und um das Haus herum. Ein schmaler Betonplattenweg führte zum Dienstboteneingang. Von der Lage her konnte er zur Verwalterwohnung gehören. Der Rest des Hauses musste aus den Zimmern bestehen. Auf der hinteren Veranda standen ein schmutziger Mülleimer und ein Kasten Alkohol. Die Tür hinter dem Fliegengitter stand offen. Drinnen herrschte Dämmerlicht. Ich hielt mein Gesicht an das Gitter und lugte hinein. Durch die offene Tür hinter dem Vorraum konnte ich einen Stuhl mit gerader Lehne ausmachen, über der eine Jacke hing, und auf dem Stuhl saß ein Mann in Hemdsärmeln, mit Hut. Ein kleiner Mann. Was er machte, konnte ich nicht sehen, aber er saß offenbar in der Küche am Tisch der fest eingebauten Essecke.
Ich hämmerte an die Gittertür. Der Mann regte sich nicht. Ich hämmerte noch einmal, fester. Diesmal kippelte er auf dem Stuhl zurück und zeigte mir ein kleines blasses Gesicht mit einer Zigarette darin. »Wassn?«, bellte er.
»Verwalter.«
»Nich da.«
»Wer sind Sie?«
»Geht ’n dich das an?«
»Ich will ein Zimmer.«
»Kein Zimmer frei. Kansse nich lesen?«
»Da habe ich zufällig andere Informationen«, sagte ich.
»Ach ja?« Er schnipste sich mit dem Fingernagel die Asche von der Zigarette, ohne sie aus dem kleinen, traurigen Mund zu nehmen. »Kannse dir dein Hirn drin braten.«
Er stellte den Stuhl wieder waagerecht und werkelte weiter, woran auch immer.
Ich machte viel Lärm, als ich von der Veranda stieg, und überhaupt keinen, als ich wieder hinauftrat. Vorsichtig tastete ich die Gittertür ab. Sie war von innen zugehakt. Mit dem Taschenmesser hob ich den Haken aus der Öse. Es klapperte leise, aber das Klappern aus der Küche war lauter.
Ich trat durch den Vorraum ins Haus. Der kleine Mann war beschäftigt und bemerkte mich nicht. In der Küche gab es einen dreiflammigen Gasherd, ein paar Regalbretter mit fettigem Geschirr, einen schäbigen Kühlschrank und den Esstisch. Der Esstisch war voller Geld. Vor allem Scheine, aber auch Münzen in allen Größen. Der kleine Mann zählte sie, machte kleine Stapel und notierte die Beträge. Er befeuchtete seinen Stift, ohne sich um die Zigarette im Mund zu scheren.
Auf dem Tisch mussten ein paar hundert Dollar liegen.
»Miete eingetrieben?«, fragte ich kumpelhaft.
Mit einem Ruck drehte der kleine Mann sich um. Er lächelte kurz, schweigend. Das Lächeln eines Mannes, der im Herzen nicht lächelt. Er nahm die Kippe aus dem Mund, ließ sie fallen und trat sie aus. Er holte eine frische Fluppe aus der Hemdtasche, steckte sie sich in das gleiche Loch im Gesicht und suchte nach einem Streichholz.
»Hasse dich hübsch reingeschlichen«, sagte er freundlich.
Als er kein Streichholz finden konnte, drehte er sich lässig auf dem Stuhl um und suchte in seiner Manteltasche. Etwas Schweres schlug an das Holz der Lehne. Ich packte ihn am Handgelenk, bevor das schwere Teil aus der Tasche zum Vorschein kam. Er ließ sich nach hinten fallen, und die Manteltasche hob sich in meine Richtung. Ich trat ihm den Stuhl unter dem Hintern weg.
Er kam hart auf dem Boden auf und schlug mit dem Kopf an die Tischkante. Das hielt ihn nicht davon ab, nach mir zu treten; er zielte mit dem Fuß zwischen meine Beine. Ich ging einen Schritt zurück, seinen Mantel in der Hand, und holte aus der Tasche, in der er herumgenestelt hatte, eine .38er.
»Es wird hier nicht gemütlicher, wenn du auf dem Fußboden sitzt«, sagte ich.
Er stand langsam auf und tat benommener, als er war. Er fummelte mit der Hand hinten am Hemdkragen herum, und als sein Arm in meine Richtung fuhr, blitzte Metall auf. So ein sportlicher kleiner Kampfhahn aber auch.
Ich zog ihm die eigene Pistole über das Kinn, und er setzte sich wieder. Ich trat auf die Hand, in der er das Messer hatte. Er verzog vor Schmerz das Gesicht, machte aber keinen Mucks. Ich kickte das Messer in eine Ecke. Es war lang und dünn und sah sehr scharf aus.
»Schäm dich«, sagte ich. »Mit Messern und Pistolen auf Leute losgehen, die einfach nur eine Unterkunft suchen. Selbst heutzutage geht so was nicht.«
Er klemmte die schmerzende Hand zwischen die Knie und pfiff zwischen den Zähnen. Der Klaps aufs Kinn schien ihm nicht geschadet zu haben. »Okay«, sagte er. »Okay. Ich muss ja nicht perfekt sein. Nimm die Kohle und verpiss dich. Aber glaub ja nicht, dass wir dich nicht kriegen.«
Ich sah mir die Sammlung aus Kleingeld und kleinen und mittleren Scheinen auf dem Tisch an. »Die Leute zahlen wohl nicht gern, so wie du bewaffnet bist«, sagte ich. Ich ging zur Haustür und probierte den Türgriff. Sie war nicht abgeschlossen. Ich drehte mich wieder um.
»Die Pistole werfe ich in den Briefkasten«, sagte ich. »Nächstes Mal lässt du dir die Hundemarke zeigen.«
Er pfiff noch immer leise zwischen den Zähnen und hielt sich die Hand. Er schätzte mich mit einem Blick ab, dann schaufelte er das Geld in eine zerschlissene Aktentasche und ließ den Verschluss zuschnappen. Er nahm den Hut ab, richtete rundherum die Krempe glatt, setzte ihn sich keck wieder auf den Hinterkopf und warf mir ein stilles, geschäftsmäßiges Lächeln zu.
»Mit der Wumme is mir egal«, sagte er. »Die Stadt ist voller Alteisen. Aber den Stecher könntest du bei Clausen lassen. Hab ich mir lange zurechtgefeilt.«
»Und oft benutzt?«, sagte ich.
»Kann schon sein.« Lässig schnipste er mit den Fingern in meine Richtung. »Vielleicht sehen wir uns ja bald mal wieder. Wenn ich einen Freund dabeihabe.«
»Er soll sich ein sauberes Hemd anziehen«, sagte ich. »Und dir auch eins leihen.«
»Na na«, sagte er tadelnd. »Wie schnell wir doch taff werden, wenn man uns diese Marke anpinnt.«
Er schlängelte sich flink an mir vorbei, die Stufen der hinteren Veranda hinunter. Seine Schritte klangen auf der Straße wider und verhallten. Sie erinnerten mich an Orfamays Absätze im Flur vor meinem Büro. Und irgendwie hatte ich ein komisches Gefühl, als hätte ich meine Trümpfe falsch ausgespielt. Ohne einen bestimmten Grund. Vielleicht, weil der kleine Mann so stahlhart gewesen war: kein Wimmern, kein Wüten, nur dieses Lächeln, das Pfeifen zwischen den Zähnen, die hohe Stimme und dieser Blick, der nichts vergaß.
Ich hob das Messer auf. Die Klinge war lang und dünn und konisch, wie eine glatte Rattenschwanzfeile. Griff und Scheide waren je aus einem Stück gegossen, aus leichtem Plastik. Ich hielt das Messer am Griff und holte mit Schwung in Richtung Tisch aus. Die Klinge schoss heraus und steckte zitternd im Holz.
Ich holte tief Luft, schob den Griff wieder über die Klinge und ruckelte sie aus der Tischplatte. Ein sehr spezielles Messer. Jemand hatte sich Gedanken gemacht, hatte Absichten damit gehabt, und zwar keine guten.
Ich öffnete die Tür, die tiefer ins Haus führte, und ging ins nächste Zimmer, Pistole und Messer je in einer Hand.
Ein Wohnzimmer mit Klappbett, das Bett offen und zerwühlt. Es gab einen dick gepolsterten Sessel mit Zigarettenloch in der Armlehne. An der Wand neben dem Fenster stand ein hoher Sekretär aus Eiche, die Türen halb aus den Angeln, wie alte Kellertüren. Nicht weit davon stand eine Schlafcouch, darauf lag ein Mann. Seine Füße hingen in groben grauen Socken in der Luft. Sein Kopf hatte das Kissen um einen halben Meter verfehlt. Das war für ihn kein Schaden, so wie der Kissenbezug aussah. Seine obere Körperhälfte steckte in einem Hemd von undefinierbarer Farbe und einer abgetragenen grauen Strickjacke. Der Mund stand offen, auf der Stirn glitzerte der Schweiß. Er atmete wie ein alter Ford mit undichter Zylinderkopfdichtung. Auf dem Tisch neben ihm ein Teller voller Zigarettenstummel, ein paar davon sahen selbstgebaut aus. Auf dem Fußboden eine fast volle Flasche Gin und eine Tasse, in der Kaffee gewesen sein musste, doch das war schon eine Weile her. Der Raum stank vor allem nach Gin und schlechter Luft, ein Hauch Marihuana war auch dabei.
Ich öffnete ein Fenster, lehnte die Stirn an das Fliegengitter, um etwas Sauerstoff in die Lungen zu bekommen, und warf einen Blick auf die Straße. Zwei Kids schoben ihre Fahrräder am Holzlager-Zaun entlang und hielten immer wieder an, um die Toilettenwand-Kunst auf den Latten zu betrachten. Sonst rührte sich im Viertel nichts. Nicht einmal ein Hund. Unten an der Ecke hing Staub in der Luft, als wäre dort ein Auto durchgefahren.
Ich trat an den Schreibtisch. Dort lag das Meldebuch. Ich blätterte zurück, bis ich auf den Namen ›Orrin P. Quest‹ stieß, in klarer, säuberlicher Handschrift. Jemand anders hatte mit Bleistift die Nummer 214 hinzugefügt, weder klar noch säuberlich. Ich blätterte bis zum Ende durch, fand aber keinen weiteren Eintrag für Zimmer 214. In der Nummer 215 wohnte jemand namens G.W. Hicks. Ich klappte das Buch wieder zu und ging zur Couch. Der Mann schnarchte und blubberte nicht mehr und hatte den rechten Arm über der Brust, als würde er eine Rede halten. Ich beugte mich hinab, klemmte seine Nase fest zwischen Zeige- und Mittelfinger und stopfte ihm mit einem Zipfel der Strickjacke das Maul. Das Schnarchen riss ab, und er sperrte die Augen auf. Sie waren glasig und blutunterlaufen. Er versuchte, sich aus meinem Griff freizukämpfen. Als ich sah, dass er ganz wach war, ließ ich los, nahm die Flasche Gin vom Boden und goss etwas in ein Glas, das umgekippt neben der Flasche gelegen hatte. Ich zeigte dem Mann das Glas.
Mit dem sehnsüchtigen Blick einer Mutter, die ihr verlorenes Kind wieder in die Arme schließen will, streckte er die Hand danach aus.
Ich hielt es so, dass er nicht herankam, und sagte: »Sie sind der Verwalter?«
Er leckte sich die verklebten Lippen und sagte: »Gr-r-r-r.«
Er versuchte, das Glas zu fassen zu bekommen. Ich stellte es vor ihn auf den Tisch. Er packte es vorsichtig mit beiden Händen und kippte sich den Gin ins Gesicht. Dann lachte er laut und warf mit dem Glas nach mir. Ich fing es auf und stellte es umgedreht wieder auf den Tisch. Der Mann betrachtete mich und versuchte, dabei streng auszusehen, ohne Erfolg.
»Wassslos?«, krächzte er beleidigt.
»Verwalter?«
Er nickte und fiel fast von der Couch. »Ich bin wohl schwipsig«, sagte er. »Klitzeklein bisschen schwipsig, komisch.«
»Alles in Ordnung«, sagte ich. »Sie atmen ja noch.«
Er stellte die Füße auf den Boden und stemmte sich in die Aufrechte.
Er gackerte, plötzlich belustigt, setzte drei unsichere Schritte, ging auf alle viere und wollte in ein Stuhlbein beißen.
Ich zog ihn wieder hoch, setzte ihn in den Polstersessel mit dem Brandloch und schenkte ihm noch etwas von seiner Arznei ein. Er trank, schlotterte heftig, und plötzlich bekam sein Blick etwas Klares und Verschlagenes. Säufer dieser Preisklasse finden immer wieder kurz in die Wirklichkeit zurück. Man kann diese Augenblicke nie kommen sehen und weiß nie, wie lange sie dauern.
»Scheiße, wer sind Sie denn?«, knurrte er.
»Ich suche einen Mann namens Orrin P. Quest.«
»Hä?«
Ich sagte es noch einmal. Er wischte sich mit den Händen über das Gesicht und sagte knapp: »Weggezogen.«
»Weggezogen wann?«
Er machte eine ausladende Handbewegung, fiel fast aus dem Sessel, machte eine ausladende Bewegung in die andere Richtung, um das Gleichgewicht wiederzufinden. »Willndrink«, sagte er.
Ich schenkte ihm noch mal ein und hielt das Glas außerhalb seiner Reichweite.
»Herramit«, sagte der Mann mit Nachdruck. »Ich bin unlücklich.«
»Alles, was ich will, ist die neue Anschrift von Orrin P. Quest.«
»Nu siehmaeina an«, sagte er gewitzt und langte tapsig nach dem Glas in meiner Hand.
Ich stellte das Glas auf dem Boden ab und holte eine meiner Visitenkarten für ihn aus der Tasche. »Das hilft Ihnen vielleicht beim Konzentrieren«, sagte ich.
Er studierte die Karte sehr gründlich, grinste höhnisch, faltete sie zusammen, dann noch einmal. Er legte sie sich auf die Handfläche, spuckte darauf und warf sie über die Schulter.
Ich reichte ihm das Glas Gin. Er leerte es auf meine Gesundheit, nickte feierlich und warf es ebenfalls über die Schulter. Es rollte über den Boden und knallte an die Fußleiste. Erstaunlich leichtfüßig stand der Mann auf, zeigte mit einem Daumen auf die Zimmerdecke, ballte die Finger darunter zur Faust und ließ die Zunge scharf an die Zähne schnalzen.
»Raus jetzt«, sagte er. »Ich habe Freunde.« Er warf einen Blick auf das Telefon an der Wand, dann sah er mich wieder verschlagen an. »Ein paar Jungs, die kümmern sich dann um dich«, höhnte er. Ich sagte nichts. »Glaubssu nich, was?«, fauchte er in plötzlicher Wut. Ich schüttelte den Kopf.
Mit einem Satz war er am Telefon, krallte sich den Hörer und wählte die fünf Ziffern einer Nummer. Ich sah zu. Eins-drei-fünf-sieben-zwei.
Zu mehr reichte es bei ihm erst einmal nicht. Er ließ den Hörer fallen und an die Wand schlagen und setzte sich daneben auf den Boden. Er hielt sich den Hörer ans Ohr und knurrte die Wand an: »Ich will mimm Doc rehn.« Schweigend hörte ich zu. »Mit Vince! Mimm Doc!«, rief er wütend. Er schüttelte den Hörer, dann schleuderte er ihn von sich. Er stützte sich auf dem Boden auf und krabbelte auf allen vieren im Kreis. Als er auf mich stieß, sah er überrascht und ungehalten aus. Schwankend stand er wieder auf und streckte die Hände aus: »Willndrink.«
Ich hob das Glas auf und molk die Flasche Gin leer. Er nahm das Glas mit der Würde einer beschwipsten Witwe entgegen, kippte es mit lässigem Schwung hinunter, ging gelassen zur Couch und legte sich hin, wobei er sich das Glas als Kissen unter den Kopf schob. Er schlief augenblicklich ein.
Ich legte den Telefonhörer wieder auf die Gabel, warf noch einen Blick in die Küche, tastete den Mann auf der Couch ab und fischte ihm ein paar Schlüssel aus der Tasche. Darunter war ein Generalschlüssel. Die Tür zum Flur hatte ein Schnappschloss, und ich stellte es so ein, dass ich wieder hineinkonnte; dann machte ich mich auf den Weg die Treppe hoch. Ich hielt inne und notierte mir auf einem Briefumschlag ›Doc – Vince, 13572‹. Vielleicht war das eine Spur.
Im Haus war es ganz still, als ich mich auf den Weg nach oben machte.
4
Der Generalschlüssel des Verwalters, der gründlich abgefeilt worden war, öffnete geräuschlos das Schloss von Zimmer 214. Ich stieß die Tür auf. Das Zimmer war nicht leer. Über einen Koffer auf dem Bett beugte sich ein stämmiger, kräftig gebauter Mann. Er stand mit dem Rücken zu mir. Auf dem Bettzeug lagen Hemden, Socken und Unterwäsche; er packte sie ohne Eile sorgfältig ein und pfiff dabei durch die Zähne, tief und monoton.
Als die Türangel knarrte, erstarrte er. Er machte eine schnelle Bewegung mit der Hand in Richtung Kissen.
»Oh, Entschuldigung«, sagte ich. »Der Verwalter hat gesagt, das Zimmer wäre frei.«
Er war so kahl wie eine Pampelmuse. Er trug dunkelgraue Flanellhosen und durchsichtige Plastik-Hosenträger über einem blauen Hemd. Seine Hand kam wieder unter dem Kissen hervor, machte sich an seinem Kopf zu schaffen, dann ließ er sie sinken. Als er sich umdrehte, hatte er Haare auf dem Kopf.
Sie wirkten ganz natürlich – weich, braun, ungescheitelt. Darunter seine Augen, die mich anstarrten.
»Sie können es immer auch mit Klopfen versuchen«, sagte er. Seine Stimme war belegt, sein breites vorsichtiges Gesicht hatte schon einiges hinter sich.
»Wieso denn? Wo der Verwalter doch gesagt hat, das Zimmer wäre frei?«
Er nickte, beruhigt. Das Blitzen verschwand aus seinen Augen.
Ich trat weiter ins Zimmer hinein, ohne Einladung. In Koffernähe lag ein Groschenroman mit dem Rücken nach oben auf dem Bett, eine Liebesgeschichte. In einem Aschenbecher aus Grünglas lag eine qualmende Zigarre. Das Zimmer war ordentlich aufgeräumt und, für die Verhältnisse im Haus, recht sauber.
»Er hat wohl geglaubt, dass Sie schon ausgezogen sind«, sagte ich und versuchte, wie ein gutwilliger, wahrheitsliebender Mensch auszusehen.
»In einer halben Stunde können Sie rein«, sagte er.
»Darf ich mich mal umsehen?«
Er lächelte freudlos. »Noch nicht lange in der Stadt, was?«
»Wieso?«
»Noch neu hier, oder?«
»Wieso?«
»Gefallen Ihnen das Haus und die Lage?«
»Nicht besonders«, sagte ich. »Das Zimmer sieht okay aus.«
Er grinste und zeigte eine Porzellankrone, die für die anderen Zähne zu weiß war. »Wie lange suchen Sie schon?«
»Fange gerade erst an«, sagte ich. »Was sollen die Fragen?«
»Da muss ich ja lachen«, sagte der Mann, ohne zu lachen. »Man sieht sich hier in der Stadt kein Zimmer an. Man greift sofort unbesehen zu. Das Städtchen ist schon so rammelvoll, dass ich mir schon mit dem Tipp, dass hier was frei wird, zehn Dollar verdienen könnte.«
»So ein Pech«, sagte ich. »Mir hat ein Mann namens Orrin P. Quest von dem Zimmer erzählt. Wieder ein Zehner weniger in Ihrer Tasche.«
»Ach wirklich?« Nicht das kleinste Wimpernzucken. Kein Muskel regte sich. Ich hätte genauso gut mit einer Schildkröte reden können. »Kommen Sie mir nicht komisch«, sagte der Mann. »Da sind Sie an den Falschen geraten.«
Er klaubte sich die Zigarre aus dem Grünglas-Aschenbecher und blies eine kleine Wolke in die Luft. Durch den Qualm warf er mir einen grauverschleierten, bösen Blick zu. Ich holte eine Zigarette heraus und kratzte mich damit am Kinn.
»Was passiert denn mit Leuten, die Ihnen komisch kommen?«, fragte ich. »Müssen die Ihnen die Perücke halten?«
»Kein Wort über meine Perücke«, fauchte er.
»Ach, Entschuldigung auch«, sagte ich.
»Am Haus hängt ein Schild, ›Kein Zimmer frei‹«, sagte der Mann. »Wie kommen Sie da hier rein und finden eins?«
»Sie haben den Namen wohl nicht verstanden«, sagte ich. »Orrin P. Quest.« Ich buchstabierte es für ihn. Nicht einmal das machte ihn glücklich. Dann kam eine eisige Pause.
Abrupt drehte er sich um und tat einen Stapel Taschentücher in seinen Koffer. Ich trat ein wenig näher. Als er sich wieder umdrehte, hatte sein Gesicht so etwas wie einen wachsamen Ausdruck angenommen. Wenn es nicht von Anfang an wachsam gewesen wäre.
»Freund von Ihnen?«, fragte er wie nebenbei.
»Sind zusammen aufgewachsen«, sagte ich.
»Ruhiger Zeitgenosse«, meinte der Mann locker. »Wir haben uns zusammen die Zeit vertrieben. Arbeitet für Cal-Western, oder?«
»Früher mal«, sagte ich.
»Ach, er hat gekündigt?«
»Entlassen.«
Wir starrten einander an. Das brachte uns beide nicht weiter. Doch wir hatten das in unseren Leben schon oft getan und erwarteten keine Wunder.
Der Mann steckte sich die Zigarre wieder in den Mund und setzte sich neben den Koffer auf das Bett. Als ich hineinblickte, sah ich unter einer schlampig zusammengelegten Unterhose den eckigen Griff einer Pistole.
»Dieser Quest ist vor zehn Tagen hier ausgezogen«, sagte der Mann nachdenklich. »Er glaubt also, das Zimmer wäre noch immer frei?«
»Dem Meldebuch nach ist es auch frei«, sagte ich.
Er machte ein verächtliches Geräusch. »Der Säufer da unten hat bestimmt seit einem Monat nicht mehr ins Meldebuch geguckt. Aber – Moment mal.« Sein Blick wurde schärfer, und er bewegte seine Hand wie zufällig über den Koffer und klopfte zufällig auf etwas in der Nähe der Pistole. Als er die Hand zurückzog, konnte man die Pistole nicht mehr sehen.
»Ich bin noch ganz verschlafen heute Morgen, sonst hätte ich es früher gemerkt«, sagte er. »Sie sind ein Schnüffler.«
»Na gut, sagen wir, ich bin ein Schnüffler.«
»Was ist das Problem?«
»Es gibt kein Problem. Ich hab mich nur gefragt, warum Sie das Zimmer haben.«
»Ich bin aus der 215