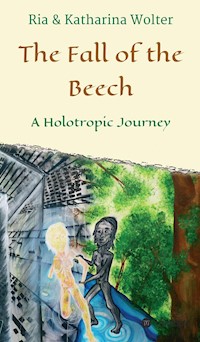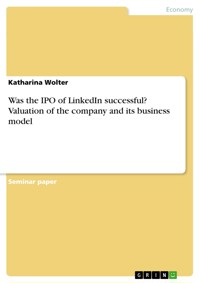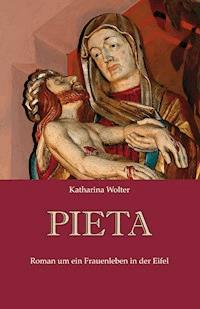Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rhein-Mosel-Vlg
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Familien-Knopfbüchse ist der Ausgangspunkt für Katharina Wolters autobiographische Erzählung, in der die alten Knöpfe immer neue Erinnerungsbilder ihrer Kindheit und Jugend hervorrufen, fröhliche und traurige, mit denen sie die 30er und 40er Jahre in ihrem Heimatdorf beschreibt. Offen und ohne falsche Sentimentalität schildert sie ihre persönliche Entwicklung und das Schicksal ihrer Bauernfamilie, das schließlich bestimmt wird durch das Aufkommen der Nazis und den folgenden Krieg. Ergreifend erzählt sie vom Leidensweg ihrer jüdischen Nachbarn im Dorf, aber auch von dem Leid, das der "Helden" -Tod ihrer Brüder über die Familie bringt. Ich wühle in den Knöpfen, schütte sie auf ein Tablett, auf dem sie nun ausgebreitet leigen. Es ist irre. Generationen liegen da nebeneinander. Ich kann die Knöpfe greifen, begreifen, die einer vor hundert Jahren in seiner Hand hielt, dessen Namen fast keiner mehr nennt. Knöpfe sind viel stabiler als ein Mensch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© 1993 2. Auflage 1995 eBook-Ausgabe 2011RHEIN-MOSEL-VERLAGBrandenburg 17, D-56856 Zell/Mosel Tel. 06542/5151, Fax 06542/61158 Alle Rechte vorbehalten ISBN: 978-3-89801-796-1 Lektorat: Dr. Charlotte Houben, Kronenburg Titelbild: Katharina Wolter
Katharina Wolter
Die Knopfbüchse
Kindheit und Jugend im Eifeldorf
RHEIN-MOSEL-VERLAG
Für meine Mutter genannt Burg Lies
Diese Erzählung basiert auf den Erlebnissen meiner Familie. Die außerhalb der Verwandschaft stehenden Figuren sind von mir erfunden, sie entsprechen nicht wirklichen lebenden oder verstorbenen Personen.
Katharina Wolter
I.
Ich brauche Knöpfe. Sieben Knöpfe für eine Weste, welche nun endlich fertig geworden ist. Gehäkelt und gestrickt. Die alte Knopfbüchse muß her. Die braune Dose aus Blech, in der einmal der Bohnenkaffee aus Bremen kam, sie sollte wie eine Holzkiste aussehen, weil sie so angestrichen war. Dunkle Holzmaserung und auf dem Deckel ein Schiff in Einlegearbeit aus hellem Holz. Aber wie schon gesagt, sie ist doch nur aus Blech. Die alte Kaffeebüchse, ramponiert, aber unverwüstlich, so wie ihr jetziger Inhalt: Abgeschnittene Knöpfe von drei oder vier Generationen.
Nun brauche ich sehr viel Geduld und Ausdauer. Aus tausend Knöpfen sieben zu finden, welche sich ähneln und zusammenpassen. Meine Finger wühlen in den Knöpfen, prüfen, vergleichen, und das Gefühl, in einer längst versunkenen Zeit zu leben, geht ganz langsam von den Fingerspitzen hinauf, dahin, wo alles im Gedächtnis gespeichert ist. Da sind ja drei, vier echte Perlmuttknöpfe von Mutters Bleylejacke. Sie hatte immer nur eine, ihr ganzes Leben lang. Es war die gute, für sonntags. Die war hellgrau und mit ganz winzigen, bunten Borten an den Ärmeln und unten herum, dann vorne die echten ‚Perlmottknäpp‘.
Sie wird eines Tages schwarz eingefärbt. Die gute ‚Bleylesjacke‘ liegt im Topf voll schwarzer Brühe. Der steht auf dem Herd. Mutter rührt mit dem langen, hölzernen Persilknüppel immer rund – eine Stunde lang. So steht es auf dem Tütchen aus der Apotheke: Stoffe färben nach Gebrauchsanweisung. Von dem Tag an hat Mutter eine schwarze ‚Bleylesjacke‘.
»Sie sind nu vorbei, die Zeiten, wo ich noch so was Helles anhabe. Die Jugendjahre sind ohnehin herum, un ich muß ja auch eppes Schwarzes für ‚gut‘ haben, nu wo unser Gertrudchen gestorben is. Un ich darf net immer so viel heulen am Grab, hat dat Forster Traut gesagt, dat tät dem Kind weh, dat will dat Kind net haben.«
Schwarze Kleider muß sie noch oft anziehen. Wie Klärchen dann auch noch stirbt an der Schwindsucht. Wie Franz dann auch noch fällt in Polen beim Rückzug. Vater grübelt und sinniert:
»Wenn sie ihm den letzten Urlaub für den ‚Krombiereausmacher‘ (Kartoffelernte) noch gegeben hätten – ich hatte ihn beantragt – aber der Kompanieführer hatte geschrieben, daß sie nun jeden Mann brauchen für den Endsieg, und übrigens war Ihr Sohn ja erst in Urlaub. Ich hätte ihn versteckt. Ich wußt ja, dat bald Schluß war. Er könnt noch am Leben sein.«
»Dat hättste net gekonnt, Andunn,« sagt Mutter,»die wären gekommen, die hätten ihn gefunden und an die Wand gestellt, und dann hättense dich auch verhaftet und erschossen.«
»Ich hätt ihn versteckt, hinten in der alt Scheuer im Schafstall, die Tür mit Strohpungen (Strohballen) zugesetzt, man kann net sehen, dat da noch wat is. Die klein Schurp (Luke) zu der Wies hin is mit Brennessele zugewachsen, da konnten wir ihm et Essen herein geben.«
»Aber et war noch e dick halb Jahr bis zum Kriegsend, Andunn, dat hätt net gut ausjange.«
»Ich hätt ihn versteckt, er könnt noch am Leben sein.«
Immer noch wühle ich in den Knöpfen, suche sieben, die sich ähnlich sehen. Was soll‘s? Knäpp sind Knäpp! Oder doch nicht? Die reden ja ganze Bände: Die Vergangenheit, die Kindheit, Menschen, liebe Menschen, tote Menschen. Kleidungsstücke, die sie einmal anhatten, das Leben, das sie hatten, mein halbes Leben – und das alles in der Knopfbüchse.
Was ist das denn für einer? Richtig dick, gewölbt, Messing, Kupfer oder was? Von Metallen verstehe ich nicht viel. Jedenfalls wird er schön blank, wie ich ihn reibe. Eine Kanone ist drauf und eine schöne Krone. Hat das etwa mit den alten Preußen zu tun? Auf der Rückseite steht geschrieben: J.R. Gaunt & Son London. Haben sich die Preußen die Uniformknöpfe in England machen lassen, als sie noch gut Freund mit ihnen waren?
»Nein«, sagt Walter, »das ist ein englischer Uniformknopf aus dem ersten Weltkrieg.«
Dann hat mein Vater ihn mitgebracht aus dem ersten Krieg, wie die englische Feldflasche ganz aus Messing. Und hat sie lange verwahrt.
Auf einmal sammeln sie Metall. Jeder muß jetzt Opfer bringen. Die Glocken werden von den Kirchtürmen gerissen. Sie haben nichts mehr, um Granaten zu machen. Wir müssen auch etwas geben, wenn sie kommen. Das fällt auf, wenn wir nichts geben.
»Aber wo haben wir noch eppes? Bei uns, da is nix mehr zu holen, dat han mir ja all schon im vorigen Krieg geben müssen, wat aus ‚Kopper un Blei‘ gewesen is«, sagt Vater.
Auf einmal hat Vater die englische Feldflasche in der Hand. Die ist aus reinem Messing.
»Die Engländer, die hatten nix Schlechtes. Die hab ich gefunden nach der Tankschlacht von Chambree, und nu wird se spendiert für noch en Krieg. Für et Vaterland. Dat ech net lache! Vaterland, wat is dat überhaupt? Mich hat et nur jeknecht! Vier Jahr im Schützengraben, un nix han ich davon, mein Jesundheit is futsch!«
Vater – der ewige Rebell gegen Obrigkeit, König, Kaiser, Papst, Preußen, Kommiß und zuletzt Hitler! Nutzt ihm aber nichts. Muß trotzdem in den Krieg. Und vier Jahre im Westen, Stellungskrieg, Schützengraben, mit der Nase im Dreck, Trommelfeuer, Dumm-Dummgeschütze und nix zu fressen, und mit den Knochen unter freiem Himmel im Wasserloch. Ich kenne die Geschichten alle auswendig. Nicht mal Gefreiter geworden in vier Jahren. Das ging auch sicher nicht, wenn der den Mund nicht gehalten hat. Und hält ihn immer noch nicht, nie und nicht! Schlägt mit der Faust auf den Tisch, stampft mit dem Fuß auf den hölzernen Stubenboden, brüllt:
»Die Lumpen! Die Verbrecher, dieser hergelaufene Kerl! Wie kann e janz Volk so einem nachrennen?!«
Hat ihm aber nichts geholfen, sein ohnmächtiges Wüten. Seine beiden Söhne müssen trotzdem dran glauben, der Otto in Stalingrad, der Franz in Polen. Wieder krachen die Fäuste auf den uralten Backmuldentisch, so daß bei jedem Schlag das Mehl durch Ritzen und Wurmlöcher rieselt.
»Dieser wahnsinnige Verbrecher!!!«
»Andunn, um Gottes Willen, sei still.«
Sein Bruder Klaus sagt es, ist Studienrat und jeden Sommer bei uns in den Ferien. Hat schon seinen Rausschmiß aus dem Staatsdienst hinter sich, weil er einmal zu denen gehört hat, die die Rheinische Republik machen wollten. Frei von den preußischen Junkern, sagt er.
»Wir hatten alles, was ein kleiner Staat braucht, Tradition, alte Kultur, Industrie und Landwirtschaft.«
Diese Idee paßte der damaligen Regierung und den nachfolgenden Braunen überhaupt nicht in den Kram. Onkel Klaus hält sich einige harte Jahre mit Geschichtenschreiben über Wasser, für katholische Zeitschriften, die später aber auch verboten sind.
Dann ist er Lehrer an einem katholischen Internat bei den Dominikanern: Deutsch, Latein und Griechisch. Wie man denen dann das Haus auch wegnimmt, darf er wieder an einem staatlichen Gymnasium unterrichten, denn mittlerweile ist Krieg und viele Lehrer sind Soldaten. Da brauchen sie ihn auf einmal wieder, aber er ist nun mal ein schwarzes Schaf, da muß man immer noch genau aufpassen, was man sagt. Und drei Kinder im Studium, es ist in diesen Zeiten gar nicht so einfach, den Helden zu spielen, die Spitzel liegen auf der Lauer. Darum immer:
»Andunn, um Gottes Willen sei still, wenn dich jemand hört.«
»Dat is mir egal,« knirscht Vater. Ist ihm aber doch nicht egal, auch er hat Angst. Unser Haus steht aber ziemlich einzeln. Auf der einen Seite ist unser Garten, fast hundert Meter lang. Dahinter steht die alte Schule und da ist die meiste Zeit keiner, außer vormittags, wenn die Kinder drin sind. Durch die dicken Bruchsteinmauern dringen die Geräusche von außen nicht so leicht hinein, so wie sie durch die dicken Bruchsteinmauern unserer Wohnstube nicht so leicht nach außen dringen. In den Schulpausen machen die Kinder einen solchen Lärm, daß das ganze Unterdorf von dem fröhlichen Geschrei beim Fangenspielen und dem eintönigen Singsang der kleinen Mädchen beim ‚Kranzspielen‘ (Reigen) erfüllt ist. Keiner hört es, was Vater schimpft, gegen die Nazis.
Auf der anderen Seite unseres Hofes wohnen ‚Leimes Mama‘ und ‚Leimes Papa‘ mit Sohn Leo. Sie heißen aber nicht Leimes mit ihrem Nachnamen, das ist nur der Hausname. Eigentlich schreiben sie sich Haas und sind Juden.
Wir sind gut Freund mit denen. Sie hatten einmal ein sauberes kleines Kolonialwarengeschäft.
An einem Vormittag will ich nach Schulschluß heimgehen, wie jeden Tag. Es ist nicht mehr die alte Schule neben unserem Haus, sondern die neue im Oberdorf, weil ich ja schon im fünften Schuljahr bin, und will froh heimgehen, wie jeden Tag, weil ich Hunger habe und Mutter gut gekocht hat, aber auf einmal ist alles anders als jeden Tag.
Im Dorf ist Unheil im Gange. Oben auf dem Dach der alten Synagoge klettert ein Mann herum. O wei, der kann aber runter fallen. Das hohe spitze Dach! Aber er fällt nicht herunter, der Teufel hält ihn fest. Mit einer langen Bohnenstange schlägt er immer feste gegen den Davidstern. Kriegt ihn aber nicht weg, der ist viel zu fest, hängt nur ein bißchen schief und verbuckelt nachher und noch lange Zeit. Und es bummst und kracht in der ‚Juddeschul‘. Aus den hohen Fenstern spritzen Glasscherben. Kerzenständer und Gesetzesbücher fliegen durch die Luft, landen im Dreck. Wir Schulkinder tuscheln untereinander:
»Die haben ihnen sogar den Tabernakel kaputt geschlagen. Ach was, die Juden haben keinen Tabernakel.«
»Aber doch, das Ding ist aus Eisen oder Silber, und wie sie es nicht aufkriegten, hat der eine mit dem Revolver reingeschossen.«
»Was war denn drin? Das Allerheiligste?«
»Gibt es nicht bei denen, Großvater hat emal gesagt, dat is der ‚Droaßelman‘, wat die da drinn han.« (Eine der Unwissenheit der Leute entsprungene Greuelgestalt, die angeblich im Allerheiligsten der Synagogen verehrt oder angebetet wurde.)
»Nein, nein,« sage ich, »Gesetzesrollen sind drin mit den zehn Geboten.«
Aber keiner weiß es genau von uns Schulkindern. Nun
weiter auf dem Heimweg mit dem ‚Schullesack‘ (Schulranzen) auf dem Buckel. Da wohnt der Salli, dem alten Mendele sein Sohn und die gute Hedwig, seine Frau. Sie haben einen kleinen Sohn, das winzige Manfredchen. Den hatten sie mit Bananen und Apfelsinen großgezogen, weil er sonst nichts essen konnte, ganz klein und erbärmlich ist er gewesen, als er auf die Welt kam und seither nicht viel gewachsen. Bananen und Apfelsinen, da muß ich staunen, ich wüßte mal gern wie die schmecken. Die Mendels Hedwig hat den größten Busen, man kann sich das nicht vorstellen, ein liebes freundliches Gesicht, schöne glänzende schwarze Haare und ganz dünne Beine, ein feines geblümtes Kleid, und so ein schwächliches Kind an der Hand, und so lieb hat sie ihn, daß man es sehen kann. Wie oft hatte ich sie so stehen sehen vor ihrem kleinen Haus mit dem Bäckerladen, es roch da immer so gut nach Weißbrot und ‚Schäßje‘. Aber heute nicht. Alles ist anders. Es ist hell, wie jeden Tag. Die Sonne scheint. Die Häuser stehen da wie immer. Die holprige Dorfstraße unter meinen Füßen und der Himmel über mir, das kenne ich doch, das ist mein Dorf seit ich tasten und krabbeln kann. Und niemand tut mir etwas Böses, weil ich hier hin gehöre und dem ‚Burg Lies‘ sein ‚jüngst Mädchen‘ bin.
Aber ich fühle es in meinem kleinen Kopf, es ist auf einmal alles anders. Aus der Zeit heraus gehoben. Die überdeutliche Helligkeit meiner Wahrnehmungen, das Nichtbegreifenkönnen, das kalte Grauen. Das Dorf hat seine Heimeligkeit verloren. Alles ist anders. Das Festgefügte fällt auseinander.
Riesengroße, schwarze, böse Vögel kreisen über den Dächern und werfen dunkle, jagende Schatten auf die Gesichter und in meinen Kopf. Das Fremde, Unbegreifliche ist über mir. Ist in mir.
Da liegt alles im Hof: Zucker, Mehl, Bohnenkaffee. Mutter zählt die Kaffeebohnen immer einzeln ab, wenn sie so müd‘ geschafft ist, will sich ‚en Tass Kaffee‘ machen und hier liegt er pfundweise im Dreck. Und dem Salli sein‘ Backstub kaputt geschlagen. Den kleinen Laden verwüstet. Die kleine Stube verwüstet und kaputt geschlagen. Die Juden hatten es feiner gehabt als wir. Übergardinen und ein Sofa. – Nur eines sagt Hedwig andauernd:
»Dem Manfredchen sei Spielsache han se zertreten. Dem Kind sei Wägelche han se hingemacht.«
Nichts beklagt sie sonst noch. Ich hab sonst nichts gehört, nur immer:
»‘S Manfredche, ‚s Manfredche, em Manfredche sei Sache.«
Weiter renne ich mit dem Schullesack aufem Buckel. Muß es doch erzählen dem Vater, der Mutter. Bald bin im im Unterdorf, bald daheim. Da ist ja unser Haus. Noch wenige Schritte und nix kann mehr passieren, heute, wo alles anders ist als bisher.
Soll ich nicht lieber in den Knöpfen wühlen? Das ist einfacher. Eine runde, schöne Sache. Die schicke Weste, mein Schatz wird sie gerne anziehen und sie hält ihm den Rücken schön warm, wo er es doch in den letzten Jahren so mit den Nieren hat. Da habe ich schon die Knöpfe fast beisammen, fünf, sechs ...
Aber nein. Ich muß weiter mit meinem Schullesack. Ein- mal auf dem Weg kann ich nicht mehr zurück. Da ist noch ein Haus an dem ich vorbei muß, ehe ich gerettet bin in unserem Hof. Und das ist das Haus von Leimes Papa und Leimes Mama.
Darauf sitzen sie jetzt, alle die großen, bösen, schwarzen Vögel. Schlagen die Krallen in das morsche Schieferdach. Glotzen mich an, krächzen schadenfroh und plustern die zerrupften, schmutzigen Federn auf. Zischen hämisch:
»Judd – Judd, Judd – Judd.«
In Leimes Hof rennt die Ruth hin und her. Sie ist gerade zu Besuch bei ihren Großeltern. Sie hatte noch Glück, wie ich später erfahre, denn ein volles Zwei-Liter-Einmachglas war, als sie ins Freie flüchtete, an ihrem Kopf vorbei gesaust und – krach – auf den Steinen neben ihr zerschellt. Die wäre vielleicht tot gewesen, hätte es ihren Kopf getroffen, weil es aus dem oberen Stockwerk geflogen kam, denn da stand ja der Einmachschrank mit den vielen Gläsern drin und dem grünen Fliegendraht davor.
Die Häscher sind fort. Verschwunden wie ein böser Spuk. Darum getraue ich mich hinein.
Zerstört ist meine kleine, schöne, blitzsaubere Welt. Wie hatte ich ihn geliebt, den kleinen Laden. Manchmal durfte ich sogar hinter die Theke gehen, und dann dachte ich, ich kann hier auch mal was verkaufen. In den Holzkästen war alles, was ich mir an Reichtümern vorstellen konnte: Zucker, Salz, Reis, Nudeln. Der Bohnenkaffee stand oben im Regal. Kleine feine Päckchen mit je einem viertel Pfund Kaffee. Auf den Packungen stand immer, lange hatte ich daran buchstabiert, als ich das Lesen erlernte: »Zunf‘s Tee schmeckt eben so vorzüglich, wie Zunf‘s Kaffee.« Auf der Theke neben der Waage mit der kupfernen Schüssel mit der Schnute vorne dran, wo man die spitzen Tüten reinlegen konnte beim Zucker- und Salzwiegen, stand das Beste. Drei riesige Gläser mit dicken Glasdeckeln, die einen noch dickeren Glasknopf obendrauf hatten. Die Gläser waren bis oben hin vollgestopft mit Rahmkamellen, Brustkamellen, Lutschern, die wie Eichhörnchen aussahen, durchsichtig, grasgrün, knallrot. Einmal hatte ich fünf Pfennige und mir einen Lutscher gekauft, der wie ein Eichhörnchen war.
Auf der einen Seite des Ladens stand ein Regal mit Stoffen. Einmal bekam ich ein Sonntagskleidchen davon. Betty hatte ein Kleid aus demselben Stoff. Sie war die kränkliche Tochter vom alten Haas, sie hinkte. Darum bekam sie keinen Mann wie ihre vier Schwestern. Alles Geschäftsleute und ganz vornehm. Wohnten alle weit weg in Wittlich, Hermeskeil, Amerika oder Köln. Betty aber starb sehr früh, als die Familie noch unbehelligt lebte, und jeder seinen kleinen, bescheidenen Geschäften nachgehen konnte. ‚S‘Betty‘ selig, sagt die Leimes Mama immer, wenn sie von ihr spricht. Nun, wie sie draufhocken auf dem Dach, hämisch grinsen und zischen: Judd – Judd, Judd – Judd, hat s‘Betty selig es gut. Braucht es nicht mit anzusehen.
Hin sind die schönen alten Kaffeeservice. Ich kenne jedes einzelne Blümchen auf dem Porzellan. In dem hohen Küchenschrank, der mit seinen Glasfenstertüren bis an die Decke reichte, hatten sie alle dringestanden. Die mit dem blauen Zwiebelmuster. Die mit den winzigen roten Blümchen und der bauchigen Kaffeekanne. Suppenschüssel und Teller im gleichen Muster. Viele einzelne große Kaffeetassen mit großen, erhabenen, bunten und goldenen Blumen drauf. Wie oft hatte ich im Sommer auf der heißen, steinernen Haustürschwelle aus Mayener Basalt gehockt, die kleinen Hände auf die kühlen, schwarz-weißen Steinplatten der im Schatten liegenden, offenen Dielenküche gestützt und den Glasschrank bestaunt: blau, weiß, rot, gold, viel, viel Gold. Einmal aus so einer großen, goldenen Tasse trinken, das wär mal was.
Da hinein brocken sie immer die Matzen, Malzkaffee drauf und Zucker. Der Papa Haas ißt das immer mit dem Löffelchen aus. Kann doch nicht gut schmecken, denke ich, wie ich ihm dabei einmal zugucke. Die haben sich das aber ausgedacht, daß die Matzen nicht so trocken sind, wo sie sie doch eine ganze Woche lang essen müssen, an den Tagen der ungesäuerten Brote. Und warum der Leimespapa immer die Mütze aufbehält beim Essen, verstehe ich auch nicht. Daheim heißt es immer:
»Mütze ab, wenn de herein kommst! Oder haste Müsche (Spatzen) drunter?«
Heute aber steht der obere Teil des Küchenschrankes auf dem Kopf und bratsch! Das ganze Zeug aus Glas und Porzellan mit einem Rumms auf die blankgescheuerten schwarzweißen Steinplatten. Nur das Brautkännchen aus Glas mit den zwei flammenden, roten Herzen drauf, ist noch ganz. Wohl auch sonst noch ein paar Sachen.
Mitten drin steht die Leimesmama und sagt:
»Der eine sagte zu mir, guten Morgen Frau Haas, wir wollen ihnen gerade mal die Möbel grade stellen.«
Sie hatten eine große schwere Axt. Damit ging das schnell. Der Leo ist fort. Den haben sie einige Tage zuvor verhaftet. Auch den Salli, den Mann von der Hedwig und auch sonst alle jüngeren kräftigen Juden. Man wollte ungehindert dreinschlagen können. Wenn die sich gewehrt hätten, – es hätte ja sein können, daß so ein Saujudd noch auf die Idee gekommen wäre, sein Eigentum zu verteidigen. »Alte Leute, Frauen und Kinder, die packen wir schon noch.«
Über dem ganzen Wirrwarr hängt ein komischer scharfer Geruch, den ich nicht kenne. »Dat ist der Cognak, den sie vom Sohn Benny zum Geburtstag bekamen,« sagt meine Mutter, »die Flasche ist kaputt.« Mutter ist nun auch herüber gekommen. Kann nicht viel sagen zur Leimesmama vor lauter Zorn und Erbarmen. Die sagt nur immer:
»Lies – Lies, Lies – Lies.«
Et Lies, das ist meine Mutter. Aber mit einem Mal hat die Threes, so heißt die Leimesmama, das Bild in der Hand, s`Betty selig. Das Glas ist zersplittert. Und mit einem Mal ist alles nicht mehr so wichtig, was da liegt. Was sie mit Bienenfleiß zusammengetragen in einem langen, harten Leben, und sieben Kinder großgezogen und alles immer tipp-topp gehabt, kein Stäubchen, die Herdplatte so blank, ich guckte manchmal rein und glaubte es sei ein Spiegel.
»Se han em ‚Betty selig‘ sei Bild,« weiter kommt sie nicht.
Allen Nachbarn zeigt sie es. Ich höre sie sonst um nichts viel jammern. Nur immer:
»S‘Betty selig, se han em ‚Betty selig‘ sei Bild zerschlage.«
Aber ‚s Betty selig‘ lächelt hinter der zerborstenen Glasscheibe wie ein Engel:
»Wein doch net, Mama, et hat mir ja net weh getan. Ist doch nur das Glas gewesen, an mich kommen die net mehr dran, so en lang Axt han die garnet.«
Daheim bin ich wieder. Die schwarzen Vögel sind weg. Hier in unserer Stube, wo der warme Ofen brennt, pickt mir keiner mehr von denen in den Kopf. Hier haben sie keine Macht über mich. Und der Dippekuchen steht auf dem Tisch, dampft, riecht gut, hat eine schöne braune Kruste. Dazu gibt es eingemachte Birnen, die flutschen nur so durch den Hals in den Bauch. Aber selbst dem Vater hat es diesmal die Sprache verschlagen. Ich glaube, das stellt bei ihm noch Verdun in den Schatten. Nun auf einmal reden sie davon, daß der Pastor da gewesen ist. Er besucht immer alle Kranken und kommt auch jeden Dienstag nach der Messe unsere Gertrud besuchen. Die liegt nun schon viele Wochen schwer krank in der Kammer neben der Stube, und wird und wird nicht besser.
Wie er da auf den schönen, jungen Doktor aus Karden getroffen ist, und die beiden haben eine Gesinnung. Der Doktor kommt immer zu Gertrud, ist tüchtig und wird ihr helfen. In der Kammer bei der lieben, stillen, herzkranken Gertrud sind alle zusammen, und draußen im Nachbarhaus kracht es. Türen und Fenster zu und ohnmächtige Wut. Was die alles gesagt haben!
»Hätt‘s einer gehört, se wären jetzt schon all im Zuchthaus un kämen ihr Läbdesdaach net mehr heraus.«
Das sagt Mutter. Der junge Doktor ist doch so fromm, hat eine schöne junge Frau und schon drei Kinder. Jedes Jahr eins. Der Krieg ist erst ein paar Wochen alt, da sagt er zu meiner Mutter:
»Frau Kraemer, diesen Krieg müssen wir verlieren.«
Mutter hat ja nicht den Durchblick, wie so ein Studierter und fragt: »Warum?«
»Wenn wir diesen Krieg gewinnen, Frau Kraemer, lohnt sich das Leben nicht mehr in unserem Land, da hat es keinen Sinn mehr, Kinder in die Welt zu setzen.«
Fünf hat er, wie er ein paar Jahre später den ‚Heldentod‘ stirbt.
Später dann räumen sie den Vorhof der Synagoge auf. Man wirft alles Brennbare auf einen Haufen und steckt es an. Kultgegenstände, viele alte Schriften und Bücher, wie alt sind sie? Hundert Jahre oder tausend? Gleichviel, sie brennen, verbrennen. Anklagend züngeln die Flammen gegen den Himmel:
»Wo bist du, Gott unserer Väter?«
Zuletzt liegt da ein Haufen Asche, grau und schmutzig. Irgend jemand stochert mit einem Stock drin herum, so daß noch einmal ein wenig schwarzer Qualm aufsteigt. Er spuckt hinein und sagt verächtlich zu den herumstehenden Kindern:
»Ló hat der Droaßelman erein jefuurzt.«
II.
Aber es müssen doch auch ein paar hellere Farben drin sein in dieser verflixten Knopfbüchse. Ich weiß es genau, daß es die gibt. Vielleicht die hier. Dutzendweise blankgewetzte Hosenknöpfe, Buxeknöpp oder Boxeknäpp genannt. Wenn sie neu sind, sind sie vornehm schwarz lackiert. Geht aber schnell ab, wenn sie ein paar mal übers Waschbrett gerubbelt sind – und scharfe Lauge – und Mutters Hände ganz rot. Was soll daran schon lustig sein? Aber Mutter muß manchmal doch lachen, wenn sie sie so einen Boxeknopp genau besieht. – Elegant und solide – so steht es eingeprägt rund um jeden Knopf. Darum geht es auch nicht ab nach hundert Wäschen und steht jetzt noch da, nach einem halben Jahrhundert. Solide ja, das kann ich bezeugen, aber elegant? Ich weiß nicht recht.
Zumindest sind die Hosen nicht sehr elegant, wo die Knöpfe ihren Stammplatz haben. Die blauen geflickten, montags frisch, samstags verdreckt und verschwitzt. Montags müssen alle Knöpfe dran sein, vorneherunter und oben am Bund, wo die breiten Hosenträger drangeknöpft werden, sonst zum Dunnerkeil ist mit der Frau nix los, wenn sie nicht dafür sorgt, daß ihre Mannsleute propper angezogen sind.
Geflickt ist immer propper. Je mehr Flicken, desto tüchtiger und haushälterischer ist die Frau. Hellgrau verblichen und verwaschen ist die ehemals dunkelblaue Köperjacke, aber nur noch an den Stellen, die nicht geflickt sind. Die Flicken sind eigentümlich ineinander verschachtelt, neue dunkelblau, ältere in verschiedenen Blau- und Grautönen je nach Alter. Das Ganze sieht aus, wie eine Landkarte der USA mit ihren geraden, verschachtelten Grenzlinien.
Der Vater sitzt im Hof auf dem niedrigen Schabellchen, (Fußschemel) den Sensenstock zwischen den Knien und dengelt die Sense. Bei ihm steht der Juchem vom Nachbarsdorf, er stützt sich auf den Koescht (Harke), ruht sich ein bißchen aus, während sie davon reden, daß es dieses Jahr nun schon genug geregnet hat, und daß sie jetzt gern Heu machen wollen, wenn es nur mal trocken hält. Mutter geht zum Schuppen, sie braucht noch einen Arm voll Holz um den Herd zu stochen, weil es jetzt an der Zeit ist, das Mittagessen zu kochen. Da sieht sie, wie der Kastesch Matthes sich auch zu den Mannsleuten gesellt hat, der geht immer kurz vor elf Uhr an unserem Haus vorbei und zur Kirche Mittag läuten. Wenn es aber noch ein Viertelstündchen zu früh ist, kommt er öfter in unseren Hof, um ein bißchen zu plaudern.
»Nun, da han ich ja noch en Stund Zeit für ze kochen,« meint Mutter und, »goode Morje,« sagt sie, als sie mit dem Arm voll Reisig an den Mannsleuten vorbei zurück zur Küche geht. Dort sagt sie zu unserem Klärchen: »Na ja, der Juchem hat aber wieder en franselich (zerfranst) Arbeitsjäckelchen an un in der Bux e paar Löcher. Ich hätt bald gemeint, der Hintern hing heraus. Ich kann net verstehen, dat sein Grit ihn so gehen läßt, so ging unser Andunn net.« Einmal hatte Mutter davon erzählt, daß der Juchen als sie jung waren, immer Spaß an ihr gehabt hätte, sie aber nicht an ihm (an jemanden ‚Spaß haben‘ heißt in den Betreffenden verliebt sein).
»Er war immer ein herzensguter Mensch, aber ich wollte ihn net. Aber dat die Grit ihn heut mit so kaputten Brocken (Kleidungsstücke) herumlaufen läßt ...«
Vielleicht denkt sie, hätt ich ihn genommen, käm er heut anders heraus. Aber Mutter hat den Andunn genommen und hat ihn gern, wenn er auch oft so kriddelich (launisch) ist.
Im Winter steht er oft vor dem großen Schrankofen. Die vier Türen stehen offen. Vater lehnt mit dem Rücken am Ofen und stützt die Arme auf die zwei oberen gekachelten Ofentüren und die Wärme zieht ihm so richtig schön in den Hintern und ins Kreuz, wo er so oft den Hexenschuß drin hat. Mutter kommt herein und stellt den Topf mit Krumbiere (Kartoffeln) erst mal auf den Fußboden, weil sie nicht an den Ofen ran kann. Sie selbst stellt sich ganz dicht vor ihren Andunn und der legt die Arme um ihre Mitte, sie ihre Arme um seinen Hals. Sie geben sich einen Kuß, ich gucke zu und weiß, das ist gut. Weil Vater dann immer so kleine Lachfältchen um die Augen hat und gut gelaunt ist. Ich bin ja noch so klein und darf ruhig dabei sein, wenn sie sich einen Kuß geben oder zwei.
Aber schlafen tun sie immer in verschiedenen Kammern. Mutter bei uns Mädchen, Vater irgendwo oben in einem Kämmerchen oder auf der großen Stube, wo die Jungs sind. Auch das ist für mich selbstverständlich, aber für die Eltern noch lange nicht. Das erfahre ich aber erst viele Jahre später, und daß es etwas mit ‚Ogina Knaus Methode‘ zu tun hat. Klärchen hat einmal ein Buch gefunden, das in Vaters Kleiderschrank, in den wir eigentlich nie hineinschauen durften, versteckt war und es gelesen.
»Ich hat et nicht gut genug versteckt, dat Buch, und da sagte dat Kind doch eines Tages zu mir: ‚Modter jetzt weiß ich auch, warum Vadter jetzt immer oben schläft.‘ Ich han jemeint et haut mir einer mit nem Hammer vor de Kopp.«
Das sagt Mutter, als sie es mir erzählt. Ich bin aber selber schon verheiratet, wie sie mit diesen Geschichten heraus rückt. Oder war es doch schon vorher? Ich weiß es nicht mehr genau. Aber genau weiß ich, daß ich sie eines Tages bedränge. Ich stehe kurz vor meiner Heirat, will es genau wissen, will es von ihr erfahren, wie es geht. Aber sie kann es nicht sagen. So festgefahren ist das Tabu. »Ich kann nur sagen, dat et eppes körperliches is.« Daß ist alles, was ich aus ihr heraus kriege.
Immer will ich alles wissen. Eine Kuh kalbt. Im Stall sind die Großen, Vater, Onkel, Brüder, Nachbarn, die herbeigerufen sind. Aus der halboffenen Stalltüre dringt es muh, muh, muuhh, dumpf, gequält und schauerlich. Sie rennen durch den Hof, holen ein Seil. Einer kommt aus der Stalltüre, die Arme bis zu den Ellbogen mit Blut verschmiert.
»Geh rein in die Küch, Kinder dürfen net zugucken!« Ich weiß aber, daß es drin war im Bauch. Hatte gesehen, wie die Braune einen schweren, dicken Panz (Bauch) hatte und ich bedauerte sie, weil sie sich so abschleppen mußte, wenn sie zur Wiese ging. Die anderen Kühe rannten ihr manchmal davon und sie immer hinterher mit dem schweren Bauch. Das Euter prall mit glänzenden Zitzen schleifte fast über den Boden und schlug, wenn sie rennen wollte immer hin und her, es mußte weh tun. Aber was jetzt im Stall passiert, tut noch weher, Blut und Muhh – muuhh. Aber wie? – Wo? – Was ist damit? – Wie kommt es heraus? Wo kommt es heraus? Ich frage meinen Bruder Franz, der schon zu den Großen gehört: »Wo kommt das Kälbchen heraus? Aus der Schnüss (Maul)?« – »Ja,«sagt Franz, »aus der Schnüss.«
Doch ich zweifle, denke weiter dran, darf nicht, tue es doch. Und das ist schon eine Sünde. Denken, daß es hinten aus dem Loch kommt – nein, darf ich nicht.
Alle haben es mir einmal gesagt. Sie sitzen am Tisch und trinken Malzkaffee, ich spiele und turne auf dem Fußboden herum, strecke den kleinen Hintern in die Luft. »Deck dich zu, dat macht man net, dat darfst du net.« – »Darf ich net?« – »Nein!« – »Darf ich da auch net hingucke?« – »Nein!« –»Auch net dran fühlen?« – «Nein! Immer zudecken.«
Das Kind ist etwa zwei oder drei Jahre alt und weiß jetzt schon, daß es unten etwas Böses hat. Das war meine allererste Aufklärung, die treibt noch heute ihr Unwesen in mir. Allerdings erfahre ich einige Jahre später, daß es mildernde Umstände gibt, man darf sich da kratzen, wenn es einen juckt und es keiner sieht.
Tragisch ist der Tag meiner ersten heiligen Kommunion. Ich bin so gut vorbereitet. Was ist an einem Kind zu bereiten? Haben sie nicht begriffen, daß ER gesagt hat: »Lasset die Kleinen zu mir kommen und wehret es ihnen nicht.«
Doch das geht nicht einfach so, einfach hin in die ausgebreiteten Arme des göttlichen Kinderfreundes, hinein in die unendliche Liebe. Du bist unwürdig! Ich habe so viele Sünden, wie der Hund Flöhe hat. Und alle gebeichtet. »Ich habe genascht, ich habe in der Kirche geschwätzt, ich bin gegen meine Eltern ungehorsam gewesen, ich habe mich mit meinen Geschwistern gezankt, ich habe anderen Kindern Schimpfworte gesagt, ich habe gestohlen.« – »Was?« – »Einen Apfel.« – »Einen Apfel? Auflesen darf man einen ab und zu, wenn man Hunger hat.« sagt der Kaplan. »Nein, ich habe ihn am Baum abgepflückt, der uns nicht gehörte. Ich habe, ich habe, ich habe. Ich habe (das ist das Schwerste zum Sagen) Unkeusches getan.« – »Allein oder mit anderen?« – »Einmal allein, zweimal mit anderen (bei Todsünden muß man die genaue Anzahl sagen). Die spielten Doktor, wollten, daß ich mithelfe, die waren schuld, keine Ausrede, mitgehangen – mitgefangen. Ich habe Unkeusches gedacht, ich habe unkeusche Bilder angeschaut.« Habe ich nun alles gebeichtet? Ich glaube schon, Gott sei Dank, jetzt bin ich würdig.
Unkeusche Bilder gibt es bei uns eigentlich gar keine. Aber doch, einmal ist die Näherin dagewesen und hat einige Tage für uns genäht, Sonntagskleider für Klärchen, Gertrud und mich. Da war ein Modeheft. Man konnte sagen, so will ich mein Kleid haben. Ein bißchen Reklame ist auch in dem Heft, Persil bleibt Persil, ein Frauenkopf oben und die Haare hängen unheimlich lang an der ganzen Heftseite herunter, ein Kamm mit dem man greise Haare schwarz kämmen kann. Eine Frau, man sieht nur die obere Hälfte und jetzt kommt das Schlimme, die Sünde, denn die hat einen dicken Busen, richtig zwei Stück. Darunter steht: Formschöne Büste.
Büste – wie ich allein an diesem mir unbekannten, sicher sehr unkeuschen Wort herumwürge, darf ich es lesen, denken, hab ich das Bild richtig freiwillig angeguckt? Nein, nein, ich hab schnell weggeguckt! Oder doch nicht? Ist es dann eine schwere Sünde oder eine ‚läßliche Sünde‘. Ich konnte die Katechismusfrage, was gehört zu einer schweren Sünde, auswendig. Dazu gehört:
1. Die wichtige Sache.
2. Die klare Erkenntnis.
3. Der freie Wille.
Jetzt gehts aber richtig los, ich gehe systematisch an die Sache ran. Also erstens, wichtige Sache? Na klar. Doch bei Punkt zwei und drei komme ich nicht klar. Ich gehe alles nochmal von vorne an durch, immer wieder, zehnmal, hundertmal, und die Angst, es falsch zu machen, unwürdig zu beichten, Todsünde, Hölle, Teufel, zumindest viele, viele Jahre Fegefeuer, verdunkeln das Bild des göttlichen Kinderfreundes.
Franz hat so ein Bild. Es ist sein Kommunionbild und hängt schön eingerahmt über seinem Bett. Und schön ist der Jesus. Freundlich lacht er und gut, und alle Kinder rutschen auf seinen Knien herum, und es macht ihm gar nichts aus. Ich möchte auch dahin. Ich renne auf ihn zu, spüre, da ist alles was es gibt, aber auf einmal Scharen von großen, schwarzen Vögeln, die schlagen mit den Flügeln und verjagen mich, ich kann nicht zu IHM.
Ich hocke heulend in der Ecke in der Kammer neben der Wohnstube, wo sie alle sitzen und den Tag meiner ersten heiligen Kommunion feiern. Und ein riesengroßer, schwarzer Vogel sitzt auf dem Kopf, der mit dem schönen weißen Kommunionkränzchen geschmückt ist, bohrt seine Krallen ins Hirn des Kommunionkindes und krächzt immerzu: Hingeschaut, wichtige Sache, freier Wille, klare Erkenntnis, unwürdige Kommunion. Unwürdige Kommunion ist die größte, schwerste Todsünde, die es gibt. Da schlägt man den Heiland eigenhändig ans Kreuz und spuckt noch drauf.
Mutter kommt in die Kammer und holt einen Streuselkuchen für den Kommunionskaffeetisch. »Was machst du hier, komm doch Kaffeetrinken, aber warum heulste so?« – »Modter, Modter ich han...« – »Aber nein.« Sie weiß meinen Kummer; ich hatte es ihr schon am Samstag Abend mit viel Stottern erzählt.
Am Samstag Nachmittag sind die Mutter, meine Schwestern und einige Cousinen, die schon zum Fest gekommen sind, mit fröhlicher Arbeit in der Küche, kochen, backen, putzen. Morgen ist ja weißer Sonntag. Ich komme von Forst nach Hause, war in der Pfarrkirche, habe alles richtig gebeichtet, nun so richtig froh, federleicht, hüpfe auf einem Bein. Zu helfen brauche ich heute auch nicht, sind genug große Mädchen da, arbeiten für das Fest und alles wegen mir. Eine Tasse Malzkaffee und ein Äppelschmeerbrot, dann trolle ich mich.
Irgendwer sagt zu mir, wie ich über die Straße hüpfe, »Du hast ja Morgen e groß Fest,« und ich bin mächtig stolz. Hinter der Kirche steht ein altes Haus. Aus dem stammt meine Großmutter, die Burg Amie. Die ist aber schon lange tot. Das tut mir leid, viele andere Kinder haben eine Großmutter, nur ich nicht.
Ich gehe oft und gerne in das alte Haus. Ein Cousin meiner Mutter wohnt da und sie haben viele kleine Kinder, Buben und Mädchen, wie die Orgelspfeifen. Ich bin daheim das Kleinste, will immer noch ein Kindchen, doch wir kriegen keins mehr. Darum spiele ich eben oft mit den Verwandtenkindern. An diesem Nachmittag hat eines der kleinen Bübchen nur ein Hemdchen an, aber kein Höschen. Ist sicher gerade keins mehr trocken. Und jetzt kommt das Verhängnis, wie es sich hinhockt, glaube ich auf einmal, ich hab dahin geguckt. Gesehen hab ich nichts. Oder doch? Fort ist alle Freude. Fest hin, Weißer Sonntag her, jetzt bin ich wieder unwürdig, aber kann nicht mehr beichten gehen. Es ist für alles zu spät.
Ich schleiche nach Hause und drücke mich in den Ecken herum, muß denken und prüfen, wie ich‘s gelernt: »Wichtige Sache, klare Erkenntnis, freier Wille.« Aus meiner Not ein scheues, leises »Modter, Modter, komm mal her, ich muß dich eppes fragen.« Ich sage und frage, aber selbst Mutter die Große, die Gute kann mir nicht mehr helfen. Sie sagt mir, daß es bestimmt nicht schlimm war, für ein paar Minuten geht es mir besser, aber dann schlagen wieder die schwarzen Flügelschläge in meinem Hirn und die Angst geht mit mir ins Bett. Vorher hatte Mutter mich in die große Zinkwaschbütte gesteckt. Es ist schon etwas Besonderes, daß sie das heute selber mit mir macht, sonst tun das immer die großen Schwestern, hauptsächlich Klärchen. Waschen, anziehen, erziehen, alles. Und Schimpfe und Backpfeifen gibt es dabei massenhaft. Ich will nicht, wälze mich auf dem Boden, trete, schreie. Sie, Klärchen hat ganz lange dünne Finger, die klatschen nur so um die Ohren. Es ist überhaupt alles lang und dünn an ihr. Sie hat es schwer mit mir. Kleines Trotzköpfchen, kleines Sündenböckchen.
Nur heute läßt es sich die Mutter nicht nehmen ihr Kommunionkind selber abzuschrubben. Wie ich dann sauber bin und stehe ganz ‚nackisch‘ in der Bütte, guckt sie mich auf einmal ganz froh und mit Liebe an und sagt: »Eweil bist du aber e richtig Engelche.« Ach Mutter, Mutter, warum glaube ich dir nicht?
Sie ist immer geneigt, den Glauben als etwas Gutes, Frohes zu begreifen, Gott als gut anzuerkennen. Manchmal erzählt sie: »Unser Michel, der Russ hat gesagt: ‚Gott ist nicht wie Menschen meinen, Gott ist ganz, ganz anders.‘« ‚Unser Michel‘ ist ein russischer Kriegsgefangener gewesen, im ersten Weltkrieg hatte er ein paar Jahre zu unserer Familie gehört, war gutmütig und fleißig.