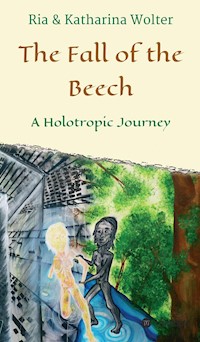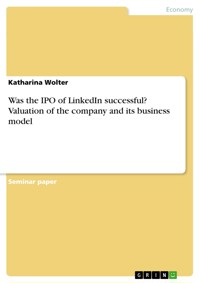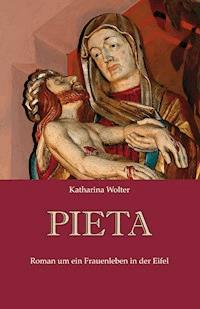
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rhein-Mosel-Vlg
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In ihrem Roman 'Pieta' erzählt Katharina Wolter das Leben von 'Rösje Leyendecker' und beschreibt dabei den Wandel im Eifeldorf 'Endingen' während des 20. Jahrhunderts. Sie schildert das Leben der Familien als Kernzellen der Dorfgemeinschaft in sozialer, aber auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Ein Leben, das dem Jahresablauf der Landwirtschaft folgt, geprägt von mühsamer, körperlicher Arbeit, bestimmt durch die überkommenen Regeln bäuerlichen Wirtschaftens und Haushaltens und gehalten von traditioneller Religiosität. Symbol und Ausdruck dafür ist die Pieta in der Schwanenkirche, die Figur der trauernden Muttergottes, bei der vor allem die Frauen des Dorfes immer wieder Trost und Hilfe suchen. Der Gang dorthin, wie eine kleine Wallfahrt mit vielen Gebeten, wird schon von Kindesbeinen an zur häufigen Übung. Daran ändert auch die Machtübernahme des Nationalsozialismus wenig, die ansonsten auch im Dorf nicht ohne Folgen bleibt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 382
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© 2005 eBook-Ausgabe 2011RHEIN-MOSEL-VERLAGZell/Mosel Brandenburg 17, D-56856 Zell/Mosel Tel. 06542/5151, Fax 06542/61158 Alle Rechte vorbehalten ISBN: 978-3-89801-799-2 Korrektur: Thomas Stephan
Katharina Wolter
Pieta
Roman um ein Frauenleben in der Eifel
RHEIN-MOSEL-VERLAG
Mein Dank gilt allen, die mir Anregungen zu diesem Buch gegeben haben und meiner Enkelin Helen Wolter, die mir über die Stolpersteine der neuen Rechtschreibung hinweghalf. Die Figuren meines Buches sind von mir frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig.Die Bibelerzählungen sind freie Interpretationen von mir.Katharina Wolter
1. Kapitel
Gerade hat sich das kleine Mädchen ein bisschen unterm blühenden Kirschenbaum hingestreckt. Rösje will sich ausruhen. Der Vormittag war ja auch anstrengend genug gewesen. Fünf Stunden Schule, davon zwei Stunden Sport, die einen kilometerweiten Anmarsch zu dem im Wald liegen Sportplatz beinhalteten. Dann Laufen, Ballwerfen und Springen in die Springgrube. Mit dem Sport hat sie‘s nun mal nicht. Alle anderen laufen schneller, werfen weiter. Springen geht ja noch, sie ist halt ein magerer Grashüpfer mit langen Beinen.
Behaglich kuschelt sie nun im moosdurchsetzten Gras, blinzelt ins grüne Blätterdach über sich, wartet schon lange auf die Kirschen, die viel zu langsam dick werden. Jeden Tag eine ins Mäulchen gestopft, wieder ausgespuckt. Nix zu machen, immer noch knappisch und sauer, wenn auch schon mit trügerischem Rot. »Lo kann mer nix dran mache«, denkt Rösje, »loa muss die Sunn noch besser schäine, immer schäine, schäine un schäine, su warm un hell be hout Medtag.«
So ein winziges Strählchen zwinkert durchs dichte Kirschenlaub, sticht Rösje in die Pupille. Schnell kneift sie die Augen zu, hört nur noch aufs Summen der dicken Hummel und entschlummert.
Nicht lange genug kann das müde Schulmädchen schlafen. Schon pirscht sich Fränzchen, ihr kleiner Bruder und spezieller Quälgeist, heran, und kitzelt mit einem langen Grashalm ihre Stirn. Sie schrickt auf, routinemäßig schlägt sie aus, ihre kleine Faust prallt an Fränzchens Rippen, der lässt sich sofort mit allerhand mehr Gewicht als das seiner Schwester auf sie drauf plumpsen, und schon ist eine zünftige Katzbalgerei im Gange. Quietschen, schnaufen, knuffen, zwicken. Da ertönt vom Hof her die Stimme der Mutter:
»Röösje! Röösje! Bo biste?« Keine Antwort. Der kleine Deikert hat seiner unterlegenen Schwester mit seinen kurzen, dreckigen Fingern den Mund verstopft. Er reitet ihr mit dem Hintern auf dem Magen, sie zappelt mit Armen und Beinen wie eine Biene, die auf dem Rücken liegt. Die Mutter aber ist den ihr wohlbekannten, verdächtigen Geräuschen nachgeeilt, packt Fränzchen beim Genick, reißt ihn hoch.
»Dou wüster Jung! Weile awer erein mit dir, hout jehste net mehr spille.« Mutter Kätt gibt ihm mit der flachen Hand ein paar Klapse auf den Hintern, er trollt sich maulend ins Haus.
Kätt hat ihrem zerzausten Mädchen auf die Beine geholfen, putzt ihr Rotz und Tränen ab, strählt mit den Fingern das zerzauste strohblonde Haar. »Dou arm Dinge, hat en dech widder esu rummeneert, na woart mei Jingeltje, deine Vadter kimmt gläich haam! Dann kann en sech of eppes jefasst mache, der Lousert!« »Ach, lass doch Modter, sag em Vadter nix.« Rösje hat schon wieder Mitleid mit dem Kleinen, nimmt ihn wie immer in Schutz. Sie bemuttert den um drei Jahre Jüngeren von jeher. Sie hat sich wieder der Länge nach ins Gras gelegt, sagt gähnend:
»Lass mich noch e bißje penne, Modterche, ech han net vill Schullaufgabe hout ze mache.«
»Dann schlaf noch e half Stündje, die Tant Plun hat jefroacht, ob dou mit ihr off Schwannekirch wells jon, dou sollst aafholle, wenn se den Rusekranz bät.« Rösje quält sich ein müdes »Joa Modter« ab und drückt ihr Gesicht mit einem Seufzer ins Gras. Sie kann die fromme, strenge Tante nicht ausstehen. Freundlich ist die zu Kindern nur, wenn sie ihre »Zähne aus« hat, was bedeutet, dass ihr künstliches Gebiss irgendwo im Wasserglas liegt, weil sie wehe Bellere (Zahnfleisch) hat. Ja, und mit eingefallenem Mund ist man zwangsläufig bescheidener als sonst. Die alten »Veddere und Base« (alte Männer und Frauen) gehen ja meistens mit großen Zahnlücken, denn künstliche Zähne sind zu teuer. Jedoch Tant Plun hat das Tränken eines Kalbes schon frühzeitig vier Schneidezähne gekostet. Es muss ein kräftiges Kälbchen gewesen sein. Tant Plun stand in gebeugter Haltung, drückte seinen Kopf in den Milcheimer, um ihm das Saufen beizubringen, als das unterdrückte Tier ihre Faust abschüttelte und mit seinem Schädel hochfuhr, der Plun mit Schmackes gegen den Mund. Und weil ihre Backenzähne sich eh schon nicht mehr als erhaltenswert erwiesen, bekam sie ein ganz neues, schönes »Jebeß« mit regelmäßigen, schneeweißen Zähnen, so teuer, dass nicht nur das rebellische, sondern noch ein zweites, ganz unschuldiges Kalb verkauft wurde und sein Leben beim Metzger aushauchen musste. Mit den weißen blitzenden Zähnen, die beim Sprechen nur ein scharfes, zischendes »SSS« zuließen, jagte Tant Plun dem Rösje Furcht ein. Seufzend drückt das Kind sein Gesicht auf seine mageren Arme. Mit der Ruhe war es aus, denn heute Nachmittag, während sie durch andere Dörfer gingen, würde sie bestimmt nicht mit bescheiden eingefallenen Lippen beten. Rösjen würde präzise und ausdauernd ihren Teil des Wechselgebets bestreiten müssen, da gibts kein Pardon. Darum verlässt sie ihr Lieblingsplätzchen unterm Kirschbaum und geht zur Mutter ins Haus. Die bindet ihr ein frisches, weißes, besticktes Sonntagsschürzchen vor, kämmt ihr das Flachshaar und knüpft zwei hellblaue Schleifen an ihre Zöpfe. Solchermaßen getröstet, tritt das Kind an Tant Pluns Seite den »Gang« zur etwa fünf Kilometer weit gelegenen Schwanenkirche an. Plun trägt einen schwarzen Stoffbeutel und sagt:
»Ech han Empelesaft (Himbeersaft) und en Botterbreck (Butterbrot) debäi, dat jet et ewwer erst off em Rückweech ze esse un ze trinke.« Gleich nach dem ersten Rosenkranz, der unweit des Pfarrdorfes Forst zu Ende gebetet ist, hat das Kind schon Durst, die Kehle ist trocken. Es schielt nach dem schwarzen Beutel, an dem sich die Konturen einer Flasche abmalen, aber es wagt nicht, um einen Schluck Himbeerwasser zu bitten. Doch als die beiden an Pfarrhaus, Kirche und Friedhof vorbei sind und Tant Plun resolut in den Pfaffenhauser Weg einbiegt, hört Rösje den »Boor« plätchern. Sie rennt auf ihn zu, hält die kleine Hand geübt zur Schale gerundet unter die Zutt (Auslauf) und trinkt sich satt am frischen Brunnenwasser.
Die Tante ist stehen geblieben, dreht sich um, weil sie das Kind an ihrer Seite vermisst, sieht wie es sich mit dem Gesicht schräg unter der Zutt am Wasserstrahl labt und ruft:
»Heh! Bo bläivste dann?!« Rösjen ist mit ein paar flinken Sprüngen wieder neben ihr, bekommt jedoch eine Ermahnung.
»Wenn mer wallfahre jaht, moss mer Durscht aushalle, sonst helft dat bädde nix!« Jetzt wagt Rösje eine Antwort:
»Awer wie ich mit meiner Modter neulich jange säin, durft ich och Wasser trenke, un de Modter hat och jetronk am Forschter Boor.«
Daraufhin zischt Tant Plun ein scharfes, verächtliches »SSS« durch die Zähne:
»Däi Modter – bat weiß die dann schun?!« Jetzt ist Rösje aber sauer, denn auf ihre Mutter lässt sie nichts kommen. Trotzig geht sie neben der strengen Tante, und als die im steilen Pfaffenhauser Weg wieder einen neuen Rosenkranz anfängt, betet das Kind nur widerwillig. Die heiligen Worte werden routinemäßig heruntergeleiert, und darum wird sie bei der nächsten Beichte bekennen müssen: »Ich habe unandächtig gebetet.« Nachdem Tante Plun und Rösje die Steinbrücke über den Brohlbach betend überschritten, schnaufend und betend die kleine Anhöhe überwunden haben, liegt ein weites, flaches Land vor ihnen, nun geht es sich etwas leichter zwischen hohen Kornfeldern, grünen Kartoffeläckern und blühenden, süß duftenden Kleefeldern. Auch unter ihren Füßen der schmale Feldweg ist zwischen den tief eingeschnittenen Wagenspuren mit niedrigem weißem Klee bewachsen. Bauernkinder kennen alle wilden Blüten und kleinen Früchte, die man auslutschen oder knabbern kann. Und ohne lange zu überlegen hat sich Rösje in den kühlen Klee gehockt, sie pflückt die weißen Köpfchen ab und saugt genüsslich den Blütennektar. Tant Plun, die auf ihr »heiliger Bartholomäus bitte für uns« kein »wir bitten dich erhöre uns« hört, dreht sich um und ermahnt das säumige Kind mit scharfen SSS-Lauten geschwängerten Worten. Schuldbewusst läuft es wieder neben der Tante her, die einen großen Schritt hat. Die Kleine muss jedesmal zwei machen, wenn Plun einen tut. Aber nun, da das Türmchen der Schwanenkirche am Horizont aufgetaucht ist, betet Rösje mit neuem Eifer, bald kann sie sich in der kühlen gotischen Kirche ausruhen, und auf dem Heimweg gibts dann den Himbeersaft. Von fruchtbarem wohlbestelltem Ackerland umgeben steht die alte Kirche. Anstatt eines Hahnes als Wetterfahne ziert ein Schwan die Spitze des Türmchens. Ein grünsaftiger Anger voller Apfelbäume, dessen tief hängende knorrige Äste schon mit jungen, schwellenden Früchten übersät sind, ist der Kirche vorgelagert. Gleich hinter dem Chor beginnt ein Bauerngarten voller Bohnen, Salat, Lilien und halbwilden Rosen, der sich bis zum naheliegenden Gehöft hinstreckt. So liegt das Haus unserer lieben Frau, nicht anders als die meisten Häuser der Eifelbewohner, eingebettet in Früchte, Blumen und Gräser, als hätte sie nichts anderes im Sinne als Weizen und Kartoffeln zu ernten, am Mittag eine Schüssel Bohnen, Salat oder Zuckererbsen für ihre hungrige Familie aus dem Garten zu holen. Allerdings erinnert der altehrwürdige Bau an seine adlige Herkunft, er stammt aus Zeiten, in denen die Bewohner der Eifel eher in Hütten als in mehr oder weniger schmucken Häusern lebten. Den Rittern und Grafen war es weniger wichtig wie die Menschen lebten, als dass sie lebten. Wer hätte sie ernährt, wenn nicht die Bauern, ihre Burgen Wehrtürme und Kirchen gebaut, wenn nicht die Handwerker und Leibeigenen im Hungerlohn? Nun sind die stolzen Burgen zerstört und verwaist, aber die Schwanenkirche steht immer noch da und birgt das Bild der »Schmerzhaften Muttergottes« mit ihrem toten Sohn auf dem Schoß.
Über einen schmalen Trampelpfad durchs hohe Gras erreichen unsere Pilgerinnen die niedrige Seitentür. Tant Plun drückt die klobige schmiedeeiserne Klinke nach unten und die schwere eisenbeschlagene Eichentür nach innen. Rösje wird von einem ehrfürchtigen Schauer erfasst, nun, da sie vor dem Seitenaltar kniet, dessen filigranes, teilweise vergoldetes, neugotisches Schnitzwerk im Gegensatz steht zu der Figur, die es umrahmt: Eine Mutter, die ihren gefolterten, ermordeten Sohn auf ihrem Schoße hält. Jede blutverkrustete Wunde an seinem entseelten Körper brennt nun im Mutterherzen. Nicht nur ein Schwert, wie der greise Simeon ihr damals im Tempel geweissagt hat, durchdringt ihn. Die messerscharfen Stiche sind nicht zähl- oder messbar. Es ist das Bild der Mütter aller Zeiten. In Zeiten von Kriegen und Hungersnöten, Mord und Totschlag im Namen der Ideologien. In Zeiten der Aufklärung und des materiellen Fortschritts und Wohlstandes, die den Hunger der Seelen nicht stillen und den heranwachsenden Kindern oft nur trügerisches Glück vermitteln.
Das trauliche Bild der Weihnachtskrippe, das süße Glück der jungen Mutter nach überstandener Geburt, sollte eigentlich den Karfreitag überstrahlen, tut es aber nicht. Oft bleibt später nur die Pieta, eine gealterte Mutter, die ihr krankes oder gefährdetes Kind im Herzen trägt, dem sie nicht mehr helfen kann.
Rösje versteht und weiß von alldem noch nicht viel. Nachdenklich betrachtet das Kind das Bild so genau wie es sich alles beguckt, wie es alle Dinge genau erklärt haben will, was aber keiner tut, und so muss es sich wie so oft selber Antworten suchen auf Fragen, die man eigentlich nicht stellen, ja nicht einmal denken darf: Jesus, so hat sie es in der »Christelehr« (Religionsunterricht) gelernt, ist freiwillig in den Tod gegangen für uns. »Wie konnte er das seiner Mutter antun?«, fragt das Kind. Und ob Maria ihn nicht lieber behalten hätte, und ob sie schon wusste, warum er das getan hat?
»Kind, warum hast du uns das angetan?«, fragt Maria ihren zwölfjährigen Jesus im Tempel. »Siehe dein Vater und ich haben dich drei Tage lang mit Schmerzen gesucht.« Selbst sie, die Heiligste, wagt es Fragen zu stellen. Ob sie diesen Mord wirklich so fraglos hingenommen hat, denkt Rösje – und – »Herr, was du erduldet ist alles meine Last, ich habe das verschuldet was du getragen hast«, heißt es in einem Karfreitagslied, und, wie kann Maria mich liebhaben, wenn ich dran schuld bin, und warum ist der Jesus auf ihrem Schoß so klein, ganz dünne Ärmchen, war doch ein Mann und dreiunddreißig Jahre alt, hat der Kaplan gesagt.
Das Kind weiß noch nicht, dass selbst die größten Männer im Bewusstsein ihrer Mütter immer kleine Jungen bleiben. Sicherlich wollte der Künstler das hier ausdrücken. Ein scharfes Flüstern reißt Rösje aus ihren suchenden Gedanken:
»Mir bäden eweile die Litanei, holl aaf!« Tant Plun hat schon das Gebetbuch aufgeschlagen, sie beten nun die »Lauretanische Litanei«, in deren schönen, poetischen Vergleichen die Muttergottes als »geheimnisvolle Rose« und »elfenbeinerner Turm« benannt und angerufen wird. Dabei ist es dem Kind plötzlich ganz froh und warm ums Herz geworden, ja es vergisst für heute seine quälenden, verbotenen Fragen, nimmt die Kerzen und den Blumenduft des Altars wahr und freut sich auf den Heimweg mit Himbeersaft und Weißbrot. Dass die Tante extra ein Weißbrot für heute gekauft hat, versöhnt Rösje: »Se is doch net esu janz bös, de Tant Plun.«
Der Sommertag hat sich schon geneigt, als die Pilgerinnen zu Hause ankommen. Tant Plun muss noch die vier Kühe melken und Rösje hat noch ein paar Rechenaufgaben zu machen.
»No, wie woar et dann?«, fragt ihre Mutter, und weil Tant Plun ihr zum Lohn zwei Groschen in die Schürzentasche gesteckt hat, sagt Rösje:
»Och ja, ech jelawen schun, sos hät se mir net die zwien Grosche jän.« Sie sitzt hinterm Tisch und macht Hausaufgaben, flink lässt sie die zwei Münzen im untersten Fach ihres hölzernen Griffelkästchens verschwinden, das ist ihr sauerverdientes Geld. Und gleich morgen früh wird sie im Dorfladen sein und sich den dicken, weißen Radiergummi kaufen, auf den sie schon lange ein Auge geworfen hat, den mit dem roten Aufdruck »Gummi Arabicum«, denn ihr derzeitiger ist so abgenutzt, dass sie ihn kaum noch zwischen Daumen und Zeigefinger klemmen kann.
Mutter Kätt stellt einen Stoß Teller auf den Tisch:
»Biste bal fertig met schreiwe? Mir äessen jeleich, der Vadter un die Läit vom Rummelevereinzele sein schun hamkumme.« Rösje löst noch schnell ihre letzte Rechenaufgabe, räumt ihre Schreibutensilien in den Schullesack (Schulranzen), hilft dann ganz selbstverständlich beim Tischdecken. Zehn Teller, Löffel und Gabeln, Messer braucht es keine, weil es wie meistens nichts zu schneiden gibt. Kätt stellt schnaufend einen Zehnlitertopf voll Griesmehlsuppe auf den Tisch. Und weil sie aus frischer Kuhmilch gekocht ist, hat diese Suppe ihren prima Geschmack und hohen Nährwert. Rechts und links platziert sie dann je eine große Emailleschüssel, eine voll geschmälzter Krumbiere, und eine hoch gefüllt mit frischem Kopfsalat.
Die Familienangehörigen, ergänzt von zwei Frauen, die heute mithalfen Runkelrüben vereinzeln, nehmen in guter Laune ihre Plätze ein. Feierabend nach so einem Tag mit gekrümmtem Rücken und Hitze, Feierabend vermischt mit dem Duft von ausgelassenem Speck und gekochter Milch, das geht einem durch und durch, da lacht man selbst über harmloses Gefrotzel bei Tisch. Rösje sitzt zwischen ihrer Mutter und Liesbeth, ihrer ältesten Schwester, neben dieser Peter, der zwei Jahre älter ist als sie, am Kopfende hat Vater Fritz seinen Platz und rechterhand der kleine Lausert Fränzchen, der meistens etwas ausgefressen hat. Auch heute Abend schaut er von schräg unten scheu zum Vater auf. Der jedoch lacht ihn freundschaftlich an, scheinbar haben Mutter und Schwester ihn nicht verraten. Da riskiert er schon wieder, seine Nachbarin, die sechzehnjährige Pittjes Gisela, anzustupsen. Die ist immer dazu aufgelegt mit ihm zu schäkern, bei von deren Tischnachbarin, der Janickels Trein, ein missbilligendes Kopfschütteln hervorruft:
»Pschscht!«, macht sie und rammt der Gisela ihren spitzen Ellbogen in die Rippen, dass ihr jäh das Lachen vergeht. Trein arbeitet schon dreißig Jahre als gelegentliche Tagelöhnerin auf dem Hof, hat sozusagen Hausrecht und weiß, was sich gehört. Rechts neben ihr, Rösje schräg gegenüber, hat nämlich der »Grußvadter« japsend und ächzend in seinem Lehnstuhl Platz genommen, geleitet von Lena, der zweitältesten Schwester, die sich am oberen Kopfende niederlässt.
Der alte Bauer, immer noch Besitzer und Herr des Hofes, außerdem die Autorität in der Familie, fängt an zu beten:
»Im Namen des Vadters-Sohnes-Geistes-Amen – Herrgotthimmlijervadter seechne diese Gaben, die wir von deiner milden Hand zu uns nehmen wern – aam, Vadter unser der du bist.« Jetzt fallen alle mit lauter Stimme ins »Vaterunser« ein, und anschließend mit gutem Hunger über die einfachen, herzhaften »Gaben« her.
Rösje ist kein großer Esser, nach einem Teller Griesbrei mit etwas Zucker und Zimt bestreut, ist sie schon satt. Mutter Kätt mahnt:
»Äess doch noch e paar Krumbiere un Schloat«, weil sie sich Sorgen macht wegen des dünnen, schnell wachsenden Mädchens. Und weil sie der Ansicht ist, dass manche Krankheiten in den Familien erblich sind, denkt sie oft: »Hoffentlich beerbt dat Kind net unser Ännchen, dat hat och nie richtije Appeditt jehatt – un ist mit sechzehn Joahr an der Schwindsucht jestorwe.« Ännchen war eine jüngere Schwester von Kätt gewesen.
Rösje indes schiebt den Teller von sich und sagt:
»Ech säin satt.« Ihr ist der Appetit nicht zuletzt deshalb ganz vergangen, weil der Grußvadter wieder einmal so ungeniert über den Tisch gehustet und seinen Schleim herausgewürgt hat, um ihn dann umständlich und geräuschvoll in den Eimer mit Sägemehl auszuspucken, der steht sonst neben dem Ofen, während des Essens halt neben seinem Lehnstuhl. Sie darf allerdings den Tisch nicht verlassen, bis alle fertig sind. Der Großvater passt genau auf, dass alle Regeln eingehalten werden, dass nichts aus dem aus vielen Vaterunsern bestehenden Abendtischgebet, in dem eine ganze Anzahl Heilige und Nothelfer angerufen werden, ausgelassen, und außerdem »Allerabjestorbenen Seelen« gedacht wird. Darum dauert das kombinierte Tisch- und Abendgebet mindestens eine halbe Stunde. Für die Erwachsenen, die nun gesättigt sind und froh, dass sie eine Weile untätig dasitzen dürfen, mag es eine Art Meditation sein, halbandächtig und ein bisschen schläfrig die wohlbekannten Gebete und Anrufungen mitzumurmeln, jedoch den Kindern ist es oft zu langweilig. Fränzchen trommelt mit den Füßen gegen die Backmulde unter der Tischplatte, Vater Fritz drückt nach einem strengen Blick des Großvaters die zappelnden Beine nach unten. Rösje kann die Augen nun nicht mehr offen halten, nickt ein und lehnt den Kopf an Mutters Arm, die ihn aus Mitleid eine Weile da ruhen lässt, aber ein lautes Tock-tock, ein alter knorriger Knöchel, der auf die hölzerne Tischplatte klopft, lässt Rösje und Kätt hochfahren, beide beten nun mit letzter Kraft: »– Stunde unseres Todes Amen!«
Kätt und Lena geleiten den Großvater aus der Stube in seine Schlafkammer. Lena muss in dem kleinen Zimmerchen nebenan schlafen. Sie darf die Tür über Nacht nicht schließen, damit der kranke Mann jemanden hat, den er jederzeit rufen kann, falls er etwas braucht, und dass er keine Angst zu haben braucht, er müsse alleine sterben.
»Eijentlich müsst dein Modter häi bei mir äen der Kammer schlafe, dat wär ihr Flicht«, sagt er oft zu Lena, wenn sie nicht schnell genug aus ihrem Bett an sein Bett kommt, »Awer seit mein Fraa duut äes – un dann oos Kätt verheirod, han ich joa keinen Menschen mehr.«
»Grußvadter, ech sein doch bei dir, bat wellste dann?«
»Ech säin nass jeschwitzt, do mir e anner Himd an.« Leni nimmt eins von den weißen Hemden aus handgewebtem Leinen aus der Truhe, zieht ihm das feuchte aus und das trockene an. Die Sommernacht ist schwül, auch sie ist naßgeschwitzt aber zu müde sich selber abzutrocknen, sie lässt sich wie sie ist auf ihr Bett fallen. »Un morjefrüh widder int Rummelefeld«, denkt sie, »könnt ich doch amol richtich ousschlafe, un iwwerhaupt, wenn der Grußvadter will, kann der sich noch janz gut selwer et Himd wechsele, neulich hat en sich allein off de Weg jemach un is zu Fuß jange bis no Dümmes of die Spoarkass un hat den Kunstdünger abbestellt, den de Vadter bestellt hat, der alt Geizkragen! Als ob meine Vadter en dumme Jung wär.« Mit diesem widerspenstigen Gedanken schläft das geplagte Mädchen ein.
Nach dem Vereinzeln von Runkelrüben gehen die Eifeler Frauen und Mädchen durch die Kartoffeläcker und hacken das Unkraut aus, später noch einmal durch die Rübenfelder, ehe die größer werdenden Pflanzen den gesamten Boden überwuchern und die Arbeit behindern.
Erst wenn die Hackfruchtäcker ganz sauber dastehen, kann vor der Heuernte eine kleine Verschnaufpause eingelegt werden. Was heißt hier Verschnaufen? Man (frau) kann sich nun der Haus- und Gartenarbeit ungehindert widmen. Sie kann auch mal zwischendurch ins Nachbarhaus und ein kleines Schwätzchen halten. Kätt geht gerne zu ihrer Schwägerin, der »Schnäidersch Marie«, ins Oberdorf. Mit ihr versteht sie sich gut, viel besser als mit der Nachbarin Plun, ihrer Kusine väterlicherseits.
Marie ist für sie wie eine ältere Schwester, wenn die ihr einen Rat gibt, weiß sie, dass er aus einem klugen Kopf aber auch einem guten Herzen kommt. Marie kennt weder Neid noch Eifersucht. Sie ist meistens ganz zufrieden mit ihrem bescheidenen Dasein und es macht ihr gar nichts aus, dass andere Frauen sich etwas einbilden auf ihre Herkunft und ihre Äcker. Johann, ihr Mann, verdient nicht gerade viel als Briefträger. Marie jedoch hat die Nähmaschine und einen Stoß »Staelle« (Schnittmusterbogen) ihres Vaters geerbt, hat sich, nachdem sie als junges Mädchen nur schwere Feldarbeit verrichtet hat – sie war sieben Jahre als Magd auf einem großen Bauernhof auf dem Maifeld verdingt gewesen – das Nähen selber beigebracht, und schneidert ganz passable Sonntags- und Werktagsbekleidung für die Dorfleute. Schon als Schulkind hatte sie neben ihrem Vater gehockt, mit Nadel und Faden gearbeitet, Nähte versäubert, Knöpfe angenäht und dem »Schneidervater« so manchen Kniff abgeguckt. Gar zu gerne wäre sie auch Schneiderin geworden, aber so viele Aufträge hatte der Schneiderjuppes auch wieder nicht, dass er auf den Verdienst seiner heranwachsenden Kinder hätte verzichten können, denn es waren derer sieben an der Zahl. Fritz ging als Knecht in einen Winzerbetrieb an die Mosel, Marie als Magd aufs »Mawelt« (Maifeld) und die Mutter hatte noch fünf kleinere Geschwister satt zu machen. Als diese alle bis auf den Jüngsten aus der Schule entlassen waren und außer Hause eine Stellung hatten, starb die Mutter, und Marie kam heim, wo der Vater, schwach auf der Brust und müde vor sich hinstichelnd auf dem Schneidertisch saß. Nach einem Jahr legte er sich ins Bett, ließ sich dankbar von Marie versorgen bis die Lebenskräfte nach einem weiteren Jahr ganz entschwunden waren.
»Dou krichs et Häusje un de Nähmaschin«, sagte er eines Morgens und gab ihr ein Stück Papier in die Hand. »All die Joahr haste mir un däiner Modter treu un braf et Jeld abjeliewert«, er zeigt auf das Papier, »ich han et neulich vom Lehrer unerschreiwe lasse, et is gültig, dat Testament – so, un nou ruf mir de Pastur, et is an der Zeit.«
Und so hatte Marie nach ihres Vaters Tod ein eigenes Dach überm Kopf und heiratete ihren Hennes, mit dem sie schon einige Jahre ging. Bald hatte sie das kleine Haus in schönste Ordnung gebracht, es war gemütlicher und wohnlicher als manches große Bauernhaus. Und deshalb hält sich Kätt auch so gerne hier auf, wenn sie ein bisschen Zeit hat an Sonntagnachmittagen, aber auch wintertags, wo es genug zu flicken, zu spinnen und zu stricken gibt. Der Winter hat zwar seine rauhen Seiten hier auf den Moselhöhen, daran ist man jedoch gewöhnt, er bringt aber etwas mehr Ruhe als die drei übrigen, arbeitsintensiven Jahreszeiten.
Rösje schläft »Owenoff« (1. Stock) bei Lisbeth im Bett. Gerne kuschelt sie sich an die große Schwester, da braucht sie sich nicht so zu graulen und im Winter ist es schön warm unterm Federbett zu zweit. Es ist kein Ofen im Zimmer, der Mond scheint durch die Eisblumen des kleinen Fensters, das Kind ist erkältet und wird jede Stunde von einem Hustenanfall geweckt. Wie so oft im Winter hat die ganze Familie die Grippe, den einen hat es mehr, den andern weniger erwischt, am ärgsten natürlich den alten Bauern. Er liegt nun schon zwei Wochen flach im Bett. Leni hat auch Fieber, und darum bemüht sich Kätt, ihrem Vater alles gut und recht zu machen. Die Pendeluhr unten in der Wohnstube hat gerade zwölfmal geschlagen, als Rösje ihre Mutter die Holztreppe hochkommen hört. Das Elternschlafzimmer ist nebenan, durch die dünne Lehmwand kann sie jedes Wort verstehen:
»Kätt, kimmste endlich int Bett, et is schon widder medte Noacht.«
»Joa, joa«, seufzt die Mutter, »de Vadter, – ieh der mich john lässt.«
»Kätt, dou bis vill zu anflällich (geduldig) met deinem Vater, dou brauchs och deine Schlaf, komm her, ich wärmen dich.«
Das Kind hört die alte Bettstelle drüben knarren, Mutter liegt nun im Bett, die Eltern reden noch eine Weile, alles Dinge, die ein jeder in der Familie weiß, wichtige Dinge, die nicht geklärt sind. Das Kind hört wie sein Vater sagt:
»Wenn en dir wenichstens et Haus of de Namen schreiwe ließ, wenn ich dran denken bat dou schon alles für deine Vadter jedon has!«
»Has ja recht Fritz, ich darf net drüwwer nachdenken, uns Resi hat mit alldem nix zu don. Mit zwanzich Joahr en Beamte jeheirod un in de Stadt jezogen, dat hat et gut, und dat meint am End noch wat ich all für en Vorteil hier hätt.«
»Wenn deinem Vadter wat paseert, un der hat die Sach net jeregelt, dann müssen mir dem Resi dat halwe Haus errausbezahle, awer dat machen ich net mit, dann jin ich noch lieber int Ruhrjebiet schaffe, als dat ich mich hier krumm un buckelich schufte für anner Leut.« Das Kind hört die Mutter seufzen:
»Fritz, sei so gut, hür off, ich dät gern schlafe, ech han kein Kurasch für mit em Vater üwer dat Thema zu schwätze.« Die letzten Worte klingen weinerlich, der Vater sagt:
»Beruhich dich Kättche, vielleicht wird et all noch gut, schlaf gut – gonacht.« Noch ein gemurmeltes: »Gonacht Fritz«, und es ist still. Auch das Kind weiß, nun ist es eine Weile gut, jedoch hat es das alles schon oft gehört und weiß selber, dass es im Grunde gar nicht gut und überhaupt nicht richtig ist, soweit kann es schon denken.
Es hat noch seinen einfachen, kindlichen Glauben. Darum kommt es nicht klar damit, dass oft die ganz frommen Leute wie Tant Plun und der Grußvadter böser sind als andere, die nicht soviel wallfahren oder beten. Der leise rasselnde Rosenkranz begleitet den Grußvadter wo er geht, sitzt oder liegt. Darum müsste er doch wissen, dass man nicht so böse sein darf, nicht fluchen, nicht über andere Leute herziehen, die Mutter nicht schikanieren, und den Kindern Angst machen, wenn sie mal irgendeine seiner vielen Anordnungen und einen seiner Ansprüche nicht genau befolgen. »Käenner de net folje, kummen in de Höll!«
Und immer hackt er auf Vater Fritz herum, er sei kein richtiger Bauer, weil sein Vater ein Schneider war, Fritz ein Habenichts, keine Furche Ackerland unter den Füßen – »un dat er su eppes erläwe mosst, dat et Kätt su en Lumpekerl jehäirod hat!« Und doch ist Fritz für Rösje der beste, freundlichste Vater auf der Welt, und ganz fleißig. – Und wie immer kommt das Kind in Gewissenskonflikt. Man darf ja nichts Böses denken über andere, auch nicht über Grußvadter. Mich hat er ja manchmal ganz gern und gibt mir einen Groschen, wenn Fränzchen nicht dabei ist. Mit diesem versöhnlichen Gedanken ist das Kind auf einmal eingeschlafen. Schläft solange, bis der nächste Hustenanfall es wieder hochfahren lässt. Lisbeth zieht Rösje unters Federbett murrt:
»Deck dich zo, et wird mir kalt«, aber Rösje erstickt fast, heult und ruft nach der Mutter. Schon geht die Tür auf, der Vater kommt, er ist froh, dass sein Kättche endlich schläft. Er kümmert sich um Rösje, hält seine kühle Hand an ihre Stirne.
»Käend. Käend, dou has ja huh Fiewer, häi is et vill zu kalt in dem Kämmerche.« Kurz entschlossen hebt er das Kind aus dem Bett, wickelt es in eine Decke und trägt es hinunter in die noch warme Stube, wo er aus ein paar Stühlen und der Lehnenbank, Kissen und einem alten Federbett schnell ein provisorisches Bett baut und das Kind samt einem warmen Ziegelstein an den Füßen hineinkuschelt. Im Kochofen ist noch Glut, die facht er an, kocht Holunder-Fliedertee mit braunem Zucker, setzt sich neben das Kind und flößt ihm langsam und schluckweise das heiße Gebräu ein, der Hustenreiz ist erstmal weg. Der Vater deckt sie bis ans Kinn zu, dann breitet er noch eine schwere wollene Joppe über das Federbett.
»So, eweil schläfste moal schien«, sagt er und will gehen.
»Vadter jank net fort, ich gräilen eso«, piepst das Kind, und Fritz setzt sich geduldig auf einen Stuhl, steckt seine große Hand unter die Decken, hält das kleine heiße Händchen wie ein Vögelchen in seinem Nest.
Der graue Wintermorgen kriecht schon durch das Fenster, als Rösje aufwacht. Fritz sitzt immer noch neben ihr, sein Kopf ist auf der Tischplatte auf seinen Arm gebettet. Rösje hört das leise Schnarchen, sch-scht scht, und fühlt sich geborgen, weil er noch da ist. Sie zieht an seiner Hand:
»Vadter, Vadter, ich han so en Duascht, Vadter, Vadter, ich sein janz klätschepuddelsnaß.« Fritz tut noch einen kurzen Schnarcher und schreckt hoch, weiß im ersten Moment gar nicht, wo er dran ist.
»Kättche bat es?«, fragt er, dann spürt er seine kalten Füße, den steifen Rücken und merkt, dass er gar nicht in seinem eigenen Bett liegt, spürt die Feuchtigkeit seiner rechten Hand da unter der Decke. Das Kind sagt nochmal: »Duascht, Duascht«. Fritz steht auf, gibt Rösje abgekühlten Tee in die Tasse, den sie gierig trinkt.
»So, eweil holen ich dir e trocken Hemd.« Er stocht das Feuer, im Wasserkessel ist noch warmes Wasser, das er ins Waschbüttchen schüttet. Mit einem Stückchen Kernseife, Waschlappen und Handtuch gewappnet kommt der Vater zum provisorischen Bett schält das kranke Mädchen aus den durchgeschwitzten Sachen.
»Siehste, mei Mädche, dat Fiewer es schon fort«, sagt er, wäscht ihren mageren Körper, zieht ihr ein trockenes Hemd über, und da kommt auch Mutter Kätt mit frischen Biberbetttüchern. Lisbeth hat ihr schon gesagt, dass der Vater mit Rösje hinunter in die Stube gegangen war. Bald darauf geht es dem Kind richtig gut.
Als die Geschwister so eins nach dem anderen aufgestanden und in der warmen Stube erschienen sind, thront es hinterm Tisch in seinem Bankbett und genießt den Krankenstand. Das Tollste ist, sie braucht nicht in die Schule. Der Vater schreibt eine Entschuldigung, die er der Schreiners Hildegard mitgeben wird. Im selben Schuljahr wie Rösje, kommt sie jeden Morgen um sie abzuholen. Sie braucht Rösje unbedingt, denn die ist gescheiter, die weiß immer die Hausaufgaben. Hildegard macht sich gar nicht die Mühe sich etwas zu merken. Jeden Nachmittag kommt sie mit dem Schullesack, schmeißt ihn wie ein lästiges Objekt auf die Bank, stößt immer die gleiche Frage hervor:
»Bat han mir off?« Dann machen sie und Rösje gemeinsam die Hausaufgaben. Nun ja, als sie nun zur Stubentür hereinkommt und Rösje liegt da hinterm Tisch im Bankbett, weiß sie schon, dass sie heute alleine gehen muss, ist betröppelt. Vater Fritz gibt ihr das kleine, aus seinem Notizblock gerissene Blatt Papier, worauf er eine Entschuldigung geschrieben hatte.
»Joff dat dem Lehrer, un sag em en schöne Gruß von mir.« Stumm dreht sich Hildegard um und will gehen, als Rösje ihr nachruft:
»Dou muss awer hout selwer offpasse bat ihr offkricht, ich bleiwen mindestens dräi Daach dehaam!« Noch trauriger will Hildegard nun gehen:
»Et is de hiechste Zäit, ich muss jon, kummen sos ze spät«, murmelt sie.
»Komm hout Noamendaach bei mich, ich helfen dir schräiwe«, tröstet Rösje ihre Freundin noch, die dann etwas fröhlicher »Tschüüsss!«, ruft und in den Schnee hinausstapft.
Als nun der Kaffeetisch gedeckt ist, können die Geschwister nicht ihre gewohnten Plätze einnehmen, quetschen sich an der vorderen Tischseite zusammen.
»Dräi Daach wills dou krankfeiere?«, fragt Leni. »Bild dir nur nix ein, denkste mir brauchen keine Platz am Desch?« Fränzchen ist eifersüchtig, weil seine Schwester nun krank ist und ein Ei bekommt. Er kriecht unter den Tisch und kneift sie in die Seite, so dass sie »Au!« schreit.
»Loaß dat arm Käend in Ruh!«, sagt Vater Fritz, zieht Fränzchen am Ohr unterm Tisch hervor. »Et war vill krank dies Noacht!« Rösje wirft dem Vater einen dankbaren Blick zu, der redet weiter:
»off em Speicher is noch e klein Öfche, so en ›Buxebeintje‹. Dat stellen ich in et Kämmerche, e Stück Ofenrohr han ich och noch, dann machen ich e schön Feuerche an un dann können die Mädje et da viel besser aushalten, et is einfach zu kalt owe für e krank Käend.«
Und Vater Fritz hält Wort. Als er den Pferdestall ausgemistet, mit Peter das Vieh gefüttert und alle Stalltüren mit Schtriebäiche (Strohballen) gegen die grimmige Kälte abgedichtet hat, steigt er mit dem Ältesten auf den Hausspeicher, und sie stemmen gemeinsam das Buxebeintje herunter ins Kämmerchen, schließen es mittels eines Ofenrohrs an den Kamin an. Fränzchen will seine Sünde gegen Rösje wieder gut machen, schleppt schon ein Bündel Stroh und Reisig herbei, der Witz von einem Öfchen wird gefüttert, der kleine Lausert darf das Streichhölzchen ans Stroh halten und nach anfänglichem Gequalme brennt das Feuer lichterloh. Es bullert förmlich, so gut zieht das Buxebeintje, und weil das Ofenrohr mindestens zwei Meter um die Ecke des Kämmerchens geleitet ist, breitet sich schon nach einer halben Stunde eine angenehme Wärme aus, und nach einer weiteren halben Stunde fängt sogar das dicke Eis an den Fensterscheiben zu schmelzen an. Peter hat einen ganzen Stoß Scheiterholz an der Wand hochgebaut. Mutter Kätt freut sich auch und meint:
»Et is schun gut, dat mei Vadter im Bett liegt, dat der dat net merkt mit den Brandholz, sos dät er üwwer die Verschwendung grummele.«
»Der hat nix zu grummele, dat Holz han ich un de Peter im Berch all abjemacht, jerissen, aus dem Tal errousjetragen, jesägt un jespaalt, un dat Öwechje han ich von dahaem mitjebracht.«
»Dat weiß ich ja, Fritz, er brouch et ja net zu wissen, ich sein jedenfalls richtich froh, dat et nou su schien warm is häidrinn.«
Noch vor dem Mittagessen liegt Rösje wieder in ihrem mit heißen Ziegelsteinen vorgewärmten Bett, es kommt ihr hier vor wie in einem ganz anderen, neuen Zimmer, so schön warm! So heimelig knistert das Feuer. Das Kind liegt ermattet, langsam steigt das Fieber im Laufe des Tages, aber nicht mehr so arg hoch. Der kleine Kopf brummt ein bisschen, kann Gottseidank nicht mehr so viel und genau denken. Große runde Löcher sind aus dem Eis der Fensterscheiben herausgeschmolzen und das Kind sieht ein Eckchen Winterhimmel, ein Stück vom Kirchturm mit Schallloch (Turmfenster) und ein Stückchen Glocke dahinter blinken, einen Zweig des schneebedeckten Nussbaumes, auf dem sich eine Kohlmeise schaukelt und die Federn sträubt, so dass der Schnee auseinanderstäubt.
Die Mutter kommt herein und bringt Tee. Das Kind macht sich Sorgen um den kleinen Vogel und fragt:
»Modter, habt ihr och die Vijelcher jefüttert?« Das ist nämlich sonst seine Arbeit; die Vögel füttern, die Katzen, den Hofhund und was sonst noch an kleinen Tieren herum »kreucht und fleucht.« Schmetterlinge, Bienen oder Hummeln, die sich sommertags durchs offene Fenster in ein Zimmer verirrt hatten, scheuchte Rösje mit Geduld hinaus ins Freie, jeder Käfer oder Ohrwurm, der hilflos und irritiert über die Dielen krabbelte, wurde von ihr behutsam aufgehoben und an die frische Luft befördert.
Einmal hatte Rösje sogar heimlich eine Maus aus der Drahtmausefalle befreit, in eine kleine Kiste gesteckt und gefüttert. Aus Angst, von den großen Geschwistern ausgelacht zu werden, hatte sie die Zigarrenkiste mit dem Mäuslein in der Futterküche hinter der Kleiekiste versteckt, jedoch als sie am anderen Tage mit einer Brotkruste und einem kleinen Stückchen Speckschwarte zur Fütterung ihres Schützlings in die »Foderküsch« kam, sprang die große, schwarze Katze mit der heftig piepsenden Maus zwischen den Zähnen an Rösje vorbei ins Freie.
Damit hatte sie nicht gerechnet, lief wutentbrannt der Katze nach, konnte sie aber nicht mehr einkriegen und stand verwirrt da. Das war doch Muschi gewesen, ihre Lieblingskatze mit den grünen Augen, welche sie immer dann so genüsslich zwinkernd zu einem schmalen Schlitz verengte, wenn sie auf Rösjens Schoß lag und heftig schnurrend genoss, wie das Kind ihr seidigweiches, schwarzglänzendes Fell streichelte.
Da hatte es lange darüber nachzudenken und zu grübeln, dass ein Wesen einmal so sanft und zärtlich sein konnte, ein anderes Mal aber auch ein mörderisches Biest. Es wusste noch nicht genug von dem Kreislauf der Natur, in der, so wunderbar sie ist, letztendlich das Gesetz des Fressens und Gefressenwerdens herrscht.
Ein paar Tage danach hatte Muschi sich in der Scheune oben im weichen Heu ihr Wochenbett eingerichtet und kurz darauf vier Katzenkinder geboren. Jedes hatte seine eigene Farbe und war anders gemustert; schwarzweiß gefleckt, grau getigert, rotgrau gestreift, nur eins war kohlschwarz wie seine Mutter. Fränzchen und Rösje waren außer sich vor Bewunderung! Als sie die Katzenbrut entdeckten, waren die Tierchen schon über ihre neuntägige Blindheit hinaus, blinzelten aus ihren dunklen Äuglein verwundert die Kindern an, und Muschi hatte nichts dagegen, als sie die Winzlinge in die Hand nahmen und streichelten. Auf einem Bauernhof ließ man meistens alle jungen Katzen am Leben. Katzen wurden immer gebraucht, teils zum Schmusen, teils zum Mäuse oder Ratten jagen.
Nun gab es aber noch größere Raubtiere in und um die Gehöfte, das waren Marder und Füchse. Wenn Marder in einen Hühnerstall gerieten, lagen am anderen Morgen einige Hühner, vornehmlich aber Junghennen da, die Köpfe abgebissen, das Blut ausgesaugt. So war ein Marder auch an die Katzenbrut geraten als Muschi frühmorgens ihre Kinder alleine gelassen hatte und in den Kuhstall gegangen war, um ihre Schüssel Milch zu schlecken. Sie wusste genau die Melkzeit. Mutter Kätt goss jetzt reichlicher ein, schließlich saugten die vier Jungen die ganze Nacht an Muschi, so viel und oft sie Lust hatten. Die kam sich morgens vor wie ausgetrocknet, trank gierig und hatte gerade genüsslich den letzten Tropfen Milch geschleckt, war dabei, sich Schnäuzchen und Schnurrbart zu säubern, als ein jämmerliches jaulendes Miauen sie aufhorchen ließ und mit einem Sprung aus dem Kuhstall in die Scheune trieb. In irrsinnigem Tempo raste sie die hohe Leiter hinauf, stürzte sich todesmutig auf den Marder, der gerade das graugetigerte Kätzchen am Genick hatte. Der Räuber ließ das Junge fahren, es gab einen grässlichen Kampf zwischen Katze und Marder, den Muschi bestimmt nicht hätte gewinnen können, wenn die Kämpfenden sich nicht ineinander verbissen hätten, über den Rand des Heubodens gerollt und hinunter in die Tenne gestürzt wären, wo Peter gerade hinzukam, um mit der morgendlichen Arbeit zu beginnen. Mit dem Heugabelstiel drosch er auf das Tierknäuel ein, der Mardes entwich, und Muschi hockte aus vielen Wunden blutend da. Peter wollte sie aufheben, aber sie fauchte ihn an und kroch hinkend zur Leiter, erklomm sie mühsam, um nach ihren Kindern zu sehen. Das grau getigerte Kätzchen lag ein Stück weit neben dem Nest und war verblutet.
Während Rösje in ihrem Krankenbett an die Kätzchen denkt und vom vergangenen Sommer träumt, ist sie gerade ein bisschen eingeschlafen. Fränzchen kommt leise ins Kämmerchen geschlichen, geht auf Zehenspitzen ans Öfchen und legt ein Scheit aufs Feuer. Kätt sieht ihn herauskommen, und wie er ganz leise die Tür hinter sich zumacht, denkt sie lächelnd: »Is doch en gode Jung uns Fränzje, wie der so besorgt um et Rösje is.«
Im selben Moment kommt Schreiners Hildegard zur Haustür herein, mit ihrem Schullesack auf dem Rücken. Da spielt der gode Jung sich sofort als Beschützer auf, er versperrt der verdutzten Hildegard den Weg, sagt laut und ruppig:
»Nix da! Dou därfs net bei uns Rösje, dat is vill zu krank, janz schwer krank is dat, jank heim un mach dein Schullaufgabe selwer, dou dumm Deer!« Und Hildegard will sich gerade umdrehen und den Rückzug antreten, sie traut sich nicht, an dem »fresche Panz«, so nennt sie ihn heimlich, vorbeizugehen, als Rösje, vom Geplärr ihres Bruders aufgeweckt, aus dem Bett springt, zur Tür eilt, sie einen Spaltbreit öffnet und von oben her ruft:
»Hildegard, komm eroff, der Drecksack hat dir nix ze sagen! Ich helfen dir schreiwe, su schwer krank sein ich joarnet mehr!« Als nun Hildegard mit ihren Nagelschuhen die Treppe hochstampft und in Rösjens Kammer hinein verschwindet, denkt der kleine Junge: »Nou woar ich emol extra brav, han Holz eroff jetron un alles, un nou sein ich als widder en Drecksack, dann is et egal bat ich mache, da kann ich ja eweile och en einem Stück immer fresch sein.« Er stürmt die Holztreppe hinauf und tritt mit seinen kräftigen, ebenfalls mit Nagelschuhen bestückten Fußballbeinchen mindestens sechsmal gegen die Tür, die ihm das blöde Hildchen vor der Nase zugeschlagen und von innen verriegelt hat. Tränen der Wut und Eifersucht laufen ihm über das knallrote Gesicht. Der Großvater schreckt im Bett hoch und wimmert selbstmitleidig:
»Bat sein ich doch häi en meinem eijene Hous für en arme, alte un kranke Mann! Daach und Noacht ka Roh vür dene missratene, unjezogene Bällech!«
Er klopft mit seinem schweren Eichenstock an die Wand, Kätt eilt herbei, um ihn zu beruhigen, Fritz eilt hinauf um sein »wüst Käend« zu bändigen. Er straft nicht sofort, sondern lässt sich von Fränzchen erzählen, was passiert ist. Schließlich gibt er dem Sohnemann eine Kopfnuss, putzt ihm die Nase und meint begütigend:
»Dou has et sicher gut jemeint, un dat Rösje darf net Drecksack son, awer dou darfs och net wider die Dür träde, wenn mir dat all so mache däte, wären uns Düren all schun lang kabott, kurz und klein wären die dann, und dann dät üwerall die Kält erein kumme.«
»Ich machen et net mehr, Vadter«, verspricht der kleine Zornnickel, nimmt sich zum tausendsten Male vor, ein braves Kind zu werden. Keiner kann in so ein Bubenherz hineinschauen und sehen, dass es sich im Grunde nichts anderes wünscht als Liebe, es aber nicht sagen kann. Keiner macht sich groß Gedanken darum, wie schwer es so ein fünftes Rad am Wagen, will sagen fünftes Kind hat, um ein bisschen mehr Anerkennung und Aufmerksamkeit zu bekommen. Aufmerksam werden die Großen aber meistens erst dann, wenn man nicht gehorcht oder etwas Schlimmes anstellt, und darum stellt man eben immer wieder etwas an und weiß selber nicht, dass sowas aber das genaue Gegenteil von Liebe einbringt.
»Vorsicht! Offjepasst! Ech kummen!«, brüllen helle Jungenstimmen draußen. Schlitten sausen die leicht abschüssige Dorfstraße hinunter, der Schnee ist festgefahren und glatt, Fußgänger könnten sich kaum auf den Beinen halten, wäre da nicht an den Häusern entlang ein schmaler Streifen mit Asche gestreut.
»Ich weiß eppes Jingeltje, jeh e besje Schlidde foahre, Fränzje, doa kannste dech oustobe un bis dann e besje ruhijer wenn de heim kimmst, un loaß dann die Fraaläit in Ruh«, sagt Fritz. »Komm ich holen dir deine Schlidden vom Speicher erunner, tu dir schon emal deine Jacke, de Metsch un de Hänsche (Handschuhe) an.«
»Au ja!«, schreit Franz, und kurz darauf stapft er an seines Vaters Hand durch den etwas höheren Schnee am Straßenrand aufwärts bis zu Abfahrt. Aber heute ist hier der Deuwel los, selbst die großen, schulentlassenen Völker »fahren Schlitten«, haben Mädchen vorne draufgepackt, die sich kreischend chauffieren lassen, und die wildesten Buben landen öfters nicht ohne eine gewisse Absicht im Straßengraben, weil sie sich nach so einem Sturz mit den Mädels im Schnee wälzen können.
Vater Fritz sieht mit leichter Verwunderung seine sonst so ruhige, fromme, gerade mal fünfzehnjährige Tochter Leni mit lachendem, erhitzten Gesicht auf einem Bockschlitten sitzen, von dem flotten, siebzehnjährigen Schreinerjupp mit beiden Armen fest umschlungen und festgehalten. Sie bemerkt ihren Vater gar nicht, als sie mit Schmackes an ihm vorbeisausen, der Jupp und die Leni.
»Nou kuck emol an, uns braf Lenche«, denkt Fritz, »et wird och schun gruß, lo muss ich e Aug droff halle. Annereseits, bat hat dat Mädje vom Läwwe? Et schafft de janze Daach eso fläißich, un nachts lässt ihm der Grußvadter kein Ruh. Ich tät et ja als emal ablösen, awer der alt Querkopp well mech ja net sehn an säinem Bett!« Schon wieder einmal in betrübliche Hilflosigkeit geraten, wird Fritz von seinem Sohn aus den traurigen Gedanken gerissen:
»Vadter, komm foahr mäet mir, ich säin ze bang für allein, die Gruße rennen mech üm.« Fritz aber will nicht von Leni gesehen werden, will ihr das bisschen Spaß nicht verderben. »Uns Leni weiß wat sich jehört, et passt selwer auf sech of«, denkt der Vater und sagt zum drängelnden Fränzchen:
»Weißte wat? Mir zwin jehn hinten auf de Retscheweg, der ist och richtig steil, un doa han mir vill Platz, doa kimmt uns keiner in die Quer. Setz dich droff, ech zejen dech«, sagt Fritz und dann zieht er seinen Filius die steile Retsch hinauf. Ein paar zaghafte Spuren ziehen sich hier auch durch den Schnee, und oben angekommen sehen sie da noch eine junge Frau, die Knüppersch Lisa mit ihren zwei Kindern, dem Alfredchen und der Zilli, beide gehen sie noch nicht zur Schule, die trauen sich auch noch nicht zu den Großen auf die spiegelglatte Dorfstraße.
»Eweile haste Jesellschafft«, sagt Fritz, und zur Lisa gewandt: »Wellste net e bisje off et Fränzje met offpasse, dat en keine Unfug macht? Ich muss nämlich haam jon, mir han e poar Kranke in de Bette liejen, und et Kätt hat all Händ voll zu don.«
»Secher dat, jank nur ham, et Fränzje kann mit em Alfredche Schlidde foahre un ich mit dem Zilli.«
»Dankeschön Lisa, un schick ihn haam, wenn et däister wird.Tschüss dann, un schick dich Jung!«
Zu Hause angekommen schaut Fritz sofort bei Rösje herein, die immer noch hustend und fiebrig im Bett liegt. Schreinersch Hildegard ist gerade mit ihren Schulaufgaben fertig geworden, packt ihre Sachen und will gehen.
»Hoffenlich biste bal widder gut«, sagt sie, »ich han kein Lust so allaen in der Schull.«
»Zwien Daach wird et noch daure«, meint Fritz und befühlt Rösjens heiße Stirn, »richt dat dem Lehrer aus.«
»Dat machen ich, goode Besserung, Gonacht«, sagt Hilde und macht sich auf den Heimweg. Der frühe Winterabend senkt sich schon hernieder, die Straßenlichter gehen an und verjagen die dunklen Schatten. Hildgard ist froh, sie »greult« wenns dunkelt, jedoch sieht sie da ein paar Gestalten, die blitzschnell in den Schatten zwischen Haus und Scheune verschwinden. »Ber is dat«, fragt sie sich, erkennt im Vorbeigehen aus dem dunklen Winkel jetzt deutlich zwei Stimmen, die ihres großen Bruders Jupp, und die von Leni:
»Los mech jon, Jupp, autsch! Dou drecks mir jo de Rippen äen!«
»Komm, Leni. Sei net eso bös üwer mich, – jof mir eine einzije Kuss, ich don dir jo sonst nix.«
»Dat han ich noch nie jemach, Jupp, dat derf ich net, dann kann eppes passiere!«
»Sei net esu dumm, Leni, von em Kuss krichtse kein Käend, probier et nur emoal aus, dat es schien!«
»Nou ja gut, ewer zuerscht lässte mich los, ich machen et dann freiwillig, zwinge lassen ich mich zu nix.«