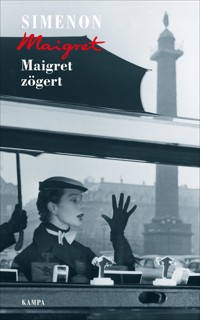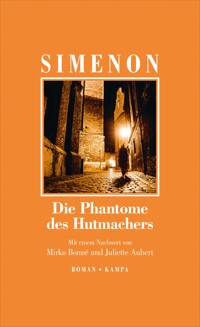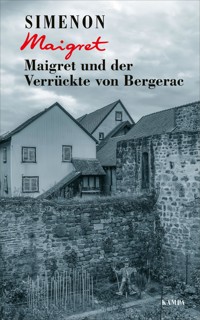9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantik
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In einem Moment der Unachtsamkeit - genauer: der erotischen Ablenkung durch seine Affäre auf dem Beifahrersitz - verursacht der Bauunternehmer Joseph Lambert einen schweren Verkehrsunfall mit einem Schulbus, bei dem zahlreiche Kinder zu Tode kommen. Lambert begeht Fahrerflucht; statt sich zu seiner Schuld zu bekennen, setzt er mit Hilfe seiner Geliebten alles daran, seine Beteiligung am Unfall zu verschleiern. Doch die Schlinge zieht sich enger … Mit einem Nachwort von Hermann Schmidt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Georges Simenon
Die Komplizen
Roman
Aus dem Französischen von Stefanie Weiss
Mit einem Nachwort von Hermann Schmidt
Atlantik
1
Es kam plötzlich und mit voller Wucht. Und dennoch war es so, als habe er schon immer darauf gewartet. Es durchzuckte ihn nicht. Er wehrte sich nicht dagegen. Von dem Augenblick an, in dem es hinter ihm durchdringend zu hupen begann, von einer Sekunde zur nächsten, wusste er, dass die Katastrophe unvermeidlich war, und zwar durch seine Schuld.
Es klang nicht wie eine gewöhnliche Hupe, was ihm da im Nacken saß. Es war eine Mischung aus Wut und Entsetzen; ein unheilverkündendes Heulen, das durch Mark und Bein ging wie eine Schiffssirene in einer Nebelnacht im Hafen.
Gleichzeitig sah er im Rückspiegel den rot-weißen Koloss herandonnern, sah das verkrampfte Gesicht und die ergrauten Haare des Busfahrers, merkte, dass er selbst auf die Fahrbahnmitte geraten war.
Er kam nicht auf die Idee, seine Hand zurückzunehmen, die noch immer zwischen Edmondes Schenkeln steckte. Die Zeit hätte auch gar nicht gereicht.
Er hatte das untere Ende der Grande Côte fast erreicht, die Stelle, wo die Straße im rechten Winkel nach links abbog; aus der Entfernung sah es so aus, als ende sie abrupt an der Außenmauer des Château Roisin.
Seit einigen Minuten regnete es, gerade stark genug, dass sich ein schmieriger Film auf dem Asphalt hatte bilden können.
Es war merkwürdig. In diesem Augenblick hatte er sich mit allem abgefunden: mit der Katastrophe, mit seiner Schuld. Er wusste, dass sein Leben gleich entzweigeschnitten sein, ja, dass er es vielleicht verlieren würde, und er tat, was ihm zu tun blieb, ohne wirklich daran zu glauben. Er versuchte, nur mit der linken Hand, wieder auf die rechte Seite hinüberzukommen. Wie zu erwarten gewesen war, brach der Wagen jedoch über das Heck aus, geriet ins Schleudern, drehte sich um die eigene Achse und rollte fast quer zur Fahrtrichtung aus.
Wie durch ein Wunder kam der Bus noch an ihm vorbei. Lambert glaubte den Fluch zu hören, den ihm der Fahrer mit verzerrtem Gesicht entgegenschrie. Hinter den Scheiben sah Lambert die Köpfe von nichtsahnenden Kindern. Dann krachte es; Blech zerfetzte kreischend – der Koloss war gegen einen Baum geprallt und schlitterte jetzt schräg auf die Kurve zu.
Sein eigener Wagen, der noch nicht völlig zum Stillstand gekommen war, fuhr indessen weiter – gefügig, als ob nichts geschehen sei. Der Bus dagegen prallte mit voller Wucht und der Gewalt einer riesigen Ramme auf die Außenmauer des Château Roisin auf.
Lambert hielt nicht an. Er hatte nur den einen Gedanken: weg, fort von hier, um das nicht mit ansehen zu müssen. Er besaß die Geistesgegenwart, nicht auf der Landstraße zu bleiben, sondern rechts in den Chemin de la Galinière einzubiegen.
Edmonde hatte nicht geschrien. Sie hatte sich nicht gerührt. Er hatte nur gespürt, wie sie erstarrt war. Sie hatte sich zurückgelehnt, und ihm schien, dass sie die Augen geschlossen hatte.
Er hatte nicht den Mut, in den Rückspiegel zu schauen, um zu sehen, was hinter ihnen vor sich ging. Aber vor der ersten Kurve warf er doch einen Blick in den Spiegel, und da erblickte er einen riesigen Feuerschein.
Er hatte sich im ganzen Leben noch nie so schrecklich gefühlt; nicht einmal, als er nach einer Granatexplosion verschüttet gewesen war. Es war doch völlig unmöglich, dass er hier in seinem Auto saß und fuhr, dass er vor sich auf die Straße schaute, dass er atmete. Irgendetwas musste gleich bersten, in seinem Kopf oder in der Brust. Er war so schweißgebadet, dass seine Hände vom Steuerrad abrutschten.
Ihm kam die Idee, anzuhalten und kehrtzumachen. Aber er schaffte es nicht. Das ging über seine Kräfte. Er wollte nichts sehen. Panik, eine Macht, über die er keine Kontrolle hatte, trieb ihn weiter.
Trotz allem war er fähig, an Einzelheiten zu denken. Etwa hundert Meter hinter der Kurve und der Mauer, auf die der Bus aufgeprallt war, befand sich die Tankstelle der Despujols, die auch einen kleinen Laden mit Getränkeausschank betrieben. Er kannte sie wie alle in einem Umkreis von etwa zehn Kilometern um die Stadt. Die alte Despujols war taub, aber ihr Mann, der zu dieser Tageszeit höchstwahrscheinlich im Garten arbeitete, hatte zweifellos den Lärm gehört. Ob die Despujols Telefon hatten? Es fiel ihm nicht ein. Wenn nicht, musste Despujols in das Dörfchen Saint-Marc, etwa einen Kilometer entfernt, hinüber, um Hilfe herbeizurufen. Ein Auto hatte er nicht. Er würde sein Fahrrad nehmen.
Lambert wagte immer noch nicht, Edmonde anzusehen, die nach wie vor regungslos neben ihm saß. Sie hatte offenbar den Saum ihres Kleides wieder tiefer gezogen, ohne dass er etwas davon gemerkt hatte, denn er hatte den hellen Fleck ihrer Knie nicht mehr im Augenwinkel.
Er musste etwas tun, musste irgendwohin. Bloß – wohin? Das wusste er noch nicht. Jetzt, nachdem er die Kurve hinter sich gelassen und in den Chemin de la Galinière eingebogen war, hatte er das Recht verwirkt, wieder zurückzukehren. Er durfte sich auch nicht im Dorf, etwa achthundert Meter entfernt, blicken lassen. Er schlug deshalb den ersten Feldweg zu seiner Linken ein, wobei er voller Schrecken an die Möglichkeit dachte, dass ihnen ein Bauer begegnen könnte.
Wenn er die große Umgehungsstraße, die Route du Coudray, erreichte, war er gerettet. Dann konnte er behaupten, von jedem x-beliebigen Ort zu kommen, von gar nichts zu wissen, an diesem Tag nicht über die Grande Côte gekommen zu sein.
Rechts lag jetzt ein Bauernhof, aber es war niemand zu sehen. Es regnete immer noch, ein typischer spätsommerlicher Landregen. Eigentlich fast schon ein Herbstregen. Sein Herz schlug weiterhin sehr schnell. Seine Hand lag feucht und zitternd am Lenkrad.
Er schämte sich. Er war unsagbar unglücklich. Dennoch zwang er sich, alles Mögliche zu bedenken, sich gegen alle Eventualitäten zu wappnen.
Er hörte sich laut sagen:
»Wir halten in Tréfoux.«
Das war fast am anderen Ende der Stadt, um die die Route du Coudray herumführte. Er kannte sich dort überall aus; er hatte in der ganzen Gegend Baustellen, die er fast täglich inspizierte. Gerade kamen sie von einer dieser Baustellen auf dem Renondeau-Hof, wo seine Leute dabei waren, das Stahlgerüst für eine Scheune aufzustellen.
Lambert hatte auch die Gebäude der Molkereigenossenschaft von Tréfoux errichtet, zu der eine mustergültige Käserei gehörte, und zweihundert Meter weiter entstand jetzt eine großangelegte Schweinemast, in der die Abfallprodukte Verwendung finden sollten.
Lambert hatte viel gearbeitet – mehr noch als sein Vater und mehr als sonst jemand in der Stadt. Und nun war mit einem Schlag die ganze Anstrengung von fünfundzwanzig Jahren bedroht.
Wie viele Sekunden hatte es dafür gebraucht? Nur wenige! Nicht einmal die Zeit, die er gebraucht hätte, um seine rechte Hand zurückzuziehen.
Der Bus hatte bestimmt auf halber Strecke zum ersten Mal gehupt, aber Lambert war sich nicht sicher. Er hatte nicht darauf geachtet. Und doch hatte er das Hupen wieder im Ohr; es stieg in ihm auf, wie Fetzen aus einem Traum bisweilen vor einem aufsteigen. Der Fahrer hatte Hupzeichen gegeben, um sich von weitem bemerkbar zu machen. Der Bus war schnell gefahren, er brachte Kinder aus einem Ferienlager zurück nach Paris oder in irgendeine Stadt im Norden.
Lambert fuhr jetzt auf die Route du Coudray, und von nun an war es fast so, als sei er dem Leben wiedergegeben worden. Auf der gut ausgebauten Straße herrschte reger PKW- und LKW-Verkehr. Etwa dreihundert Meter weiter vorn wurde eine rote Tankstelle sichtbar und noch ein Stückchen weiter weg eine Gastwirtschaft mit Terrasse. Lambert hätte beinahe angehalten, um etwas zu trinken; vielleicht könnte er sich dabei auch ein Alibi verschaffen, indem er so ganz nebenbei einflocht, er käme gerade vom Renondeau-Hof und sei auf dem Weg nach Tréfoux.
Aber war das nicht übervorsichtig? Vielleicht würde er damit gerade auf sich aufmerksam machen? Es kam zwar oft vor, dass er an einem Landgasthaus anhielt und sich einen Weißwein bestellte, aber nie, wenn er seine Sekretärin dabeihatte.
Edmonde begleitete ihn selten. Er hätte nicht erklären können, was ihn an diesem Tag, als er schon am Aufbrechen war, gepackt hatte.
»Nehmen Sie die Pläne, Mademoiselle Pampin«, hatte er zu ihr gesagt, »und warten Sie unten im Wagen auf mich.«
Marcel, sein Bruder, der auch im Büro war, hatte ihm, wie es seine Art war, schweigend einen Blick zugeworfen und ihn damit aufgebracht. Als ob Marcel da mitreden konnte! Jeder zimmert sich sein Leben nach seiner Fasson zurecht. Marcel hatte das Leben gewählt, das ihm gefiel, und schien damit zufrieden. Kein Grund, anderen seine Prinzipien aufzuerlegen.
»Du brauchst die Pläne?«, hatte Marcel gefragt.
»Ja.«
Joseph Lambert hatte seinem Bruder dabei in die Augen gesehen. Es war nicht das erste Mal, dass sie auf Kollisionskurs gingen, wenn man das überhaupt so nennen konnte, denn Marcel trat mit schöner Regelmäßigkeit den Rückzug an. Oder besser gesagt: Marcel begnügte sich damit, nicht nachzuhaken und stattdessen ein Lächeln aufzusetzen, das so dünn war wie sein flaumiges blondes Schnurrbärtchen.
Zu dem Zeitpunkt hatte es noch nicht geregnet; die Büroräume waren voller Sonne gewesen. Sie hatten sie drei Jahre zuvor renoviert und, wie in modernen Firmen üblich, mit Glastrennwänden versehen. Nur Joseph hatte ein Büro, in das man keinen Einblick hatte. Wenn er dann zusätzlich unter dem Vorwand, dass die Sonne blendete, die Jalousien herunterließ, brauchte er nur noch Mademoiselle Pampin zu sich hereinzurufen, wie zum Diktat oder einer anderen Arbeit. Niemand, noch nicht einmal Marcel, hätte es sich erlaubt, sein Zimmer zu betreten, ohne vorher anzuklopfen.
Was dann geschah, hatte zweifellos so geschehen müssen.
»Nehmen Sie die Pläne, Mademoiselle Pampin, und warten Sie unten im Wagen auf mich.«
Er hatte es ganz spontan und ohne präzise Absichten gesagt.
Sie wusste, was das zu bedeuten hatte.
Sie waren nur noch knapp zwei Kilometer südlich von der Stadt, als plötzlich die Sirenen der Feuerwehr aufheulten.
Lambert wusste, dass es zu spät war. Er war im Krieg gewesen und hatte Panzer, Lastwagen und abgeschossene Flugzeuge brennen sehen.
Es kam jetzt darauf an, kaltblütig zu bleiben. Er durfte nicht auf das Heulen der Sirenen achten, das ihn an das verzweifelte Hupen des Busses erinnerte.
Die Molkerei lag am selben Kanal wie sein eigener Betrieb, nur ein paar Kilometer flussabwärts und schon außerhalb der Stadt, während sein Betrieb noch an ein dichtbesiedeltes Viertel angrenzte. Die Arbeiter, die die neuen Gebäude für die Schweinezucht errichteten, hatten gerade Schluss gemacht. Nur der Polier war noch da; er hatte die Tasche umgehängt, in der er seine Tagesverpflegung mitbrachte, und wollte sich gerade aufs Rad schwingen. Er tippte mit der Hand an die Mütze und grüßte.
»Guten Abend, Monsieur Joseph.«
Er hatte über dreißig Jahre bei Lambert senior gearbeitet und dessen Söhne schon gekannt, als sie noch kleine Jungen waren. Er sagte »Monsieur Marcel« und »Monsieur Joseph«. Er hatte so gut wie nie die Gelegenheit, »Monsieur Fernand« zu sagen, da Fernand in Paris lebte und sich fast nie zu Hause blicken ließ.
»Guten Abend, Nicolas. Hier alles in Ordnung?«
Edmonde war im Wagen sitzen geblieben. Lambert warf ihr zum ersten Mal einen Blick zu, seit sie die Grande Côte verlassen hatten. War ihr anzusehen, dass sie gerade eine Katastrophe miterlebt hatte?
Sie war blass, ja. Aber kaum mehr als sonst. Sie hatte von Natur aus einen hellen, farblosen Teint, was umso mehr überraschte, als es nicht zu dem fast runden Gesicht, den vollen Backen und der kräftigen Figur passte.
»Seid ihr noch fertig geworden mit dem Verschalen, für den Beton morgen?«
»Ja, kurz bevor es zu regnen anfing. Haben Sie die Sirenen gehört? Da brennt’s wohl irgendwo.«
»Scheint so.«
Es war ihm unangenehm, dass Edmonde den Blick auf ihn richtete. Was mochte sie denken? Wie beurteilte sie das, was passiert war, was er getan hatte? Und was dachte sie jetzt, in diesem Augenblick, von ihm? Unmöglich, es zu erraten. Er hatte noch nie ein so teilnahmsloses Gesicht gesehen wie das ihre, und ihr Körper teilte die Unbeweglichkeit ihrer Züge. Man konnte sie minutenlang ansehen, ohne eine Bewegung an ihr wahrzunehmen.
Sie war jetzt ein Jahr bei ihm. Er hatte sie nach der Pleite des Eisenwarenhändlers Penjard eingestellt, dessen Sekretärin sie gewesen war. Die Angestellten hatten sich zuerst über ihren Namen lustig gemacht und keine Gelegenheit ausgelassen, ihn auszusprechen und dabei übertrieben zu artikulieren:
»Guten Tag, Mademoiselle Pampin!«
»Guten Abend, Mademoiselle Pampin!«
Unter sich nannten sie sie »die Pampine«, und eines Tages hatte Lambert durchs geöffnete Fenster gehört, wie ein junger Maurer erklärt hatte:
»Sie hat was von einer Kuh!«
Ein Mann in Ledergamaschen und Cordhose kam jetzt von der Molkerei zu ihnen herüber. Es war Bessières, der Leiter der Genossenschaft. Lambert, der bei seinem Wagen stand, streckte ihm die Hand entgegen, und der Polier tippte erneut an die Mütze.
»Salut, Bessières.«
»Salut, Monsieur Lambert.«
»Haben Sie die Sirenen gehört?«, fragte der alte Nicolas auch ihn.
»Ja. Ich habe gleich in der Stadt angerufen. Sieht so aus, als ob ein Bus voller Kinder gegen die Mauer des Château Roisin geprallt ist und Feuer gefangen hat.«
Bessières wischte sich mit dem Taschentuch den Schweiß von der Stirn. Er hatte selbst sechs Kinder; ein paar von ihnen konnte man drüben im Hof spielen sehen. Und seine Frau war gerade wieder schwanger.
Das war die erste ernsthafte Prüfung. Lambert, der nicht so schnell damit gerechnet hatte, war noch nicht dazu gekommen, sich Gedanken darüber zu machen, wie er sich inskünftig verhalten sollte. Edmondes Anwesenheit war ihm unangenehm.
»Von einem Ferienlager?«, hörte er sich fragen und war erstaunt darüber, wie natürlich seine Stimme klang.
»Wahrscheinlich. Man weiß noch nichts Genaueres.«
Lambert wischte sich ebenfalls den Schweiß ab – völlig ruhig, wie ihm schien, aber er vergewisserte sich doch mit einem raschen Blick, ob seine Hand nicht zitterte.
Es war besser, nicht eigens zu betonen, dass er vom Renondeau-Hof komme und über die Route du Coudray zurückgefahren sei.
›Man ist stets in Versuchung, zu viel zu reden‹, dachte er.
»Ich wollte bloß schnell nach dem Rechten sehen«, murmelte er deshalb nur. »Nicolas hat mir gesagt, dass wir bis Monatsende mit allem fertig sind, wenn es ein paar Tage schön bleibt.«
»Wollen Sie auf ein Glas hereinkommen?«
»Nein, danke. Ich hab noch im Büro zu tun.«
Er hatte sich ganz normal verhalten. Sie hatten sich unterhalten wie Leute, die sich seit langem kennen und häufig sehen.
»Und sonst, wie geht’s? Sind alle gesund?«
Anstatt diese Frage zu beantworten, sagte Bessières wie zu sich selbst:
»Ich glaube, ich setze mich mal eben in meinen Wagen und schaue nach, was da unten eigentlich los ist.«
Das war alles. Lambert stieg wieder in seinen Citroën, wendete und fuhr in Stadtrichtung zurück. In den Außenbezirken und dann im Zentrum war bereits eine ungewöhnliche Erregung zu spüren. Vor den Haustüren hatten sich Menschengrüppchen gebildet, und Männer und Jugendliche hatten sich auf ihre Fahrräder geschwungen und waren alle in dieselbe Richtung unterwegs.
An der Place de l’Hôtel-de-Ville, wo er in einer halben Stunde im Café Riche zum Bridge erwartet wurde, kam ihnen ein Krankenwagen entgegen, der zur Klinik hinauffuhr. Offenbar war er leer. Das war der bisher schlimmste Augenblick, und er hätte beinahe am Straßenrand angehalten, so matt und kraftlos fühlte er sich.
Im Café entdeckte er Lescure, den Versicherungsmakler, der zusammen mit Nédelec bereits an ihrem Tisch saß.
»Gehen Sie nicht noch im Büro vorbei?«, fragte Edmonde. Offenbar hatte er unschlüssig gewirkt.
Es war das erste Mal seit der Grande Côte, dass sie den Mund aufmachte. Ihre Stimme klang teilnahmslos.
»Ist vielleicht besser«, sagte Lambert, während er überlegte, ob sie ihn mit ihrer Bemerkung nicht diskret zur Ordnung rief.
»Es ist halb sieben«, ergänzte sie.
Er verstand nicht sofort, was die Uhrzeit damit zu tun hatte.
»Na und?«, fragte er.
»Möchten Sie denn, dass ich bis zum Quai Colbert mitkomme, oder ist es nicht besser, wenn ich gleich hier aussteige?«
Sie hatte recht; um halb sieben war ja Büroschluss.
»Sie können hier aussteigen«, antwortete er.
»Soll ich das Dossier Renondeau hierlassen?«
»Ja.«
»Auf Wiedersehen, Monsieur Lambert.«
»Auf Wiedersehen, Mademoiselle Pampin.«
Sie machte die Wagentür zu und entfernte sich in Richtung des nahegelegenen Viertels Saint-Georges, in dem sie zusammen mit ihrer Mutter wohnte. Er sah ihr nach und fühlte sich erleichtert und etwas verloren zugleich, als sie seinem Blick entschwand. Sie hatten nichts vereinbart, hatten mit keiner Silbe über den Vorfall gesprochen. Er wusste noch nicht einmal, ob sie reden oder schweigen würde. Kannte er sie überhaupt?
»Kommst du?«, fragte Weisberg, der Inhaber des Kaufhauses Prisunic, der auch zu ihrer Bridgerunde gehörte, in dem Moment, als Lambert sein Auto wieder in Bewegung setzen wollte.
»Nicht sofort. Ich muss zuerst ins Büro.«
»Kommst du gerade in die Stadt zurück?«
»Ja, gerade eben.«
»Hast du’s schon gehört?«
»Ja. In der Molkerei haben sie’s mir erzählt.«
»Ich war eben dort und wollte mal schauen, aber das konnte ich nicht. Es ist so furchtbar, dass ich gleich wie verrückt nach Hause gerannt bin, um nachzusehen, ob meine Kinder wirklich alle am Leben sind.«
»Sind welche gerettet worden?«, brachte Lambert hervor.
»Nicht eines. Das heißt, ein Mädchen … Es waren nämlich Jungen und Mädchen im Bus. Aber es wäre ein Wunder, wenn sie das Kind retten könnten. Benezech ist schon dort, und auch die Gendarmerie. Der Unterpräfekt muss jeden Moment kommen, und der Präfekt hat Bescheid geben lassen, dass er auch da ist, bevor es dunkel wird.«
Benezech, der Chefkommissar der lokalen Polizei, war auch einer der Bridgespieler. Er war ein großer, rothaariger Mann mit auffallendem Schnauzbart und langen hellen Haaren auf dem Handrücken.
»Dann bis gleich.«
»Ja, bis gleich.«
In einer, in zwei Stunden würde es vielleicht niemanden mehr geben, der so mit ihm redete, der ihm die Hand gab. Er war weitergefahren, und auf dem ganzen Weg begegneten ihm Gesichter, die ernster und düsterer waren als sonst. Auf den Gehwegen und in den Geschäften standen weinende Frauen herum.
Soweit er sich erinnern konnte, war die Grande Côte leer gewesen, als er sie hinunterfuhr. Er war fast sicher, dass ihm kein Fahrzeug entgegengekommen war und auch kein LKW auf dem Randstreifen auf halber Höhe der Steigung gestanden hatte, was häufig vorkam.
Aber wie stand es mit Radfahrern? Wären sie ihm aufgefallen, wenn welche da gewesen wären?
Und danach, als er nach rechts abgebogen war: Hatte womöglich jemand von den Despujols in der Tür gestanden? Nicht sehr wahrscheinlich, aber auch nicht ausgeschlossen. Sein Citroën war schwarz, und es gab eine Menge schwarzer Wagen dieses Typs in der Stadt und Umgebung. Außerdem sind die Leute selten so geistesgegenwärtig, sich das Kennzeichen zu merken.
Andererseits hätte ein Bauer auf dem Feld ihn im Vorüberfahren ohne weiteres erkennen können. Er hatte einen ziemlich unverwechselbaren Kopf und war einer der bekanntesten Männer in der Gegend.
Ab dem Château Roisin war er sich seiner Sache ziemlich sicher; sein Gedächtnis hatte alle Einzelheiten automatisch registriert – bis hin zu einer rotbraunen Kuh, die aus der Weide ausgebrochen war und am Wegrand herumirrte.
Aber davor? Da war vor allem dieser Mensch, der von allen nur der »Ziegenmann« genannt wurde und von dem er folglich auch nicht wusste, wie er hieß. Ein komischer Kauz, der in einer Bruchbude unweit der Straße hauste und stundenlang mit seinen vier oder fünf Ziegen am Straßenrand unterwegs war, um sie an der Böschung grasen zu lassen.
Man war so daran gewöhnt, ihn irgendwo zu sehen, wenn man die Grande Côte hinauf- oder hinunterfuhr, dass man überhaupt nicht mehr auf ihn achtete. Und in diesem Moment hatte Lambert noch keinerlei Veranlassung gehabt, sich um andere zu kümmern. Jetzt aber war das von größter Wichtigkeit. Zwischen dem Zeitpunkt des Unfalls und dem Eintreffen der Helfer hatte es nicht so stark geregnet, dass die Reifenspuren auf der Straße verwischt worden wären. Die Gendarmen hatten sich sicher gründlich mit diesen Spuren beschäftigt, ebenso wie Benezech und seine Leute.
Lambert hatte in der Zeitung Berichte über erstaunliche Rekonstruktionen von Unfällen gelesen, bei denen es keine Zeugen gab. Sie würden bestimmt innerhalb kürzester Zeit feststellen, dass der bergab fahrende Bus verzweifelt versucht hatte, einem anderen Wagen auszuweichen, der auf die Straßenmitte geraten und immer weiter nach links abgekommen war.
Und es war unausweichlich, dass man diesen Wagen suchen würde.
Am Ladequai direkt gegenüber dem großen Firmenschild mit der Aufschrift »J. Lambert Söhne« hatte ein Frachtkahn festgemacht; an Deck hing regennasse Wäsche auf der Leine. Ein kleines Mädchen presste sein Gesicht gegen eines der Kajütenfenster, und die plattgedrückte Nase, der beschlagene Atemfleck darunter und die sonnengebleichten Haare des Kindes verliehen dem Bild etwas Gespenstisches.
Im Schiff drinnen wurde es früh dunkel, man hatte bereits die Lampe angezündet. Der Vater war bestimmt auf ein Glas in die etwa dreihundert Meter flussabwärts gelegene Schleusenkneipe gegangen, während die Mutter das Abendessen kochte.
Die Büros waren schon geschlossen, die Angestellten bereits weg. Auch Marcel war nicht mehr da – möglicherweise war er zur Unfallstelle geeilt, als er die Sirenen hörte.
Marcel war nicht sonderlich robust, deshalb war er im Krieg Sanitäter gewesen. Und danach war er dem Roten Kreuz beigetreten. Er nahm das sehr ernst. Er nahm das ganze Leben ernst. Besonders stolz war er darauf, dass sein ältester Sohn zur École Polytechnique zugelassen worden war und dass sein Zweitältester, Armand, der beste Schüler des Gymnasiums war. Und Monique, seine Tochter, besuchte natürlich die Klosterschule von Notre-Dame!
Beinahe hätte Lambert die Renondeau-Akte im Wagen liegenlassen, er ging zurück, um sie zu holen, schloss die Tür zu den Büroräumen auf und legte den Ordner auf Mademoiselle Pampins Schreibtisch.
Jouvion, der Nachtwächter, war offenbar bereits in seinem Häuschen, das hinter Balken, Hohlblock- und Backsteinstapeln versteckt war. Aus dem Ofenrohr, das durch das Blechdach getrieben worden war, sah man Rauch aufsteigen.
Oben im ersten Stock waren Schritte zu hören; entweder seine Frau oder das Hausmädchen. Lambert wollte, dass alles war wie immer, und so stieg er die Treppe zur Wohnung hinauf.
Früher war das die Wohnung seiner Eltern gewesen. Er und seine beiden Brüder waren hier geboren worden, zu einer Zeit, als die Räume viel weniger großzügig und modern gewesen waren. Er war schon mindestens siebzehn gewesen, als das erste Badezimmer installiert worden war.
Weder sein Vater noch seine Mutter hätten Aufteilung und Einrichtung der Räume wiedererkannt, wenn sie sie im jetzigen Zustand gesehen hätten. Seine Mutter war vor nunmehr zehn Jahren als Erste von ihnen gegangen, und es war erst drei Jahre her, dass auch der alte Lambert gestorben war. Er war nicht etwa an Altersschwäche oder infolge einer Krankheit gestorben. Vielmehr war er auf einer Baustelle aus zwanzig Metern Höhe von einem instabilen Balken gestürzt. Bis zum Schluss hatte er sich etwas auf seine Furchtlosigkeit eingebildet, und oft genug hatte er die jungen Arbeiter mit einem krächzenden »Lass mich mal ran, Kleiner!« beiseitegeschoben.
Lambert sah Angèle, das Hausmädchen, in der hellerleuchteten Küche stehen. Sie hatte offenbar von dem Unglück erfahren, denn sie schniefte und hatte rote, verweinte Augen.
»Wo ist Madame? Nicht zu Hause?«
»Nein, Monsieur. Sie ist weggegangen, als sie von dem Unglück gehört hat.«
»Allein?«
»Nein. Monsieur Marcel hat sie im Wagen mitgenommen.«
Er fühlte sich plötzlich niedergeschmettert, als ob sich all das gegen ihn persönlich richtete, als ob sich bereits ein feindlicher Clan gegen ihn formierte.
»Monsieur ist nicht hingegangen?«
»Nein.«
»Es scheint ganz furchtbar zu sein, einer der schrecklichsten Unfälle, die es je gegeben hat. All die armen Engelchen, die auf dem Heimweg zu ihren Eltern waren und dann …«
Er zündete sich nervös eine Zigarette an. Es war die erste seit der Grande Côte.
»Wenn man nur wüsste, wie viele noch davonkommen«, fuhr Angèle fort. »Eben haben sie im Radio gesagt …«
Er bemerkte erst jetzt, dass der kleine Apparat in der Küche angestellt war, aber der Ton war leise gestellt.
Er konnte sich nicht einfach hinlegen; er konnte nicht sagen, dass er krank sei und niemanden sehen wolle, wie er es am liebsten getan hätte. Er musste sich wie an jedem anderen Abend benehmen. Er musste sprechen, zuhören und wie alle anderen den Kopf schütteln und seufzen.
»Ich bin dann zurück wie immer, Angèle.«
Wie immer, das bedeutete gegen acht. Er ging ins Badezimmer, um ja nicht gegen eine seiner Gewohnheiten zu verstoßen. Er wusch sich die Hände und kämmte sich das Haar. Beim Händewaschen hatte er das Gefühl, dass Edmondes Geruch noch an seinen Fingern haftete.
Er war versucht, sich einen Schnaps einzuschenken, um die Ruhe in seinem Innern wiederherzustellen. Aber er brachte den Willen auf, darauf zu verzichten.
Beim Trinken war er sonst nicht zimperlich. Das gehörte fast zu seinem Beruf. Es kam allerdings vor, dass er zu viel redete, wenn er ein paar Gläser getrunken hatte, und zwar mit einem gewissen Nachdruck, den er dann für Aufrichtigkeit hielt. Im Café Riche zum Beispiel konnte er sich so weit gehenlassen, dass er mit der Faust auf den Tisch schlug und laut sagte:
»Wenn wir nur nicht umgeben wären von so einer Bande von A…!«
Oder er konnte empört gegen nicht näher bezeichnete Personen zu Felde ziehen.
»Der Tag, an dem jeder Einzelne beschließt, sich nicht mehr von diesen Halunken …«
Es war beklemmend, zuerst durch die leere Wohnung und dann durch die dunklen Büros zu gehen, er durchquerte sie, als sei er auf der Flucht. Er beneidete die Leute auf dem Frachtkahn, die sich jetzt schon zu Tisch setzten, da sie um fünf Uhr früh aufstanden. Er beneidete sogar den alten Jouvion, der auf der gusseisernen Platte seines Ofens wahrscheinlich gerade Kartoffeln röstete.
Morgen, übermorgen, wenn er wusste, woran er war, würde es ihm bessergehen. Wenn es so weit kommen sollte, dass man ihn verhaftete, dann am besten gleich. Na und? Im Krieg war er praktisch laufend in Lebensgefahr gewesen, hatte riskiert, ein Bein zu verlieren oder zu erblinden.
Also, was soll’s?
Er würde sich nicht verteidigen. Er hatte sich etwas zuschulden kommen lassen, das stimmte. Das brauchte man ihm nicht erst zu sagen; schließlich war er der Erste gewesen, dem das klargeworden war. Und alles Übrige ging nur ihn etwas an. Jeder macht aus seinem Leben, was er kann, und er hielt sich nicht für schlechter als jeden anderen aus seinem Bekanntenkreis.
Er setzte sich in seinen Wagen und fuhr los, auf den ersten hundert Metern versehentlich ohne Licht. Es war zwar noch nicht völlig dunkel, aber die Sonne war schon vor einer Weile untergegangen.
Jetzt, bei künstlichem Licht, wirkte die Stadt viel düsterer – vor allem, seit die Büros und Werkstätten geschlossen hatten. Die Leute waren nämlich nicht zu Hause in ihren Wohnungen, sondern draußen, auf den Gehwegen und in den Cafés; sie diskutierten, sie gestikulierten und wehklagten. Manche Frauen weinten. Mit den Kindern wusste man nichts anzufangen, und die Erwachsenen verstummten sofort, wenn plötzlich eins vor ihnen stand.