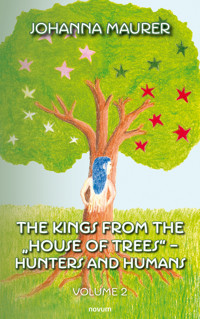26,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Königin Gurjana und Stellkönig Yirdim regieren das "Haus der Bäume". Und obwohl die Elben ewig leben, wird es Zeit, die Machtübergabe vorzubereiten. Thajo strebt bereits seit jungen Jahren nach dem Thron. In ihm schlummert der König und er sieht sich mit Schwert und Ross vor seinen Streitern ins Gefecht reiten. In ferner Zukunft will er ein gerechter Regent mit einer weisen Königin an seiner Seite sein. Für Tharandil steht fest, er will Sattel- und Zaumzeugmacher werden. Gurjana und Yirdim beobachten seine Neigung zu einem Handwerk mit einem Schmunzeln, wenn er einen Beruf ergreifen möchte, dann soll er es tun. Die Königssöhne haben den gleichen Anspruch auf die Kronen, sind sie sich jetzt einig, gibt es später kein Gerangel um die Plätze im Thronsaal, außer die Götter sehen es anders vor …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1236
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2024 novum publishing
ISBN Printausgabe: 978-3-99146-284-2
ISBN e-book: 978-3-99146-285-9
Lektorat: Mag. Eva Reisinger
Umschlagabbildung: André Schneeberger
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
Innenabbildungen: Sylvia Wilhelm
www.novumverlag.com
Widmung
Diese Geschichte ist
für meine Zwillingsschwester, Karin, die mir mit Rat und Kritik zur Seite stand.
Für eine Freundin, Michéle, die mich ermutigte das Manuskript an einen Verlag zu senden.
Für meinen Mann, Heiko, der die allererste Version zu lesen bekam und mir den Rücken stärkte weiter zu schreiben.
Einleitung: Schöpfungsmythos derElben von Pelegorn
Ein jedes Volk hat seine Geschichte. Ein jedes Volk erinnert sich in Erzählungen und Sagen von Generation zu Generation, woher seine Welt und es selber kamen. Ein jedes Volk, eine jede Welt, ein jedes Universum hat seinen Ursprung in der Vergangenheit. Im ersten Augenblick einer längst vorübergezogenen Ewigkeit liegt der Anfang von allem und jedem.
Es ist ein kalter Tag zu Beginn des ersten Winterlumnos und dazu schneit und regnet es abwechselnd im Dauermodus. Langsam macht sich eine leichte Aufregung bei den Kindern breit und eine stille Freude schleicht sich bei den Erwachsenen in die Herzen. Die Hohe Zeit hat begonnen und mit ihr rückt das Geburtsfest der Götterkinder näher und näher und gerade der Nachwuchs sehnt es sich herbei, denn sie hoffen auf reiche Gaben. Was mögen die Boten der Götter ihnen wohl als Geschenk in die Stube legen? Untereinander flüstern sich die beiden Königskinder ihre geheimsten Träume ins Ohr und in Gedanken flechten sie ihre Wünsche ins Gebet mit ein: „Lieber Hirsch, lieber Wolf, ich hätte so gerne ein Paar neue Winterstiefel mit Stickerei am Schaft. Genau die, welche ich auf dem Wintermarkt gestern gesehen habe“, bittet Jamena, und Thelekos fragt: „Lieber Wolf, lieber Hirsch, könntet ihr mir einen Sattel aus rotem Leder bringen? Der würde meinem grauen Pferdchen so gut stehen.“
Es ist die Zeit der Wünsche für die Kinder und Halbwüchsigen und die Zeit der Geschichten für alle Elben. Traurige und spannende, lustige und gruselige, und fast jeden Nachmittag sammelt sich eine kleine Schar von neugierigen Zuhörern und Lauscherinnen in der Bibliothek vom Palast. Alle Kinder der Bediensteten dürfen in den vier Dekaren vor dem Hohen Fest dort hinein und der alte Bibliothekar erzählt frei heraus oder liest ihnen aus einem dicken Buche vor.
Und jedes Jahr berichtet er zuallererst von der Geschichte ihres Volkes. Vom Entstehen ihrer Welt und von ihrem Werden. Angefangen mit dem ersten Blinken der Funken, mit dem ersten Gedanken der Götter, bis hin zur Vollendung der Schöpfung aller Dinge und allen Lebens alleinig durch ihren Willen.
Die meisten der Kinder haben den Mythos über die Entstehung schon öfters gehört und doch kommen sie immer wieder zu der Eröffnungslesung. So auch heute, und auf dem Teppich, in Nestern aus Kissen und Decken hocken und liegen zwei Dutzend Jungen und Mädchen, vom Viertklässler, für die ganz Kleinen ist der Mythos zu kompliziert, bis hin zu den Jährlingen, die nächsten Herbst das Jahrhaus besuchen werden. Einerseits freuen sie sich darauf, endlich der Welt der Erwachsenen anzugehören, andererseits blicken sie ein wenig traurig, denn sie werden an diesem Hohen Fest ein letztes Mal Geschenke auspacken.
In einem bequemen Sessel sitzt der alte Bibliothekar und neben ihm auf einem kleinen Tischchen steht ein Glas mit Wein. Erzählen trocknet die Kehle aus und gerade bei einem langen Kapitel wie dem heutigen ist es ratsam, die Stimme zwischendurch ein wenig zu ölen.
„Ruhe, darf ich um Ruhe im Saale bitten“, tönt seine sonore Stimme durch den großen Raum und das Kichern und Plappern verebbt.
„Ich heiße euch alle willkommen zum Beginn der Zeit der Geschichten. Mögen eure Ohren wach sein und euer Verstand anwesend“, Gelächter bei dem schon älteren Nachwuchs, „denn wie immer erinnere ich zu Anfang der Hohen Zeit an den Ursprung des Elbenvolkes, und woher ihr kommt, dürft ihr niemals vergessen.“
Und der Bibliothekar beginnt, ein Buch ist unnötig, er hat die Wörter schon hundertmal gesprochen, er vergisst nie etwas.
„Alles war grau. Pelegorn, oder das, woraus Pelegorn einst werden sollte, war grau, hellgrau, mittelgrau, dunkelgrau. Nebel, Wolken und Dunst in jeglichen vorstellbaren Grautönen. Das Grau war formlos, fließend, ineinander wirbelnd, ohne Anfang, ohne Ende, gestaltlos, unfassbar, ungreifbar, verschwamm vor den Augen und es gab kein Oben, kein Unten, kein Links, kein Rechts, kein Vorne, kein Hinten. Mit einem Male tut sich was und „Zisch“, ein winziger Blitz funkt auf inmitten des Grau, und dann ein zweiter. Immer und immer wieder und sie tanzen umeinander und jagen sich und hüpfen von einer Schattierung in die nächste. Inana und Morojo in Form von göttlichen Funken erschienen eines Tages im Grau und sie kamen aus einer anderen Dimension oder Welt oder Sphäre oder Zeit. Ihr alle kennt den Namen ihrer Heimat. Wer kann den mir sagen?“
Flugs zeigen eine Menge Finger zur Decke und da der Bibliothekar keinen von den Schlaubergern bevorzugen möchte, dirigiert er mit den Händen, als hätte er einen Chor vor sich stehen.
„Wir nennen sie die Erste Welt“, ruft die ganze Bande gemeinsam, die meisten wussten sowieso, was kommt, und er nickt wohlgefällig, bevor er weiterspricht:
„Seit ungenannten Zeiten schlüpfen die Götter durch die Tore zwischen den unzähligen Welten und sie fanden und finden und werden in Zukunft Orte finden, in denen sie mit ihrer Schöpferkraft eine Veränderung erwirken.
Nun waren sie hier im Grau, und ich möchte bemerken, dass es zwei Dinge schon immer gab. Ewig bestehen die Tore und ewig sind die göttlichen Funken, man möchte sagen, sie gehören irgendwie zusammen. Beide existieren ohne zeitlichen Anfang und ohne zeitliches Ende. Für unseren kleinen Verstand unverständlich und unerklärbar. Aber vielleicht wird ja irgendwann einer von euch ein studierter Diener der Götter und entdeckt den Zeitpunkt der Entstehung.“
Grinsen bei einigen Kindern im Publikum, bei den meisten Heranwachsenden im Umfeld vom Palast gehen die Berufswünsche eher in Richtung Jägerdasein und Handwerk. Das, was sie jeden Tag um sich herum haben.
Unbeeindruckt fährt der alte Elbe fort mit seinen Worten.
„Munter drehen und kreisen und rotieren die Funken durch das Grau. Wer von euch schon mal Irrlichter im Moor sah, dem kann ich sagen, so ähnlich müsst ihr euch das vorstellen. Mitten in einer wabernden Nebelpampe blinkt und schimmert es, springt auf und nieder, fitscht von einer Seite zur anderen. Die Sinne verwirrend, das Auge irritierend, aber diese Lichter haben keine bösen Gedanken. Sie verführen den Wanderer nicht auf Abwege in den tiefen Morast, sondern sie tragen den Gedanken zur Erschaffung unserer Welt in sich.
Wer aufmerksam lauscht, kann sie sogar mit leisem Stimmchen wispern hören, immer und immer wieder, in einer unendlichen Abfolge – Wir waren, wir sind, wir werden sein. Wir schaffen und erschaffen, aus Unfertig wird Fertig. Ein jeglicher Gedanke in uns ist gleich ein Schritt zum Werden. Aus Nebel werde Land, aus Dunkel werde Licht, aus unserem Willen werde Pflanze, werde Kreatur, werde Elbe.“
Beim letzten Satz senkt er seine Stimme zu einer beschwörenden Tonlage und die Kleinsten schauen ihn mit großen Augen an. In ihrer kindlichen Fantasie meinen sie, tatsächlich die Worte von zwei herumschwirrenden Götterfunken zu vernehmen, wobei ein bisschen Magie von seiner Seite aus die Illusion perfektioniert.
„Wo sollen die Götter mit ihrem Werk anfangen? Es gibt so viel, was sie erschaffen wollen. Aber sie sind ja bereits Meister im Aufbau von Welten und sie wissen genau, was als Erstes vonnöten ist in einer Sphäre wie dieser hier. Irgendeine Struktur muss in die formlosen grauen Massen hinein als Basis für die Anfertigung eines neuen Universums.
Allein durch die Kraft ihrer Gedanken verwirbelt sich ein Teil des Grau in wabbelige Kugeln aller Größen und mit ihren Händen ballen sie die bis gerade noch gestaltlosen Wolken zusammen. Es sind die Urformen der Sterne, der Sonne und von Pelegorn mit seinem Mond“, dabei reckt er seine zwei Hände nach oben und tut, als wenn er selber die Nebelbänke zusammenschieben würde, um sie zwischen den Handflächen zu formen.
„Hei, was haben Inana und Morojo doch für einen Spaß mit den Wolkenkugeln. In ihrem Übermut der Schöpfung rollen sie die Bälle mit Schwung durch den endlosen Raum. Sie sausen kreuz und quer zielgerichtet aufeinander zu und knapp aneinander vorbei. Prallen die Kugeln aufeinander, zerstieben sie in tausend kleinste Fetzen und Puderwölkchen. Puff macht es und die gerade entstandenen Gebilde zerfließen dahin und erneut pressen die Götter riesige Murmeln aus den Nebelschwaden zusammen, nur um sie wieder mit einer anderen abzuschießen.
Ein heilloses Durcheinander herrscht in der Weite und für eine Weile haben Morojo und Inana ihre kindliche Freude an dem Spiel mit den Himmelskugeln. Schließlich ist es genug der Rumalberei, denn immerhin sind sie die Schöpfer und mit dem nötigen Ernst nehmen sie ihre Arbeit wieder auf.
Eifrig werkeln sie nun an der Gestaltgebung der Himmelskörper und an der Sphäre, in der sie schweben sollen.
Ihrem Wunsche nach erhält nun jede Kugel ihren Platz und somit schaffen sie Bestand und Bestehenbleiben.
Wie festgeklebt hängt nun ein jeder Stern, und auch Pelegorn, völlig unbewegt und starr in der grauen Suppe.“
Stille im Raume, alle Augen hängen an seinen Lippen und der Bibliothekar nimmt ganz gelassen erst mal einen großen Schluck Wein.
„Aber dann gibt es ja gar keinen Tag und keine Nacht“, bemerkt ein kleines Mädchen schlauerweise. Genau für einen solchen Gedankengang machte er die Pause. Damit prüft er, ob sie ihm auch aufmerksam folgen.
„Ach, da haben wir ja eine Blitzmerkerin unter uns, und genau das Problem erkannten die Götter ebenfalls ein wenig später. Aber alles der Reihe nach. Jetzt dachten sie erst mal, so ist es schon besser, wenn alles seine Ordnung hat, denn nur in der Ordnung gedeiht, was man schaffen möchte. Jedoch, nach einer Weile gefällt ihnen ihr Werk nicht mehr so recht, denn es erscheint ihnen einfach zu leblos. Unzufrieden huschen sie zwischen den Bällen hindurch.
Schier endlos breitet sich eine immer noch graue und lichtlose und öde Welt um sie herum aus. Zwar gibt es jetzt die wabernden Nebel und darin die kleinen und großen Kugeln, Formen, an denen das Auge sich festhalten kann, aber sie wirken wie angenagelt in der weiten Leere.
Was fehlt, ist ein Tanzen und Drehen, Lebendigkeit wäre nett anzuschauen. Vielleicht sollten sie es doch mit vorsichtiger Bewegung innerhalb bestimmter Grenzen versuchen. Zaghaft stoßen sie mit den Fingern ein paar Kugeln an. Bloß nicht zu viel Kraft aufwenden und sie müssen aufpassen, wohin sie rollen, sonst knallt es wieder. Nur geradeaus schubsen erweist sich auf die Dauer als äußerst unpraktisch, weil sie hinterherlaufen müssen, und zudem besteht jederzeit die Gefahr eines Zusammenpralls.
Eine kreisförmige Bewegung ist die Lösung und mit ihren Gedanken formen sie runde und elliptische Bahnen und setzen die Wolkenbälle darauf. Ein kleiner Stups mit den Fingern und der immerwährende Reigen aller Himmelskörper startet seinen Lauf.
Ein kompliziertes System mit unzähligen Globen entsteht, von unermesslich groß bis hühnereiklein, und ein besonders dicker Brocken dreht sich um seine eigene Achse in der Mitte. Drumherum tanzen die anderen Ringelreihen und die Gesetze von Schwerkraft und Fliehkraft, die Götter sind bewandert in der Physik, halten die wattigen Körper fest auf ihren Gleisen. Gemäß dem göttlichen Wunsche ziehen die Kugeln nun auf den Himmelsstraßen dahin und zusätzlich rotieren sie um sich selber. Morojo war von der Kreiselbewegung entzückt, als er sie zufällig bei einer Murmel entdeckte, und fand, diese gehöre mit eingebaut.
Hier und da müssen sie noch mal eingreifen und die eine oder andere Umlaufbahn von einem Stern korrigieren und die Laufzeit von Pelegorns Mond wird neu justiert, aber danach sind sie äußerst angetan von ihrem gelungenen Weltenwerk. Das System ist perfekt und alles bewegt sich im Gleichklang, mal abgesehen von den etwas eigenwilligen Kometen und Asteroiden. In schönster Harmonie ziehen die großen und kleinen Kugeln aneinander vorbei und immer rund und immer rund. Voller Freude über das gelungene Zusammenspiel huschen sie kreuz und quer als blitzende Lichtstreifen von Stern zu Stern.
Doch es tut sich ein Manko auf. Jedes Mal, wenn sie sich nach der Hüpferei irgendwo niederlassen möchten, um zu pausieren, ist da kein geeigneter Ort. Natürlich ist es ihnen möglich, ganz nahe über der Oberfläche eines Nebelballes zu schweben, aber sich darauf setzen, funktioniert nicht. Obwohl sie ja schon federleicht sind, sinken sie ein und hindurch und wer will schon Jahre damit verbringen, längs durch einen Planeten zu rutschen oder seiner Kawastasse hinterher zu schwimmen? Gepresste Nebelmasse bleibt durchlässig, egal wie sehr sie die auch quetschen und quetschen.
Für die weitere Entwicklung braucht es eine feste Kruste, auf der ein jeglich Ding, was immer sie noch im Laufe der Schöpfung sich erdenken, stehen kann, und somit muss ein stabiler Untergrund her.
Ohne dem würde alles, was Gewicht hat, in dem weichen bodenlosen Grund eintauchen und wie in einem tiefen zähen Morast verschwinden. Auf Nimmerwiedersehen verschluckt, allerdings mit dem Unterschied, dass es irgendwann auf der anderen Seite wieder zum Vorschein kommt.
Es kostet die Götter einiges an Überlegung, um eine praktikable Lösung zu finden. Bislang enthielten die Sphären, in denen sie wirkten, feste Materie in irgendeiner Form, aber hier? Hier müssen sie von der Pike auf anfangen. Oder?
Oder sie schaffen die nötige Substanz herbei. Drum herum, verbunden durch die Tore, existieren ja bereits tausende von Universen. Gut gedacht, jedoch eine Aufgabe, welche selbst von Göttern kaum zu bewältigen ist. Es würde Millionen von Äonen dauern, genügend Steine und Erden und Metalle heranzutragen. Zudem können sie auch nicht beliebig viel Zeug woanders mopsen. Es würde dort in den Welten fehlen und zu Irritationen führen. Was sollen die Bewohner denken, wenn mit einem Male ihre Sterne fort sind, oder der Nachbarplanet?
Nein, dies Vorgehen ist völlig ausgeschlossen und ein anderer Plan muss her. Der Funke Inana dümpelt freudlos und leicht missgelaunt durch das Grau. Ihre Strahlkraft hat nachgelassen und sie ist müde vom Dauerfliegen. Ein Blick zur Seite und sie sieht Morojo. Der hat noch Energie und vor lauter Anstrengung, eine hilfreiche Idee zu finden, glüht sein Licht und winzige Blitze fitschen aus seinem großen Funken heraus. „Der schmilzt gleich, wenn der so weitermacht“, denkt sie und im selben Augenblick hängt Inana zitternd vor Aufregung im Weltenraum. Das ist es! Die Lösung! Ein einfacher chemischer Prozess. Schmelzen und Abkühlen und hoffen, dass eine feste Kruste sich dabei bildet. Aber wie schmilzt man Wolkengespinste?“
Fragend blickt der Bibliothekar in die Runde und diejenigen, welche zum x-ten Male hier sitzen, rufen im Chor: „Im Backofen mit Feuer und Wärme.“ Für die Neulinge vertieft er die Erklärung.
„Ihr kleinen Leckermäuler mögt doch alle Zuckerwatte. Und was passiert, wenn man die erwärmt? Natürlich nur ein wenig, sonst verbrennt die zarte Masse mit einem Wusch. Der Zucker verflüssigt sich und beginnt zu tropfen und daraus werden nach dem Abkühlen Zuckerklümpchen.
Inana und Morojo rücken eng aneinander und vereinen sich zu einem großen Funken und mit der ihnen innewohnenden göttlichen Energie und voller Konzentration auf den einen Gedanken lodert ein prächtiges Schmiedefeuer auf. Gut temperiert und gleichmäßig muss es brennen, denn auch das beste Metall gebiert kein gutes Schwert, wenn zu heiß geschmiedet.
Vorsichtig senken sie sich in die Wolkenbälle hinein und ihre Hitze lässt die graue Masse von innen heraus blubbern und fließen. Drehen, drehen und drehen, schnell und gleichmäßig, damit die Kugelform bestehen bleibt. Die ersten Ergebnisse sind recht zufriedenstellend, wenn dabei auch ein paar unförmige Knubbel entstanden sind. Abfall, den sie in den weiten Raum schleudern und den wir heute als Meteoriten bezeichnen. Auf unberechenbaren Bahnen ziehen sie dahin, kommen und gehen, manche Wissenschaftler behaupten sogar, sie würden durch Tore die Sphären wechseln. Aber dazu solltet ihr eure Lehrer in der Schule befragen.
Übung macht den Meister und sie verbessern ihre Vorgehensweise und die anschließenden Ergebnisse können sich sehen lassen. Makellos rund und glatt und glänzend schwebt nach einigen tausend Jahren eine große Anzahl an Himmelskörpern durch die endlose Weite. Ein paar lassen sie weiterhin als Nebel bestehen und dazu gehört auch unser Mond. Warum, fragt ihr? Weil es ihnen so gefällt.
Hinter jeder grauen Färbung verbirgt sich ein anderes Element und jede Farbtönung wird zu etwas anderem und gemischt ergeben sie interessante neue Schöpfungen. Unter dem Druck ihrer Hände und der Wärme ihrer Funken entstehen alle bekannten Mineralien, Metalle, sämtliche Erde und die edlen Steine.
Inana ist glücklich, endlich kann sie sich niederlassen und verschnaufen, und gemeinsam mit Morojo betrachtet sie die Schöpfung der kalten Dinge.
Gold- und Silberadern, grüngesprenkelte Kupferablagerungen, glatter Basalt, feingezeichnete Marmorschichten, splittriger grauer Schiefer und glimmender Spat und dazwischen liegen versteckt Diamanten und glänzende Edelsteine.
An deren Blitzen und Funkeln, was zu dieser Zeit nur im Götterlicht sichtbar ist, hat besonders Inana ihre Freude und sie beschließt, in einige der Steine etwas göttliche Magie einfließen zu lassen.
Sie webt die Gesten und spricht die Worte und erschafft die Siberyl in all ihren Varianten und gibt einem jeden seine nützliche Eigenschaft. Jedoch, noch sind sie grau in grau und ohne die ihnen heute typischen Farben. Schlichte und doch perfekte kristalline Strukturen mit einem Hauch der Ewigkeit innendrin.“
An dieser Stelle macht der Bibliothekar eine Pause, erfahrungsgemäß ist nach diesem Abschnitt garantiert ein Zuhörer dabei, der mal auf die Toilette gehen möchte.
Warum sollte es heute anders sein, und prompt springen einige der Jüngeren auf und mit einem „Ich muss mal wo hin“ entschwindet ein kleiner Pulk durch die Tür in das Seitengemach, dem die nützliche Örtlichkeit angegliedert ist.
Die verbliebenen Jungen und Mädchen recken und strecken sich und zu ihrer Erfrischung bringt Almuth Saft und Knabbergebäck, damit das werte Publikum bei Laune bleibt.
„So, alle wieder da? Alle mit Essen und Trinken versorgt? Weiter in der Geschichte“, ruft der alte Elbe und klatscht in die Hände.
„Jetzt kommt das mit dem Licht, den Teil finde ich am schönsten“, raunt ein Jährling seinem Nachbarn ins Ohr und dann klappt er schnell den Mund zu, denn er hält den ganzen Verein auf.
„Eine lange Zeit geht dahin und das neue Universum besteht jetzt aus grauen formlosen Nebelschwaden, in denen runde Kugeln aller Größen ihre Bahnen ziehen. Schön anzuschauen, das Ebenmaß der Bewegung und die sich abwechselnden Graufarben. So viele Nuancen, unzählige Zwischentöne und doch alles grau und dazu ein immer gleichbleibender diffuser Schimmer. Stetiges Dämmerlicht allerorten, nur dort, wo ihre Funken aufblitzen, ist strahlende Helle zumindest in einem kleinen Umkreis.
Es wäre schön, überall und in jeder Ecke und auf jeder Kugel Hell und Dunkel zu haben. Ein von sich aus leuchtendes Objekt wollen sie kreieren, das den gesamten weiten Raum mit Licht erfüllt. Einem riesigen Kandelaber gleich mit einer Helle von tausenden von Kerzen oder Siberyl soll es strahlen, und die Götter erschaffen die Sonne. Viel, viel später und sozusagen als erfreulicher Nebeneffekt nährt die Wärme und das Licht der Sonne alles Leben.
Frisch ans Werk, das Helle muss auf die eine Seite und das Dunkel auf die andere. Allerdings ist das bei einem Universum aus Grau nicht so einfach wie bei einem Ei. Da genügt ein vorsichtiger Klacks, damit die Schale bricht, und schon können wir Gelb und Weiß mit einem Handgriff trennen, weil die Grenzen deutlich zu Tage treten.
Vor ihnen liegt eine große Aufgabe, denn sie müssen die weißen Nebeltropfen behutsam aus dem Mischmasch herausfiltern. Und womit? Alles, was sie haben, sind ihre knielangen Haare. Morojo fällt es schwer, sich von seiner Haarpracht zu trennen, aber er muss seinen Schopf opfern, damit sie daraus ein Netz mit allerfeinsten Maschen knüpfen können.
Immer und immer wieder werfen sie das Gewirke im weiten Bogen aus und wie ein Fischer sein Netz durch den See zieht und Fische fängt, so treiben Inana und Morojo die weißen Tröpfchen zusammen. Eifrig und unermüdlich füllen sie den Planeten im Mittelpunkt des Sternensystems mit der glimmenden Helligkeit und immer weiter zwängen und drücken sie jeden noch so winzigen Lichtpartikel unter die feste Hülle und mit jeder Handvoll, die dazukommt, strahlt es mehr und mehr.
Nur, wir hatten das bereits, wenn ich irgendwo eine Sache fortnehme, entsteht dadurch eine Leere und genau das geschah mit dem Weltenraum. Sie seihten und fischten nach jedem noch so kleinsten Glimmerteilchen und zwischen den Himmelskörpern wurde es schwärzer und schwärzer, weil außer dem dunklen Nebel nichts mehr verblieb. Eine Entwicklung, die Inana und Morojo in ihrem Enthusiasmus und der Sehnsucht, eine strahlende Helle zu schaffen, kaum bedacht hatten, und mit der tiefen Dunkelheit kam auch die Kälte.
Vorerst sind sie jedoch äußerst entzückt über ihr Werk. Alle Planeten und Sterne umkreisen nun eine gleißende Sonne und werden aufgrund ihrer Rotation mal von der einen, mal von der anderen Seite mit Licht beschienen. Unser Mond umrundet flink Pelegorn und dank des Sonnenlichtes verändert er sein Aussehen. Mal ist er in seiner ganzen Schönheit zu sehen und mal nur als eine schmale Sichel. Somit erschufen die Götter die Mondphasen und damit für ihre Elbenkinder einen messbaren zeitlichen Ablauf.
Zufrieden mit den bislang erschaffenen Dingen lassen sich die beiden Funken auf einer der Murmeln nieder und genießen für eine Weile die Wärme der Lichtstrahlen, welche auf sie herniederscheinen. Ganz nett und wohlig, in der Sonne zu sitzen, nur wird es nach einer Weile ziemlich heiß. Bei jedem Umlauf für die Hälfte der Zeit dasselbe flirrende und in den Augen brennende Licht und nur die Dunkelstunden bringen Erholung. Weder Berg noch Tal sorgen bei Tage für ein schattiges Plätzchen. Um sie herum nur weiße Helligkeit und absolut glatte und graue Ödnis und Hitze. Nirgends ist ein kühler und schattiger Unterschlupf zu finden und sie denken über eine Umgestaltung einiger Himmelskugeln nach.
Licht und Schatten sollen tagsüber gleichermaßen sein und dafür braucht es eine abwechslungsreich gestaltete Oberfläche. Erneut gehen Morojo und Inana ans Werk und packen kräftig zu. Ein wohldosierter heißer Hauch von den Funken und die erstarrte Substanz von Pelegorn weicht wieder auf und wird formbar wie zähes Gummi.
Es ist eine harte Arbeit, selbst für Götter. Tag um Tag kneten und schieben sie mit ihren Händen das Gestein in Höhen und Tiefen. Sie treten mit den Füßen Dellen und Senken und ihre geschickten Finger formen wahre Kunstwerke aus der Erde.
Unter lautem Getöse und ohrenbetäubendem Rumpeln brechen die einst spiegelglatten Flächen auf. Ihr müsst euch das ähnlich vorstellen wie im Frühjahr, wenn die Eisdecken auf den Bächen und Seen splittern und krachen. Allerdings in einer viel, viel größeren Dimension. Die gesamte Kruste unseres Heimatplaneten bebt und formt sich neu.
Zackige Spalten zerreißen die Landmassen, Falten wellen sich, so weit das Auge reicht, dünne und dicke Erdschichten schieben sich über- und untereinander, Gebilde aus Fels und Sand nehmen Gestalt an.
Hoch und höher türmen sich Berge und Zinnen und tiefe Täler liegen dazwischen, langgezogene Gebirgsketten teilen die weiten Ebenen und kleine Hügel und mächtige spitze Kuppen brechen aus den Hochplateaus hervor.
Schroffe Grate ragen in den Himmel, sanfte Hänge gleiten hinunter auf die Talsohlen und steile Felswände wachsen zu unüberwindlichen Mauern empor.
Über und über mit Dreck beschmiert lacht Morojo erfreut und Inana klopft sich lässig den Staub von den Handflächen. Das ist ihnen wahrlich gut gelungen. Dieser Stern hat ein unverkennbares Gesicht und sie sind sehr stolz darauf. Was ist es jetzt für ein Vergnügen, sie springen von der Sonne in den Schatten und dazu entdecken sie jede Menge Orte, an denen man sich verstecken kann. Übermütig jagen zwei Götterfunken die Hügel rauf, die Hügel runter, springen über steile Felskanten und schleichen durch enge Schluchten. Die Götter spielen Fangen, bis sie nach Atem ringend schließlich in einer Grotte an einem Berghang sitzen und den Sonnenuntergang in einer grauen Welt bewundern.
Wieder genügt ihnen das Geschaffene für eine Zeit lang und dann werden sie der grauen Eintönigkeit überdrüssig. Im hellen Licht der Sonne kommt einem das Grau, selbst in seinen tausend Schattierungen, irgendwann langweilig vor. Zudem ermüdet es die Augen, immer nur auf graue Schlieren zu schauen, und ihnen scheint eine Abwechslung in der Farbgestaltung eine gar treffliche Sache.
Erneut gehen Morojo und Inana an die Arbeit, sie wissen aus Erfahrung, wie sie eine bunte Welt kreieren können.
Alles, was dafür nötig ist, ist ihr Wollen, ihre göttlichen Gedanken und Sonnenlicht, und das steht ihnen reichlich zur Verfügung. Sanft streichen ihre Hände über die Oberflächen aller Dinge und jede Berührung und jedes Darübergleiten mit den Fingern hinterlässt eine bunte Spur, denn die absolut glatten Flächen brechen in aberwinzige Falten und Risse auf. So klein, dass man sie nur mit einem besonderen Vergrößerungsglas sehen kann.
Ein Wunder und doch nur eine einfache physikalische Gegebenheit. Farbe entsteht einzig und allein aus reflektiertem Licht, der Regenbogen ist das beste Beispiel dafür. Alle Farben dieser Welt sind darin enthalten und ihr Ursprung liegt in reinem, weißem Sonnenlicht, welches durch die Spiegelung in den Regentropfen in seine einzelnen Bestandteile zerlegt wird.
Blau der Saphir, grün der Smaragd, gelb der Citril, rot der Rubin, weiß der Bergkristall, rosé der Quarz, golden und silbern die Edelmetalle, rot der Sandstein, schwarz die Kohle, creme der Marmor, fuchsrot das Kupfer.
Jetzt erstrahlen auch die Siberyl in ihren eigenen Farben, mit Bedacht wählte Inana sie aus, Rot steht für die Wärme, Blau steht für das Sternenlicht in der Nacht, tiefes Violett steht für die Gedankenkraft und Weiß steht für die Reinheit der Seele, die Wahrheit von Worten und die Lauterkeit von Taten.
Alle Steine beinhalten einen winzigen Abglanz ihrer göttlichen Person, ihrer immensen Macht, ihres starken Willens und ihrer enormen Schaffenskraft.
Es sind einzigartige Geschenke der Götter an uns Elben und gleichzeitig ein immerwährendes Zeichen, eine stetige Erinnerung daran, dass die Götter da waren, da sind und da sein werden.
Aber bis ihre Elbenkinder auf Pelegorn wandeln werden, ist es noch viele Jahrhunderte hin und Inana sorgt sich ein wenig um die mächtigen Siberyl. Die Tore stehen für alle Lebewesen offen und auch wenn nur einige die Fähigkeit besitzen, sie zu durchschreiten, können doch jederzeit Kreaturen aus anderen Welten in diesem neuen Universum auftauchen. Sollten solch magiegefüllte Edelsteine in falsche Hände geraten, hätte das vielleicht weitreichende und unerwünschte Folgen.
Dies gilt es zu verhindern und Morojo und Inana legen einen Bann auf die Siberyl und den Zauber, der in ihnen eingeschlossen wurde. Sie sollen schlafen, so lange, bis ein Volk diese Welt besiedelt, dessen Angehörige mit dem bloßen Willen ihrer Gedanken, der Kraft der Worte und der Gesten die Steine aufwecken und sie sollen sie für das Gute, für die Wahrheit und vor allen Dingen gemäß den Weisungen der Götter gebrauchen.
Als das getan ist, fühlt sich Inana ob dieser Sorge erleichtert und sie und Morojo geben sich am Tage dem Farbenrausch hin und in der Nacht wachen sie im silbernen Licht des Mondes und beobachten der Sterne Tanz am Firmament. Unbeschreiblich schön in ihrer Gestalt und aufregend bunt in ihrem Kleide ist die neue Welt.
Ihr tut der Hintern weh vom Sitzen auf dem harten Steine und auch Morojo rutscht unruhig hin und her. Eine weiche Unterlage wäre schön und dazu samtene Flächen. Darauf ließe sich bequem liegen und ruhen. Was fehlt, ist eine Sanftheit und auch Bewegung. Sämtliche Sterne laufen in Runden um und um, warum sollte auf Pelegorn Stillstand sein?
Bei aller Schönheit und Farbenpracht, in welcher der Fels und der Sand daherkommen, es sind weiterhin starre und an einem Punkt verharrende Objekte. Wenn man mal von dem Sand absieht, den der Wind über den steinernen Boden fegt und an Hindernissen zu Dünen aufbaut. Obwohl die Körnchen wandern, sind sie im Endeffekt doch nur toter Stein.
Sie möchten etwas Lebendiges, etwas, was sich locker im Winde wiegt, etwas, was die schroffen Kanten abrundet, etwas, was die kahlen Flächen bedeckt und wenn sie schon dabei sind, dann wäre etwas, was Schatten spendet auf den ausladenden Ebenen, auch von großem Nutzen.
Dafür braucht es nur eines, Samenkörner, und die holen sie aus den anderen Welten. Eine Handvoll von diesem Planeten, einen Sack voll vom nächsten. Emsig huschen Inana und Morojo durch die Tore hinaus und zurück. Bunt gemischt und in großer Auswahl bringen sie alle erdenklichen Pflanzen und Grünzeug nach Pelegorn.
Auf dem blanken Boden ausgesät würden die Körner und Samen jedoch rasch austrocknen und davonfliegen, also gehen sie daran, mit ihren Fingernägeln schmale Furchen zu ziehen, wo keine natürlichen Risse im Gestein vorhanden sind.
Schnellwachsende Pflanzen, Gräser und niedere Gewächse strecken bereits nach kurzer Zeit die ersten grünen Spitzen aus dem grauen Untergrund heraus. Ihnen folgen Büsche und Bäume aller Sorten und in kürzester Zeit überzieht ein Meer aus Grün die Oberfläche von Pelegorn.
Im Winde wogende Grasdecken bis zum Horizont, weiche Teppiche aus Moos in den Wäldern und im Schatten der himmelhohen Bäume gedeihen Farne und Kräuter. Ein Rascheln und Raunen erfüllt die Luft, in den Blättern und im Astwerk macht der Wind seine Musik, und die dünneren, biegsamen Büsche wiegen sich dazu im Luftzug wie Tänzer.
Für eine Weile ist die Freude bei Inana und Morojo groß, alleinig durch ihre Gedanken lebt ein jedes Gewächs, aber sie können ja nicht immer und ewig nur an Bäume und Gras denken.
Sobald sie ihre Sinne von ihrer Schöpfung abwenden, beginnt das Sterben. Ohne Feuchtigkeit verdorrt ihr wunderschöner Garten zusehends. Was sie brauchen, ist Wasser, erfrischendes Nass, welches regelmäßig vom Himmel rinnt und die Pflanzen tränkt. Wolken müssen her, sie sind der ideale Wasserspeicher und das einfachste Transportmittel.
Wirbelnde graue Massen, Sturmwolken, Gewitterwolken, Regenwolken, jedoch alle graue Nebelmasse ist hart und steinig. Nicht ein Fetzen graue Pampe mehr da auf Pelegorn, der sich dafür eignen würde.
Schwunglos und traurig gleiten Inana und Morojo über die nun ausgedörrten, ehemals grünen Weiten und sie ist untröstlich ob des Anblicks. Kahle Baumstämme, vertrocknetes knisterndes Gras, staubige Matten, wo einst dichtes Moos.
Die Nacht deckt mit ihrer Dunkelheit das Elend zu, aber der Schlaf mag nicht kommen und die Götter schauen hinauf zum Himmelszelt, wo der Mond gerade über den Horizont klettert. Das ist die Lösung, der Mond, aus welchen Gründen auch immer haben sie ihn als Nebelkugel bestehen lassen. Jetzt im Nachhinein war das eine weise Entscheidung.
Wenn sie davon etwas holen würden, dann hätten sie Wolken, vollgepackt mit Milliarden Tropfen Wasser. Gut, der Mond würde dann ein wenig kleiner ausfallen und es wäre weniger hell, aber wer braucht schon einen Riesentrabanten?
Hier endet unsere heutige Geschichte. Die meisten von euch wissen sowieso, wie es weitergeht. Wer trotzdem noch mal zuhören möchte, ist herzlichst eingeladen. Morgen um dieselbe Zeit.“
Kurzer Beifall für den Erzähler und dann erhebt sich die Schar der Zuhörer von den Plätzen und entschwindet auf den Flur. Alles, was zurückbleibt, ist ein Durcheinander von Kissen und Decken auf dem Boden, und Almuth und der Bibliothekar räumen mit einem nachsichtigen Lächeln im Gesicht hinter der Rasselbande auf und löschen die Lichter.
„Ich freue mich, euch erneut so zahlreich zu sehen. Nun denn, nehmen wir die Geschichte wieder in Angriff“, begrüßt der Bibliothekar die Jungen und Mädchen am darauffolgenden Nachmittag.
„Wo waren wir stehen geblieben?“, fragt er pro forma in die Runde. Sollte eigentlich jeder wissen, war ja erst gestern.
„Beim Mond und den Wolken“, tönt die Antwort im Chore und er nimmt den Faden auf.
„Das Märchen vom Mond brauche ich hier glaube ich niemandem erzählen, aus dem Alter seid ihr alle raus“, Gekicher bei den Kleineren, „bleiben wir also beim tatsächlichen Geschehen. Wie viel Wolkenmasse für eine ausreichende Bewässerung der Pflanzen nötig sein wird, können Inana und Morojo nur schätzen. Wenn sie zu viel vom Mond fortnehmen, sieht er mickrig aus und zusätzlich bestünde die Gefahr einer Überschwemmung, sollte es wegen der übergroßen Wolkenmasse immerfort regnen. Da heißt es aufgepasst und mit Augenmaß ans Werk gehen. Vorsichtig bestücken sie den Himmel über Pelegorn mit grauen und weißen Nebelbällchen und damit der Mond seinen Umfang behält, zupfen sie den verbliebenen Nebel ein wenig auseinander. Dadurch erhält er zwar ein paar dunklere Flecken, weil die Schwärze des Weltenraumes durchblinkt, aber Inana gelingt ein schönes Muster von Hell und Dunkel.
Auf der Götter Geheiß hin ziehen nun Regenwolken um die Welt und Millionen Tropfen fallen aus ihnen hernieder. Trotz aller Bemessung der Nebelmenge und wohl gedachter Verteilung ist es einfach zu viel Feuchtigkeit für den Boden allein. Vollgesaugt wie ein Schwamm ist alle Erde und nach einiger Zeit passt nicht ein Schluck mehr hinein. Es kommt wie befürchtet und die Sturzflut nimmt kein Ende und der Regen sammelt sich in den Senken und Abgründen und Schluchten. Inana und Morojo schauen verzweifelt auf die steigenden Wasserstände, jedoch, eine schnelle Abhilfe fällt ihnen nicht ein. Wohin sollten sie das Zuviel an Wasser auch abschöpfen und womit?
Tatenlos, weil sie keine Lösung parat haben, müssen sie mitansehen, wie ein Teil der Pflanzenschöpfung schlicht absäuft. Alles, was ihnen bleibt, ist, den Dingen ihren Lauf zu lassen und sie ziehen sich auf die Position der aufmerksamen Beobachter zurück.
An dieser Stelle möchte ich einen kleinen Schlenker machen und eine Sache anmerken. Die Götter handeln, wenn es ihnen angebracht erscheint, immer wieder in dieser Weise. Auch die Schicksale und Ereignisse in unserem Leben sind für sie häufig Geschehnisse, deren Entwicklungsrichtung sie einzig und allein uns überlassen. Nur sie allein kennen und entscheiden den Zeitpunkt ihres Eingreifens, aber immer und jederzeit ruhen ihre Augen auf den Elbenkindern.
So viel dazu, weiter im Text. Jedes Gewächs trinkt und trinkt und nebenbei füllen sich die tieferen Senken und Ebenen mit Regenwasser. Das Meer und die Seen breiten sich aus und unzählige Flüsse und Bächlein bahnen sich ihren Weg durch das Gelände. Eine erstaunliche Veränderung der Oberfläche nimmt Gestalt an und das Ergebnis gefällt den Göttern. Sonnenlicht tanzt auf den Wellenspitzen, klare Quellen sprudeln aus Felsritzen und durch das Mondlicht silbern eingefärbte Bachläufe winden sich Bändern gleich durch die Wiesen und Wälder. Welche Schönheit doch durch eine dumme Fehlplanung und den Zufall entstehen kann.
Abgesehen davon brauchen sie sich bei solchen Wassermengen keine Gedanken mehr über einen ständigen Nachschub zu machen. Es ist genügend Nässe vorhanden und sie tüfteln an einem Kreislauf aus Verdunstung, Wolkenbildung und Abregnen, bis ihnen der Wechsel zwischen Trocken und Nass perfekt erscheint.
Von da an bringen Wolken ihre kostbare Fracht in einem mehr oder weniger regelmäßigen Turnus in alle Ecken der Welt und somit ist das, was wir „Wetter“ nennen, entstanden.
Grün ist es, Grün in allen nur vorstellbaren Schattierungen und Formen, Blätter, Nadeln, Wedel, Stängel, Stämme, zig Arten von Bäumen, Büschen, Gräsern, Moosen, Farnen und was es sonst noch alles gibt.
Inana und Morojo sind glücklich in ihrer wunderbaren neuen Welt und noch schöner wäre es, wenn sie die mit anderen Wesen teilen könnten.
Leer erscheinen ihnen die weiten Ebenen, die undurchdringlichen Wälder, die Hänge der Berge, die Oasen der Wüste, die Wasser und der Himmel. Unendlich viel Raum um sie herum für etwas Neues, welches die Welt mit seinem Dasein bereichert.
Warum also nicht auch hier die Tiere erschaffen? Andere Welten sind voll davon und sie können dabei ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Zwei-, vier- oder sechsbeinig, Zähne oder lange Zungen, Hörner oder Haare, Pelz oder Schuppen, Gras- oder Fleischfresser, ein weites Feld zum Austoben und Ausprobieren.
Emsig sammeln sie die Früchte der Bäume, denn aus ihnen sollen die Wesen wachsen. Eicheln, Eckern, Kastanien, Nüsse und was es sonst noch an Samen und Keimlingen gibt, tragen sie zusammen und erfüllen einen jeden von ihnen mit ihren Gedanken und ihrem Willen.
Reihe um Reihe drücken sie die Früchte in die Erde, immer schön eine Sorte beieinander, damit sie die Übersicht behalten. Regen und Sonne tun danach das Ihrige dazu und bereits nach kurzer Zeit keimen die Setzlinge.
Anfangs schauen die Triebe aus wie die eines normalen Baumes, aber dann tut sich was. Die grünen Schösslinge verändern sich, statt gerade nach oben zum Licht zu streben, beginnen sie interessante Formen anzunehmen und gleichzeitig verschwindet das Grün. Zarte Blättchen rollen sich zusammen, dünne Stängelchen kringeln sich, es bilden sich Knubbel mit Köpfen und Augen, mit Beinen und Flügeln, mit Haaren und Federn, mit Hufen und Krallen. Alle möglichen Geschöpfe wachsen aus dem Boden. Winzige Tierchen genauso wie große Lebewesen, schön und hässlich, niedlich und abscheulich, nützlich und schädlich. Geschöpfe des Tages und der Nacht. In allen Lebensräumen finden sie ein Zuhause, Himmel, Erde, Wasser, Wüste, unter der Oberfläche und hoch in den Bergen.
Die Funken kennen kein Gut und kein Böse und daher hat ein jedes Geschöpf seinen Platz in ihrer Welt und in unsagbarer Vielfalt an Anzahl und Aussehen bevölkern sie mit der Zeit den Planeten.
Allerorten, wo Inana und Morojo gehen und stehen, ist nun ein Gewimmel und Getümmel um sie herum. Mit ihren Händen streichen sie über das dichte Fell der Bergschafe, schauen in die runden Knopfaugen der Eulen, stemmen sich im Spaße gegen das Geweih eines Hirsches und packen eine meckernde Ziege bei den Hörnern. Abstand ist geboten bei den immer hungrigen Raubtieren und doch kann Inana es im Übermut nicht lassen, einen Gmork am Schwanz zu zupfen. Allerdings mischt sich in die Freude der Götter über die neuen Begleiter schon bald ein bitterer Tropfen. Im Gegensatz zu ihnen sind die Tiere sterblich und vergehen nach der Zeit, die ihnen innewohnt. Was ihnen fehlt, ist die Ewigkeit der Götter. Zwar können sie immer und immer wieder Samen in die Erde legen, aber das wäre ein mühseliges Unterfangen. Nein, es muss einen anderen Weg geben.
Ihr alle kennt den Spruch: ‚Da hat jemand das Rad neu erfunden‘, was so viel bedeutet wie, da meint jemand, eine nigelnagelneue Idee zu haben, wobei die längst existiert und seit Jahrhunderten in Gebrauch ist.
Nun, die Götter erfinden tatsächlich ein Rad, oder eher eine Sache, die man aber von der theoretischen Funktionsweise gesehen damit vergleichen könnte. Das Rad des Lebens.
Diese wunderbare automatische Erneuerung des Daseins. Gleich einem Mühlrade läuft sie um und um, gegliedert in Geburt, Daseinsspanne und Sterben. Noch einmal pflanzen sie sämtliche Früchte der Bäume in die Erde und diesmal legen sie in jeden noch so kleine Samen einen Hauch ihrer selbst, einen aberwinzigen Funken, und entzünden damit in jeder Kreatur das Feuer der Erneuerung. Alles, was da kreucht und fleucht, erhält eine Fingerspitze voll von der Unendlichkeit des göttlichen Seins. Zwar legen sie die nicht in das einzelne Wesen, das muss irgendwann sterben, aber in die Gattung, aus der es stammt.
Die Kunst, ihre Art aus sich selber heraus am Leben zu erhalten, wird ihnen geschenkt, indem sie den Tieren die Geschlechter geben und dazu den Instinkt zur Paarung. Möge ein Männchen zu einem Weibchen finden und beide gemeinsam für neues Leben auf Pelegorn sorgen.
Jetzt jagen die Funken überglücklich ob der äußerst raffinierten Erfindung der Vermehrung mit den Pferden über die Ebene, tauchen mit den Fischen tief hinab in die See, fliegen neben den Vögeln über die hohen Berge, taumeln mit den Schmetterlingen durch ein Blütenmeer und graben sich mit den Drachen in Höhlungen ein. Überall findet sich nun kleines Getier, es schlüpft in den Nestern aus Eiern, es wird lebendig in engen Kammern und auf der weiten Ebene geboren. Manchmal wohlumsorgt und behütet von den Alten, manchmal vom ersten Atemzug allein auf sich gestellt. Ein jedes Geschöpf gebiert und zieht den Nachwuchs auf nach seiner Art.
Und wenn ihr euch jetzt fragt, was mit Inana und Morojo ist, ob die Götter ebenfalls einen aus lebendiger Materie geschaffenen Körper bewohnen, dann ist das eine sehr schwer zu beantwortende Frage. Wie haben wir sie uns vorzustellen? In jedem Tempel findet ihr Statuen und Bildnisse und ist euch daran etwas aufgefallen?“
Kurze Pause, damit ein jeder sich mal geistig in einen Tempel begibt, und er lächelt über die Denkfalten auf den sonst glatten Kinderstirnen. Zögerlich hebt ein Jährlingsmädchen die Hand und er winkt ihr, zu sprechen.
„In unserem kleinen Dorftempel hat Morojo dunkelblaue Haare, aber seine Figur hier in der Schlosskapelle wird mit einem grünen Haarschopf dargestellt.“
Er klatscht in seine Hände und ruft: „Darauf wollte ich hinaus. Es gibt keine einheitliche Darstellung, in jedem Tempel, auf jedem Gemälde schauen die Götter unterschiedlich aus. Ihre Gesichtszüge, ihre Haare, ihre Augen und wer schon mal in einer der anderen Gegenden Pelegorns war, weiß, jenseits unserer Landesgrenzen weisen die Statuen in Nilmogard oder Makyrien noch größere Unterschiede zu den unsrigen auf.
Niemand hat die Götter je wirklich gesehen und kein Künstler jemals ein tatsächliches Abbild von ihnen geschaffen. Alle Attribute, alle Merkmale haben wir ihnen gegeben und sind reine Fantasieerzeugnisse.
Bis zu diesem Zeitpunkt im Verlauf der Schöpfung waren Inana und Morojo in ihrer göttlichen Form zugegen. Als Geist, als Funke, als Gedanke, körperlos und doch in einer imaginären Gestalt. Ihre Gliedmaßen, Hände und Füße, sind nichts weiter als eine gedankliche Substanz, mit der sie Dinge erschaffen und formen, aber sie sind völlig andersartig, als wenn man einen Körper aus Fleisch und Blut besitzt. Ständig verändern sie ihr Aussehen, vom Funken hin bis zu etwas, was wir als ein Gespenst bezeichnen würden. Gerade wie es ihnen nötig und sinnvoll erscheint.
Die Art ihrer Existenz lässt sich nur erahnen, nur halbwegs beschreiben und eigentlich bleibt sie unbegreiflich und unverständlich für uns Elben und weil keine genaue Darstellung von ihnen überliefert ist, gestalten wir die Bilder von ihnen in einer uns vertrauten Art und Weise. Wir finden uns selber in ihnen wieder, in allen Hautfarben, mit allen Haarfarben, mit den uns eigenen Augenfarben.
Jeden Tag beobachten Morojo und Inana die lebendigen Geschöpfe und nach einiger Zeit erwächst ein leiser Wunsch in ihnen. Eine interessante Idee nimmt in ihren Köpfen Gestalt an.
Sie möchten an ihrer Umwelt in einer neuen Form teilhaben, sie möchten die Dinge, die sie schufen, mit körperlichen Sinnen fühlen, schmecken, riechen, hören, erleben. Bislang ist ihnen diese, sagen wir mal, weltliche Wahrnehmung aufgrund ihres göttlichen Daherkommens verwehrt. Wenn sie das wollen, müssen sie die Art ihres Daseins ändern, sie müssen sich einen Körper aus lebendigem Material geben.
Natürlich, wie könnte es bei Göttern auch anders sein, soll ihr Körper von feiner Statur sein und in einer den Augen angenehmen Form daherkommen.
In einer garstigen Spinnenhaut oder als windender Schleimwurm würden sie alle Kreatur um sich herum in Angst und Schrecken versetzen und verscheuchen.
Schlank und geschmeidig, wie die Raubkatzen im Dschungel, wendig und stark, wie die Pferde auf der Ebene, gerade gewachsen und aufrecht gehend, weil sie sich auf jeden Fall von den Tieren unterscheiden wollen.
Auch wenn sie alle erdenkliche Macht in sich vereinen, aus sich alleine heraus gelingt ihnen dieser Wandel nicht.
Sie benötigen dazu eine greifbare Substanz, welche sich umwandeln ließe, oder, noch besser eine Art von Gefäß, in das sie sich hineinversetzen und nach ihrer Vorstellung umgestalten können. Also machen sie sich auf die Suche nach einem dienlichen Objekt. Hierhin und dorthin schweben sie, über Berge und Täler, durch die Wälder und hinab in die Ozeane. Die Auswahl ist riesig und gleichzeitig sehr eingeschränkt, Unmengen an lebendigen Wesen, und abertausende von wunderschönen, aber toten Steinformationen. Und nichts davon kommt so wirklich in Betracht, denn ein Tier mit einem schlagenden Herzen und eigenständigem Sein scheidet von vornherein aus, genauso wie die kalte Materie. Zum Schluss bleiben nur noch die Pflanzen übrig und Inana und Morojo sitzen müde von der Sucherei vor einem Baume und betrachten den Stamm. Inana legt ganz nebenbei ihre Hand auf die Rinde, angenehm warm fühlt sich das Holz in der Sonne an, auf eine gewisse Weise lebendig, weil gewachsen, und doch wiederum kein um sein eigenes Selbst bewusstes Lebewesen.
Absolut ideal als Wohnstatt, und ihre Augen leuchten auf. Vom Material her weder zu hart noch zu weich, formbar und doch von fester Struktur. Inana lacht Morojo an und nickt ihm zu, die Bäume sind genau richtig und Morojo freut sich mit ihr und als Funken huschen sie jeweils in einen jungen Baum hinein und beginnen im Inneren zu wirken.
Genauso wie ihre Geschöpfe wollen sie zwei Geschlechter werden und Morojo gibt seinem Baume den Leib eines Mannes und Inana dem ihrigen den Körper einer Frau.
Aus der vielverzweigten Krone formt sich der Kopf mit den Augen, Ohren und Nase, die Äste wachsen zu Armen, der Stamm wird zum Rumpf und aus den Wurzeln bilden sich die Beine mit den Füßen.
Ihre Pupillen färben sich im Farbton vom Harz der Bäume und wenn jetzt einer von euch bemerkt: Halt, wir Elben haben ja auch gelbliche Augen, dem sei gesagt, genau in diesem Moment liegt tatsächlich der Ursprung unserer Augenfarbe. Sämtliche Schattierungen, von Blassgelb, wie cremefarbener Honig, bis Dunkelgelb, wie Meeresstein, durchscheinend bis trüb, alles vorhanden. Jedoch eines fehlt uns Elben, das Licht der Göttlichkeit, das strahlt nur aus ihren Augen heraus.
Höchst erstaunt über ihre neue Statur und die dazugehörigen körperlichen Merkmale betrachten sich Morojo und Inana. Wie seltsam der jeweils andere ausschaut, und sie fangen an zu lachen und verstummen sofort wieder. Völlig ungewohnt klingt ihnen ihre Stimme, bislang vernahmen sie die nur in ihrem Geiste, und sie erschrecken im ersten Moment. Jetzt hören sie die in seltsamen Tönen von außen mit den Ohren und ebenso scheint ihnen der Blick mit den neuen Augen eingeschränkt. Sie wenden die Köpfe von links nach rechts, bewegen Finger, Arme, Beine, wackeln mit den Zehen. Sehr interessant und gleichzeitig so unvollkommen in Bezug auf ihr bisheriges Auftreten und Wahrnehmungsvermögen und Bewegung.
Voller Neugierde berührt Morojo mit einem Finger Inana. Nur ein kurzer Stups auf die Haut an ihrem Handrücken und ein irritierendes Kribbeln zieht ihr den Arm hoch und ihre Augen werden ob dieses Gefühls groß und rund. Was empfindet wohl Morojo? Inana wagt einen Versuch und umfasst beherzt seine Hand mit der ihren. Warm und weich fühlt die sich an und fest umschließt er ihre mit der seinigen, wobei er ein-, zweimal hastig einatmet, weil die intensive Berührung kommt einem Blitzschlag gleich.
Nach und nach gewöhnen sie sich an die Funktionen ihrer neuen Körper. Blut strömt durch die Adern, Atem rinnt durch ihre Lungen, Reize schießen durch ihre Nervenbahnen. Was für ein unsagbar wunderbares Dasein. Mit ihrer Wandlung, mit ihrer Körperwerdung, glauben sie, die Schöpfung vollendet zu haben. Alles, was sie jetzt noch bräuchten, ist ein Name. Alles Getier und alle Pflanzen benannten sie nach Merkmalen oder Eigenheiten und so soll es auch bei ihnen sein.
Inana, heißt sie sich, die erste Frau, und er wählt den Namen Morojo, was für den ersten Mann steht. Gemeinsam sind sie das erste Paar auf der neuen Welt Pelegorn und auch der Begriff hat seine Bedeutung. In unserer Sprache könnte man es mit „Welt aus dem Grau geboren“ oder „Grauer Ursprung“ übersetzen.
Man könnte meinen, nun hätten sie alles, was ein lebendiges Wesen ausmacht. Herz, Adern, Haut, Organe, Sinne, mit denen sie ihre Umwelt in einer neuen und aufregenden Weise wahrnehmen, und doch stellen die Götter nach einer Weile fest, dass ihnen eine winzige, aber entscheidende Kleinigkeit nicht gegeben ist.
Mögen sie auch noch so Freude beim Anblick an ihren wohlgeformten Gestalten finden, zwischen ihnen springt kein zündender Funke über. Weder im Herzen noch im Körper erwacht Begehren füreinander und ohne dem kein Verlangen, beieinander zu liegen.“
Und jedes Mal grinsen die Jährlinge an dieser Stelle der Geschichte und jedes Mal erinnert er sich an seine Zeit im Jahrhaus und tief in sich drin grinst er mit.
„Ich sehe einige von euch schmunzeln. „Ist doch die einfachste Sache von der Welt“, denkt ihr vielleicht. Klar, für Fuchs und Reh, Hirsch und Gmork, die ihrem Instinkt folgen und mehr oder weniger an den jahreszeitlichen Rhythmus gebunden den Nachwuchs zeugen und in die Welt setzen, und ebenso heutzutage für uns Elben. Aber sind wir Götter? Nein. Wir sind nur ihre Baumkinder und nur einige wenige können sich in direkter Linie als Abkömmlinge von Ytharne und somit der Götter bezeichnen. Wir sind Geschöpfe, in denen der nackte tierische Zeugungswille nicht mehr an der Oberfläche deutlich zutage tritt. Allerdings schlummert dieser immer noch tief verborgen in unserem Innern, alleinig kontrolliert von unserer Ratio und den gesellschaftlichen Normen.“
„Stimmt es, dass Eisdrachen alle Schranken durch ihre immense Magie einreißen?“, ruft ein Naseweis aus der Gruppe der älteren Zuhörer dazwischen. Der Bibliothekar wiegt den Kopf, als wenn er über die Antwort erst nachdenken müsse.
„Ich weiß nicht, von wem du solches gehört hast, aber ja, das können sie tun. Mit den Geschichten zu dem Thema müsst ihr jedoch warten bis nach dem Jahrhaus.“ Einige kichern hinter vorgehaltener Hand und zwei, drei Petenten laufen die Ohren rötlich an.
„Ich bitte um erneute Aufmerksamkeit, auch wenn manche von euch gerade gedanklich abschweifen“, und der alte Elbe spricht weiter, als wenn es das kurze Intermezzo gar nicht gegeben hätte.
„Bei den Göttern ist es ihre, ihnen natürlich weiterhin, innewohnende Göttlichkeit, die den entscheidenden Unterschied zu den Kreaturen der Tierwelt ausmacht und daher sind sie im Gegensatz zu denen hoch erhaben über den niederen Akt, der einzig und allein der Vermehrung dient.
Der angeborene körperliche Trieb eines Tieres zur Erhaltung der Art funktioniert bei ihnen schlicht und ergreifend nicht. Es bedarf einer anderen treibenden Macht. Einer Macht, welche jetzt erst noch im Entstehen begriffen ist. Später geben sie die den Elbenkindern ganz selbstverständlich mit in ihr Sein hinein, aber zu diesem Zeitpunkt ist sie noch nicht existent.
Alleine die Erkenntnis, dass es ihnen trotz aller Anstrengung an Vollkommenheit mangelt, macht Inana und Morojo traurig. Was nützt ihnen ein Körper aus lebendiger Materie, wenn ihr Wunsch nach einem Sprössling unerfüllt bleibt?“
Er hat die volle Konzentration der gesamten Schar und gebannt schauen ihn mehr als zwei Dutzend Augenpaare an. Und gerade jetzt, wo es spannend wird, sagt er: „So, wir sind fast bei der Hälfte, kurze Pause“, und gleichzeitig langt er mit der Hand nach dem Weinglas.
Langsam schälen sich ein paar der Kinder aus den Decken und Kissenhaufen, wiederum andere rekeln sich genüsslich und alle greifen beherzt zu den Keksen und Getränken von Almuth.
„Was für ein Dilemma. So weit sind sie gekommen und nun scheinen sie an sich selber zu scheitern.
Sie dachten, sie hätten alles, was nötig sei, berücksichtigt und doch vergaßen sie etwas, wofür sie bislang nicht mal einen Begriff haben, und es wird noch komplizierter. An ihrem äußerlichen Daherkommen können sie das Problem nicht festmachen, es muss ein ihnen innewohnendes geistiges Fehlen sein.
Aber wie schafft man eine Sache, welche weder eine Form innehat, noch aus irgendeiner Substanz besteht, weder mit den Händen greifbar ist und sich nur schwer mit Worten beschreiben lässt?
Mächtig und kraftvoll muss dies Ding sein und es muss tief aus ihnen heraus kommen, damit sie es mit ihrem ganzen Sein wollen. Ein Quell mannigfaltigen Handelns, Ursache von Liebe und Hass, Ursprung aller Zweisamkeit, Antrieb für Leben und Tod.
Ein zweites Dasein neben dem reinen Körper, aus mehr bestehend als aus sichtbaren Attributen, Merkmalen und geistigen Fähigkeiten. Eine für das Auge unsichtbare weite und vielfältige Welt, eingelagert in das Gemüt.
Kopf und Herz, wozu haben sie beides, und wenn oben der Verstand sitzt, was wohnt dann eine Etage darunter?
Lange Zeit und sehr intensiv lauschen Inana und Morojo in die eigenen Herzen hinein. Sie hegen die Hoffnung, dort vielleicht etwas zu entdecken, was fernab vom rationalen und logischen Verstand des Kopfes darin schläft.
Inana erwacht, auch Götter ruhen, aufgeweckt von einer minimalen Veränderung in ihr. Verwirrt blickt sie sich nach Morojo um. Seine schlafende Gestalt neben ihr, ganz nahe, lässt eine völlig neue Saite von den Zehen bis zu den Haarspitzen in ihr vibrieren. Ein einzelner Ton, ein wenig verloren hallt er im Körper, oder eigentlich mehr in ihrem Geist herum. Ganz flach geht ihr Atem, bloß dies leise Klingen festhalten, bloß nicht mit einer unbedachten Aktion verscheuchen, denn er ist etwas Besonderes und das spürt sie sofort.
Je leiser Inana selber wird, in ihren Gedanken, und je ruhiger in ihren Bewegungen, desto intensiver nimmt sie den Klang wahr. Kurz schreckt sie zusammen, die Erkenntnis, dass die Melodie direkt aus ihrem Herzen kommt, übersteigt ihren Verstand. Und noch etwas geschieht, die anfangs kaum hörbare Musik, der Hauch eines Tones, wächst zu einem Bündel an verschiedensten Frequenzen und Stärken heran. Inana beginnt, die Tonfolgen mitzusummen. Immer verzwickter wird die Reihenfolge, immer verwobener die einzelnen Töne.
Schließlich erfüllt eine von Meisterhand komponierte Symphonie jede Zelle ihres Körpers. Alles in ihr, alles an ihr ist Musik, welche alle ihre Sinne erfasst und sie in einen Taumel versetzt. Ihre Nasenflügel zittern und es ist ihr flau im Magen und erst das Herz, es pocht schnell und schneller.
Was für eine unermesslich schöne Erfahrung, die will sie sofort mit Morojo teilen. Vielleicht ergeht es ihm genauso, wenn er aufwacht. Rasch rüttelt sie ihn am Arm an und im selben Augenblick meint sie, sich die Fingerspitzen zu verbrennen. Die bloße Berührung seiner Haut, gestern noch was Alltägliches, gestern noch eine einfache nichtssagende Geste, gestern noch ohne Folgen, fährt wie ein heißer Funke von ihrer Hand bis zum Grunde ihres Seins.
Morojo schreckt hoch. Was war das? Ein Wespenstich? Er schaut noch verwirrter drein als Inana, die ihre Hand anstarrt. Wieso macht sie das? Und dann lächelt er. Da steigt ein leiser Ton aus seinem Herzen empor und er versteht.
Musik, aber keine von einem Orchester gespielt mit Hörnern, Trommeln und Geigen. Musik aus dem Herzen, die Musik der Liebe in all ihren Variationen. Laut und leise, hart und weich, Stakkato und sanft dahingleitend, zärtlich und zornig.
Und mit den Tönen überschwemmen eine ganze Palette von neuen Gefühlen Inana und Morojo und regungslos, weil fasziniert und gebannt, sitzen sie sich eine Weile gegenüber und lauschen andächtig dem Konzert in ihrem Inneren.
Es ist ein Eintauchen in eine bis dahin unbekannte Welt und sie schwimmen regelrecht in einem Wirrwarr von Empfindungen. Konfus und ohne Richtung lassen sie sich auf den Klängen treiben, sie schweben und genießen, bis sie der Meinung sind, dass es an der Zeit ist, diese neue Errungenschaft mit dem Verstande anzugehen und zu erforschen.
In dem Moment, wo sie sich mit vollem Bewusstsein und unter dem Einfluss der Musik anschauen, wird ihnen zum ersten Male das unterschiedliche Aussehen ihrer Körper tatsächlich bewusst. Was ihnen bei der Formung ihrer Gestalt nur so eine Idee war, zwei Geschlechter, wird nun zu dem wichtigsten Detail.
Wieso ist es ihm nicht schon eher aufgefallen, wie schön sie in ihrer Weiblichkeit ist? Wieso ist ihr nicht schon eher aufgefallen, wie anziehend er in seiner Männlichkeit wirkt? Ein bislang unbekannter Hunger macht sich in ihnen bemerkbar, das Verlangen nach Zweisamkeit nistet sich in ihre Herzen und zieht körperliches Begehren nach sich.
Die neue Melodie, dies besondere Lied, ruft in ihnen die Fähigkeit hervor, einander in Liebe zu begegnen, und das findet seinen Ausdruck im Spiel mit Blicken, mit Worten und mit Gesten.
Bislang lösten Berührungen, Streicheln, leises Flüstern, helles Lachen, lockender Augenkontakt nur wenig Reaktion bei ihnen aus. Gut, sie nahmen den anderen wahr, amüsierten sich darüber wie Kinder, die damit nichts anzufangen wissen, aber das war es auch schon.
Wie völlig anders ist es jetzt? Wenn sie mit den Fingern über die Haut fahren, wenn sie die Lippen aufeinander legen, wenn sie sich umarmen, wenn sie ihre Hände auf den Bauch des Partners legen, dann ist da nun etwas Neues im Werden und das ist dermaßen aufregend, dass sie immer weitermachen.
Morojo und Inana sind ganz hingerissen von dem äußerst reizvollen und interessanten Spiele. Kribbeln in allen Nervenbahnen, Gänsehaut, Lust, Verlangen, Begehren hin bis zur körperlichen Vereinigung. Niemals zuvor entglitt ihnen dermaßen die Kontrolle über ihr Tun, niemals zuvor übermannte sie ein auch nur annähernd vergleichbarer Rausch. Mit den gewünschten Folgen.
Inanas Bauch schwillt nach einiger Zeit an und nach dem Ablauf eines Sonnenrundes um diese Welt gebiert sie gleich zwei Kinder, Zwillinge. Ein Junge und ein Mädchen erblicken das Sonnenlicht von Pelegorn und sie nennen den Knaben Yormas und das Mädchen Ytharne.
Jeden Tag beobachten Morojo und Inana das Heranwachsen und die Entwicklung ihrer Kinder mit Freude und auch Erstaunen, denn außer laut zu schreien und immer zu essen können sie anfangs gar nichts. Greifen, Krabbeln, Laufen, Sprechen, alles müssen sie erlernen. Nichts ist ihnen von Natur aus mitgegeben. Dabei sind die höchsten Wesen, Götter, ihre Erzeuger und da könnte man doch denken, ihr Nachwuchs käme fix und fertig mit allen Anlagen zum Leben auf die Welt. Wobei sie diese generell ja auch in sich tragen, allerdings versteckt und noch unausgebildet und es ist an Inana und Morojo, die Samen, welche in ihnen wohnen, zum Keimen zu bringen, damit ein wunderbarer Baum daraus in den Himmel wächst.
Inana und Morojo sind ihren Kindern fürsorgliche Eltern und sie fördern und fordern ihre Sprösslinge gleichermaßen. Denn beides muss sein, wenn sie irgendwann auf eigenen Beinen stehen sollen und vielleicht sogar selber eine Familie gründen.
Die Zeit geht ins Land und ihre Kinder wachsen und reifen und von Jahr zu Jahr werden sie eigenständiger. Noch sind sie sich selbst genug, Bruder und Schwester, aber es ist absehbar, dass der Zeitpunkt kommt, an dem andere, ihnen sehr ähnliche Wesen, in ihr Leben treten sollten.
Mit zunehmendem Alter brauchen sie Spielgefährten an ihrer Seite, Jungen und Mädchen, und später, wenn sie erwachsen sind, eine Frau und einen Mann.
Ziemlich überrascht von dem zügigen Gedeihen ihrer Kinder stellen Inana und Morojo fest, dass sie schneller, als es ihnen lieb ist, an die Zukunft denken müssen. Yormas und Ytharne entwachsen in Windeseile den Kinderschuhen und seit einigen Dekaren stellen sie Fragen. Fragen, auf die Inana und Morojo so recht keine Antwort finden. Warum sind wir alleine? Gibt es andere unserer Art? Wir sehnen uns nach einer Freundin, einem Freund. Nach Wesen außerhalb unserer Familie, mit denen wir spielen und reden können.
Halbwüchsige sind sie inzwischen geworden und Mutter und Vater genügen ihren Ansprüchen nicht mehr. Da muss es mehr geben und den Punkt muss man ihnen zugestehen. Sollen sie lernen, sich in eine vielköpfige Gesellschaft einzufinden und einträglich miteinander und ihresgleichen zu leben, dann bedarf es neuer Geschöpfe.
Trotz aller Eile überlegen Inana und Morojo sehr intensiv über eine Lösung, denn ein Schnellschuss könnte mehr Probleme erzeugen als aus der Welt schaffen. Was geben sie den neuen Kreaturen an Geist und an Fähigkeiten und wie viel davon? Welche Charakterzüge? Lerneifer, Neugierde, starken Willen, ein liebend Herz, einen scharfen Verstand, Kraft und Schnelligkeit, legen sie Gut wie Böse in ihre Seele und dazu die Fähigkeit, beides zu erkennen und danach zu handeln?
Schwierig, je mehr sie ihnen geben, desto mehr werden sie den Göttern ähneln. Aber wäre das ein wirkliches Problem? Immerhin sollen die neuen Geschöpfe ihre Kinder begleiten und sich sogar mit ihnen verbinden.
Somit steht eigentlich von vornherein fest, dass sie gar keine große Wahl haben, außer die Gaben großzügig zu verteilen. Zudem sollen sie von Gestalt und Antlitz her ihnen gleichen und sie sollen fühlen, denken und handeln, so wie sie es tun. Bliebe jetzt noch die Frage, aus welchem Material sie die Körper der neuen Wesen formen.
Für einen Moment erscheinen ihnen die Bäume sehr geeignet, jedoch die Idee verwerfen sie schleunigst wieder.
Die Bäume sind, seitdem sie sich darin niederließen, um Gestalt anzunehmen, ihr alleiniger Wohnsitz und das Vermächtnis der Götter an die Lebewesen dieser Welt.
Stein ist zu hart, Moos zu weich und wabbelig, Gras zu leicht und unbeständig, Sand zu locker. Wer weiß, wie es weitergeht?“ Der Bibliothekar schaut in die Gesichter seines Publikums und wartet.
„Jetzt kommt der Mistkäfer“, ruft ein Mädchen und alle lachen.
„Gut aufgepasst. Diese winzige Kreatur zeigt ihnen den Weg. Morojo sitzt an einem sonnigen Tage unter einem der großen Bäume und zu seinen Füßen krabbelt ein Käfer seines Weges. An sich kaum bemerkenswert, aber der hier schiebt eine Kugel aus Hirschdung vor sich her. Mühselig hat er ein Stückchen Mist aus einem Knödelhaufen gelöst und nun rollt und rollt er den, bis der Brocken die perfekte Form annimmt.
Ein Geistesblitz durchzuckt den Gott. Das ist es! Sie kneten die Wesen aus einem weichen und doch gut formbaren und haltbaren Material, der Tonerde.
Emsig gehen die Götter an ihre nächste Schöpfung und sie mengen Kleierde mit Wasser an und mit viel Geschick wirken sie Erdwesen mit Armen und Beinen und Rumpf und Kopf. Eine Menge Mühe und Aufmerksamkeit schenken sie deren Herstellung und nachdem die ersten Exemplare in der Sonne getrocknet sind, geben sie ihnen Lebendigkeit.
Jeder Figur hauchen sie ihren göttlichen Atem in die Nasenlöcher und damit geht ein winziger Teil ihrer selbst in die Erdkinder über. Alle Gefühle, alle Fähigkeiten, alles Willen und Wollen, alles Denken und Handeln, und der Götteratem weckt den Herzschlag in der tönernen Brust.
Stolz betrachten Inana und Morojo ihr Werk. Dies sind die ersten Elben, Sprösslinge aus Erde geboren.