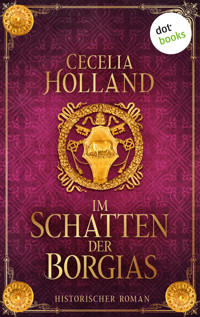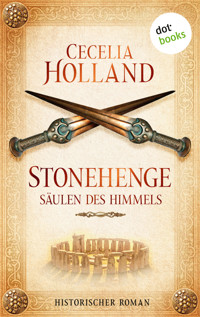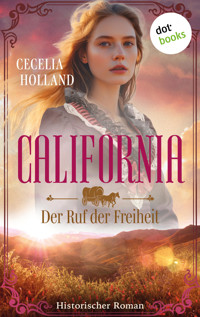Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die mächtigste Frau des Heiligen Landes: Der historische Roman »Die Königin von Jerusalem« von Cecelia Holland jetzt als eBook bei dotbooks. Jerusalem, 1187: Seit vielen dunklen Jahren kämpfen die Christen schon gegen Saladins Truppen um die Vorherrschaft im Heiligen Land. Der junge König Balduin ist zwar klug und furchtlos – doch eine schwere Lepra-Erkrankung wird ihm zu einem frühen Verhängnis. Plötzlich ist es an seiner Schwester Sibylle, die Krone zu übernehmen: Als Königin von Jerusalem hat sie schon bald nicht nur mit feindlichen Heeren, sondern auch mit Verrätern in den eigenen Reihen zu kämpfen. Ihren einzigen Verbündeten findet sie in dem Tempelritter Rannulf, dessen Treue allein Gott und seiner jungen Königin gilt. Mit seiner Hilfe setzt Sibylle alles daran, den Krieg zu gewinnen und den Frieden wiederherzustellen – doch Saladins Armee ist unerbittlich … »Das überzeugende Porträt einer bewegten Zeit und das Werk einer begnadeten Erzählerin.« Booklist Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Die Königin von Jerusalem« von Cecelia Holland wird alle Fans der Bestseller von Rebecca Gablé und Ulf Schiewe begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 730
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Jerusalem, 1187: Seit vielen dunklen Jahren kämpfen die Christen schon gegen Saladins Truppen um die Vorherrschaft im Heiligen Land. Der junge König Balduin ist zwar klug und furchtlos – doch eine schwere Lepra-Erkrankung wird ihm zu einem frühen Verhängnis. Plötzlich ist es an seiner Schwester Sibylle, die Krone zu übernehmen: Als Königin von Jerusalem hat sie schon bald nicht nur mit feindlichen Heeren, sondern auch mit Verrätern in den eigenen Reihen zu kämpfen. Ihren einzigen Verbündeten findet sie in dem jungen Tempelritter Rannulf, dessen Treue allein Gott und seiner jungen Königin gilt. Mit seiner Hilfe setzt Sibylle alles daran, den Krieg zu gewinnen und den Frieden wiederherzustellen – doch Saladins Armee ist unerbittlich …
Über die Autorin:
Cecelia Holland wurde in Nevada geboren und begann schon mit 12 Jahren, ihre ersten eigenen Geschichten zu verfassen. Später studierte sie Kreatives Schreiben am Connecticut College unter dem preisgekrönten Lyriker William Meredith. Heute ist Cecelia Holland Autorin zahlreicher Romane, in denen sie sich mit der Geschichte verschiedenster Epochen und Länder auseinandersetzt.
Die Website der Autorin: thefiredrake.com/
Bei dotbooks veröffentlichte die Autorin ihre historischen Romane »Im Tal der Könige«, »Die Königin von Jerusalem«, sowie ihre Norsemen-Saga mit den Einzelbänden »Der Thron der Wikinger« und »Der Erbe der Wikinger«. Weitere Bücher sind in Vorbereitung.
***
eBook-Neuausgabe April 2024
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1996 unter dem Originaltitel »Jerusalem« bei Forge Books. Die deutsche Erstausgabe erschien 1996 unter dem Titel »Jerusalem« bei Lübbe.
Copyright © der englischen Originalausgabe 1996 by Cecelia Holland
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1996/2002 Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG, Bergisch Gladbach
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz unter Verwendung von Shutterstock/Adrey_Kuzmin, PiciN
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ah)
ISBN 978-3-98690-944-4
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. In diesem eBook begegnen Sie daher möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Diese Fiktion spiegelt nicht automatisch die Überzeugungen des Verlags wider oder die heutige Überzeugung der Autorinnen und Autoren, da sich diese seit der Erstveröffentlichung verändert haben können. Es ist außerdem möglich, dass dieses eBook Themenschilderungen enthält, die als belastend oder triggernd empfunden werden können. Bei genaueren Fragen zum Inhalt wenden Sie sich bitte an [email protected].
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Königin von Jerusalem« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Cecelia Holland
Die Königin von Jerusalem
Historischer Roman
Aus dem Amerikanischen von Marcel Bieger
dotbooks.
»Wir haben vernommen,
ein neuer Ritterorden sei auf Erden aufgetaucht,
und zwar in jener Region, die Er,
der aus den Himmeln kam, einst im Fleisch
besuchte – eine neue Art von Rittern, die unermüdlich
sowohl gegen Fleisch und Blut wie auch gegen die
geistigen Kräfte des Bösen kämpfen.«
Hl. Bernhard
»Non nobis, Domine, non nobis,
sed Nomine Tuo ad gloriam.«
Wahlspruch der Templer
Der Tod ist der Herr des Lebens.
Sprichwort
Für Charles N. Brown,
den Zauberer von Oakland.
Kapitel 1
Am Vormittag fing auch das zweite Pferd an zu lahmen. Rannulf, der zwei Längen hinter Markus ritt, spürte, wie das Tier zusammenzuckte und aus dem Tritt geriet. Das Hinken wurde mit jedem Schritt schlimmer, bis das Pferd schließlich aufgab und sich weigerte, auch nur noch einen Meter weiterzugehen.
Rannulf ließ sich über die Kruppe zu Boden gleiten. Der andere Ritter blieb im Sattel; mit einem unterdrückten Fluch stieß er seine sporenbewehrten Fersen heftig in die Flanken des Rosses. Das Tier antwortete mit einem langgedehnten erschöpften Stöhnen. Rannulf entfernte sich ein paar Schritte vom Weg und sah sich um.
Ausgebleicht wie ein alter Knochen breitete sich die Wüste rings um sie aus. Unter dem stechend blauen Himmel erhoben sich im Süden die schwarzen, kahlen Hügel, die von den Einheimischen als Ibrahims Amboß bezeichnet wurden. Weiter nördlich verlief die Straße in Richtung einer unregelmäßigen Erhebung, die in der Hitze flimmerte. Das Pferd stöhnte vor Erschöpfung, seine Augen wirkten glasig.
Markus, der noch immer im Sattel saß, sagte: »Der Klepper ist erledigt.« Er nahm die Kappe ab und wischte sich mit dem Ärmel über das Gesicht. »Genauso wie wir.«
»Wenn wir die ganze Nacht durchreiten, erreichen wir Ascalon in der Morgendämmerung«, meinte Rannulf.
»Sicher, aber wir haben keine Pferde. Doch wie ich Euch kenne, ist Euch das in Eurer neunmalklugen Art vermutlich noch gar nicht aufgefallen.«
»Vor uns auf dem Weg liegt eine Karawanserei. Wir können bis dorthin gehen und uns dann frische Tiere besorgen.«
Markus packte die Zügel kürzer, fluchte leise und peitschte Hals und Schultern des Pferdes. Rannulf schaute wieder nach Süden und überlegte, ob es sich bei dem Dunst, der zum Himmel emporstieg, um den Staub handelte, den die anrückenden Sarazenen aufwirbelten. Allerdings glaubte er nicht, daß Saladins Heer so schnell vorankommen würde. Markus ließ den Arm mit den nutzlosen Zügeln sinken. Die Beine des Pferdes knickten ein, und es brach zusammen. Der Ritter schrie laut und schrill vor Zorn und Furcht und brachte sich mit einem gewaltigen Satz in Sicherheit.
»Wir müssen den Sattel mitnehmen«, erinnerte Rannulf seinen Gefährten.
»Zum Teufel mit dem Sattel’ Direkt hinter dem Hügel dort hinten lauern bestimmt tausend und abertausend dieser sarazenischen Sandschweine!« Markus stampfte mit dem Fuß auf. Seiner erregten Stimme war nicht anzumerken, was ihn mehr beherrschte: Angst oder Wut. »Wie weit ist es bis zu dieser Herberge?«
»Der Sattel gehört dem Orden.« Rannulf beugte sich über das noch lebende Pferd und zerrte die Gurte los.
Der Bauch des Tieres hob sich, als seine Hand darüberstrich. Die Aussicht, in der Karawanserei Pferde kaufen zu können, war nicht besonders günstig, aber dort auch noch einen Sattel aufzutreiben schien ausgeschlossen.
Markus drehte sich zu ihm um. »Laßt den Sattel liegen, Heiliger. Ich bin zwar bereit, zu Fuß zu gehen, aber ich werde dabei nicht mehr tragen, als unbedingt nötig ist.«
Rannulfs Temperament drohte mit ihm durchzugehen, und in seinen Augen blitzte es auf; er bekreuzigte sich, um den aufkommenden Zorn niederzuzwingen, und wandte sich Markus zu, doch dem anderen Ritter war das Kreuzeszeichen nicht verborgen geblieben. Er wich ein paar Schritte zurück, hob abwehrend die Hände und sagte: »Schon gut. Schon gut.« Der Mann bückte sich, lockerte das Zaumzeug und streifte es dem sterbenden Pferd über den Kopf. Rannulf wuchtete sich den Sattel auf die Schulter, und sie traten ihren Fußmarsch, den Weg entlang, an.
Der Sommer war bereits vorbei, und mit ihm war auch die ärgste Hitze verschwunden, doch auf dieser weiten, trockenen Ebene schien die Sonne die Luft regelrecht zu kochen, und das Licht waberte, als würde es durch einen Schleier aus Wasser gefiltert. Hier und dort standen Sträucher wie Tupfer auf der dünnen Sandkruste. Der Weg, der bleicher erschien als das Land zu beiden Seiten, war keine richtige Straße, vielmehr eine vielleicht hundert Schritt breite Zone, bedeckt von zahllosen Fußstapfen, Hufabdrücken, sich kreuzenden Wagenspuren und alten Dunghaufen. Aufrechtstehende Steine säumten seinen Rand, zusammen mit Felshaufen, zerbrochenen Rädern und Tragegestellen, verrottenden, nicht mehr zu gebrauchenden, vor sich hin rostenden Rüstungsteilen und mit Gebeinen.
»Wie weit ist es noch bis zu dieser Herberge?« fragte Markus abermals.
Rannulf legte eine Hand an die Stirn, um die Augen vor der Sonne zu schützen. »Wir müssen vielleicht gar nicht mehr so weit laufen. Seht.« Er deutete nach vorn. Ein gutes Stück voraus und jenseits der unregelmäßigen Begrenzung aus Steinen, Schutt und Abfällen bewegte sich eine Staubfahne in Richtung der blauen Hügel. Jemand näherte sich dem Weg aus östlicher Richtung.
»Sarazenen«, entfuhr es Markus.
»Das glaube ich nicht«, entgegnete Rannulf. »Die gehören zu uns.«
»Ihr könnt doch gar nichts erkennen. Ihr ratet einfach nur.«
»Nein. Seht doch, woher sie kommen. In jener Richtung gibt es nur Krak. Das müssen unsrige sein.« Rannulf spähte zu der sich bewegenden Staubwolke und versuchte abzuschätzen, an welcher Stelle der Zug die Straße erreichen würde. »Also los«, sagte er und rannte im Laufschritt los.
»Ich wollte, Ihr würdet reiten«, sagte Sibylle. »Ihr haltet uns nur auf.« Sie zügelte abermals ihr Pferd, um sich dem Tempo des Karrens anzupassen.
Alys, ihre Base, hockte hinter den schwerfällig trottenden Maultieren in halb sitzender, halb liegender Stellung auf einem Berg von Kissen. Eine ihrer plumpen Hände umklammerte die Kante der Seitenwand des Wagens, während die andere ständig die Fliegen zu verscheuchen versuchte, die im Schatten des Sonnenschutzes umherschwirrten. »Wenn Ihr glaubt, das hier wäre bequem, dann kommt doch her und gesellt Euch zu mir, Sibylle. Aber glaubt mir, wenn ich auf einem Pferd sitzen müßte, kämen wir noch langsamer voran.«
Sibylle stieß einen Seufzer aus. Sie reisten jetzt schon seit zwei Tagen durch diesen immer gleichen, öden Landstrich, und sie sehnte sich danach, endlich sein Ende zu erreichen und irgendwo anzukommen, ganz gleich an welchem Ort. Die Pferde der fünf Ritter, die vor ihr trabten, wirbelten einen Staubschleier auf, der ihr in die Augen drang. Sie hatte Guile, der den Befehl über ihre Eskorte innehatte, erklärt, daß sie diesen Zustand zu ändern wünsche und die Männer hinter ihr zu reiten hätten, doch der Edle hatte sie höhnisch angesehen und ihr empfohlen, sich gefälligst in den Wagen zu begeben und die Vorhänge geschlossen zu halten.
»Ihr solltet ihm nicht gestatten, so mit Euch zu reden«, sagte Alys.
»Nein, sicher nicht«, meinte Sibylle. Sie wollte nicht zugeben, daß sie sich vor Guile fürchtete. Plötzlich erscholl von vorn ein Ruf. Die Ritter drängten sich vor der Herrin zusammen und hielten an.
Irgendetwas ging dort vor. Auch der Wagen kam zum Stehen. Alys beugte sich vor, spähte durch die tanzenden Fliegen und fragte: »Was geht denn da vor?« Sibylle lenkte ihr Pferd vom Karren fort und schloß zu den Rittern an der Spitze des Zuges auf.
Guile von Krak hatte sich vor seinen Männern aufgebaut und das Schwert gezogen. Er war ein stämmiger Mann und einige Jahre älter als Sibylle. Unter dem Rand des Helms wallte sein Haar knochenweiß über die Schultern hinab. »Bleibt, wo Ihr seid!« rief er.
Sibylle zügelte ihr Pferd, reihte sich hinter Guile ein, so daß sie aus seinem unmittelbaren Blickfeld verschwand, und schaute in die Richtung, der auch seine Aufmerksamkeit galt. Zwei Männer kamen über die Straße auf sie zugelaufen. So abgerissen, schmutzig und bärtig, wie sie waren, wirkten sie wie Gesetzlose. Auf Guiles Befehl hin blieb einer der beiden stehen, während der andere weiter auf ihn zukam und erklärte: »Ich nehme Euer Pferd. Und ich brauche noch eines für meinen Bruder.«
Sibylle hob überrascht den Kopf, und Guile stieß ein verächtliches Lachen aus. »Was? Geht mir aus dem Weg, oder ich schneide Euch in Stücke.« Wie um seine Worte zu unterstreichen, legte er die Klinge auf die Schulter.
Der Mann vor ihm machte keine Anstalten, nach seinem eigenen Schwert zu greifen, das in einer schwarzen Scheide an seiner Hüfte hing. Er trug einen Sattel auf der Schulter, den er zu Boden fallen ließ, als wäre er gerade heimgekommen. Dann nahm er den Helm ab und wischte sich mit dem Ärmel seines Waffenrocks über das schweißnasse Gesicht. Sein schwarzes Haar war kurz geschnitten und reichte nicht einmal bis zu den Ohren. Ruhig blickte er zu Guile hinauf und bemerkte: »Ich bin Ritter des Tempels zu Jerusalem, und ich will Euer Pferd. Also steigt ab.«
Ein erregtes Raunen ging durch Sibylles Eskorte. »Ein Templer. Hört Ihr, ein Templer.« Guile ließ sein Schwert sinken. Sibylle ritt näher heran, richtete ihren Blick auf die breite Brust des schwarzhaarigen Ritters und erkannte unter der Schmutzschicht das rote Kreuz auf seinem Wams.
Sie fuhr zu Guile herum, der reglos neben ihr saß, das Schwert quer über dem Sattelknauf hielt und die Kiefer fest zusammenpreßte, und sagte: »Nun? Worauf wartet Ihr? Händigt ihm Euer Pferd aus.«
Guile starrte sie wütend an. Noch während sie sprach, hatte der Templer, der auf der Straße gewartet hatte, zu dem Schwarzhaarigen aufgeschlossen. »Stellt fest, ob Sie etwas Eßbares dabei haben«, verlangte er.
Sibylle lenkte ihr Pferd zwischen Guile und die beiden Ritter. »Wir werden Euch helfen. Ich bin Prinzessin Sibylle von Jerusalem. König Amalrich war mein Vater, und König Balduin ist mein Bruder. Sagt mir, wie ich Euch zu Diensten sein kann.«
Sie erwartete eine gewisse Ehrerbietung, ein wenig Respekt oder wenigstens ein Anzeichen von Dankbarkeit, doch der schwarzhaarige Templer machte sich nicht einmal die Mühe, sie anzusehen. Stattdessen wandte er sich an den anderen Ritter. »Sagt ihr, sie soll nach Krak zurückkehren, oder wo immer sie hingehört, und zwar rasch. Und sie soll den Wagen hierlassen.« Guile stieg ab, und der Templer ging um Sibylle herum, um die Zügel zu übernehmen. »Bringt auch ein Pferd für meinen Bruder«, befahl er Guile. »Nun sputet Euch! Schnell, Mann!«
Sibylle spürte, wie ihr das Blut zu Kopf stieg. Für ihren Geschmack hatte sie diesem zerlumpten, schmutzigen und namenlosen Mann, der ihr da auf der Straße entgegengelaufen war, genügend Höflichkeit erwiesen. Doch da trat der andere Templer vor und blickte zu ihr hoch. Er war noch jung, trug einen braunen Bart, und seine Augen wirkten über den sonnenverbrannten Wangen erstaunlich blau. »Edle Prinzessin, bitte vergebt dem Heiligen, aber sein Gelöbnis verbietet ihm jeden Umgang mit Frauen. Wir befinden uns auf einer dringenden Mission. Saladin zieht von Ägypten aus nach Norden, hierher, und mit ihm kommt ein Heer von dreißigtausend Mann. Wir müssen unbedingt nach Askalon gelangen, wo er zuerst zuschlagen wird.«
»Saladin!« rief Sibylle erschrocken. »Aber das ist doch unmöglich.« Sie drehte sich im Sattel und blickte nach Süden, wo sich die Wüste wie eine gewaltige Barriere ausbreitete. »Die Sarazenen haben doch noch nie von Ägypten aus angegriffen.«
»Der Sultan scheint es sich anders überlegt zu haben«, erklärte der braungebrannte Mann. »Und mein Bruder hat recht, Prinzessin. Ihr müßt Euch in Sicherheit bringen, und der Wagen ist dafür viel zu langsam.«
»Meine Cousine ist ... sie kann nicht reiten«, wandte Sibylle ein.
Der Schwarzhaarige schwang sich auf Guiles Pferd. »Dann bindet sie am Sattel fest.« Er hielt seine Augen von ihr abgewandt, als sei sie nicht wert, überhaupt zur Kenntnis genommen zu werden. Ein Knappe eilte mit einem anderen Pferd herbei. Der braunhaarige Ritter ergriff die Zügel und stieg in den Sattel.
»Ich nehme an, ich bekomme immer noch nichts zu essen, oder?« brummte er.
Der Schwarzhaarige stieß ein tiefes, mißgelauntes Knurren aus. Guiles Pferd tänzelte bereits aufgeregt unter ihm und zerrte an den Zügeln. Er blickte über die Schulter zu Guile hinüber, der ohne Pferd dastand. Das gerötete Gesicht des Ritters von Krak hatte sich verfinstert. »Bringt den Sattel zum Tempel in Jerusalem«, sagte der Templer. Er spornte Guiles Pferd zu einem raschen Trab an und entfernte sich mit dem anderen Ritter an seiner Seite.
»Häßlicher Bauernlümmel«, murmelte Sibylle erregt.
Sie schaute abermals besorgt in Richtung Süden. Wenn zutraf, was die Templer behauptet hatten, daß die Sarazenen tatsächlich von Ägypten her angriffen, lag das Königreich von Jerusalem ungeschützt vor ihnen. Wie Sibylle wußte, hielten sich alle christlichen Armeen weit im Norden auf, in der Nähe von Homs und vor Aleppo. Sie mußte unbedingt nach Askalon, um dort alles zu unternehmen, was in ihrer Macht stand.
Guile konzentrierte seinen finsteren Blick auf Sibylle. »Nun, Ihr habt ihn gehört. Schafft Eure verdammte Base aus dem elenden Karren, damit wir endlich weiterkommen.«
»Ja«, antwortete sie. »Ich glaube, das ist eine ausgezeichnete Idee, Guile.« Sie ritt zurück zum Wagen, um Alys auf ein Pferd zu verfrachten.
Kapitel 2
»Also«, bemerkte Markus unnötigerweise, »da sind sie ja.« Rannulf schob seinen Helm aus der Stirn.
Sie hatten ihre schweißtriefenden Pferde am Rand eines steilen, buschbewachsenen Hügels angehalten. Vor ihnen fiel das Land in einem weiten Bogen zu der Ebene hinab, die sich nach Süden und Westen bis Askalon und zum Meer hin erstreckte. Staub hing dick in der reglosen Luft und trübte den Blick auf die grünen Hänge der Hügel. Und inmitten dieses aufgewühlten bräunlichen Schleiers bewegte sich das Heer der Sarazenen wie ein gewaltiger Strom über den tiefliegenden Grund.
An dieser Stelle trat ein Wadi aus den Hügeln hervor und bohrte sich in die Ebene, ein breites, ausgetrocknetes Flußbett, das tief in den Boden einschnitt. Die Vorhut von Saladins Armee hatte das Wadi bereits passiert. Die Nachhut befand sich irgendwo weit im Süden außer Sicht und hielt sich wahrscheinlich noch in der Nähe der Stadt Ramlah auf, die die Sarazenen in der vergangenen Nacht geplündert und niedergebrannt hatten. Saladins Heer hielt keine besondere Ordnung ein. Die Feinde wußten, daß es im Umkreis von hundert Meilen kein christliches Heer gab, das stark genug gewesen wäre, sich ihnen entgegenzustellen. Wenn sie die wenigen Franken überhaupt bemerkt hatten, die sich durch die Hügel zwischen ihnen und Jerusalem pirschten, so zeigten sie jedenfalls kein Interesse an ihnen. Die Sarazenen bewegten sich in einzelnen Wellen vorwärts, lange Reihen von Kamelen, jedes davon mit Vorräten und einem Tragekorb beladen, und in jedem dieser Körbe ein Axtkämpfer, ein Lanzenträger oder ein Bogenschütze. Es gab auch berittene Bogenschützen, Beduinen zumeist, die in ihren langen weißen Gewändern wie Möwenschwärme aussahen. Und dazwischen immer wieder Soldaten, die zu Fuß gingen und ihre berittenen Kameraden um Mitnahme baten. Gelegentlich erlaubte ein Reiter einem von ihnen, sich am Steigbügel festzuhalten und sich ein Dutzend Schritte mittragen zu lassen.
»Sie werden wenigstens zwei Tage brauchen, um das Wadi zu durchqueren«, bemerkte Markus.
»Schon möglich.« Rannulf kannte die Gegend. Das Flußbett selbst war flach und breit und stellte daher kein Hindernis dar, doch das südliche Ufer fiel abrupt zehn oder fünfzehn Fuß tief ab, und dort, am oberen Rand, staute sich das Sarazenenheer, weil die Pferde und auch viele der Kamele vor dem Sprung zurückscheuten. Die Soldaten, die nachfolgten, verteilten sich nach beiden Seiten, so daß mittlerweile das gesamte südliche Ufer des Wadi von Saladins Kriegern bedeckt war. Unvermittelt gab ein Teil des Ufers dem Gewicht der dicht an dicht stehenden Soldaten nach. Erdreich und ein Dutzend Pferde stürzten ins trockene Bett. Die Schreie der Tiere und Reiter erreichten nur schwach die Ohren der beiden heimlichen Beobachter.
»Dort kommt der König«, rief Markus. »Was wollt Ihr ihm erzählen? Himmel, das ist ein großes Unglück.«
Rannulf schüttelte den Kopf, während sein Blick auf der Menschenmenge verharrte, die sich langsam über die Ebene wälzte. Es mußten Tausende, wenn nicht Zehntausende sein, und er wurde des Versuchs müde, sie zu zählen. Zwischen den Feinden und Jerusalem und dem Grab Christi standen weniger als fünfhundert Franken, von denen die meisten nicht einmal Ritter waren.
Hufschläge erklangen auf dem trockenen Hang hinter ihnen, und er drehte sich um, um zu sehen, wie der König von Jerusalem herannahte, zusammen mit dem Großmeister des Jerusalemer Tempels und dem Bischof von Sankt Georg, der auf seinem weißen Esel hinterhertrabte. An der Spitze des Hügels zügelte der junge König sein Pferd neben den Templern, warf einen Blick über die Ebene in Richtung Süden und sog scharf die Luft ein.
Rannulf betrachtete ihn genauer. Balduin war erst siebzehn Jahre alt und seit drei Jahren König. Damals war er schon aussätzig gewesen. Die Krankheit hatte sein Gesicht zerfressen und in eine klumpige Ruine verwandelt, und die Lippen waren von schwärenden Wunden bedeckt. Die glatte Seide seines goldgesäumten Umhangs und der goldene Ring der Krone schmückten sein totes Fleisch wie Grabbeigaben. Lange Zeit starrte er auf die Feinde hinunter.
»Oh, Gott«, bemerkte er schließlich, »es sind so viele.«
Neben ihm saß Odo von Saint-Armand, der Großmeister der Templer in Jerusalem, auf seinem Pferd. Der größte Teil des Jerusalemer Kapitels der Templer war im Vormonat nach Norden in den Kampf gezogen, doch der Großmeister hatte sich geweigert, sich dem Kreuzzug anzuschließen, da der König nicht mitgeritten war. Odo von Saint-Armand würde sich nicht selbst herabsetzen, indem er jemandem von geringerem Rang folgte. Jetzt strich er sich mit den Fingern durch den lohfarbenen Bart und betrachtete prüfend das ferne Heer der Sarazenen.
»Aber viele von ihnen sind keine ausgebildeten Kämpfer.«
»Und ihre Ordnung ist miserabel. Sie bringen es nicht einmal zustande, sich in Formation zu bewegen«, sagte der König. Seine Stimme klang fest. Am Sattelknauf ballte sich seine Rechte zur Faust. »Ich will sie angreifen. Jetzt. Sofort. Ich will sie schlagen, empfindlich schlagen. Koste es, was es wolle.«
Markus richtete sich bei diesen Worten besorgt auf. Sein Blick streifte Rannulf und bat stumm um Unterstützung. »Sire, uns stehen nur ein paar hundert Mann zur Verfügung. Und wenn wir fallen, gibt es keine Hoffnung mehr für Jerusalem.«
Rannulf beobachtete Balduin. Ihm gefiel das Feuer, das so kraftvoll in dem verfallenden Körper des jungen Königs loderte. Der Aussätzige saß vorgeneigt im Sattel, den Rücken durchgedrückt und die Faust immer noch geballt. Die Augen leuchteten hell und lebendig in dem verwüsteten Gesicht, und seine ganze Aufmerksamkeit galt dem feindlichen Heer. »Wir haben Jesus Christus«, sagte er, »und wir haben das Wahre Kreuz.«
Hinter dem König murmelte der Bischof: »Sire, die Templer verstehen ihr Handwerk.«
Er wollte sich damit Markus’ Meinung anschließen, der wie üblich zum Rückzug neigte, doch auf der anderen Seite des Königs ertönte das meckernde Kichern des Großmeisters. »Zumindest einige von uns.« Er wandte sich an Rannulf. »Was haltet Ihr davon?«
»Wir können es versuchen«, meinte der Templer. »Sie haben ihre Reihen viel zu weit auseinandergezogen, genau wie der König es gesagt hat.«
»Ein einziger heftiger Angriff«, erklärte Odo. »Wir attackieren sie direkt hier auf unserer Seite des Wadi, wo sie das Ufer hinaufsteigen müssen. Dort halten sie die geringste Ordnung ein und müssen sich erst neu formieren. Wir könnten ein paar von ihnen erschlagen und dem Rest einen höllischen Schrecken einjagen.«
»Ein Angriff«, sagte der Bischof mit angespannter Stimme. »So unterlegen, wie wir sind, scheint mir das schierer Wahnsinn zu sein.«
»Wir werden es so machen«, bestimmte der König. Er trieb sein Pferd zu seinen Soldaten hinüber. »Geht zu den Männern. Sagt ihnen, wenn sie Jesus und das Wahre Kreuz lieben, dann müssen sie mir jetzt folgen.«
Odo wendete sein Pferd und ritt den Hang hinunter zu der Handvoll Männer, die unten auf dem ebenen Gelände warteten. Der König folgte ihm, der Bischof trieb seinen Esel an, und Rannulf hob die Zügel, um sich ihnen anzuschließen. Markus musterte ihn mit düsterer Miene.
»Ihr mußtet ja unbedingt zustimmen. Odo hätte überhaupt nichts gesagt, wenn Ihr Euch nicht dafür ausgesprochen hättet.« Der junge Ritter warf einen raschen Blick auf den sich entfernenden König und wandte sich dann wieder an Rannulf. Seine Wangen waren hinter dem eisernen Nasenschutz des Helms rot angelaufen. »Erteilt mir die Absolution.«
Rannulf zügelte sein Pferd. Die anderen Männer waren ihnen schon ein Stück voraus, trotzdem blieb ihnen noch etwas Zeit. Er trieb sein Pferd so nah zu Markus hin, daß die Knie der beiden Ritter sich berührten. Markus hob eine Hand, um sein Gesicht zu bedecken. Seine Stimme schwankte, er klang leise und angespannt, und die Worte kamen hastig.
»Vergib mir, Jesus, denn ich habe gesündigt. Ich war eitel und voller Gier nach Speisen, nach Wein und nach Frauen. Ich wollte gelobt werden. Ich habe gelogen. Ich habe meinen Willen über Gottes Willen gestellt. Meine Gedanken sind während des Gebetes abgeirrt. Ich habe die, die über mir stehen, beneidet, und die, die unter mir sind, verachtet. Ich habe den Namen Gottes aus nichtigem Anlaß und im Zorn benutzt. Ich habe meine Pflichten vernachlässigt. Ich hatte Angst vor dem Sterben.« Atemlos hielt er einen Moment inne. »Das ist alles.«
»Bereut Ihr Eure Sünden?«
»Es tut mir von Herzen leid, Gott beleidigt zu haben, der all meine Liebe verdient.«
»Te absolvo«, sagte Rannulf, schlug das Zeichen des Kreuzes über Markus und bekreuzigte sich dann selbst. Markus war nun rein. Rannulf wünschte, er würde sich ebenso gereinigt fühlen. Weiter unten formierte Odo das kleine Heer des Königs zu Kolonnen. Von der Nachhut her kamen die Knappen mit den Packpferden, die die Kampfausrüstung der Ritter trugen. Allen Soldaten voran ritt der Bischof von Sankt Georg auf seinem weißen Esel und trug das Banner mit dem Kreuz. Markus machte Anstalten, sein Pferd in Bewegung zu setzen, doch Rannulf streckte den Arm aus, um ihn aufzuhalten.
»Erteilt mir auch die Absolution.«
Markus Augen weiteten sich, und eine seiner Augenbrauen zuckte hoch, doch er war zu klug, um etwas zu sagen. Rannulf hob eine Hand vor sein Gesicht und wandte den Blick ab. »Vergib mir, Herr Jesus, denn ich habe gesündigt. Ich habe Lust nach einer Frau verspürt und im Herzen Ehebruch mit ihr begangen.«
Bei diesen Worten verstieß Markus gegen die Vorschriften, indem er den Kopf drehte und den Ritter anstarrte. Rannulf spürte das Gewicht des Blicks und starrte zu Boden.
»Bereut Ihr Eure Sünden?«
Er murmelte die vorgeschriebenen Worte.
»Ego te absolvo«, sagte Markus.
Nun sah Rannulf ihn an, und Markus beugte sich vor, um ihn zu umarmen, und küßte ihn auf die Wange. Seite an Seite ritten sie zu der kleinen Kreuzzugsarmee hinab.
Die Ritter gehörten nicht dem Jerusalemer Kapitel an. Drei Tage zuvor, als Saladins Heer Gaza passiert hatte, hatten sich die achtzehn Ritter, die zur Garnison der dortigen Feste gehörten, an der Küste entlanggeschlichen und waren bei Askalon zur kleinen Heerschar des Königs gestoßen. Doch sie waren Templer, und das allein zählte. Zusammen mit Rannulf und Markus stellten sie Odos gesamte Streitmacht dar. Der Großmeister lenkte sein Pferd langsam an der Reihe entlang und musterte sie, und als Rannulf und Markus sich ihr anschlossen, erteilte er mit klarer Stimme seine Befehle.
»Wir haben keine Standarte, also müßt Ihr mich im Auge behalten. Bleibt stets in Bewegung. Sie dürfen keine Gelegenheit erhalten, uns mit ihrer Überlegenheit zu erdrücken. Laßt nicht zu, daß sie uns in die Zange nehmen. Mit anderen Worten: Haltet die Linie zusammen.« Er drehte sich zu Rannulf um, der gerade seinen Helm aufsetzte. »Rannulf Fitzwilliam wird den Platz am Ende des rechten Flügels einnehmen. Sollte ich fallen, übernimmt er den Befehl und ist Euer Meister.«
Rannulf ritt zum Ende der Reihe. Markus gliederte sich links neben ihm ein. »Ihr habt uns das eingebrockt«, murrte er. Der Ritter hakte den an seinem Sattel hängenden hölzernen Schild los und streifte sich den Gurt über den Kopf, so daß der lange, unten spitz zulaufende Schutz auf seinem linken Arm ruhte.
Auch Rannulf legte seinen Schild an. An seinem Rücken und in seinem Hals fühlte er ein Kribbeln, wie stets vor einem Kampf. Der Gurt des Schildes drückte wie gewohnt auf die entzündete Stelle an seiner Schulter. »Gott helfe uns allen.« Er legte eine Hand auf den Griff seines Schwertes. Markus befand sich links von ihm auf gleicher Höhe, und jenseits seines Kameraden bildeten die anderen Ritter eine feste Mauer, die bis zum Großmeister reichte.
Odo hob den Arm, und die gesamte Schlachtreihe der Templer bewegte sich geschlossen vorwärts.
»Halt.« Rannulf zügelte sein Pferd. Der junge König galoppierte ihm in den Weg.
Vor ihnen auf dem Hang hatte der Bischof von Sankt Georg seinen Esel angehalten und blockierte den Weg der kleinen christlichen Heerschar. Hoch über dem Kopf erhoben hielt er die Standarte des Königreiches, einen langen, von goldenen Bändern umwundenen Stab, an dessen Spitze sich ein Reliquiar befand, das einen Splitter des Wahren Kreuzes enthielt. Gold und Edelsteine bedeckten das Behältnis, und die goldenen Bänder funkelten in der Sonne, so daß die Christen es auch aus der Ferne erkennen und daraus Mut schöpfen konnten. Als sich die Franken nun in Bewegung setzten, preschte der König vor, sprang von seinem Pferd und warf sich vor aller Augen auf den staubigen Boden, genau dort, wohin der Schatten der Standarte fiel. Er breitete die Arme aus und bildete so, auf dem Boden liegend, selbst ein Kreuz.
Ein Raunen ging durch die Männer, und sie drängten näher heran. Selbst Rannulf und die übrigen Templer bewegten sich vorwärts. Und dann erklang die Stimme des Königs.
»Lieber Herr Jesus, Sohn Gottes, ich will sie nicht unbehelligt vorbeiziehen lassen. Laß mein Leben hier bei der Verteidigung Jerusalems enden. In Deinem Namen und zu Deinem Ruhm flehe ich Dich an. Wenn Saladin weiterziehen soll, so laß mich dann den Tod finden, wenn ich mich ihm in den Weg stelle.« Der König erhob sich aus dem Staub. Die Augen, aus denen Tränen strömten, glitzerten hell und klar in seinem verwüsteten Gesicht. »Dein Wille geschehe!«
Da erhob sich aus den dichtgedrängten Reihen der Männer ein rauher Ruf. »Gott will es! Deus le vult!«
Bei diesem Schlachtruf spürte Rannulf, wie sich die Härchen in seinem Nacken aufstellten. Er fühlte eine plötzliche Stärke in seinen Armen und Schultern, und seine Hand zuckte zum Schwert. Das Pferd bäumte sich unter ihm auf. Am anderen Ende der Schlachtreihe hob Odo den Arm, und die Ritter bewegten sich in raschem Trab vorwärts. Der junge König galoppierte den Hügel hinauf, und der Bischof folgte ihm, so gut und so rasch er es vermochte. Hinter ihnen ließ der lärmende Schwarm der übrigen christlichen Krieger den Kampfruf ertönen.
»Gott will es!«
Zwei Längen hinter dem König überquerten die Templer die Hügelkuppe in ungebrochener Linie und spornten ihre Tiere zum Galopp an. Jetzt fiel das Gelände vor ihnen ab, und sie konnten die Feinde sehen, weit auseinandergezogene Reihen sarazenischer Krieger, verstreut über die Ebene und halb verborgen vom Staub, den sie aufwirbelten. Rannulf zog sein Schwert. Der lederumwickelte Griff paßte genau in seine Hand. Das vertraute Gewicht zu spüren weckte in ihm den Wunsch, zuzuschlagen, Hiebe auszuteilen und zu töten. Markus ritt so dicht neben ihm, daß Rannulfs Bein gegen die Schulter seines Pferdes stieß.
»Deus le vult!«
Laut erschallte der Ruf, und hundert andere Stimmen fielen ein. »Deus le vult!« Dünn und schwach wirkte der Schrei in der stauberfüllten Luft. Doch weiter vorn im und am Wadi wurde er vernommen.
Überall entlang des Uferrandes erhoben sich warnende Rufe. Beim Anblick der Christen, die auf sie zujagten, versuchten jene Sarazenen, die dem Ansturm als erste ausgesetzt sein würden, so rasch wie möglich der Gefahr auszuweichen. Der junge König hielt direkt auf ihre Mitte zu. Das Wahre Kreuz befand sich nur eine halbe Pferdelänge hinter ihm, und gleich darauf folgte die Masse der Templer wie eine heranrollende Mauer.
Die Sarazenen wichen vor den Gepanzerten zurück. Noch bevor der junge König sein Pferd in ihr Zentrum lenken konnte, wendeten viele ihre Tiere zur Flucht. Die Mutigeren unter ihnen hielten stand und versuchten zu kämpfen, doch die gewappneten Ritter auf ihren schweren Pferden brachen über sie herein und ritten sie nieder. Das Scheppern und Klirren wurde von den durchdringenden Schreien der Sterbenden übertönt. Rannulfs Körper schien in Flammen zu stehen; er hieb mit dem Schwert um sich und fühlte sich lebendig bis hin zur Spitze seiner Klinge.
Vor ihm am brüchigen Rand des Grabens stolperten an die hundert weißgewandete Männer mit flatternden Umhängen rückwärts in jene, die noch immer versuchten, aus dem trockenen Flußbett hinauszuklettern. Rannulf stürzte sich mitten unter sie und hieb auf jeden ein, der in seine Reichweite geriet. Markus galoppierte dicht an seiner linken Seite, und die übrigen Templer donnerten neben ihnen heran. Ein Kamel, gewaltig wie ein Turm, mit einem Krieger an jeder Seite, hielt auf Rannulf zu. Der Mann im rechten Tragekorb holte mit einer langstieligen Axt zum Schlag aus, der im linken hob die Lanze. Rannulf trieb sein Pferd direkt gegen das Kamel. Sein Schild dröhnte unter dem Hieb der Axt. Die Lanze zuckte auf ihn zu. Er wehrte sie mit dem Schwert ab und schlug aus der gleichen Bewegung heraus zu, und der Lanzenkämpfer stürzte rückwärts aus seinem Korb. Das Kamel schrie voller Panik auf. Der sarazenische Axtkämpfer griff verzweifelt nach den Zügeln. Sein Mund stand offen, und die hellen Augen waren weit aufgerissen.
Dann verschwanden Mann und Kamel plötzlich aus seinem Blickfeld und brachen durch den Boden, und unter den Hufen von Rannulfs Pferd löste sich die Uferböschung. Der Ritter stemmte die Füße in die Steigbügel und lehnte sich weit im Sattel zurück, als sein Pferd auf den Hinterläufen zum Grund des Wadi hinabrutschte und dabei Fontänen aus Sand und Staub hochschleuderte.
Die anderen Templer folgten ihm nach unten und hielten dabei ihre Schlachtreihe geschlossen. Durch die stauberfüllte Luft erkannte Rannulf, wie sich Odos Arm am anderen Ende der Reihe hob und er schon eine neue Attacke befahl, noch bevor sie den Grund des Wadi erreicht hatten. Mit einem Sprung nach vorn bekam Rannulfs Pferd wieder festen Boden unter die Hufe, und der Ritter trieb es im Galopp in den brodelnden, jede Sicht verwehrenden Staub hinein.
Zuerst sah Rannulf überhaupt nichts. Dann klärte sich plötzlich die Sicht, und vor ihm erstreckte sich das flache, sandige Bett des Wadi. Hunderte von Sarazenen strömten in ungeordneter Flucht von ihm fort, die meisten von ihnen zu Fuß. Rannulf beugte sich über die Schulter des Pferdes vor und hieb nach einem Mann in gestreifter Kleidung, der noch zwei Schritte machte, aufschrie und dann unter den alles zermalmenden Hufen verschwand. Eine Herde durchgegangener Pferde jagte vor dem Ritter dahin und wirbelte noch mehr Staub hoch. Rannulf konnte nichts mehr erkennen. Er lenkte sein Pferd zu Markus hinüber, der links von ihm ritt, und als Markus seitlich abschwenkte, spornte er sein Pferd an, um mit ihm Schritt zu halten und seinen Platz in der Kampfreihe nicht zu verlieren.
Abermals gelangten sie aus der Staubwolke hinaus in klare Luft. Vor ihnen drehten sich einige der Sarazenen um und versuchten, sich gegen die angreifenden Ritter zu formieren. Sie sahen aus wie Beduinen, trugen keine Rüstungen und waren nur mit Stöcken und Speeren bewaffnet. Aus der Reihe der Templer stieg ein kehliger Triumphschrei auf. Rannulf zügelte sein Pferd ein wenig, um die Schrittlänge zu verkürzen. Die Schlachtreihe schloß zu ihm auf und schwenkte in Richtung der zum Widerstand entschlossenen Sarazenengruppe. Im letzten Moment gab er dem Pferd die Zügel frei, schoß vorwärts und krachte mitten in die zusammengedrängten Männer. Die Beduinen wandten sich zur Flucht, doch es war schon zu spät. Die Templer ritten sie einfach nieder. Rannulf brauchte nicht einmal sein Schwert einzusetzen. Dann erblickte er durch den Vorhang aus dahintreibendem Staub weitere Sarazenen, die in Stellung gegangen waren.
Markus stieß einen Warnschrei aus. Rannulf hörte seine Stimme trotz des Schlachtenlärms und lenkte sein Pferd zu ihm hinüber. Er konnte die übrigen Templer gerade noch ausmachen, doch welche Kommandos Odo gab, war nicht mehr zu erkennen. Vor ihm tauchte auf dem flachen Grund des Wadi eine Gruppe berittener Bogenschützen auf. Ihre Pferde tänzelten nervös. Trotz der vor Staub flimmernden Luft konnte Rannulf das geschwungene Holz ihrer Bögen gut erkennen. Er duckte sich im Sattel und suchte hinter dem Schild Schutz. Ein Pfeil prallte von seinem Helm ab. Dann ging unvermittelt ein ganzer Pfeilregen rings um ihn nieder.
Die Templer hielten in ihrem Ansturm nicht inne. In ihren Rüstungen und hinter den Schilden ritten sie unverwundbar durch den Pfeilhagel, trafen in vollem Galopp auf die viel leichteren sarazenischen Reiter und trieben sie fast bis zum Rand des Wadi zurück. Ein Krummschwert zuckte vor Rannulfs Gesicht auf. Er antwortete mit einem heftigen Schlag und spürte, wie Fleisch und Knochen unter seiner Klinge nachgaben. Sein Pferd geriet ins Straucheln, fing sich aber wieder. Rannulf atmete staubgesättigte Luft ein, doch nur einen Augenblick später brach er wieder ins Freie.
Am anderen Ende der Reihe fuhr Odos Arm hoch. Rannulf ließ sich in den Sattel zurücksinken und zügelte sein Pferd, bis es in Schritt fiel. Die weit auseinandergezogene und gewellte Reihe der Templer kam zum Stehen und nahm rasch wieder die ursprüngliche, festgeschlossene Aufstellung ein. Neben Rannulf schnappte Markus deutlich hörbar nach Luft. Die meisten der übrigen Männer sahen heil und gesund aus. Rannulf drehte sich im Sattel und blickte sich um.
Am gesamten südlichen Ufer des Wadi wimmelte es von Sarazenen, die am Rand des Grabens emporkletterten. Überall auf dem flachen Grund des trockenen Flußbettes lagen Körper von Menschen, Pferden und Kamelen. Vom König oder dem Wahren Kreuz war nichts zu sehen. Die anderen Christen jagten im Wadi auf und ab und stürzten sich auf jeden, der noch laufen konnte.
Ein Schlag traf Rannulf am Arm, und er zuckte zusammen. Markus starrte ihn an. »Odo verlangt nach Euch«, sagte er und deutete in dessen Richtung.
Rannulf galoppierte die Reihe entlang zum Großmeister, der mit gekrümmtem Rücken im Sattel hockte und über das Wadi hinwegblickte. Als Rannulf sein Pferd neben ihm anhielt, deutete Odo mit der Hand nach vorn und fragte: »Was ist denn da drüben los?«
Ein Stück weiter hinunter hatten die Sarazenen eine Art Schlachtordnung aufgebaut. Oben am Ufer des Wadi wimmelte es von Bogenschützen, die dem gesamten Bereich Deckung gaben, so daß die Männer, die sich noch unten im Graben befanden, sicher nach oben gelangen konnten.
»Muß sich um jemand Wichtigen handeln«, meinte Rannulf. Mitten unter den Bogenschützen leuchtete plötzlich etwas Gelbes auf. Die Farbe des Sultans. »Seht.
Mamelucken – erkennt Ihr die Helme?« Er zeigte auf das ferne Glänzen polierten Stahls. »Das ist die Halqa. Die Garde des Sultans.«
Odo sog scharf die Luft ein. »Greifen wir ihn uns!«
Rannulf packte ihn am Arm und hielt ihn zurück. »Nicht von hier unten. Wir müssen die Böschung hinauf und ihn dann von der Seite her angreifen.«
»Ihr übernehmt die Führung«, sagte Odo. Er stellte sich in die Steigbügel und ließ den Arm kreisen. »Doppelreihe. Doppelreihe.«
Rannulf kehrte zu seinem Platz in der Schlachtreihe zurück, die nun wendete und in Kolonne ritt. Ein kurzer Galopp das Wadi hinab brachte ihn zu einer Stelle, an der sie die Böschung erklimmen konnten, ohne auf Gegenwehr zu stoßen. Sein Pferd arbeitete sich mit gesenktem Kopf den Hang hinauf und schnaubte bei jedem Schritt. Die anderen Männer folgten ihm paarweise. Die ganze Zeit über blieb Markus dicht neben ihm. Er atmete noch immer schwer und er hielt sich schief, so als könne er eine Seite nicht bewegen. Am Fuß der Böschung streckte Rannulf eine Hand aus und legte sie dann dem Kameraden auf die Schulter.
»Alles in Ordnung?«
Der Kopf des jungen Ritters fuhr herum. »Gottes Wille wird geschehen«, erklärte er mit rauher Stimme.
Er saß noch immer aufrecht im Sattel und hielt seinen Platz in der Formation; doch das Schwert lag quer über seinem Sattel, und soweit Rannulf gesehen hatte, hatte er es bisher noch nicht zum Schlag erhoben. Vor ihnen erstreckte sich das gewundene Ufer des Wadi, zerwühlt und brüchig vom Auf- und Abstieg der Truppen. Sie bahnten sich ihren Weg hinauf.
Die gut zweihundert Schritt entfernten Bogenschützen hatten sie jetzt bemerkt und richteten ihre Waffen aus. Die ersten dunklen Pfeile schnitten durch die Luft, fielen aber harmlos vor ihnen zu Boden. Hinter den ungebärdigen Bogenschützen erkannte Rannulf mehrere gelbe Gewänder und die schimmernden Brustpanzer und spitzen Helme mameluckischer Offiziere. Sein Herz machte einen Satz. Er faßte die Zügel kürzer, um auf Befehle zu warten. Das von der Schlacht erregte Pferd bäumte sich unter ihm und kämpfte heftig gegen die Zügel, während Odo die Kolonne der Templer wieder zu einer Schlachtreihe formierte.
Rannulf kniff die Augen zusammen, um besser sehen zu können. Die gelben Gewänder drängten sich wie ein Büschel Dotterblumen am Ufer zusammen. Hinter ihnen mühten sich Männer zu Fuß ab, irgendetwas aus dem Wadi hinauszuschaffen. Eine Sänfte. Bänder flatterten an ihrem Baldachin. Rannulf stieß einen Schrei aus.
»Odo! Das ist der Sultan!«
Am Ende der Reihe schrie der Großmeister: »Ergreift ihn!«
Die Templer griffen an. Die gelbgewandeten Wachen des Sultans stellten sich ihnen entgegen, und ihre Rücken waren dem Wadi und den verängstigten Männern zugekehrt, die sich von unten hinaufmühten. Die Bogenschützen schossen einen so dichten Schwarm von Pfeilen ab, daß er die Sonne verdunkelte. Die Templer in ihren Kettenhemden ritten, ohne Schaden zu nehmen, durch den Geschoßhagel. Als die Sarazenen sie unbeirrt näherkommen sahen, schrien sie durcheinander, warfen ihre Bögen weg und rannten davon.
Die gewappneten Mamelucken hingegen flüchteten nicht. Mit gezogenen Schwertern sammelten sie sich zwischen den herannahenden Templern und der Sänfte, und ihr schrilles Kriegsgeschrei schallte herausfordernd. Die vom Schweiß glitschigen Zügel glitten durch Rannulfs Finger. Das Pferd schoß vorwärts, und mit einer Länge Vorsprung vor den anderen Templern trug es ihn direkt zum Feind. Als die beiden Heere aufeinanderprallten, schienen sie für einen kurzen Augenblick zum Stillstand zu kommen; das Dröhnen des Zusammenstoßes klang in Rannulfs Ohren wie ein gewaltiger Schlag auf einen Amboß. Dann bäumte sich sein Pferd auf, drängte sich zwischen die kleineren Tiere der Sarazenen, und Rannulf hieb mit dem Schwert auf die Gegner ein. Mit weitausholenden Schlägen bahnte er sich einen Weg durch die gelbgekleidete Horde in Richtung der Sänfte. Ein Hieb traf seinen Schild, und er holte mit dem linken Arm aus und schlug mit dem Schutz selbst zu. Irgendetwas krachte unter der Schildkante. Markus tauchte wieder zu seiner Linken auf und drängte vorwärts. Soweit Rannulf erkennen konnte, benutzte er sein Schwert nicht, trotzdem bahnte er sich seinen Weg mit hochgezogenem Schild voran und hielt seinen Platz in der Schlachtreihe. Dann tauchte die Sänfte direkt vor Rannulf auf, nur noch ein paar Schritte entfernt.
Die Träger hatten sie hastig abgesetzt und die seidenen Vorhänge beiseite gerissen. Hastig bemühten sie sich, die hochgestellte Person herauszuholen und zu einem weißen, geschmeidigen Kamel zu schaffen. Rannulf war den übrigen Templern eine halbe Länge voraus, und zwei der gelbgewandeten Wachen stürzten vor, um ihn abzuwehren. Sein Pferd stellte sich auf die Hinterläufe.
Der von Wachen und Dienern umgebene Mann, der aus der Sänfte hinauskletterte, drehte sich um. Durch Staub und Schreie hindurch richtete er seinen Blick direkt auf Rannulf – ein schmächtiger Mann mit gepflegtem schwarzen Bart und stechendem Blick. Unvermittelt fiel sein Turban hinab und enthüllte einen Schädel, der so kahl wie eine Zwiebel war. Rannulf stieß einen Schrei aus. Er gab seinem Pferd die Sporen und versuchte, den Glatzkopf zu erreichen, um ihn mit seinem Schwert zu spalten. Der schmächtige Mann warf sich auf das weiße Kamel und flüchtete in den Schutz einer größeren Gruppe von Soldaten.
Wütend über das Entkommen des Gegners hieb Rannulf um sich und stürmte gegen die Wand aus Männern und Pferden an, die sich zwischen ihm und dem Kahlköpfigen befand, dessen Schädel er unbedingt zerschmettern wollte. Die Gegner wichen vor seinem Angriff, doch es war schon zu spät; sein Pferd scheute, und der kahlköpfige Mann entfloh.
Und nun rief Odo ihn zurück.
Rannulf stieß einen wütenden Schrei aus. Alles in ihm verlangte danach, weiterzumachen und den Glatzkopf zu jagen, doch die Schlachtreihe kehrte um, und er mußte sich anschließen. Der Großmeister führte sie auf die Ebene hinaus, ließ anhalten und formierte sie zu einem weiteren Angriff.
Als Rannulf sein Pferd zügelte, befand sich Markus noch immer dicht neben ihm, doch dann glitt der junge Ritter unvermittelt aus dem Sattel und landete schwer wie ein Sack voller Steine auf dem Boden. Rannulf warf einen Blick über die Schulter. Die Sarazenen hatten sich über die ganze Ebene verteilt und rannten in alle möglichen Richtungen davon, die Gelbgekleideten ebenso wie die gewöhnlichen Soldaten. Rannulf hob den Arm, um Odo ein Zeichen zu geben, schwang sich aus dem Sattel und kniete neben Markus nieder.
Der Ritter hatte sich auf dem von Hufen zerstampften Boden voller Schmerz zusammengekrümmt und Arme und Beine dicht an den Körper gezogen. Blasen bildeten sich auf seinen Lippen.
Odo kam herbeigeritten. »Das war der Sultan, und wir haben ihn entkommen lassen.«
»Ihr habt mich zurückgerufen.« Rannulf legte eine Hand an Markus’ Hals, dort, wo der Kragen des Brustpanzers endete, und fühlte den schnellen, schwachen Herzschlag.
»Bleibt bei ihm«, sagte Odo. »Ich mache mich auf die Suche nach dem König.« Er ritt davon, und die übrigen folgten ihm. Es waren fünf weniger als bei ihrem Aufbruch, doch sie hatten überall auf der Ebene tote Sarazenen zurückgelassen – ein guter Tausch. Rannulf wünschte nur, er hätte diesen glatten, kahlen Schädel unter die Klinge seines Schwertes bekommen.
Er erhob sich, ließ den Schild von seinem Arm gleiten und hängte ihn an den Sattel. Dann nahm er die Trense aus dem Maul des Pferdes und band die hinter dem Sattel befestigte schwarzweiße Decke los. Die Schlacht hatte sich verlagert. Von Süden her trug der Wind die Schreie, das Klirren der Waffen und das Donnern der Hufe heran. Er schaute rasch in die Runde, ob irgendwo Plünderer zu entdecken wären, und hockte sich dann wieder neben Markus.
»Könnt Ihr aufstehen?«
Markus murmelte etwas. Rannulf erkannte an dem gurgelnden Geräusch in dessen Atem, wie es um ihn stand, doch wenigstens hatte sich Markus ein wenig entkrampft, und so konnte Rannulf dessen Beine strecken und ihn in die Decke hüllen. Er nahm Markus den Helm ab, und mit einem Seufzen ließ dieser den Kopf auf den Boden sinken.
Sein Gesicht hatte eine blaßgrüne Färbung angenommen. Der rechte Arm war gebrochen – schon seit der ersten Attacke, wie Rannulf wußte. Noch eine weitere Wunde war zu erkennen, ein tiefer Schnitt im Schenkel, doch es war etwas anderes, das ihn tötete, etwas in seiner Brust, das Rannulf nicht sehen konnte.
»Laßt mich nicht allein«, sagte Markus. »Bitte laßt mich nicht allein.«
»Das werde ich nicht«, beruhigte ihn Rannulf. Er faltete eine Ecke der Decke so, daß Markus seinen Kopf darauf betten konnte.
»Wir haben gewonnen«, sagte Markus.
»Bis jetzt schon.« Rannulf ließ abermals den Blick schweifen. Er hatte schon in anderen Schlachten gekämpft, die gewonnen schienen, bis sie sich plötzlich in eine Niederlage verwandelt hatten. Auf dieser Seite des Wadi konnte er nichts erkennen, das sich bewegt hätte, von ein paar streunenden Pferden abgesehen, die in der Ferne nervös dahintrabten. Vom Lärm des Kampfes war nichts mehr zu vernehmen. Ein paar Schritte von ihm stand sein erschöpftes Pferd, direkt neben Markus’ Tier. Die Schulter des Templers war von Blut bedeckt, und die Wunde am Bein klaffte so weit offen, daß man den weißen Muskelstrang sehen konnte.
»Ich sterbe«, flüsterte er.
Rannulfs Kopf senkte sich. Er setzte sich mit gekreuzten Beinen neben Markus. »Gott sei uns gnädig«, sagte er, nahm die Hand des jungen Ritters und hielt sie fest. Nachdem der Kampf vorüber war, schien seine Seele zusammenzuschrumpfen, und neben dem sterbenden Mann fühlte er sich schwach und zerbrechlich. Ihm war kalt. Der Tag verschwand langsam hinter dem Horizont. Die Luft war noch immer stauberfüllt, doch nun kam von der See her eine würzige Brise auf. Ein Schatten, der einer gekrümmten Klinge glich, glitt über die Ebene und über Rannulf hinweg, und er schaute nach oben. Hoch über ihm, am unermeßlichen Himmel, zog ein Geier mit ausgebreiteten Schwingen seine Kreise. Hinter ihm tauchte ein weiterer Aasvogel auf und dann noch einer. Rannulf festigte seinen Griff um Markus’ Hand, und einen Augenblick lang spürte er gar nichts. Dann erfolgte ein schwacher Druck als Antwort. Markus lebte noch. Rannulf bereitete sich darauf vor, bei ihm zu wachen.
Der junge König Balduin überließ es seinem Pferd, sich einen Weg durch die zunehmende Dämmerung zu suchen. Seine Knappen folgten ihm dichtauf. Die Luft stank wie in einem Schlachthaus. Das Zwielicht war von gräßlichen Geräuschen erfüllt, dem Mahlen von Zähnen und dem Schnappen von Schnäbeln, dem Schlagen und Flattern von Flügeln und den heiseren Schreien von Aasvögeln, die zu vollgefressen waren, um sich noch in den Himmel erheben zu können.
Die weite Ebene war von Leichen übersät; er war schon weit geritten, und noch immer kam er an Toten vorüber.
Erst jetzt begriff er allmählich, welch einen gewaltigen Sieg sie errungen hatten. Bei all diesen Toten handelte es sich um Sarazenen. Saladins gewaltiges Heer war hier, an den Ufern dieses Wadi, von ein paar hundert Rittern zerschlagen worden. Den Rittern Gottes. Gott hatte ihm diesen Sieg gegeben, als ein Zeichen, ein Versprechen; wenn er seinen Glauben bewahrte und nicht aufgab, würde Gott sein Königreich noch lange erhalten.
Vor ihm in der Dämmerung öffnete sich das Wadi wie eine Wunde in der Wüste. Am Rand der Böschung stürzte sich ein Plünderer wie ein Schakal auf einen Gefallenen. Dann zog er sich plötzlich zurück und floh. Irgendjemand dort unten war noch nicht tot.
»Halt«, befahl der König und zügelte wachsam sein Pferd. Alles, was er erkennen konnte, war eine Silhouette in der Dunkelheit. Jemand saß dort in der Ebene und hielt ihm den Rücken zugewandt. Dem Erscheinungsbild nach mußte es ein Franke sein, dachte Balduin. Er ritt vorwärts, und dann erkannte er trotz der Dunkelheit, um wen es sich handelte.
Wieder rief er »Halt« und hob die Hand, um seine Knappen zurückzuhalten. Dann ritt er allein die letzten paar Schritte zu dem Mann, der dort in der Ebene hockte.
Es war der Templer Rannulf, barhäuptig und schweigend. Selbst als König Balduin sein Pferd neben ihm zügelte, schenkte ihm der Ritter keine Beachtung. Dann entdeckte der König den anderen Templer, der neben Rannulf lag.
Dieser Mann war tot. Oder zumindest schien es so. Eingehüllt in eine Decke mit schwarzweißem Muster lag er zusammengekrümmt auf dem Boden. Balduin stieg vom Pferd. Noch immer sagte Rannulf kein Wort. Er saß mit gekreuzten Beinen da; in der Linken, die auf seinem Knie ruhte, hielt er die Hand des toten Ritters. Seine Augen waren weit geöffnet und starrten, ohne zu blinzeln, auf einen Punkt in der Ferne.
Balduin beugte sich vor und streckte den Arm nach dem toten Ritter aus, doch im selben Augenblick bewegte sich Rannulf. Seine freie Hand schoß vor, packte den König am Handgelenk und hielt ihn zurück. »Rührt ihn nicht an.«
Der König zog seine Rechte zurück. »Lebt er noch? Dann bringt ihn nach Ramlah. Dort können wir ihn behandeln.«
Rannulf schüttelte den Kopf. »Er ist tot.«
»Wir können ihn dort beerdigen, mit allen Ehren, die er verdient.«
»Ich will ihn in Jerusalem begraben, dort, wo er hingehört.«
Der König ließ sich nieder und versuchte, den Blick des Templers auf sich zu lenken. »Wir haben hier einen gewaltigen Sieg errungen. Die anderen Templer berichten, Ihr hättet beinahe Saladin selbst erschlagen. Ich brauche einen Mann wie Euch. Kommt mit nach Ramlah.«
»Ich gehe nach Jerusalem.«
»Ich bin Euer König.«
»Jesus ist mein König«, sagte der Templer, und da gab Balduin seine Überredungsversuche auf. Müde erhob er sich wieder, und als er sich seinem Pferd zuwandte, mußte er all seinen Willen und seine Kraft zusammennehmen, um in den Sattel zu steigen. Der Wind würde schärfer, heulte wie ein Grabgesang und schien eine Warnung vor den Schlachten, die noch kommen würden, mit sich zu tragen. Er wünschte, er könnte hierbleiben und sich diesen Templern anschließen, doch es waren nicht seine Kameraden, und er mußte dorthin gehen, wo er handeln konnte. Der König lenkte sein Pferd herum und führte seine Knappen in Richtung Ramlah.
Kapitel 3
Rannulf Fitzwilliam war in Cotentin in der Normandie als jüngster Sohn eines Ritters ohne Landbesitz geboren worden. Die Familie lebte auf einer abgelegenen Feste an der Küste, wo sein Vater als Burgvogt eingesetzt war. Seine Mutter war gestorben, als Rannulf noch ein kleines Kind gewesen war, und er konnte sich nicht mehr an sie erinnern. So wuchs er wie ein Wildfang auf, lernte zu kämpfen, bevor er laufen konnte, sich das mit Gewalt zu nehmen, was er begehrte, und niemandem zu trauen.
Er folgte seinen Brüdern in die angevinischen Kriege, und als sie starben, rächte er sie mit einem Eifer, der weit über die Gefühle hinausging, die er ihnen zu Lebzeiten entgegengebracht hatte. Denn kämpfen war alles, worauf er sich verstand. Sein Schwert verschaffte ihm einen Platz in König Henrys Heer, doch seine niedere Geburt verwehrte ihm den Aufstieg an des Königs Hof. Rannulf konnte weder lesen noch schreiben, noch rechnen und war kaum der lateinischen Sprache mächtig. Kirchen sah er nur höchst selten von innen. Seine freie Zeit verbrachte er mit Trinken und Spielen, oder er jagte den Frauen nach, und er kannte auch keine andere Medizin als eben diese: Wenn er nach den Ausschweifungen einer Nacht mit Kopfschmerzen erwachte, trank er, um sich zu kurieren, und wenn eine Frau so zornig auf ihn war, daß sie mit dem Messer auf ihn losging, zog er davon und suchte sich eine neue.
Er spürte, daß die Verderbtheit und Schlechtigkeit dieses Lebenswandels wie ein Fluch auf ihm lastete, und doch hielt er daran fest. Ihm gefiel die Macht, die er darin fand. Rannulf legte seinen Wünschen keine Zügel an, und er verweigerte sich nichts, selbst wenn ihn das, was er wollte, im Innern zutiefst abstieß.
Als er in der Garnison einer Festung an der bretonischen Grenze Dienst tat, verliebte er sich in eine Frau aus dem Ort und bedrängte sie, bis sie in ein Kloster flüchtete. Mit Gewalt versuchte er, sich zu dem Stift Zutritt zu verschaffen. Für diese Tat exkommunizierte ihn der Bischof. Der König entließ ihn daraufhin. Seine Kameraden fingen an, ihn zu meiden. Er spürte, wie sich die Türen zu Glaube, Licht und Hoffnung donnernd vor ihm schlossen. Rannulf sah sich selbst kopfüber in die Hölle hinabstürzen, doch er konnte das Ruder nicht herumreißen und sein Leben in eine neue Richtung steuern. Manchmal wünschte er sogar, alles möge so schnell wie möglich zu Ende sein.
Einige Zeit, nachdem die Glocke für ihn geläutet und das Buch für ihn geschlossen worden war, kam er an einer Kapelle in einem Wäldchen vorbei und verfiel – vielleicht weil es ihm verboten war – auf den Gedanken, dort zu beten. Er ging hinein und kniete vor dem aus Torf und ein paar Stöcken gefertigten Altar. Plötzlich tauchte ein junges Mädchen in der Kapelle auf, den Arm voller Blumen.
»Seid Ihr gekommen, um errettet zu werden?« fragte es. Es zeigte keinerlei Furcht vor ihm, obwohl er sich gerade überlegte, ihm Gewalt anzutun. »Ich zeige Euch, wie«, sagte es, »doch zuerst müßt Ihr gebunden werden.«
»Dann bindet mich«, meinte er mit einem Lachen, denn er glaubte an nichts und wollte nur, daß es in seine Reichweite kam.
Das Mädchen ging zu ihm, süß und sanft und arglos, und kam ihm so nahe, daß sein Atem Rannulfs Gesicht streifte. Es nahm seine schwieligen Hände und legte Handfläche gegen Handfläche. Dann wand es eine Kette, geflochten aus Gänseblümchen, um seine Handgelenke. Es tat das ganz ernsthaft, so als könne es auf diese Weise tatsächlich einen Mann wie ihn binden.
Er zitterte vor Begierde. Am liebsten hätte er das Mädchen gleich zu Boden geworfen und es mit Gewalt genommen, um es weinen zu sehen und zuzuschauen, wie das Blut seine weißen Schenkel befleckte. Doch die Blumen fesselten ihn wie Eisen, und das junge Mädchen gebot über ihn wie ein König. Es blickte ihm in die Augen und sagte: »Nun müßt Ihr Gott bitten, Euch zu retten.« Er kniete neben dem jungen Mädchen und wiederholte das Credo mit ihm, und zum ersten Mal achtete er auf die Worte. Und dann war er es, der weinte. Geblendet von Scham und Schuld, Angst und Schmerz weinte er viele Stunden. Als er wieder zu sich kam, war das Kind verschwunden.
Rannulf begriff, daß ihm noch einmal die Gnade zuteil geworden war, sein Leben zu ändern. So ritt er nach Rouen zum Ordenshaus der Templer und unterwarf sich Jesus Christus. Drei Monate später befand er sich auf dem Weg ins Heilige Land. Er hatte das Gelübde abgelegt, nie wieder eine Frau anzuschauen, und den Eid geschworen, nur noch gegen die Feinde Gottes das Schwert zu erheben.
Das war vor mehr als zehn Jahren gewesen. Und heute kam es ihm so vor, als hätte er immer hier, im Tempel in Jerusalem, gelebt.
Markus war erst seit eineinhalb Jahren hier, und nun würde er für immer hier ruhen.
Rannulf stand am Rand des Grabes und blickte auf den toten Mann hinab, der in einen sauberen weißen Waffenrock gekleidet und in seinen schwarzen Umhang gehüllt war. Nur drei andere Ritter hielten mit ihm Totenwache und sahen zu, wie der Priester in seiner grünen Robe den letzten Segen sprach und Weihwasser versprenkelte. Der Rest des Kapitels war schon vor Wochen nach Norden gezogen, um in der Umgebung der Stadt Homs nach dem Rechten zu sehen, und bisher waren erst wenige von ihnen zurückgekehrt.
Nachdem die formellen Begräbnisworte gesprochen waren, traten die Templer zu ihrem eigenen Ritus zusammen. Sie stellten sich im Kreis um das Grab auf, legten sich gegenseitig die Arme auf die Schultern, schwangen vor und zurück und riefen Gott an, sie ebenso zu erlösen, wie Er Markus erlöst habe. Und schließlich ließen sie eine Schaufel von Hand zu Hand gehen und häuften Erde auf Markus’ Körper. Als Rannulf die Schaufel weitergegeben hatte, kniete er am Grab nieder und versuchte zu beten. Er haßte diesen Teil seines neuen Lebens mehr als alles andere, dieses endlose Knien und die gemurmelte Wiederholung der immer gleichen Worte. Manchmal sah er sich überhaupt nicht dazu in der Lage, sondern hockte nur mit gesenktem Kopf am Boden, während schwärzeste Gedanken von Mord und Fleischeslust seinen Geist durchströmten. Um Markus’ willen zwang er sich dazu, mehrere Paternoster zu sprechen. Während er sich durch das Gebet mühte, wurde die Schaufel in die Erde gestoßen und weitergegeben, und die Erde fiel dumpf ins Grab. Immer wenn ein Ritter Markus diesen letzten Dienst erwiesen hatte, entfernte er sich. Bald waren alle gegangen. Bis auf einen.
Dieser eine war German von Montoya, der Präzeptor, der gerade aus Homs zurückgekehrt war. Als Offizier wartete er nicht lange, sondern räusperte sich und sagte: »Entschuldigt die Unterbrechung, Heiliger.«
»Ich bin fertig«, erklärte Rannulf und erhob sich. Die feuchte Erde, auf der er gekniet hatte, klebte an seiner Kleidung. Er mußte an Markus denken, der inmitten dieser Erde lag, und erschauerte.
German von Montoya bekreuzigte sich. »Möge Gott ihn erretten. Als er damals hierherkam, dachte ich, er würde den Orden verlassen oder einfach fortlaufen. Er schien ein wertloser Mensch zu sein.«
Rannulf erinnerte sich an den Mut, den Markus in der Schlacht gezeigt hatte. Mit Sicherheit würde Gott einen Ritter aufnehmen, der sein Leben gegeben hatte, um dem Wahren Kreuz zu folgen. Er stieß die Schaufel in die lockere Erde und ging hügelaufwärts. »Wir alle sind ziemlich wertlos.«
Der Friedhof der Templer lag auf einem steilen, mit Dornbüschen bewachsenen Hang über dem Tal von Kidron, außerhalb des versperrten Goldenen Tores. Jenseits der steil abfallenden Schlucht befand sich inmitten eines finsteren Dickichts aus Buschwerk und wildem Wein der Garten Gethsemane. Das Gewicht dieses Ortes lastete wie Blei auf Rannulf. Über diesen Boden, auf dem er schritt, mochte auch Gott selbst gewandelt sein, oder Abraham oder Jesus. Selbst die Sonne, die wie ein Geist über den wolkenbedeckten Himmel schwebte, wirkte nur wie der Schatten eines helleren Lichtes. Die östliche Mauer der Stadt erhob sich über ihnen. Ihre Reihen von Steinen wirkten wie übereinandergestapelte Särge.
»Gott hat uns geschaffen und will uns erretten, also können wir nicht völlig ohne Wert sein«, bemerkte German sanft. »Ich würde gern etwas über Eure Reise nach Kairo erfahren.«
Germans schwarzer Bart war von Grau durchzogen, eine Seltenheit unter den Templern, bei denen selbst Rannulf mit seinen sechsunddreißig Jahren schon als betagt galt. Sein hohes Alter verdankte German seiner Aufgabe als Meister der Novizen, einer Pflicht, die ihn von den Schlachtfeldern fernhielt. Als sie am Fuß der Mauer entlanggingen, um das nächste geöffnete Tor zu erreichen, erzählte ihm Rannulf von der langen Reise nach Ägypten und wie er und Markus sich mit Lügen und Bestechungen bis nach Kairo vorgewagt hatten.
»Und Eurer Ansicht nach bestimmt dort also Saladin«, sagte German. Die beiden Männer folgten dem schmalen Fußpfad bis zum Tor an der Ecke der Mauer, schritten hindurch und gelangten in das Viertel des Tempelberges.
»Niemand rührt sich, wenn er es nicht befiehlt«, erklärte Rannulf. »Die Ägypter haben nicht mehr das Herz, um in einen Krieg zu ziehen. Es ist ein Jammer. Sie wollen einem nur noch irgendwelche Sachen verkaufen.«