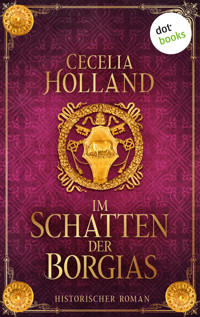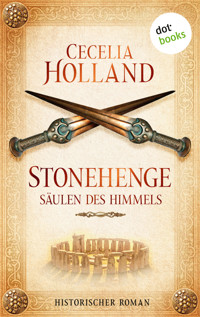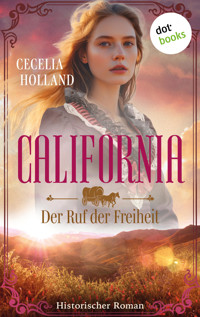Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ihr Vater besteigt den Thron, der rechtmäßig ihr gehört – nun greift sie zu den Waffen ... »Eine großartige Mischung aus Action, Spannung, Romantik und historischer Geschichte.« Booklist Nordspanien, 8. Jahrhundert: Von Geburt an war es der jungen Ragny bestimmt, die nächste Königin der Westgoten zu werden – doch als ihre Mutter stirbt, reißt ihr machthungriger Vater die Krone an sich. Um ihr Leben zu retten, muss Ragny aus ihrer Heimat fliehen. Als Ritter getarnt reist sie nach Paris, wo Karl der Kahle verzweifelt versucht, die Stadt gegen die brandschatzenden Wikinger zu verteidigen. Nur dank Ragnys Besonnenheit kann der Ansturm der Nordmänner abgewehrt werden – doch als der König ihr zum Dank die Hand seiner Tochter schenkt, wird ihre ritterliche Tarnung enthüllt. Schnell schlägt die Dankbarkeit der Pariser in Hass um und ihr droht der Tod am Scheiterhaufen … Werden die Flammen Ragnys Schicksal besiegeln – oder kann sie den Thron zurückerobern, für den sie immer bestimmt war? Ein packender historischer Roman für alle Fans von Rebecca Gablé und des Weltbestsellers »Die Päpstin«.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 477
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Nordspanien, 8. Jahrhundert: Von Geburt an war es der jungen Ragny bestimmt, die nächste Königin der Westgoten zu werden – doch als ihre Mutter stirbt, reißt ihr machthungriger Vater die Krone an sich. Um ihr Leben zu retten, muss Ragny aus ihrer Heimat fliehen. Als Ritter getarnt reist sie nach Paris, wo Karl der Kahle verzweifelt versucht, die Stadt gegen die brandschatzenden Wikinger zu verteidigen. Nur dank Ragnys Besonnenheit kann der Ansturm der Nordmänner abgewehrt werden – doch als der König ihr zum Dank die Hand seiner Tochter schenkt, wird ihre ritterliche Tarnung enthüllt. Schnell schlägt die Dankbarkeit der Pariser in Hass um und ihr droht der Tod am Scheiterhaufen … Werden die Flammen Ragnys Schicksal besiegeln – oder kann sie den Thron zurückerobern, für den sie immer bestimmt war?
Über die Autorin:
Cecelia Holland wurde in Nevada geboren und begann schon mit 12 Jahren, ihre ersten eigenen Geschichten zu verfassen. Später studierte sie Kreatives Schreiben am Connecticut College unter dem preisgekrönten Lyriker William Meredith. Heute ist Cecelia Holland Autorin zahlreicher Romane, in denen sie sich mit der Geschichte verschiedenster Epochen und Länder auseinandersetzt.
Bei dotbooks veröffentlichte die Autorin ihre historischen Romane »Im Tal der Könige«, »Die Königin von Jerusalem«, sowie ihre Norsemen-Saga mit den Einzelbänden »Der Thron der Wikinger« und »Der Erbe der Wikinger«. Weitere Bücher sind in Vorbereitung.
Die Website der Autorin: thefiredrake.com/
***
eBook-Neuausgabe Mai 2024
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1999 unter dem Originaltitel »The Angel and the Sword« bei Forge/Tom Doherty Assoc., LLC, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 2001 bei Ullstein
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1999 by Cecelia Holland
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2001 by Econ Ullstein List Verlag GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von © shutterstock/Boiko Olha, Andrey_Kuzmin, 44ee32e
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (lj)
ISBN 978-3-98952-220-6
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Ritterin« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Cecelia Holland
Die Ritterin
Historischer Roman
Aus dem Amerikanischen von Anke Grube
dotbooks.
Kapitel 1
Königin Ingunn hatte einen Fehler begangen, für den sie zeit ihres Lebens bezahlt hatte, aber nun, da ihr Leben vorbei war, sah sie eine Möglichkeit zur Wiedergutmachung.
»Meine Tochter!« Sie sammelte ihre schwindenden Kräfte und rief in den Raum hinaus: »Wo ist Ragny? Wo ist meine Tochter?«
Das wuchtige Holzbett umschloss sie wie eine Kiste. Ein hölzerner Rahmen für ihren Tod. Im Raum davor rührte sich etwas. Die Männer drehten sich um, als sie ihre Stimme hörten. Markold, ihr Gemahl, trat einige Schritte vor, mit schweren Stiefeltritten auf dem binsenbestreuten Fußboden.
»Sie ist schlecht und lieblos, meine Königin. Sie ist einfach fortgegangen.« Seine schwarzen Augen leuchteten. Königin Ingunn sah, mit welch aufmerksamem Eifer sein Blick sie erforschte, ihre Schwäche abschätzte, ihre Seufzer, ihre Blässe und ihr Zittern, um festzustellen, wie nahe sie dem Tode bereits war.
Sie wusste, dass er log. Er besaß die Kraft der Wahrheit nicht. Sicher hatte er das Mädchen fortgeschickt, um sie und ihre Mutter in diesem alles entscheidenden Moment voneinander fernzuhalten. Obwohl Markold mit gierigen Augen ihren Todeskampf verfolgte, blieb er zurück, nicht gewillt, ihr zu nahe zu kommen. Selbst Markold, dieser grobe Klotz menschlichen Lehms, wusste um die Mächte, die jetzt um sie waren, da die Tore des Himmels sich auftaten und ein Kraftstrudel sie dorthin zog.
Er hatte Angst, der Narr. Sie schloss die Augen und sammelte den letzten Rest ihrer Kraft. Markold war ihre Sünde. Als sie jung und wild gewesen war, hatte sie ihn erwählt, seines Körpers, seines Muts und seiner Kraft wegen. Sie hatte ihn zum König gemacht, ohne sich dabei um seine Seele zu scheren, und er hatte sie verraten. Wertlos wie Schlacke war Markold und, schlimmer noch, böse und herzlos.
König war er nur durch sie, seine Gemahlin, das letzte Gefäß, in dem Roderichs heiliges Blut floss, das heiligste Blut der Christenheit, das jetzt abgedrängt war in diese letzte kleine Bergfestung, diese letzte Ecke des einstigen Königreichs. Roderichs Reich würde mit ihr sterben. Markold konnte nicht König werden, und das wusste er. Und trotzdem wollte er irgendwie Vorteil aus ihrem Tod schlagen. Sie würde seine gemeinen, ehrgeizigen Pläne vereiteln. Am Ende, ganz am Ende, würde sie wieder in Ordnung bringen, was sie vor langer Zeit, als achtloses, lüsternes und eigenwilliges Mädchen, angerichtet hatte.
Im Sterben machte sie den Weg für ihre Tochter frei. Ragny würde einen besseren König für das Reich finden, damit die Sünde der alten Königin wieder gutgemacht und Roderichs Haus auf den rechten Weg zurückgebracht werde, um das Königreich von den Ungläubigen zurückzuerobern, zur größeren Ehre Christi. Ingunn hatte versagt und ihren Teil in diesem großen Schicksalsplan nicht erfüllt, aber jetzt würde sie alles wieder bereinigen, durch Ragny.
Sie schloss die Augen. Noch würde sie nicht sterben. Markold würde sich noch gedulden müssen. Er hatte sich geweigert, nach einem Priester zu schicken. Erst hatte er gesagt, so krank sei sie nun auch wieder nicht, und dann ließ sich natürlich kein Priester finden, der gewillt war, in die Nähe von Markolds Turm zu kommen, nicht einmal für die rechtmäßige Königin.
Es kümmerte sie nicht, dass kein Priester bei ihr war, aber sie musste Ragny unbedingt noch einmal sehen. Das Tor zwischen den Welten stand offen vor ihr, sie sah dem Tod ins Angesicht, war aber noch am Leben. Während sie sich mit aller Kraft festklammerte, wurde das gewaltige Himmelslicht stetig stärker, fast hörbar in seiner Beharrlichkeit, und sandte ein Prickeln über ihre müden Gliedmaßen. Aus dieser anschwellenden Kraft, durch dieses Tor, wollte sie einen Beschützer für ihre Tochter rufen, eine Macht, die schon alt gewesen war, ehe Christus geboren wurde.
Nur würde sie nicht mehr lange durchhalten können. »Ragny!«, rief sie erneut. »Wo ist meine Tochter?«
Markold trat wieder näher, blieb in einiger Entfernung stehen und starrte sie mit der kalten Lust seiner grenzenlosen Begierde nach dem Tod an. Er rang die Hände. »Wie ich schon sagte, meine Königin, sie ist irgendwohin verschwunden. Ich kann sie nicht finden.«
Sie knirschte mit den Zähnen. Der Tod zerrte sie davon. Ragny würde bald kommen müssen. Verzweifelt stieß sie eine Lüge hervor. »Hol sie her, Markold, oder ich nehme dich mit. Ich werde nicht sterben, bevor du stirbst, Markold –«
Hastig wich er vom Bett zurück. Derb, roh und erdgebunden, ein Klumpen menschlichen Lehms, fürchtete er dumme, nicht reale Dinge. Er sagte: »Ich werde Seffrid schicken, meine Königin.«
Sie ließ sich wieder auf die Kissen zurücksinken. Mit ihrer Drohung hatte sie zu viel von ihrer Kraft verbraucht. Sie konnte spüren, wie der Tod sie einhüllte wie ein Mantel, wie er sie an sich zog, Zoll um Zoll. Ragny musste kommen und sie musste ihre Kräfte schonen. Geduldig schloss sie die Augen.
Markold trat vom Bett weg. Seffrid, der neben der Tür Wache stand, stellte sich gerader hin, mit herabhängenden Armen, als er seinen Namen hörte. Er konnte erkennen, dass die Königin noch nicht tot war, wenn sie auch so aussah mit ihren glasigen, eingesunkenen Augen und der grauen Haut. Aber tot war sie noch nicht. Kalt fragte er sich, was Markold ihr wohl gegeben hatte. Und warum der König sie nicht einfach mit den Betttüchern erdrosselt hatte.
Markold war der König, und Seffrid, sein Hauptmann, tat den Willen des Königs. Nichts anderes spielte eine Rolle. Markold nickte ihm zu.
»Geh, such Prinzessin Ragny und bring sie her.« Er sagte das mit lauter, schallender Stimme, damit sogar die Leiche auf dem Bett ihn hören konnte. Das breite, pockennarbige Gesicht des Königs glänzte vor Schweiß. Sie warteten hier schon seit Stunden und für Markold war es harte Arbeit.
Er begleitete Seffrid zur Tür der Kammer, und dort murmelte er: »Du brauchst nicht besonders gründlich zu suchen, Seffrid.« Er klopfte ihm auf die Schulter und zwinkerte ihm zu.
Seffrid trat auf den Treppenabsatz hinaus. Es gefiel ihm nicht, die Prinzessin von ihrer sterbenden Mutter fernzuhalten, aber er hatte schließlich nichts zu sagen. Schon seit langem wusste er, dass er dazu neigte, sich wie ein lendenlahmer Weichling von Gefühlen überwältigen zu lassen, und so überließ er alles Derartige Markold, der stark war und auch Seffrid stark machte. Es spielte keine Rolle, was er von der Sache hielt. Er musste tun, was ihm befohlen wurde. Er stieg die Treppen des Turms hinab, durchquerte die hölzerne Dürnitz, Markolds Burgsaal, und im Burghof schickte er einen der herumlungernden Knechte nach seinem Pferd.
In der Nacht war starker Regen gefallen, aber jetzt ragte der klobige graue Turm in einen harten blauen Himmel und die Sonne funkelte grell in den Pfützen. Irgendwo gackerte ein Huhn. Der Geruch nach angebranntem Fett hing in der Luft. Bei der Burgmauer rollten zwei Sklaven einen Eisentopf herum und versuchten, ihn zu säubern. Der Knecht führte das Pferd durch den aufspritzenden Schlamm.
Am Burgtor saß der Wächter und aß etwas, einen Krug auf dem Schoß. Als Seffrid aufstieg, rief der Wächter: »Lebt sie noch?«
Seffrid ritt zum Tor. »Sie lebt.« Er wusste nicht wieso; sie sollte längst tot sein, das arme Wesen.
Er unterdrückte diese weichliche Regung. Markold wusste schon, was er tat.
Der Wächter bekreuzigte sich verstohlen und warf über die Schulter hinweg einen Blick auf den Turm. »Gott schütze unsere Königin Ingunn. Verrat ihm nicht, dass ich das gesagt habe.« Er schob das Tor auf und entließ Seffrid in die Welt.
Markolds Turm stand auf dem Sattel des Passes. Gen Norden führte die Straße in ein Bergtal hinunter und gen Süden schlängelte sie sich auf die Ebenen Spaniens zu. Seffrid zügelte sein Pferd und fragte sich, wo er am besten nicht nach Prinzessin Ragny suchen sollte. Die Sonne brannte auf ihn nieder, und es wehte ein leichter, warmer Wind, aber im Westen verdunkelte sich der Horizont. Seffrid war nicht hier geboren – er war Franke, und eines Tages war er, von Norden kommend, auf dieser Straße zu Markolds Turm gelangt -, aber er hatte den Geruch eines kommenden Sturms erkennen gelernt und jetzt bekam er einen Hauch davon in die Nase.
Auch Ragny kannte er, ein seltsames und wildes Mädchen, und er nahm an, dass sie nach Norden geritten war, um zu jagen. Also wandte er sich nach Süden und ritt die Straße hinunter zu der kleinen Ansammlung von Steinhütten am Fuß des Passes.
Früher war hier ein Dorf gewesen. Als er herkam, waren die meisten dieser Hütten noch bewohnt gewesen, aber Markold hatte alle Bewohner vertrieben. Er hatte sich noch nicht einmal die Mühe gemacht, sie zu töten, sondern ihnen einfach alles genommen, was sie besaßen. Und jetzt waren nur noch ein, zwei Familien übrig, Schafhirten, deren Herden draußen in den Bergen grasten. Sie gaben Markold von ihren Schafen, wann immer er welche haben wollte. Außer ihren Schafen besaßen sie nichts, und ihre Hütten waren aus runden weißen Steinen erbaut, die sie vom Berghang geholt hatten. Der Ort war leer wie ein Friedhof, aber als er hineinritt, kam plötzlich Ragny den Hang herunter auf ihn zu galoppiert. Ihr roter Umhang flatterte hinter ihr, und ihr langes, bleiches Haar flutete im Wind. Sie ritt auf ihn zu, zog die Zügel ihres grauen Pferdes an und hielt.
»Seffrid«, sagte sie, »wie geht es meiner Mutter?« Sie hatte gewartet, begriff Seffrid. Irgendwie hatte sie gewusst, dass ihre Mutter versuchen würde sie zu erreichen, und sie hatte das Burgtor im Auge behalten und gewartet.
Er verbeugte sich so tief vor ihr, wie es dem heiligsten Blut Spaniens anstand. »Prinzessin, sie schickt nach Euch.«
»Dann werde ich gehen«, sagte sie. »Begleite mich.« Sie trieb ihr Ross an und sprengte die Straße hinauf. Seffrid wendete sein Pferd und folgte ihr.
Was für eine Schande, dass sie als Frau geboren worden war. In einem Sohn wie ihr hätte Markold seinen Meister gefunden. Er wusste, dass sie auf dem Steinfußboden ihrer Kammer schlief und ihren Kammerfrauen das weiche Seidenbett überließ. Sie aß nur Brot und Fleisch, während Markold und seine Freunde sich mit Gebäck und Süßigkeiten vollstopften, die sie heimlich von den Mohren bezogen. Aber fromm wie ein Lamm und sanftmütig war sie nicht. Sie ritt mit den Männern auf die Jagd, selbst mitten im Winter, wenn Schnee lag, und spürte die Wölfe und Bären auf, die die Herden dezimierten. Seffrid hatte sie mit Pfeil und Bogen schießen sehen und war froh gewesen, dass der Bogen nicht auf ihn gerichtet war. Er trieb sein Pferd an und versuchte, sie einzuholen.
Am Burgtor gelang es ihm endlich, als der Wächter sich abmühte, den Balken zu heben. Der Wind nahm stetig zu und dunkle Wolkenwände wälzten sich über den westlichen Himmel heran. Die Prinzessin hob ihr Gesicht dem sausenden Wind entgegen; ihre Wangen glühten.
»Ich fürchte den Sturm, der kommen wird«, sagte sie. »Die Sonne wird den Tod meiner Mutter, der Königin, nicht bescheinen.«
Seffrid sagte: »In dieser Jahreszeit sind Stürme häufig.« Beklommen dachte er, dass kein Grund bestand, in allem und jedem ein Zeichen zu sehen. Oder Gottes Werk. Aber sie war von heiligem Blut und solche Leute hatten die Gabe der Sicht. Unbehaglich schüttelte er den Gedanken ab. Das Burgtor öffnete sich. Sie überquerten den schlammigen Burghof und führten ihre Pferde am Zügel hinter sich her.
Sie sagte: »Wo ist mein Vater, der König?«
Seffrid übergab sein Reittier einem Knecht. »Er sitzt am Bett der Königin.«
Prinzessin Ragny schlug mit der Hand das Kreuzeszeichen über ihrer Brust. »Gott schütze meine Mutter«, sagte sie und hüllte sich in ihren langen Umhang.
Seffrid erwiderte nichts darauf. Die Banner auf den Wällen über ihnen waren die Banner Markolds des Grimmigen. Die Männer, die im Burghof herumlungerten und die Wärme der letzten Sonnenstrahlen genossen, waren Markolds Mannen. Seffrid selbst war Markolds Gefolgsmann. Sie war schön und wahrhaftig, diese Maid, aber sie war nur eine Frau.
Dennoch wartete sie nicht auf ihn. Sie hatte die Tür erreicht, die in den Turm führte, bevor er sie einholen konnte, und der Wächter öffnete ihr. Seffrid folgte ihr in die Dürnitz und die enge Steintreppe hinauf in den Turm bis zu der Kemenate, in der ihre Mutter lag.
Die Luft war dick, erfüllt vom Gestank des Todes. Sofort nach dem Eintreten drückte Seffrid sich an die Wand neben der Tür. Es war ihm zuwider, diese Luft zu atmen. Wieder fragte er sich, was Markold seiner Frau wohl angetan hatte. Die beiden Kammerfrauen kauerten am Fenster und beteten. Auf beiden Seiten der Tür stand eine Wache. Die Prinzessin schritt quer durch den Raum, über die zertrampelten Binsen hinweg, und trat an das Bett, dessen Vorhänge mit dem Wappen König Roderichs bestickt waren und in dem Königin Ingunn lag wie ein verwesender Leichnam.
»Mutter, ich bin hier.«
Seffrid, der an der Wand stand, hörte nur ein Murmeln, als die Königin antwortete. Die Haare standen ihm zu Berge. Die Königin sprach wie aus dem Grab heraus. Ihm fiel das Gemunkel ein, dass sie Feenblut hatte und mit Dämonen sprach. Wie konnte sie noch am Leben sein? Seffrid blickte auf, zum Fuß des Bettes hin, wo Markold stand.
Der König runzelte die Stirn, sein roter Mund war verzerrt im dicken schwarzen Filz seines Bartes. Die ungeschlachten Hände hatte er zu Fäusten geballt. Die kräftigen, stämmigen Schultern waren vorgeschoben, als wolle er etwas beiseite wuchten, das schwer war wie ein Berg. Seffrid sah, wie Markolds Blick unstet zwischen seiner Frau und seiner Tochter hin- und herflackerte. Seine Augen waren starr und brannten wie Feuer.
Dann drehte das Mädchen sich um und ihre Stimme erschallte laut und klar. »Seffrid, komm, du musst Zeuge sein.«
»Ich?«, sagte Seffrid erstaunt.
Markold stampfte vorwärts. »Was ist los?« Seine Stimme war rau. »Wofür brauchst du einen Zeugen? Die Königin redet im Fieberwahn. Sie hat nichts zu sagen, was bezeugt werden müsste!«
»Doch«, sagte Ragny. »Seffrid, komm her.«
Seffrid blickte Markold an, der mit sich kämpfte. Schließlich zuckte dieser seine bärenstarken Schultern. »Tu es«, sagte er. Ein Augenlid zuckte: ein geheimes Einverständnis, eine Warnung. Der König wich ein wenig zurück, die Augen brennend vor Zorn.
Seffrid trat ans Bett. Noch vor wenigen Tagen war die Königin schön gewesen. Nun lag sie zerstört auf der breiten Seidenplattform. Ihr Gesicht war hohl wie eine Nuss-Schale, ihre Augen wirkten riesig. Sie hob eine Hand, die dürr war wie der Zweig eines toten Baums.
»Hört mich. Hört mich an.« Sie rang nach Atem. Seffrid schüttelte leicht den Kopf. Sie würde sterben, ohne es ausgesprochen zu haben. Aber die Königin sammelte ihre Kräfte. »Vor Gott ...«, brachte sie mit hauchendem Flüstern hervor. »Er darf nicht König werden. Nur meine Tochter. Sie allein stammt aus dem Geschlecht Roderichs.«
Dieser Name ließ sie husten und mit dem Husten kam ein kleines Blutrinnsal, das ihr das Kinn herabrann. Ragny ergriff ihre Hand.
»Mutter, ich bin bereit.«
»Du allein bist die Königin«, sagte Ingunn. »Aber es wird einen geben, der dir beisteht. Ich habe nach ihm gesandt.« Mit einem Röcheln erstarb ihre Stimme. Ragny packte die Hand ihrer Mutter fester und neigte den Kopf; ihre Lippen bewegten sich. Seffrid dachte: Sie ist tot, und schreckte hoch.
Da schlug die Königin die Augen auf. Mit rasselnder Stimme brachte sie röchelnd hervor: »Geh zur Höhle der Lieder.«
»Mutter –«
»Tu, was ich dir sage. Geh – erinnere dich –«
Über die Schulter der Prinzessin hinweg sah Seffrid, wie in den Augen der älteren Frau plötzlich Verzweiflung aufglomm, als habe sie nicht genug sagen können. Sie hob die freie Hand und streckte sie nach ihrer Tochter aus.»Du –« Ein paar Tropfen Blut rannen ihr aus dem Mund. Ihre Augen glühten, als erlebe sie eine schreckliche Offenbarung. Sie brachte kein Wort mehr hervor, sondern starb vor ihren Augen. Ihr Blick trübte sich und ihre Hände sanken auf die Brust herab.
Seffrid hörte das Mädchen vor sich erstickt aufschluchzen. Mit gesenktem Kopf zog er sich zurück. Er wusste nicht, was er da eigentlich bezeugt hatte. Sie lebten in einer Traumwelt, diese Leute, mit ihrem Traum von ihrem verlorenen Königreich, von hexenhaften Kräften, Zeichen, Omen und Gebeten. Aber Ingunn war zehn Jahre lang seine Königin gewesen, und zu seinem Erstaunen senkte sich eine Last auf seine Brust, seine Augen brannten, und er wollte fortgehen und allein trauern. Stattdessen war er auf einmal zwischen sie geraten. Vor ihm stand das Mädchen, hochgewachsen, schlank und hart, und hinter ihm der König.
Ragny sagte: »Was hast du mit ihr gemacht, Markold?« Sie blickte über Seffrids Schulter hinweg. Seffrid rührte sich nicht. Er spürte den König hinter sich, als würde er Hitze abstrahlen.
»Gar nichts«, sagte Markold.
»Du bist nichts«, sagte sie. »Du bist nicht länger der König, Markold.«
Markold knurrte sie an. »Ich bin so lange der König, bis mich jemand stürzt, Mädchen. Glaubst du etwa, du kannst das vollbringen?«
»Ich muss dich nicht stürzen.« Ihre Stimme war hart und scharf wie die Klinge eines Messers. Verblüfft erkannte Seffrid, dass sie Markold nicht fürchtete. »Gott wird das tun. Du warst König durch meine Mutter. Nun ist meine Mutter tot, und du bist nicht länger König. Ich allein bin die Erbin Roderichs. Das Königreich ist mein, mein zu regieren, mein zu vergeben.«
Markold drängte sich an Seffrid vorbei, stieß seinen Hauptmann beiseite und stellte sich vor seine Tochter. Er stand so dicht vor ihr, dass sie fast aneinanderstießen, und dennoch wich und wankte sie nicht. Dankbar zog Seffrid sich einige Schritte zurück.
»Du willst Königin sein?« Markold packte eine Strähne ihres Haars. »Ich werde dich zur Königin machen, Mädchen.«
»Lass mich los«, stieß sie zwischen den Zähnen hervor.
Aber er wickelte ihr langes Haar um seine Hand und zerrte ihren Kopf zurück. »Ich werde dich heiraten, Geblüt Roderichs. Dann bin ich wieder der König, nicht wahr.«
Seffrid zuckte zusammen. Das hatte er nicht erwartet. Er sah, wie die Augen des Mädchens sich weiteten, dunkel wurden vor Schmerz und plötzlicher Angst. Sie sagte: »Das kannst du nicht tun. Das wäre eine schwere Sünde.«
»Ich werde dich heiraten«, wiederholte Markold, »und einen Sohn zeugen. Mehr brauche ich nicht von dir. Diese Hexe, deine Mutter, wollte mir ja keinen geben.« Er beugte sich über sie, mit geöffneten Lippen, um sie zu küssen.
Das Mädchen wand sich in seinem Griff und in ihrer Hand blitzte etwas auf. Markold stieß ein Geheul aus. Das Mädchen sprang zurück, ihren Dolch in der Hand, und der König taumelte, die Hand an die Wange gepresst. Dunkles Blut quoll zwischen seinen Fingern hervor.
Seffrid sprang vor, packte die Prinzessin am Handgelenk, wirbelte sie herum und schlang von hinten den freien Arm um sie. Markold fuhr zu ihr herum. Sein Gesicht war geschwollen und finster, in seinen Augen glomm es.
»Lass mich los! Ich befehle es!« Mit einem heftigen Ruck versuchte Ragny, Seffrids Griff um ihr Handgelenk zu lösen. Ihre Stärke erstaunte ihn und er brauchte all seine Kraft, um sie festzuhalten. Markold wirbelte herum und schlug sie mit einem einzigen Faustschlag zu Boden.
Seffrid rief: »Herr, Herr –« Er bückte sich, um ihr aufzuhelfen. Zu seiner Verblüffung war sie nicht gebrochen, nicht einmal eingeschüchtert, sondern stand wieder auf, den Dolch in der Hand, die Augen wie Achat. Er rief: »He! Zu mir!«, und die Wachen, aus ihrer Erstarrung gerissen, sprangen herbei, um ihm zu helfen, und dabei traten sie zwischen die Prinzessin und Markold. Seffrid entriss ihr den Dolch.
»Steckt sie in die oberste Turmkammer!«, rief Markold. »Sperrt sie ein! Morgen wird die Hochzeit sein. Und dann –« Ein Lächeln zog sich über sein aufgeschlitztes Gesicht. »Und dann werden wir sehen, ob du deinen Vater zufrieden stellen kannst, Tochter!«
Seffrid hielt sie immer noch gepackt und urplötzlich wurde sie ganz still und kalt und wehrte sich nicht mehr. »Gott ist mein wahrer Vater.« Ihre Stimme hallte durch den Raum, unversöhnlich, eisenhart. Markold grinste sie höhnisch an. Er stolzierte hinaus und knallte die Tür hinter sich zu.
Seffrid trat zurück und ließ die Prinzessin los. Die beiden Wachen tappten murmelnd um sie herum und mit einem knappen Befehl schickte er sie weg. Das Mädchen warf ihm einen einzigen, unergründlichen Blick zu und trat an das Bett, auf dem ihre Mutter lag.
»Kommt«, sagte Seffrid. »Ihr habt den König gehört.«
»Er ist nicht der König.« Das Mädchen bekreuzigte sich und schlug das Kreuzzeichen über ihrer Mutter. Sie strich der Königin behutsam über das Gesicht. »Das darf er nicht tun, Seffrid. Gott hat geschworen, dass wir unser Königreich zurückerlangen werden, wir, das Haus Roderichs. Aber nur das Haus Roderichs. Wenn wir versagen, wird Spanien auf ewig verloren bleiben und den Ungläubigen gehören.«
Ihre Stimme war fest wie Stein. Und doch entdeckte Seffrid, als er sie scharf ansah, Tränen auf ihren Wangen.
Er sagte: »Gott ist im Himmel, Mädchen. Hier unten auf der Erde ist Markold der König. Kommt jetzt.«
»Er ist nicht der König!« Sie fuhr zu ihm herum, die Wangen tränenverschmiert. »Meine Mutter hat einen Fehler gemacht. Sie wusste es, zeit ihres Lebens ... sie hat das Königreich dem falschen Mann gegeben. Aber jetzt ist das Reich mein.« Sie rang die Hände und weinte. »Du hast doch gehört, was sie gesagt hat.«
Seffrid unterdrückte ein plötzliches Aufwallen von Zorn. Was dachte sie sich? Was sollte er denn tun? »Ich bin Markolds Gefolgsmann. Ich habe nichts gehört.«
»Du hast sie gehört!«
»Ich habe nichts gehört«, wiederholte er, voller Wut auf sie.
Sie wandte das Gesicht ab. Ihre Stimme wurde leiser. »Ich habe es gehört. Ich weiß es. Gott weiß es. Aber wenn er das macht ... das, was er sagt, was er mir antun will ...« Plötzlich sank sie zu Boden wie ein Kind und schluchzte.
Seffrid brummte, sein Ärger war augenblicklich verflogen. Die beiden Kammerfrauen sahen vom Fenster aus zu. Er wies auf den Leichnam auf dem Bett. »Kümmert Euch um Eure Herrin.« Er bückte sich, hob die Prinzessin vom Boden auf, schlang die Arme unter ihre langen Beine und um ihre Schultern, trug sie hinaus und die enge Wendeltreppe hinauf in die kleine Kammer in der Spitze des Turms. Dort setzte er sie ab, in der Mitte des Raums.
Es gab ein schmales Fenster, so schmal, dachte er, dass niemand hindurchpasste, nicht einmal sie. Und unter dem Fenster ging es fast dreißig Fuß in die Tiefe. Das Mädchen tastete sich blind zu der kleinen Bettstelle hin, setzte sich, schlug die Hände vors Gesicht und weinte.
»Markold ist der König«, sagte er zu ihr. »Ihr mögt von königlichem Geblüt sein, aber er ist ein Mann und stark, und er wird sich nehmen, was er haben will. Es gibt kein Entrinnen. Ich würde Euch raten, es zu akzeptieren. Dann seid Ihr zumindest Königin, wie Eure Mutter es war. Es ist eine üble Sache, aber die Welt ist nun mal übel, Mädchen.« Er fühlte sich ein wenig hohl, wie eine Nuss, während er diese Worte plapperte. »Es tut mir leid wegen Eurer Mutter«, sagte er. Er drehte sich um, ging hinaus, schloss die Tür und sperrte ab.
Ragny weinte. Sie spürte eine große Wunde in sich, als wäre etwas aus ihrem Leib, aus ihrem Herzen herausgerissen worden. Sie legte sich auf die kleine Bettstatt und rief nach ihrer Mutter, wieder und wieder, ohne Hoffnung auf Antwort. Ihre Mutter war jetzt endlich sicher vor Markolds Faustschlägen, vor der Last von Markolds Begierden. Nach seinem Schlag hämmerte der Schmerz in ihrem Kopf.
Morgen würde er erneut auf sie losgehen. Sie wusste, was er vorhatte, denn er hatte es schon einmal versucht. Ihre Mutter war dazwischengegangen, rasend vor Zorn, und er war zurückgewichen vor der geheimen Drohung, die in ihrer Stimme mitschwang. Ragny legte die Hand auf die Beule an ihrem Kopf. Diesmal würde ihre Mutter nicht kommen; sie würde allein sein.
Eher sterbe ich, dachte sie. Und wusste, dass es wahr war: Roderichs Blut, das in ihr floss, würde eine solche Besudelung nicht dulden.
Jemand würde ihr beistehen. Das hatte ihre Mutter gesagt. Ragny hatte sie nicht ganz verstanden, und sie konnte sich nicht an den genauen Wortlaut erinnern, aber es war ein Versprechen gewesen. Vielleicht das leere Versprechen einer sterbenden, verzweifelten Frau. Geh zur Höhle der Lieder. Die Höhle war ein gutes Stück entfernt, eine halbe Tagesreise, und sie war hier eingesperrt.
In ihrem Körper eingesperrt, in dem Frauenkörper, der Markold Macht über sie gab. Das konnte sie ändern. Sie spürte den Geschmack von Metall im Mund. Sie würde nicht zulassen, dass Markold sie anrührte.
Nein, sie würde nicht einfach hier sitzen bleiben und warten. Gottes Wille war nicht immer auf den ersten Blick erkennbar. Sie kletterte aus dem Bett, stellte sich in die Mitte des Raums, breitete die Arme aus und rief Gott, Jesus Christus und den Heiligen Geist an.
Ihre Arme zitterten, so anstrengend war es, sie ganz gestreckt zu halten. Sie schloss die Augen. Geh zur Höhle der Lieder. Was hatte ihre Mutter gesagt? Einer wird dir beistehen. Sie ging zum Fenster, das so schmal war, dass sie gerade mal den Arm hindurchstecken konnte. Sie streckte den Arm aus dem Fenster. Der kalte Wind peitschte gegen ihre Hand und Regentropfen schlugen auf ihre Finger wie kleine Steine. Geh zur Höhle der Lieder. Sie machte sich daran, einen Weg zu finden, um dorthin zu kommen.
Markolds Gesicht war vom Ohr bis zum Kinn aufgeschlitzt; es hätte nicht viel gefehlt, und sie hätte ihn umgebracht. Der weiße Verband sah aus wie eine Maske. Er saß zusammengesunken auf seinem erhöhten Sitz, umflutet vom orangefarbenen Licht des Herdfeuers. Der Sturm wurde immer stärker und der Wind rüttelte die ganze Dürnitz. Zwei der Haussklaven brachten eine weitere Ladung Feuerholz herein. Markolds Gefolgsmänner kamen in die Halle, um sich an den Tisch zu setzen und zu essen.
Seffrid trat vor den erhöhten Sitz, verbeugte sich vor seinem König und nahm seinen Platz am Tisch ein. Zwei Sklaven drehten den Bratspieß über dem Feuer, ein anderer reichte einen Korb mit Brot herum. Ein plötzlicher Windstoß blies einen Aschenregen vom Herd in den Saal und Funken schwebten in die dunklen Tiefen der Halle wie irregeleitete Sterne. Seffrid hielt die Arme fest um sich geschlungen. So weit vom Feuer entfernt war ihm kalt. Er griff nach dem warmen Brot; der Sklave brachte das Fleisch auf den Tisch, und Seffrid stand auf und säbelte sich ein Stück vom Braten ab.
Die Männer ringsum ließen ihm den Vortritt, weil er Markolds erster Mann war. Er legte sein Stück Brot auf den Tisch, lud das fetttriefende Bratenstück darauf und leckte sein Messer sauber.
»Bringt der Prinzessin nichts von diesem Festmahl«, brüllte Markold. »Lasst sie hungern, weil sie ihren Vater so behandelt hat.«
Mit allen anderen stieß Seffrid ein zustimmendes Geheul aus. Er war geübt darin. Es war wie bei der Messe, bei der man auch sagte, was der Herr hören wollte. Er stopfte sich gerösteten Hammelbraten in den Mund und langte nach dem Weinbecher.
»Die Königin ist tot«, rief Markold hinter ihm. Er hatte bereits gegessen, als Erster, wie es dem König zustand, und jetzt trank er und ließ sich feiern, wie gewöhnlich. »Lang lebe der König! Die Königin ist tot!«
Sie stießen Rufe aus, alle miteinander, den Mund mit Fleisch vollgestopft. Der König schwieg einen Augenblick. Gesättigt lehnte Seffrid sich zurück.
»Seffrid!«
Er fuhr zusammen. Markolds Stimme hatte einen fiebrigen Unterton, der ihn frösteln ließ. Er stand auf und wandte sich ihm zu. »Herr, was wünscht Ihr?«
»Du weißt sehr gut, was ich wünsche!« Markold legte die Hand an den Verband. »Ich bin der König hier! Ich bin der König!«
Die gierig schlingenden Männer um den Tisch herum sprangen auf, denn jetzt kam die Erhebung, der heiligste Teil der Zeremonie. Sie bewegten sich heftig, wie aufgeschreckte Wölfe, und aus allen Kehlen drang ein einstimmiges Geheul.
»König Markold! Unser König!«
Seffrid sagte: »König Markold.« Er fragte sich, wo das hinführen sollte; er hatte Markold schon des Öfteren in dieser niederträchtigen Stimmung erlebt und es war nie etwas Gutes dabei herausgekommen.
Markolds Bart teilte sich, so breit grinste er. Er sah Seffrid über den Raum hinweg unverwandt an, und als der Lärm sich legte, sagte er: »Dann lasst sie uns runterholen, damit sie einen Eid darauf leistet.«
Seffrid sah ihn blinzelnd an. »Herr?«
»Hol sie her!«
»Wie Ihr wünscht, Herr.« Seffrid verbeugte sich erneut. Wenn Markold den Eindruck bekam, dass er zögerte, könnte er es sich ganz schnell mit ihm verderben. Er hoffte, dass die Prinzessin sich seinen Ratschlag zu Herzen genommen hatte. Er ging zur Tür.
»Seffrid!«
»Herr!« Er wirbelte herum.
»Glaubst du nicht, dass du Hilfe brauchen wirst?« Markolds Finger strichen über seinen Verband.
Seffrid fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. Was war die richtige Antwort? Gab es eine richtige Antwort? Er warf einen Blick auf die Reihen der Männer, die einsatzbereit auf den Befehl zu irgendeiner Gewalttat warteten, denn sie kannten Markold.
»Du. Und du.« Er wies auf die Nächststehenden.
Markold lächelte ihn an. »Tut ihr nicht weh.« Er lehnte sich in seinem erhöhten Sitz zurück, ganz umgeben von bernsteinfarbenem Feuerschein, der das Weiße seiner Augen hervortreten ließ. Die beiden Männer folgten Seffrid zur Treppe und hinaus aus der Halle.
»Wild geworden«, murmelte einer, als sie durch die Öffnung in der Decke geklettert waren und sich im nächsten Stockwerk befanden. Der andere zischte: »Halt’s Maul!«
Seffrid entzündete eine Lampe an der Fackel, die an der Wand hing. Er wusste, dass sie sich um seinetwillen zurückhielten. Markolds Hauptmann, Markolds rechte Hand: Sie fürchteten ihn fast so sehr wie den König. Er straffte die Schultern und versuchte, die entsprechende Größe zu zeigen. Sie passierten die Kemenate, in der die Königin gestorben war, und stiegen weiter die enge Wendeltreppe hinauf. Windböen rüttelten am Turm und Seffrid glaubte zu fühlen, wie er unter seinen Füßen schwankte, wie die Steinblöcke sich verschoben und die Stützbalken überlastet wurden, und er legte seine Hand an die Mauer. Die Flamme in seiner Hand flackerte und zischte und einmal wäre sie fast ausgegangen. Er blieb stehen und wartete, bis die Flamme wieder den Docht emporgeklommen war.
Als sie bei der kleinen Kammer in der Spitze des Turms angelangt waren, reichte Seffrid einem der Männer die Lampe, nahm den Schlüssel, der neben der Tür hing, und schloss auf. Bevor er die Tür öffnete, hieb er mit der Faust dagegen.
»Prinzessin, wir kommen herein.« Ihm kam der Gedanke, dass dies das letzte Mal sein mochte, dass sie eine solche Warnung hören würde. Er stieß die Tür auf.
Sie war fort. Die Kammer war leer. Er wusste es sofort, es lag irgendwie in der Luft. Das Umsehen diente nur zur Bestätigung. Er blieb in der Mitte der Kammer stehen und gaffte. Der Mann mit der Lampe hielt diese hoch, so dass das windgepeitschte Licht sich streute. Sie konnten in jede Ecke sehen. Die Prinzessin war nicht hier. In steigender Panik schlug Seffrid die Decke zurück und zog die Matratze vom Bett. Er ging zum Fenster und streckte den Arm hindurch. Durch das Fenster war bestimmt niemand hinausgelangt und schon fühlte er die Kälte des tobenden Sturms bis auf die Knochen. Er zog die Hand zurück, und als er aus dem Fenster blickte, sah er, wie sich im dichten Regen etwas wand, schwarz und schlangenartig.
»Hmm.« Er trat zurück, blickte wieder auf die Lampe und sah, wie die Flamme vom Wind niedergedrückt wurde, der nicht vom Fenster, sondern von oben hereinzog. Als er zu den Dachsparren hochblickte, sah er, dass dort, wo sie hochgeklettert war, Staub und Spinnweben weggewischt waren.
»Hol mich der Teufel«, sagte er. Er entriss dem Mann die Lampe, stellte sie auf den Boden und befahl: »Helft mir da hoch. Los!«
Mit verschränkten Händen bildeten sie eine Trittleiter und schoben ihn hoch. Er schwang sich auf den Dachbalken und tastete sich durch die spinnweberfüllte Finsternis zur Dachkante vor, wo Dachsparren und Wand zusammenstießen. Dort war das Mauerwerk verrottet und es war genug weggebrochen, um ein Loch entstehen zu lassen, durch das ein zartes Mädchen hindurchschlüpfen konnte.
Der Regen fegte herein, als er herankroch, und nässte sein Gesicht. Als er tastend mit der Hand den Dachbalken entlangfuhr, berührte er einen harten, nassen Stoffknoten und verfolgte das verdrehte Tuch zu dem Loch in der Wand und nach draußen. Sie hatte aus irgendwas ein Seil geknüpft. Ihr Umhang. Sie musste ihn in Streifen gerissen haben.
Er überlegte, wie es wohl sein mochte, in dem heulenden Wind und dem eisigen Regen an einem Seil aus Tuch hinunterzuklettern. »Sie muss verrückt sein.« Im Großen und Ganzen hätte er Markold vorgezogen, dachte er. Obwohl, wenn er es recht betrachtete, wäre er lieber das Seil hinuntergeklettert als Markold diese Nachricht zu überbringen. Das Loch war zu klein, er passte nicht hindurch. Er sprang zu Boden, nahm dem Mann die Lampe ab und stapfte die Treppe hinunter, um Markold mitzuteilen, dass seine Tochter entkommen war.
Kapitel 2
Markolds gerötete Augen quollen wutentbrannt aus den Höhlen. »Unmöglich. Du lügst.«
»Mein König, ich schwöre Euch, sie ist aus einem Loch im Dach geklettert.«
Markolds Blick wurde noch brennender. »Du hast sie vorhin hergeholt, entgegen meinem Befehl. Und dann hat die Königin dich zum Zeugen berufen.« Er bleckte die Zähne wie ein Wolf, das Gesicht dunkel vor Argwohn. »Du hast immer hoch in ihrer Gunst gestanden.«
»Herr, ich war Euch stets ergeben, ich habe nur getan, was Ihr mir befohlen habt. Wahrscheinlich ist sie gestürzt, Herr. Wir sollten gehen und nachsehen.«
Das brachte Markold auf die Beine. Er hievte sich aus seinem erhöhten Sitz. Seffrid drehte sich um und ging ihm voraus zur Tür der Halle. Der Gedanke war ihm auf einmal gekommen, als er die Treppe hinabstieg: Vielleicht lag das gestürzte Mädchen ja zerschmettert im matschigen Burghof, während der Regen auf sie niederprasselte. Er trat zur Tür hinaus, immer noch zwei Schritte vor Markold, in den Sturm und den strömenden Regen.
Hinter der Dürnitz, zwanzig Fuß über dem Boden, wand sich das aus Ragnys Umhang geknüpfte Seil, dessen Ende noch immer an der Turmspitze befestigt war, spiralförmig in der wildbewegten Luft. Der Burghof war ein einziger See aus Schlamm. Von der Prinzessin war nichts zu sehen. Markold trat matschspritzend an Seffrids Seite und einer der Sklaven kam mit einer Fackel hinterhergeeilt. Es gab noch nicht einmal Fußspuren. Markold fluchte und ein Tritt ließ den Matsch hoch aufspritzen.
»Diese Metze! Dafür werde ich sie zum Heulen bringen–« Er stampfte davon und starrte hoch in den dunklen, peitschenden Regen, auf das sich wild schlängelnde Seil. Seffrid schätzte, dass es weit über dem Boden endete. Sie war ein gutes Stück gesprungen. Der Regen lief ihm über das Gesicht und durch den Bart und er begann, vor Kälte zu zittern. Der Wind zerrte an ihm.
Markold kam zu ihm zurückgestampft. »Wo ist sie hin?«
»Herr, ich –«
»Du weißt es, erzähl mir nichts. Du steckst da mit drin, Seffrid, bis über beide gottverdammte Ohren! Du hast immer hoch in der Gunst der Königin gestanden –«
»Ich schwöre, ich –«
»Finde sie! Bring sie zurück!«
»Wie«, sagte Seffrid mit klappernden Zähnen.
»Finde sie und bring sie zurück, Seffrid!« Drohend schob Markold sein Gesicht so dicht vor Seffrids, dass ihre Nasen sich fast berührten. Sein Atem stank fürchterlich. »Oder ich werde mich mit dir beschäftigen, noch bevor ich ihr eine Lektion erteile.«
Seffrid trat einen Schritt zurück. Der Sklave stand in der Nähe und der Fackelschein überzog Markolds Gesicht wie eine Tünche aus Blut. Die Flamme glomm in seinen Augen. Seffrid sagte: »Ja, Herr.« Er wandte sich um und ging zum Turm zurück, um sein Schwert und seinen Umhang zu holen.
»Sei vor Mittag zurück, Seffrid!«, bellte Markolds Stimme durch den Regen.
»Ja, mein König.«
Er holte seinen schweren Umhang und sein Schwert. Als er zur Tür ging, saß Markold wieder auf seinem erhöhten Sitz, einen Weinschlauch in der Hand. Sein Blick traf Seffrid wie ein Schlag. Das Feuer loderte hoch und knisterte um das angekohlte Fleisch. Seffrid hüllte sich enger in seinen Umhang und trat in den Sturm hinaus.
Zumindest wusste er, wo er sich zuerst hinwenden musste; er hatte die Worte der Königin gehört. Die Höhle der Lieder war fast sechs Wegstunden entfernt und nur über einen schmalen, schwierigen Pfad zu erreichen, der sich über den Bergrücken zog. Unterwegs gab es keinen Unterschlupf, nicht einmal die Hütte eines Schafhirten. Aber Seffrid war zu Pferd und sehr viel Vorsprung konnte sie nicht haben. Er stellte sich vor, ungefähr auf halbem Wege auf das Mädchen zu treffen, vielleicht schon früher.
Er hoffte, sich der Höhle der Lieder nicht weiter nähern zu müssen. Sie lag in einem zerklüfteten, ruhelosen Landstrich mit tiefen Spalten und schrägen Felsvorsprüngen, voll von Gerumpel und Echos, in dem der Boden sich bewegte, Felsen unter dem Fuß nachgaben und der Wind alles fortfegte, was nicht niet- und nagelfest war. Vor dem Burgtor zwang er sein Pferd in das baumlose Gebirge, in den peitschenden, eisigen Regen hinaus. Der Wind pfiff ihm ins Gesicht und drückte ihn zurück. Er kauerte sich so tief in seinen Umhang wie möglich und zog sich die Kapuze eng ums Gesicht. Seine Zehen waren schon jetzt empfindungslos vor Kälte.
Er erwartete, auf dem breiten, grasbewachsenen Hang auf sie zu stoßen, an der steilen Bergflanke, wo der südliche Himmel unter den Pfad herabsank und der Wind sich aus den Höhen ergoss wie ein Sturzbach. In den letzten Stunden der Nacht überquerte er den Berg und fand sie nicht. Der Sturm war voller Stimmen, Schreie und Gelächter. Lichter waren auf dem Berggipfel, die tanzten wie Leuchtkäfer, und er begann zu wünschen, er hätte ein engeres Verhältnis zu Gott, denn dann hätte er jemanden, zu dem er rufen könnte. Der Regen ließ nach. Durch das fliegende Gewölk schimmerten die Sterne. Er ritt gen Osten und sah das erste Licht des Tages am Horizont aufschimmern, aber Ragny hatte er nicht gefunden, und er näherte sich der Höhle der Lieder.
Er zügelte sein Pferd. Die Morgendämmerung war nahe, und er hatte wenig Lust, diesen Gang in der Dunkelheit zu wagen. Der Regen hatte aufgehört, aber um ihn herum peitschte und sauste der Wind. Vor ihm ragte eine steile Felswand empor, deren Fuß in herabgestürzten grauen Felsblöcken begraben war. Langsam wurde es hell, aber er entdeckte keine Spur von Ragny.
Er hatte Zeit bis Mittag. Danach würde Markold ihn ebenfalls jagen. Er wusste, wie Markold mit Leuten umging, die versagt hatten. Seffrid selbst hatte einmal geholfen, ein Opfer aufrecht zu halten, damit dessen sterbende Augen die eigenen Eingeweide im Herdfeuer brutzeln sehen konnten.
Er stieg ab und suchte sich einen Weg über die Geröllhalde unterhalb der Höhle, die sich als kleine Spalte im Felsen auftat, auf halber Höhe der Felswand. Das lose Gestein drehte sich und rutschte unter seinen Füßen weg, und einmal stolperte er und fiel. Windböen zerrten an ihm, als wollten sie ihn von der Felswand stoßen. Dann, ganz plötzlich, legte sich der Wind, und irgendwo über sich hörte Seffrid eine tiefe und donnernde Musik.
Er erstarrte. Der Boden unter ihm schien zu beben. Es war der Wind hoch droben, der um die Felsen heulte und durch die Höhlen brauste. Es war nur der Wind. Die langen Töne erstarben. Er hörte nichts mehr. Alles nur Einbildung. Er dachte an Markold, der vielleicht schon Jagd auf ihn machte, und kletterte auf allen vieren den steilen Hang hinauf, bis er die Spalte im Fels erreichte, hinter der sich die Höhle auftat.
Die Felsspalte war so eng, dass er sich seitlich drehen musste, um hindurch zu gelangen. Seine Brust schrammte gegen den Fels und sein Rücken wurde gegen Stein gedrückt. Einen Augenblick lang, eingekeilt zwischen Wänden aus Felsgestein, hatte er Angst: Er fühlte sich gefangen, langsam vom Felsen zermalmt, als würde der Berg seinen Rachen schließen. Aber dann glitt Seffrid hindurch in die größere Kammer dahinter.
Eine weitere Öffnung hoch oben ließ einige Streifen Sonnenlicht herein und die gewaltige, zerklüftete Höhle breitete sich vor ihm aus. Sonnenstäubchen tanzten durch das hohe, offene Gewölbe. Die Höhlenwände waren gespalten und gefältelt wie Vorhänge. Die Sonnenstrahlen erreichten den Boden der Grotte nicht. Seffrid stand in dunklem Zwielicht, einem See aus Nachtluft, in Kälte und Feuchtigkeit. Als er sich blinzelnd umsah, fiel etwas von der Decke und zog ein hallendes Echo nach sich.
Der Boden der Höhle bestand aus Steinschutt, aufgehäuft um Stacheln und Spitzen aus Tropfstein, die aus dem Boden emporwuchsen, glitschig von Fledermaus- und Vogeldreck. Wachsam trat Seffrid ein paar Schritte vor, die kalte, dumpfige Luft in den Lungen, und suchte sich tastend seinen Weg über das rutschende, knirschende Geröll. Ein schmaler, hoher Turm aus Stein ragte in der Finsternis empor. Die Höhle stank nach Kot und feuchtem, moderndem Kalkgestein. Er richtete sich gerade auf und hielt in dem Halbdunkel Ausschau nach Ragny.
Unvermittelt und mit tiefem Schrecken wurde er sich einer anderen Gegenwart ganz in seiner Nähe bewusst, eines gewaltigen Wesens, das über ihm aufragte, mächtig und schrecklich. Er stieß einen Schrei aus; dann traf ihn ein Schlag und er fiel besinnungslos zu Boden.
Seffrid erwachte. Er war noch am Leben, stellte er überrascht fest. Prinzessin Ragny saß neben ihm auf einem Felsen und beobachtete ihn. Sonst war niemand in der Höhle.
»Nun, Seffrid«, sagte sie, »was ist dir geschehen?«
Benommen setzte er sich auf und blickte sich um. »Etwas hat mich niedergeschlagen.« Er hob die Hand und tastete nach einer Beule, fand aber keine. »Ich schwöre, etwas hat mich niedergeschlagen.« Er fragte sich, wie lange er bewusstlos gewesen war. Wahrscheinlich nicht lange. Augenblicke.
Die Prinzessin sah ihn unverwandt an. Sie trug nur ein langes, dunkles Gewand, durchnässt und verdreckt. Das wirre Haar hing ihr um die Schultern wie verfilzte Pusteblumen. Sie sagte: »Ich habe die halbe Nacht hier gewartet, Seffrid, gewacht und gebetet. Niemand sonst war hier. Nichts ist geschehen. Meine Mutter sagte, sie würde jemanden schicken, der mir helfen soll, aber außer dir ist niemand gekommen.«
Er kam auf die Füße und sah sich um. »Es war niemand sonst hier? Nichts war hier?« Er spähte in die dunklen Tiefen der Höhle. Vielleicht hatte er sich von bloßen Schatten ins Bockshorn jagen lassen. Etwas war ihm vom Dach der Höhle auf den Kopf gefallen. Das war alles. Wieder fasste er sich an den Kopf.
»Nichts und niemand außer dir und mir. Und ich glaube kaum, dass meine Mutter dich gemeint hat.«
Hastig ergriff er die Gelegenheit beim Schopf. »Vielleicht doch«, sagte er. »Schließlich hat sie mich gebeten, Zeuge zu sein. Vielleicht wusste sie, dass ich Euch wieder heimbringen kann.«
»Ich gehe nicht wieder zurück«, sagte sie.
»Prinzessin, Ihr habt keine Wahl. Markold wird Euch aufspüren, wenn Ihr nicht zurückkehrt. Ihr müsst zurückgehen und das Beste daraus machen – Frauen können sowas doch, sie können sich anpassen –«
Er hielt inne. Sie hörte nicht zu, sondern ging durch die Höhle davon, auf die kleine Spalte zu, die der Eingang war und nun blendend hell im Sonnenlicht lag wie ein Durchgang zum Himmel. Er folgte ihr. Er würde sie mit Gewalt fortschleppen müssen, erkannte er und begann zu überlegen, wie er sie gefangen nehmen konnte, ohne ihr wehzutun. Er würde sie überraschen müssen.
Sie sagte: »Meine Mutter hatte etwas im Sinn. Aber ich kann nicht warten, bis Wünsche sich erfüllen, Seffrid. Ich muss von hier fort, bevor mein Vater mir seinen Willen aufzwingt und alles für immer zunichte macht.« Gerade als er sie mit einem Satz überwältigen wollte, drehte sie sich um und sah ihn an. »Du bist nicht der, den meine Mutter mir schicken wollte, aber es muss genügen. Hast du ein Pferd für mich mitgebracht?«
Er konnte sie nicht überraschend anfallen, wenn sie so vor ihm stand, die ruhigen grauen Augen fest auf ihn gerichtet. Sein Rücken kribbelte. Er schluckte. Er sollte sie trotzdem überwältigen, aber er konnte es nicht über sich bringen. Sie musterte ihn mit steigender Belustigung. Um ihren Mund spielte der Anflug eines Lächelns und ihr Blick war fest und sicher. »Du glaubst doch nicht etwa, dass du noch immer Markolds Gefolgsmann bist, oder?«
Heiser erwiderte er: »Er wird uns beide umbringen.«
»Nein, das wird er nicht. Wir werden entkommen. Ich werde einen Ritter finden, der der wahre König werden wird. Er wird mit mir zurückkehren und mein Geburtsrecht einfordern. Und du wirst deine Belohnung erhalten.«
Es schien alles so einfach zu sein. Seffrid rieb sich mit den Handflächen über die Hüften. Sein Mund war trocken. Er dachte an Markolds Augen, die voller Wut und Hass hervorquollen, an Markolds Faust, an Markolds Grausamkeit. Und er begriff, wie sehr er Markold hasste und wie sehr er dieses wilde Mädchen mochte.
Ihm wurde klar, dass er seine Entscheidung bereits getroffen hatte, irgendwie. Oder vielmehr sie hatte die Wahl für ihn getroffen.
Er sagte: »Wohin wollt Ihr Euch wenden, Prinzessin?«
»Vielleicht nach Spanien«, sagte sie. »Oder nach Norden, ins Frankenreich.«
Das beruhigte ihn. Er sah eine Möglichkeit, etwas aus der Sache herauszuholen, ohne allzu viel zu riskieren. »Ich bin Franke, wisst Ihr. Ich kann Euch führen.« Ein heimlicher, böser Gedanke nistete sich in seinem Kopf ein: Vielleicht könnte er sie von dort aus, in sicherer Entfernung, sogar an Markold ausliefern und dabei reich werden. Er neigte den Kopf vor ihr, aus Furcht, sie könnte ihm seine Falschheit vom Gesicht ablesen. »Ich bin Euer Gefolgsmann, Prinzessin.«
»Gut«, sagte sie. »Geh jetzt. Nicht weit entfernt von hier ist ein Dorf. Du musst Pferde beschaffen, die er und seine Männer nicht kennen. Und bring mir Männerkleidung. So werde ich nicht entkommen können.«
Erneut verbeugte Seffrid sich, jetzt ganz Herr der Lage. »Wie Ihr wünscht, Prinzessin.« Er ging zum Ausgang der Höhle, erleichtert, wieder unter freien Himmel, in der Sonne zu sein, kletterte rasch den Hang hinunter und ging zu seinem Pferd.
Sie hatte jetzt keinen Vater mehr außer Gott und eine Mutter hatte sie überhaupt nicht mehr.
Sie weinte eine Weile um ihre Mutter, obwohl Ingunn jetzt gewiss im Himmel war und glückselig. Sie weinte um sich selbst, mutterlos und verloren, wie sie war. Seffrid kam nicht zurück.
Es war natürlich möglich, dass er auf dem Weg zu Markold war, um sie ihm auszuliefern. Bei diesem Gedanken überfluteten sie auf einmal Erinnerungen an alte Zeiten, an einen Markold, der nicht böse und wütend war, sondern freundlich und ungeheuer stark. Sie saß auf seinem Schoß und er gab ihr Apfelschnitze zu essen. Schmerzlich schloss sie die Augen. Vielleicht sollte sie doch zurückkehren, diese Aufgabe auf sich nehmen, um diesen Markold wiederzufinden. Vielleicht war es ja das, was Gott von ihr wollte.
Fast unwillkürlich stand sie auf, streckte die Arme in Gebetshaltung aus und wandte das Gesicht der Sonne zu. Das starke Licht wärmte sie und sie fasste wieder Mut. Sie war die rechtmäßige Königin Spaniens. Gott würde sie stärken und ihr Kraft geben, wenn sie seiner Sache diente. Sie würde tun, was Gott von ihr verlangte.
Sie dachte an Jesus, wie sie es oft tat, dem eine so ungeheure Pflicht auferlegt worden war. Er war zu seinem Vater gegangen und hatte gesagt: »Bitte, zwing mich nicht dazu.« Und Gott sagte: »Mein Sohn, es gibt sonst niemanden.«
Ragny streckte die Arme zu dem Kreuz aus, an dem Christus gehangen hatte, und schloss die Augen. Nein, sie würde nicht zu Markold zurückkehren.
Bald darauf kam Seffrid doch zurück, mit einem großen grauen Pferd und einem Maulesel, etwas Brot und Käse sowie Kleidung für sie. Sie hatte ja gewusst, dass er zurückkommen würde. Sie schlang alles Essbare herunter, bevor ihr der Gedanke kam, dass sie ihm etwas abgeben sollte. Es schien ihn nicht zu kümmern, denn er sagte bloß: »Prinzessin, wir müssen uns beeilen.«
»Nenn mich nicht Prinzessin«, sagte sie. »Zum einen bin ich jetzt Königin. Außerdem darf sowieso niemand je hören, dass du mich so nennst, also musst du es lassen. Er wird überall in den Bergen nach uns suchen. Warte hier.« Sie nahm das Kleiderbündel, ging in die Höhle und zog die Sachen an: derbe Beinlinge, ein Wams mit Kapuze, ein Gürtel, Stiefel, sogar ein Messer und ein großer Schlapphut. Der grobe Stoff verbarg die Formen ihres Körpers und sie war sowieso ziemlich mager. Sie ließ ihr Kleid einfach liegen, wo sie es hingeworfen hatte, und trat ins Sonnenlicht hinaus, wo Seffrid stand und unverwandt nach Westen blickte.
Er hielt nach Markold Ausschau. Ragny sagte: »Nun musst du mir die Haare abschneiden.«
»Aber Prinzessin«, sagte er.
»Tu, was ich dir sage.« Sie wandte ihm den Rücken zu und kniete nieder. »Schneide es so kurz wie möglich.«
Unsicher ergriff er die ersten Strähnen. Sie spürte, wie er mit dem Messer an ihrem Haar herumsäbelte, und sah die erste Hand voll, die er zu Boden warf. Sie hob die Augen, blickte nach Westen und Süden auf das Land, das sich vor ihr ausbreitete, Bergkette um Bergkette, bis es im Süden im Dunst verschwamm. »Wir sollten nach Spanien gehen«, sagte sie. »Dort liegt mein Königreich.«
Er zog ruckartig an ihrem Haar. »Prinzessin! Vergebt mir, ich wollte Euch nicht wehtun. Nein, Prinzessin, in Spanien werdet Ihr kaum Freunde finden –«
»Nenn mich nicht Prinzessin«, sagte sie.
»Wie soll ich Euch dann nennen?« Er säbelte ein weiteres Büschel ab.
»Ich werde ...« Sie blickte in die unermessliche, diesige Ferne, so außer Reichweite, wo alles möglich schien. »Ich werde Roderich sein. Nenn mich Roderich.«
»Sehr schön«, versetzte er und kürzte weiter ihr Haar.
Bald darauf war er fertig und trat zurück. Sie hob die Hand und fühlte das Stoppelhaar über ihren Ohren. »Seffrid, ich hoffe stark, dass du sonst bessere Arbeit mit dem Messer leistest.«
»Vergebt mir«, sagte er demütig.
»Macht nichts. Du findest also, wir sollten ins Frankenreich gehen.« Sie argwöhnte, dass er mit diesem Wunsch irgendeinen Hintergedanken verfolgte, aber sein Argument war schon richtig, dachte sie: In Spanien würde sie auf tausend Feinde treffen. Im Frankenreich kannte niemand sie und sie würde ganz von vorn beginnen können. Was Seffrid betraf, sie würde ihm vertrauen und hoffen, dass ihn das vertrauenswürdig machte. Sie hatte gar keine andere Wahl und bislang war sie gut damit gefahren. »Also schön«, sagte sie. »Brechen wir auf.«
Sie gingen zu ihren Reittieren. Sie sah, dass er das Maultier für sie gesattelt und seinem Pferd nur eine Satteldecke aufgelegt hatte. Als sie auf den Rücken des Maultiers kletterte, spitzte es plötzlich die Ohren und das große graue Pferd riss den Kopf vom Gras hoch. Dann hörten sie weit entfernt das tiefe Schmettern eines Jagdhorns.
»Er ist hinter uns her«, sagte Seffrid. »Verdammt soll er sein. Er sagte, ich hätte bis Mittag Zeit.« Er sprang auf den Rücken des grauen Rosses und sie ritten in hartem Trab über den Berg.
Markold hatte viele Straßen zu überwachen und zudem konnten sie die Straßen größtenteils meiden. Aber es gab nur einen einzigen Pass, der über die Berge nach Norden führte. Und zu diesem Pass, das wusste Seffrid, würde Markold selbst kommen, so schnell er konnte. Ihre einzige Hoffnung war, vor ihm dort zu sein.
Sie nahmen einen Pfad, der sich an steile Hänge schmiegte, ein höherer, rauerer, schnellerer Weg als die fahle Straße, die sie manchmal sich durch das Tal schlängeln sahen. Noch einmal hörten sie das Jagdhorn, weiter unten am Berg. Nach dem gestrigen Regen war der Tag windig und klar. Ragny – Roderich, rief sich Seffrid in Erinnerung, Roderich – schlug ein schnelles Tempo an, folgte den von Schafen ausgetretenen Pfaden auf den Hängen hoch über der Straße und hielt dann und wann an, um sich umzusehen und das Maultier verschnaufen zu lassen.
Als sie das zum zweiten Mal tat, sagte er: »Roderich, Ihr müsst darauf achten, dass sich Euer Umriss nicht gegen den Himmel abzeichnet. Wenn jemand hochblicken sollte, erwischen sie uns sofort.«
Sie sah ihn mit großen Augen an und nickte. »Oh. Richtig.« Rasch ritt sie über die Bergkuppe hinunter zur nördlichen Flanke des Berges. Sie drehte sich zu ihm um.
»Du musst mir sagen, wie ich mich als Mann verhalten soll, Seffrid. Es muss mehr dazugehören als die Kleidung.«
Seffrid lachte. »Ihr habt doch Euer ganzes Leben unter Männern verbracht – Roderich.«
»Ja, aber nie als einer von ihnen. Du musst mir sagen, worüber Männer reden, wenn sie unter sich sind – du musst mit mir reden, wie du mit einem Mann reden würdest.« Ohne die Haarpracht wirkte ihr Gesicht schmaler und der Wind hatte ihre Haut gerötet. Es gelang ihm nicht, etwas anderes zu sehen als ein junges Mädchen. Sie musterte ihn prüfend, stellte er fest, und während sie das tat, nahm sie eine andere Gestalt an. Sie straffte die Schultern und verlagerte ihr Gewicht, hielt den Kopf höher, reckte das Kinn vor und blickte ihm grimmig in die Augen.
Er suchte verzweifelt nach etwas, das er sagen konnte, und stieß hervor: »Ein Mann dient seinem Gefolgsherrn. Das ist es, was einen Mann ausmacht.« Mit einem plötzlichen Ziehen im Herzen fiel ihm der Ruf des Jagdhorns ein. Ein Mann ohne Gefolgsherr, dachte er, war kaum besser als ein Geächteter. Er zog die Schultern hoch, denn er fühlte sich auf einmal ganz nackt in dem böigen Wind.
Sie sagte: »Dann diene mir.« Sie saß im Sattel, eine Hand locker zur Faust geballt an der Hüfte; er hatte sie das nie zuvor tun sehen. Auch ihre Kopfhaltung war anders. Als ihre Blicke sich trafen, sah er ihr in die blassen Augen und entdeckte keine Spur von weiblicher Weichheit. Unvermittelt sagte sie: »Lass uns weiterreiten«, und sie jagten weiter durch die Berge.
Sie kamen zu einem Fluss, der über die Felsen zu Tal stürzte, und folgten ihm flussaufwärts auf der Suche nach einer Furt. Roderich trieb das Maultier über den steil ansteigenden Pfad, und Seffrid folgte, über Felsblöcke, auf denen Moos spross wie Elfenbetten und Bäume, nicht länger als sein Arm, aus Felsspalten hoch über dem schäumenden Wasser wuchsen. Sie kamen auf einen windumtosten Grat, überwuchert mit einer niedrigen, zitternden Matte aus Strauchwerk und Kletterpflanzen, und folgten ihm hinunter zum Flussufer.
Hier, schien es, konnten sie den Fluss überqueren. Das Wasser schoss oben aus einer engen Klamm und breitete sich auf der Wiese zu einer weiten, seichten Wasserfläche aus, die in der Sonne glitzerte. Als sie zu der Furt kamen, sah Seffrid, wie jemand sich aus dem Schutz eines kleinen, verkrüppelten Baumes erhob und vortrat. Eine Frau, stellte er verblüfft fest, eine junge Frau, in einen langen Umhang gehüllt.
»Edle Leute«, rief sie mit heiserer Stimme, »ich erflehe Eure Vergebung. Ich bitte nur um einen kleinen Gefallen und ich werde mich erkenntlich zeigen.« Mit brennenden Augen blickte sie zu Seffrid hoch. »Auf eine Weise, wie es selbst eine arme Frau vermag.«