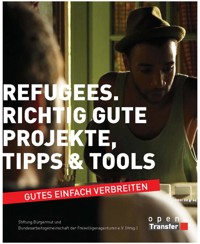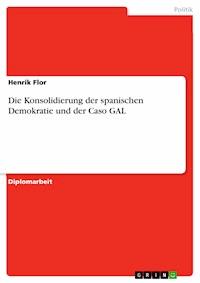
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Diplomarbeit aus dem Jahr 1999 im Fachbereich Politik - Region: Westeuropa, Note: 1,5, Freie Universität Berlin (Otto-Suhr-Institut), Sprache: Deutsch, Abstract: Die Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) töteten 1983-1987 insgesamt 28 Personen, die Mitglieder ETAs waren oder diesem Umfeld irrtümlicherweise zugerechnet wurden. ETA-Terror sollte mit gleichen Mitteln beantwortet werden, wobei vorrangig Etarras, die sich nach Südfrankreich abgesetzt hatten, ins Visier gerieten. Als Täter wurden in Frankreich sowohl spanische Polizeibeamte als auch Auftragsmörder verhaftet. In einem Mordfall war bald die Verwicklung eines hohen Mitarbeiters des Innenministeriums, der die dortigen schwarzen Kassen führte, evident. In einem Entführungsfall konnte die Beteiligung des damaligen Innenministers, Barrionuevo, sowie seines Staatssekretärs nachgewiesen werden. Neben dem Innenministerium und der regulären Polizei waren der spanische Geheimdienst CESID, das Verteidigungsministerium, die Guardia Civil sowie die französischen Geheimdienste maßgeblich an den Aktionen, die unter dem Begriff GAL subsumiert werden, beteiligt. Die juristische Aufarbeitung in Spanien begann 1987 und steht bis heute erst an ihrem Anfang. Sie wird den Spanischen Staat und Gesellschaft also noch lange beschäftigen. Ausgangspunkt für die Wahl des Themas, „Die Konsolidierung der spanischen Demokratie und der Caso GAL“, ist die Relevanz des gewählten Themas. In Spanien nahm, zusammen mit Portugal und Griechenland, die dritte große Demokratisierungswelle ihren Anfang (vgl. Huntington 1991). Aufgrund des schnellen und günstigen Verlaufs ihres Systemwechsels sind sie zu den wichtigsten Referenzpunkten in der Demokratisierungsforschung geworden. Der Caso GAL hat im Zuge seiner Aufdeckung lange Zeit die politische Tagesordnung Spaniens beherrscht. Zusammen mit verschiedenen Korruptionsskandalen der sozialistischen Regierung trug er entscheidend zur Abwahl der Regierung 1996 bei. Der Caso GAL und der sich anschließende Aufklärungsprozeß werfen ein Schlaglicht auf Defizite der jungen spanischen Demokratie: Sie stehen in diesem Zusammenhang für das Antworten auf einen großen, vielleicht systemgefährdenden Problemdruck (von Seiten ETA) mit Methoden jenseits rechtsstaatlicher Legalität. Dies offenbarte ein geringes Maß an demokratischer Durchdringung von Teilen der Polizei, des Geheimdienstes, des Innenministeriums und z.T. der sozialistischen Regierung (PSOE).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2005
Ähnliche
Page 1
Freie Universität Berlin
FB Politische Wissenschaft Otto-Suhr-Institut
Diplomarbeit
Die Konsolidierung der spanischen Demokratie und der Caso GAL
Henrik Flor
Page 3
Abkürzungsverzeichnis
APCE CESID CGPJ CIP CIS EA ETAFAZ FR GRAPO HB ICIU MULC NZZ PCE PNV PP
PSOE SZ taz UCD3
Page 4
Einleitung
Die Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) töteten 1983-1987 insgesamt 28 Personen, die Mitglieder ETAs waren oder diesem Umfeld irrtümlicherweise zugerechnet wurden. ETA-Terror sollte mit gleichen Mitteln beantwortet werden, wobei vorrangig Etarras, die sich nach Südfrankreich abgesetzt hatten, ins Visier gerieten. Als Täter wurden in Frankreich sowohl spanische Polizeibeamte als auch Auftragsmörder verhaftet. In einem Mordfall war bald die Verwicklung eines hohen Mitarbeiters des Innenministeriums, der die dortigen schwarzen Kassen führte, evident. In einem Entführungsfall konnte die Beteiligung des damaligen Innenministers, Barrionuevo, sowie seines Staatssekretärs nachgewiesen werden. Neben dem Innenministerium und der regulären Polizei waren der spanische Geheimdienst CESID, das Verteidigungsministerium, die Guardia Civil sowie die französischen Geheimdienste maßgeblich an den Aktionen, die unter dem Begriff GAL subsumiert werden, beteiligt. Die juristische Aufarbeitung in Spanien begann 1987 und steht bis heute erst an ihrem Anfang. Sie wird den Spanischen Staat und Gesellschaft also noch lange beschäftigen.
Ausgangspunkt für die Wahl des Themas, „Die Konsolidierung der spanischen Demokratie und der Caso GAL“, ist die Relevanz des gewählten Themas. In Spanien nahm, zusammen mit Portugal und Griechenland, die dritte große Demokratisierungswelle ihren Anfang (vgl. Huntington 1991). Aufgrund des schnellen und günstigen Verlaufs ihres Systemwechsels sind sie zu den wichtigsten Referenzpunkten in der Demokratisierungsforschung geworden. Der Caso GAL hat im Zuge seiner Aufdeckung lange Zeit die politische Tagesordnung Spaniens beherrscht. Zusammen mit verschiedenen Korruptionsskandalen der sozialistischen Regierung trug er entscheidend zur Abwahl der Regierung 1996 bei. Der Caso GAL und der sich anschließende Aufklärungsprozeß werfen ein Schlaglicht auf Defizite der jungen spanischen Demokratie: Sie stehen in diesem Zusammenhang für das Ant-worten auf einen großen, vielleicht systemgefährdenden Problemdruck (von Seiten ETA) mit Methoden jenseits rechtsstaatlicher Legalität. Dies offenbarte ein geringes Maß an demokratischer Durchdringung von Teilen der Polizei, des Geheimdienstes, des Innenministeriums und z.T. der sozialistischen Regierung (PSOE).
Die Kontrolle der Sicherheitskräfte - die alsreserve domainsdes alten Regimes gelten können - durch demokratisch legitimierte Institutionen war Anspruch der reformerischen sozialistischen Partei. Auf eindringliche Weise enthüllte der Caso GAL, wie dieses wichtige Projekt in
Page 5
den ersten Jahren ihrer Regierung verfehlt wurde, in denen sie sich auf die alten Kräfte angewiesen fühlte und ihre Dienste gern in Anspruch nahm.
So kann man den Caso GAL als eine Art Testfall für die junge spanische Demokratie begreifen, der Defizite in Bezug auf rechtsstaatliches Handeln von Teilen der Regierung und des Sicherheitsapparats sowie der Gewaltenkontrolle1im Sinne einer Überprüfung und gegebenenfalls Sanktionierung des Regierungshandelns offenbart. Hier wird vor allem auf die parlamentarische Kontrolle einzugehen sein. Die starke Einflußnahme der Exekutive auf diede jureunabhängige Judikative (die ihrerseits stark politisiert ist) erweist sich für einen Konsoli-dierungsfortschritt ebenfalls als bedenklich. Die Reaktion zivilgesellschaftlicher Akteure wie Menschenrechtsorganisationen und Presse sowie die Einstellung der Bevölkerung gegenüber den illegalen Methoden der Terrorismusbekämpfung werden ebenfalls Erkenntnisse zum Konsolidierungsstand in diesen Bereichen liefern.
Der empirische Befund des Caso GAL hinsichtlich der Konsolidierung der Demokratie in Spanien kann dabei über diesen konkreten Fall hinausweisen und sowohl Fortschritte als auch Defizite benennen, die strukturellen Charakter haben.
Hinzu kommt, daß im Gegensatz zur großen Aufmerksamkeit von Seiten der Massenmedien das Thema bislang in wissenschaftlichen Untersuchungen nahezu ignoriert wurde.2
Die leitende Frage soll sein, welchen Einfluß der Caso GAL und sein Aufklärungsprozeß auf die Konsolidierung der spanischen Demokratie hatte.
Dies soll in der Weise verstanden werden, daß der Caso GAL, also das verbrecherische Handeln bestimmter Teile des Regierungsapparates, Aussagen über das Verhalten von Teilen der politischen Elite und deren demokratische Durchdringung zuläßt. Weit mehr Raum wird in dieser Arbeit der sich anschließende Aufklärungsprozeß, also die Reaktion verschiedener gesellschaftlicher und staatlicher Akteure gegenüber den erlebten rechtsstaatlichen Defiziten einnehmen. Anzunehmen ist, daß der Caso GAL strukturelle Konsolidierungsdefizite und -fortschritte offenlegt, die auch für andere Politikfelder relevant sind.
1Der Begriff einer strikten Gewaltenteilung, soll hier vermieden werden. Wie in jedem parlamentarischen System soll von einer Trennung zwischen Regierung und Parlamentsmehrheit einerseits und der parlamentarischen Opposition andererseits ausgegangen werden.
2Zu den journalistischen Darstellungen gehören Álvaro Baeza 1996, Cerdán/ Rubio 1995, García 1988, García Pelegrin 1998, Miralles/ Arques 1989. Einzelne Ansätze einer wissenschaftlichen Annäherung finden sich in Kennedy 1990, Navarro 1995, Ruiz Muñoz 1997. Der Caso GAL hat jedoch noch nicht Eingang in die Untersuchungen des Systemwechsels in Spanien gefunden. So liegen noch keine Arbeiten vor, die den Zusammenhang von Caso GAL und der Konsolidierung der spanischen Demokratie untersuchen.
Page 6
In einer bereichsspezifischen Untersuchung werden die relevanten Schlüsselarenen daraufhin befragt, wie ihre Rolle im Caso GAL hinsichtlich zuvor formulierter Konsolidierungsindika-toren zu bewerten ist.
Zur Beantwortung der Fragestellung ist es also sinnvoll, nicht sämtliche der Bereiche zu untersuchen, die für eine gesamtgesellschaftliche Konsolidierung Bedeutung haben. Entscheidend ist eine bereichsspezifische Einschränkung des Untersuchungsbereichs auf diejenigen Teilbereiche, die im Zusammenhang mit dem Caso GAL stehen. Im Sinne einer „gezielten Selektion“ (Kromrey 1998: 51) müssen die zu untersuchenden Merkmale des Gegenstands reduziert werden. Dies ist Voraussetzung für die folgende systematische und theoriegeleitete Untersuchung.
Die zentrale Hypothese ist, daß der Aufklärungsprozeß des Caso GAL zwar Defizite in der Konsolidierung der spanischen Demokratie offenlegt, jedoch der sich anschließende Aufklärungsprozeß zur weiteren Konsolidierung des politischen Systems beigetragen hat. Daß die staatsterroristischen Aktionen überhaupt aufgedeckt wurden, ist für sich genommen bereits ein Erfolg. Entscheidend war hier die Rolle verschiedener Zeitungen sowie einzelner engagierter Persönlichkeiten der Justiz und Politik. Daß es zudem zur Verurteilung des ehemaligen Innenministers sowie hoher Beamter seines Ministeriums und der Polizei kam, kann als Ausnahme selbst in demokratischen Rechtsstaaten gelten.
Schnell stößt man jedoch auf Widersprüchlichkeiten: Das Interesse von politischen Parteien, der Justiz, der Presse, von Nichtregierungsorganisationen und der Bevölkerung an der Aufklärung der staatsterroristischen Aktionen war zunächst beschränkt, setzte verspätet ein und sah sich hartnäckigen Blockaden ausgesetzt. Von einem konsentierten Willen zur Aufdeckung der Geschehnisse kann keinesfalls gesprochen werden. So hatte die konservative Partei, PP, nur in einer kurzen Wahlkampfphase Interesse an der Aufdeckung des Caso GAL gezeigt; die PSOE-Opposition reagierte auf die Richtersprüche, indem er die Legitimität einer zentralen Institution des Verfassungsstaates anzweifelte; auch sind die prominentesten Verurteilten nach wenigen Monaten Haft bereits wieder in Freiheit. Die Berichterstattung in wichtigen Zeitungen orientierte sich oft mehr an der Auflagensteigerung und dem Wunsch, die Regierung zu destabilisieren, als zur wahrheitsgemäßen Aufklärung des Falls beizutragen. Das politische und gesellschaftliche Gefüge, in dem sich der Caso GAL sowie sein Aufklärungsprozeß bewegt, soll als komplexes, dynamisches System begriffen werden und muß daher prozesshaft interpretiert werden.
Page 7
In dieser Arbeit sollen diese Prozesse in einzelnen Bereichen des politischen und sozialen Systems nachvollzogen und hinsichtlich ihrer Bedeutung für den Konsolidierungsprozeß interpretiert werden.
Bei der Einteilung der zu untersuchenden Akteursblöcke orientiere ich mich an Lauths „dreigestuftes Akteursprinzip der Kontrolle“ der Regierung (Lauth 1999). Die erste Stufe bilden Bürger, Zivilgesellschaft, Verbände, Parteien, Öffentlichkeit und Medien. Ich habe die Parteien aus dieser ersten Stufe ausgegliedert und der zweiten Stufe, nämlich dem Parlament und öffentlich-rechtliche Institutionen zugeschlagen. Dies ergibt sich daraus, daß im Fall der GAL das Parlament der zentrale Rahmen der Auseinandersetzung zwischen den Parteien war. Neben der dritten Stufe, der Justiz, habe ich eine vierte eingeführt, die sich auf die Regierung selbst bezieht, also das eigentliche Kontrollobjekt, der ich die Verantwortung für eine interne Kontrolle zuweise. Wenn Teile der Regierung und ihrer Administration Todesschwadrone initiieren, halte ich die Forderung für berechtigt, wenn nicht sogar für geboten, daß andere Teile derselben Institutionen dies nicht tolerieren und auf diese Weise eine Selbstkontrolle ausüben.
Die einzelnen Blöcke sind in der Dynamik des Aufklärungsprozesses unterschiedlichen Veränderungen unterworfen worden, die sich hinsichtlich ihrer Wirkung auf die Konsolidierung der einzelnen Bereiche bewerten lassen, und die zusammengenommen ein Urteil über das politische Gesamtsystem zulassen.
Bevor verschiedene Konsolidierungskonzepte diskutiert werden, müssen beide aufeinander bezogenen Bestandteile des Begriffspaares, Konsolidierung von Demokratie, hinsichtlich ihrer Bedeutungsvielfalt und begrifflichen Reichweite charakterisiert werden. Wann man von einem demokratischen System sprechen kann, ist dabei unter den Demokratisierungsforschern, nicht unter den Demokratietheoretikern, wenig umstritten, auch wenn man sicher nicht von einem paradigmatischen Konsens sprechen kann (Merkel 1995: 32f.). a) Demokratie: In annähernd allen Beiträgen zur Konsolidierungsforschung wird Bezug auf die Minima genommen, die Dahl (1989: 233) in dem Demokratiekonzept der Polyarchie entwirft.3Eine Anzahl von Verfahren und Institutionen bilden den Rahmen, der die beiden zentralen Elemente, pluralistischer Wettbewerb sowie politische Partizipation, zur Wirkung bringen. Beide Grunderfordernisse einer Demokratie werden in sieben Kriterien konkretisiert: gewählte Amtsträger; freie und faire Wahlen; universelles Wahlrecht; freier Zugang zu öf-
3Umnur einige zu nennen: Ethier 1990, Morlino 1998, O`Donnell 1996, O´Donnell/ Schmitter 1986
Page 8
fentlichen Ämtern; Meinungsfreiheit; Zugang zu pluralistischen Informationen; Vereinigungsfreiheit.
Einzelne Autoren wie O´Donnell (1996) ergänzen diese Kriterien um einzelne weitere: So müssen die gewählten Vertreter die Möglichkeit haben, ihre Amtszeit turnusgemäß zu beenden und zusätzlich muß gewährleistet sein, daß die geltenden Freiheiten dauerhaft sind. So auch Schmitter und Karl ( zit. in Morlino 1989), die fordern, daß die gewählten Vertreter frei von Zwängen durch de facto- oder ausländische Mächte regieren können. Linz (1996), DiPalma (1990) und Przeworski (1995) fassen den identischen Grundgehalt etwas komprimierter.4Allen liegt ein funktionales Verständnis von Demokratie zugrunde, der explizit keinen normativen Gehalt hat.
Als Arbeitsdefinition soll der von O´Donnell erweiterte Dahl´sche Demokratiebegriff gelten. b) Konsolidierung: Aufgabe dieses Abschnitts ist es, aus der Vielzahl verschiedener Definitionen von Konsolidierung die Entscheidung für dasjenige Konzept zu treffen, das einerseits allgemein am überzeugendsten einen Konsolidierungsprozeß abzubilden vermag und andererseits für die Beantwortung der konkreten Fragestellung den größten analytischen Ertrag hat. Da die Fragestellung nicht auf die Analyse des Konsolidierungsprozesses in seiner Gesamtheit zielt, muß also vorrangig ein eingegrenzter theoretischer Rahmen aus den vorliegenden Theorieansätzen zur Konsolidierung entwickelt werden: Weniger bedeutende Teilaspekte der Konsolidierungsdiskussion sollen benannt und deren Vernachlässigung in der Arbeit begründet werden. Andere Teilaspekte, die bedeutend erscheinen, werden akzentuiert und zu einem Raster verdichtet, das über den empirischen Fall, den Caso GAL, gelegt werden kann.5Die Konsolidierungsforschung orientiert sich „...an einer als Prozeß und Resultat verstandenen „Festigung“ und „Sicherung“ demokratischer Regime durch Routinisierung, Institutionalisierung und Strukturierung, die Wandel nicht ausschließt“ (Liebert 1995: 76). Eine sequentielle Dreiteilung, die die Abfolge eines Regimewechsels beschreibt, ist als Idealtyp in der Demokratisierungsforschung zu einem breit akzeptierten Konsens geworden: Krise des autoritären Regimes, Transition, Konsolidierung (ebd.: 76).6
4Przeworski (1988: 58f.) kann für sich in Anspruch nehmen, die wohl minimalistischste Variante einer Demokratiedefinition gefunden zu haben - die „organized uncertainty.“
5Eine wichtige Anmerkung bei der Einschätzung der verschiedenen Konsolidierungskonzepte nimmt Kraus (1996: 263) vor: „Dabei scheint der Begriff der demokratischen Konsolidierung allerdings auch im südeuropäischen Kontext weitaus größere theoretische Definitionsschwierigkeiten aufzuwerfen als der Transitionsbegriff. Letztlich kommen in den einzelnen Vorschlägen zur Bestimmung des heuristischen Stellenwerts, zur inhaltlichen Präzisierung und zur zeitlichen Eingrenzung des Konsolidierungskonzepts auch verschiedene demokratie-theoretische Positionen zum Ausdruck.“
6Die idealtypische Konzeption Lieberts kann in der Weise erläutert werden, daß „...consolidation should be conceived of not as a „phase“ that follows transition in a neat temporal sequence, but rather as a „process“ that
Page 9
In der Empirie jedoch muß von Inkonsistenzen in dieser Prozeßabfolge ausgegangen werden: „...the incipient democratic legality must coexist with important elements of the authoritarian legality which contradict it“ (Maravall/ Santamaría 1986: 89). „...la consolidación abarca todos los procesos por los que el nuevo régimen elimina, reduce a un mínimo o reabsorbe sus iniciales inconsistencias...“ (Maravall/ Santamaría 1989: 186). Dieser Verweis zielt also auf Ungleichzeitigkeiten, die nicht nur den Transitions, sondern auch den Konsolidierungsprozeß kennzeichnen.7Pauschal von der Konsolidierung „insgesamt“ zu einem bestimmten Zeitpunkt zu sprechen, wird damit problematisch.8Ersetzt könnte dies durch eine differenziertere Ur-teilsform werden, die die Konsolidierungsniveaus der jeweiligen Teilregime benennt und in Beziehung zu der Stabilität des Gesamtsystems setzt“ (Merkel 1995: 54). Die verschiedenen Konsolidierungskonzepte lassen sich in Hinblick auf die Reichweite ihrer Forderungen an eine konsolidierte Demokratie in minimalistische sowie maximalistische Positionen einteilen. Die minimalistische Position fokusiert dabei den Konsolidierungsprozeß aus einer strategischen Sicht, die vorrangig die Wahrscheinlichkeit des dauerhaften Erhalts des bisher erreichten demokratischen Bestandes ermitteln will. Die maximalistische Position nimmt eine weitergehende, normative Sicht ein, die eine tiefgreifende Demokratisierung der staatlichen und zivilgesellschaftlichen Sphäre als Ziel der Konsolidierung nennt. Die zwei Pole, zwischen denen sich die verschiendenen Perspektiven bewegen, benennt Schedler als „preventing democratic breakdown“ vs. „deepening democracy“ (Schedler 1997: 1). Zusätzliche Uneinigkeit herrscht in der zentralen Frage, welche politischen, sozialen und ökonomischen Institutionen konsolidiert sein müssen, damit das demokratische System als krisenresistent gelten kann (Merkel 1995: 35) sowie über den Zeitpunkt der erreichten Konsolidierung.9Allgemein wird jedoch angenommen, daß die Phase der Konsolidierung länger dauert als die Transition, da sie eine sehr viel umfassendere und tiefergreifendere Entwicklungsphase darstellt (Pridham 1990b: 108).
may temporally overlap with that of transition, and the outcome of which is entirely indeterminated“ (Gunther/ Diamandouros/ Puhle 1996: 155).
7Für eine differenzierte Abgrenzung von Transition und Konsolidierung siehe Gunther/ Diamandouros/ Puhle 1995.
8Kraus (1996: 264) stützt diese Sichtweise auf die Konsolidierung als ein multidimensionales Phänomen „...das in der Regel eine Vielzahl ungleichartiger und sogar relativ widersprüchlicher Entwicklungsmomente einschließt.“
9„...consolidation is a much more nebulous concept with considerable uncertainty about its point of termination“ (Pridham 1990: 8).
Page 10
Drei Konzepte sollen schwerpunktartig vorgestellt werden. Ihre Auswahl ergibt sich daraus, daß sie beispielhaft für verschiedene Perpektiven stehen und daher einen zentralen Platz in der Literatur einnehmen.10
1.) Einleitend wird Schmitters (1993) Definition genannt, die Konsolidierung als Prozeß der Strukturierung - der Überführung der zufälligen oder gar chaotischen Arrangements der Transitionsphase in eine Form von Teilregimen begreift. Aus einer ungewissen Transitions-Konstellation mit nicht voraussagbaren Entscheidungen entwickeln sich in der Konsolidierungsphase erwartbare Ergebnisse und strukturell bestimmbare Verhaltensweisen und Orientierungen. Routinisierung, Institutionalisierung und Stabilisierung erreichen, daß aus sozialen Beziehungen soziale Strukturen werden, und aus zufälligen Interaktionen geordnete Interaktionsmuster - die partiellen Regime.11
2.) In einer minimalistischen Pespektive definieren Linz und Stepan (1996: 15f.) Konsolidierung als „...political regime in which democracy as a complex system of institutions, rules, and patterned incentives and disincentives has become, in a phrase, „the only game in town“. ...with consolidation, democracy becomes routinized and deeply internalized in social, institutional, and even psychological life, as well as in political calculations for achieving success.“ Zunächst existiert eine vielleicht trivial anmutende Grundvoraussetzungen, ohne die sich keine moderne Demokratie konsolidieren kann: Die Existenz eines Staates -stateness(ebd.: 14f.). Durch die Sezessionswünsche einer starken Minderheit im Baskenland muß dieser Punkt im Verlauf der Arbeit noch problematisiert werden.