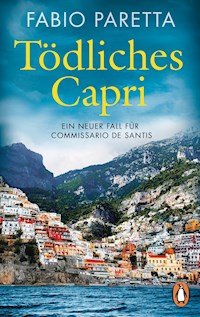9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Franco De Santis
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Franco De Santis ist Polizist von Beruf, Neapolitaner aus Überzeugung und Ex-Ehemann wider Willen. Jeden Sonntag fährt er in das Nobelviertel der Stadt, um seinen Schwiegereltern eine glückliche Ehe vorzuspielen. Doch an diesem schwülen Sommertag wird er in den Arbeiterstadtteil Bagnoli gerufen: Der Gemeindepfarrer hat sich erhängt. Franco kennt ihn seit der Kindheit und weiß, wenn er an eines glaubte, dann an das Leben. Gegen den Willen seines Vorgesetzten beginnt Franco zu ermitteln. Doch in einer Stadt, in der der Schein trügt und der Tod Alltag ist, ist die Suche nach der Wahrheit gefährlich ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 478
Ähnliche
Das Buch:
Franco de Santis ist Polizist von Beruf, Ex-Ehemann wider Willen und Neapolitaner aus Überzeugung. An einem schwülen Sommertag wird er in das Arbeiterviertel Bagnoli gerufen: Der Gemeindepfarrer hat sich erhängt. Doch Franco glaubt nicht an einen Selbstmord und beginnt zu ermitteln. Gegen den Willen seines Chefs. Mit der Hilfe seines besten Freundes. Der gute Kontakte in die Welt des organisierten Verbrechens hat – weil er ihr selbst angehört …
Der Autor:
Fabio Paretta ist das Pseudonym eines in Italien lebenden Autors. Er hat bereits an einigen erfolgreichen Buchprojekten mitgewirkt. Mit Die Kraft des Bösen verbindet er seine große Leidenschaft für das Erzählen mit seiner Begeisterung für das Land, in dem er seit Jahren lebt, und erkundet dabei Sonnen- wie Schattenseiten Süditaliens. Fabio Paretta ist mit einer Italienerin verheiratet und hat zwei Kinder.
Fabio Paretta
Kriminalroman
Prolog
Sie ging in die Küche, zündete sich eine Zigarette an, drehte das heiße Wasser auf, gab Spülmittel hinzu und starrte auf das schmutzige Geschirr im Becken, das langsam im Schaum versank. Schwach fühlte sie sich, hilflos, überflüssig. Sie bekam kaum Luft in der stickigen Mansarde. Schräge Wände, ein zerschlissener Vorhang am Dachfenster, Schimmelflecken in den Winkeln. Die Wohnung war schon für einen Bewohner zu eng, geschweige denn für zwei. Dennoch hatte ihre Freundin sie aufgenommen und erduldete sie schweigend. Was für ein Leben. Aber was sollte sie tun? Sie musste an ihren Sohn denken. Er brauchte Geld. Wo sollte sie es hernehmen?
Aus dem Radio tönte ein Liebeslied. Das Neapolitanisch ging unter die Haut. Genau wie seine Stimme, die sie eben noch am Telefon gehört hatte und die wie beim ersten Mal tief in ihr widerhallte. »Du hast dir das Meer in die Augen gegossen und in meine Brust einen Schmerz.«
Am liebsten hätte sie ihn gleich wieder angerufen. Aber wenn sie dann auflegten, war es schlimmer als vorher.
Ein Scheppern, sie schrak zusammen. Das Geräusch war aus dem Treppenhaus gekommen. Wohl nur der Blecheimer der Putzfrau, die zu den unmöglichsten Zeiten durchs Haus schlich. Eine der vielen unsichtbaren Existenzen, die rund um die Uhr schufteten, um ihre Kinder durchzubringen und sonntags dem Ehemann eine Stange Zigaretten in den Knast zu fahren. Wenigstens konnte sie ihn sehen, ihren Mann, und ihre Hand auf die Scheibe im Besuchsraum legen.
In der Gasse knallte eine Autotür, wieder zuckte sie zusammen. Es wurde gestritten, oder einige Halbstarke taten nur so, irgendwo explodierte ein Böller, jemand lachte, und dann heulte ein Motorrad auf. Sie wurde noch verrückt in diesem Loch. Dabei war es die Stadt, die einen verrückt machte.
Sie ging ans Fenster, spähte durch die Läden, das Motorrad fuhr davon, das Auto parkte aus. Nichts Verdächtiges.
Also konnte sie sich entspannen, das Küchenradio lauter stellen und leise mitsingen, die vielen Vokale und Konsonanten imitieren, mit denen die Neapolitaner ihre Worte anreicherten, während sie dafür ganze Silben einfach unter den Tisch fallen ließen. Der Sänger schmachtete eine gewisse Maruzzella an, Maruzzella, ein Wort, tausend Bedeutungen. Marisalein, Löckchen, kleine Schnecke …
Maruzzella, Maruzze’
Prima me dice sì
Po doce doce me fai morì.
Zuerst sagst du Ja, und dann bringst du mich sanft, ganz sanft um.
Sie drehte das Wasser ab, drückte die Zigarette in einem Joghurtbecher aus und zog Gummihandschuhe über. Die Musik berührte eine besondere Saite in ihr – aus dem würzig-schwülen Geruch des Sommers, aus Seetang, Abgasen, Müll und frischer Wäsche tauchte plötzlich die Vergangenheit auf. Staub auf der Zunge. Trockene Kiefernnadeln und Weizen, die sanfte, unendliche Ebene, die golden glänzte und fern, fern am Horizont durch einen Waldsaum vom Himmel getrennt wurde.
Warum nur bin ich weggegangen?, dachte sie. Auf der Suche nach einem besseren Leben. Gefunden hatte sie es nicht. Oder etwa doch? War sie nicht sogar glücklich gewesen? Mit ihm?
Mit dem Unterarm wischte sie sich die Augen trocken. Sie hatte einfach zu viel erwartet. Eine feste Arbeit, Geld für ihren Sohn, das war Glück genug. Aber auch noch Geborgenheit, Liebe? Maßlos war sie gewesen, hochmütig, und jetzt musste sie dafür büßen. Wie viel Verständnis habe ich gefunden in deinen Augen, in deiner Seele! Deine Augen dringen tiefer als jedes Wort. Aber wenn du redest, lügst du. Wie sehr ich dich hasse! Weil du mir fehlst.
Männer. Sie brachten kein Glück. In der Heimat nicht und in Italien auch nicht. Sie wusste es seit zwanzig Jahren, und doch hatte es sie wieder erwischt. Weil sie blöd war, unvorsichtig, weil sie nicht einsehen wollte, dass Männer sich abbringen ließen vom Wesentlichen. Durch kleinliche Gedanken, die sie Ideale nannten. Eine solche Begegnung gab es im Leben nur einmal. Sein Leumund, sein Amt – alles wichtiger als sie. Du musst weg, ich habe Angst um dich. Ist besser so. Für dich, hatte er gesagt. Schwachsinn! Für ihn war es besser. Männer waren feige und fantasievoll in ihren Lügen, die man so gerne glaubte. Sie erfanden hehre Ausreden für ihre Schäbigkeit, der sie opferten, was im Leben das Wichtigste war: Liebe.
Als sie mit dem Spülschwamm Gläser und Tassen auswischte, beruhigte sie das warme Wasser, und die monotonen Bewegungen gaben ihr das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun, obwohl sie die Gefangenschaft nicht länger ertrug. Auch nicht das Doppelbett, das sie mit ihrer Freundin teilte, die zwei Zahnbürsten und die schmutzige Wäsche, die sich auf den Fliesen zu einem Knäuel vermengte.
Sie suchte Trost in den Gedanken an ihren Sohn. Ein Glücksfall. Er hatte ein brillantes Abitur gemacht, Sprachen gelernt, wollte Anwalt werden, internationales Recht. Sein schmales Gesicht tauchte vor ihr auf, das jedes Mal ein wenig reifer und entschlossener wirkte, wenn er, nach langem Betteln, ein Foto mit dem Handy schickte. Er war ein attraktiver Mann geworden. Schleppte sich hungrig in die Uni, paukte verbissen für die Prüfungen, obwohl er nicht wusste, ob alles vergeblich war. Die Studiengebühr für das nächste Semester … Wenn sie kein Geld auftrieb, war alles umsonst.
Plötzlich ein Knall an der Wohnungstür. Kurz und trocken, wie eine kleine Explosion. Instinktiv lief sie Richtung Schlafzimmer, warf sich auf das Bett und fischte nach der Plastiktüte unter der Matratze, in der ihr Pass und die wenigen Wertgegenstände steckten. Dabei hinterließ sie eine Schaumspur auf dem Boden. Als sie in den winzigen Flur trat, stand ihr ein Mann gegenüber. Er hielt eine Waffe auf ihren Kopf gerichtet und legte einen Finger auf die Lippen, um sie zum Schweigen zu bringen. Das war überflüssig. Der Schrei war ihr in der Kehle stecken geblieben, als sie sein Gesicht sah. Er trug nämlich keine Maske. Der Mann dirigierte sie in das einzige Zimmer, trat an die Stereoanlage und stellte Musik an. So laut, dass die Bässe auf ihrer Bauchdecke kitzelten. Techno, den Lärm, den Jolanta so gern mochte, während aus dem Küchenradio, hilflos und verzweifelt, Sergio Bruni noch immer rief: »Maruzzella, Maruzze’ …«
Als der Mann auf sie zutrat, griff sie nach dem Kreuz an der Kette auf ihrer Brust. Bitte nicht, betete sie. Dass er nicht maskiert war, konnte nur eines bedeuten: Er würde sie töten. Nein, dachte sie, das kannst du nicht tun. Nicht mit diesem Gesicht, in dem so viel Güte steckt. Du siehst aus wie mein Sohn mit deinem kurz geschnittenen, gewellten Haar. Ihr könntet Brüder sein. Nur die Augen … Müde Lider hingen darüber, als wäre alles für ihn eine Last.
»Ich habe ein solches Verlangen, dich zu küssen. Reck mir deinen kleinen Mund entgegen, der süß wird wie Zucker, um mich zu vergiften«, sang Bruni.
Ich muss überleben, dachte sie. Wenn ich jetzt sterbe, war alles umsonst, für mich, für ihn. Die jahrelange Plackerei, das Abitur, die Hungerjahre. Sie wollte ihren Sohn noch einmal in die Arme schließen. Nur ein einziges Mal, nach drei Jahren …
»Bitte nicht«, flehte sie und versuchte, zwischen dem Sofa und dem Fremden hindurchzugleiten.
Da traf sie ein Schlag im Gesicht, und alles war dunkel.
Ein heftiger Schmerz brachte sie wieder zu sich, jemand zog an ihrer Kopfhaut, als schleifte er sie an den Haaren. Sie fiel aufs Sofa. Plastik schnitt in ihre Fuß- und Handgelenke, Leder verschloss ihr die Lippen. Etwas Glühendes senkte sich auf ihre Haut, jagte einen Stromschlag durch den Unterarm und verströmte den Geruch von Gummi und verbranntem Fleisch. Sie wollte schreien, aber sie konnte nicht. Als ihr Atem sich beruhigt hatte, löste der Lederhandschuh sich ein wenig von ihren Lippen. Dann hörte der Technobeat auf zu hämmern, und wie hinter einem Schleier sah sie, dass der Mann die Fernbedienung in der Hand hielt und lächelte.
»Willst du leben?«, flüsterte er. »Du musst nur telefonieren.«
1
Die Fliege kroch so langsam über die Panoramascheibe, als wäre sie verletzt, aber dann merkte Franco De Santis, dass sie den Bauch von außen gegen das kühle Glas presste, um sich in der Augusthitze ein wenig Linderung zu verschaffen. Er dagegen saß in klimatisierter Luft an der festlich gedeckten Sonntagstafel und zerteilte den Seeteufel, den seine Frau Isabella auf den Punkt gedünstet und mit Kräutern von der Dachterrasse verfeinert hatte. Das Filet zerfiel auf der Zunge in saftige, zarte Stücke und entfaltete den Duft des Meeres.
Franco schloss für einen Moment die Augen, trank einen Schluck Wein und genoss, wie das Tischgespräch zwischen seiner Frau, ihrer Tochter und den Schwiegereltern allmählich zu einem sanft wogenden Rauschen verschwamm.
»In die Oper?«, fragte seine Schwiegermutter gerade.
»Oper«, »Carmen«, »San Carlo« – De Santis hörte nur sanftes Blubbern, wie die Luft, die aus dem Lungenautomaten an die Oberfläche steigt.
»Aber das hättet ihr mir doch sagen können, ich hätte euch Karten besorgt!«, fiel der Schwiegervater ein. »Franco!«
De Santis fuhr zusammen, er wusste nichts von einem Opernbesuch. Er wollte nur diesen Sonntag genießen, das Essen und vor allem den Augenblick, wenn er Isabella für sich haben würde.
»Gebt eure Karten zurück. Morgen treffe ich Riccardo Muti im Rotary Club, von dem bekomme ich sie gratis«, meinte der Schwiegervater. Er verkehrte in den besten Kreisen der Stadt, oder besser gesagt, die Kreise, die sich um ihn bildeten, galten als die besten.
»Unsere haben auch nichts gekostet. Ein Kunde hat sie mir gegeben«, konterte Isabella lächelnd.
De Santis betrachtete sie und dachte: Was für eine Frau! Was für ein unerklärliches Glück, das ich damals hatte.
»Seit wann geht ihr denn wieder zusammen aus?«, fragte die vierzehnjährige Ludovica mit einem engelhaften Lächeln.
Die Sonntagsessen waren ein ebenso köstliches wie heikles Ritual. Zwar hat so gut wie niemand einen unbefangenen Umgang mit seinen Schwiegereltern, vor allem wenn sie aus einer völlig anderen Schicht stammen, aber bei Franco war die Sache besonders kompliziert. Denn vor sechs Wochen war er ausgezogen, damit sie beide nachdenken konnten über ihre Ehe. Er brauchte nicht nachzudenken, er wollte sie weiterführen, doch Isabella war noch zu keinem Ergebnis gekommen. Einstweilen wahrten sie den Schein, und sonntags, nach dem Dessert, wurde nach wie vor diese Ehe vollzogen.
»Warum sollten sie nicht zusammen ausgehen?«, fragte die Schwiegermutter zurück, sichtlich alarmiert.
De Santis spürte, wie ihm ein Schweißtropfen auf die Stirn trat, trotz der angenehmen neunzehneinhalb Grad Celsius.
»Na jaaa«, setzte Ludovica an, »es gibt da so einiges …«
Sowohl Isabella als auch Franco versuchten, ihre Tochter mit drohenden Blicken zu bändigen, aber seit Ludovica in der Pubertät war, hatte sie den Rausch der Macht und die Lust an der Eskalation entdeckt. Da ihr das Leben an sich, besonders aber das ihrer Eltern, schnurzegal war, setzte sie es gerne aufs Spiel und verfolgte erheitert, wie das Ganze ausging. Meistens mit einer beachtlichen Prämie. Für sie. Sie drohte mit der Apokalypse, und die Welt zahlte, um nicht unterzugehen.
»Was heißt das, einiges?«, fragte der Schwiegervater in formellem Ton. Man bewegte sich nun nicht mehr auf der Ebene des Klatsches, sondern der offiziellen Verlautbarungen.
»Das, was in jeder Ehe vorkommt, selbst in der besten«, wiegelte De Santis ab.
»Ha!«, lachte Ludovica kurz und höhnisch.
»Schluss jetzt«, schaltete Isabella sich ein, sprang auf und fügte hinzu: »Hilf mir mal mit dem Dessert.«
Das Mädchen blieb sitzen.
De Santis war unschlüssig, was zu tun sei, aber die Anziehungskraft seiner Frau war stärker als die Angst vor einem Eklat, den ihre Tochter in seiner Abwesenheit heraufbeschwören mochte. »Ich greif dir unter die Arme, Schatz«, sagte er, folgte seiner Frau und legte ihr zärtlich die Hand auf den Rücken. Unter der Seidenbluse spürte er die Muskeln längs der Wirbelsäule. Bei jedem Schritt zeichneten sie die schlingernde Bewegung des Beckens nach. »Isabella«, flüsterte er und näherte sich ihrem Ohr, um das sich die langen schwarzen Locken kringelten.
»Lass das bitte, später …«, sagte sie, wie jeden Sonntag, und er konnte es kaum erwarten, das Protokoll mit dem Nachtisch, dem Espresso und dem Gläschen Sambuca zu absolvieren. »Sieh lieber zu, dass du unsere Tochter zur Räson bringst. Wir haben eine klare Abmachung.«
»Keine Sorge«, erwiderte er.
»Was heißt hier, keine Sorge?«
Was sie nicht wissen konnte und auch nicht wissen sollte: Ludovica erpresste ihren Vater, und noch hoffte sie auf Erfolg. Sie wollte ein iPhone 6 haben, »wie jeder« in ihrer Klasse. Und sie hatte in eleganten Andeutungen eine Verbindung zwischen ihrem Verhalten bei Tisch und diesem Wunsch hergestellt. »Du glaubst doch nicht, dass ich die Komödie vor Oma und Opa mitspiele?«, hatte sie ihm zur Begrüßung gesagt.
»Das glaube ich wohl.«
»Wieso sollte ich?«
»Um weiterhin unser Wohlwollen und unsere Zuwendung zu genießen.«
»Ich brauche kein Wohlwollen, sondern ein neues Handy. Ich mache mich zum Otto vor der ganzen Klasse.«
»Dann lass uns sehen, wie das Essen läuft.«
Sie hatte nur gegrinst. Wo er das Geld für ein iPhone 6 hernahm, war ihr egal, doch ihm war es ein Rätsel, wie er seiner Tochter diesen Wunsch erfüllen sollte. Als Commissario verdiente er, mit allen Ortszulagen, kaum mehr als ein Kellner.
Isabella hatte ein Zitronensorbet vorbereitet, der perfekte Abschluss für ein Fischessen an einem heißen Tag. Als sie das Silbertablett mit den fünf Kelchen anheben wollte, griff er unter ihren Armen hindurch und nahm es ihr ab. Dabei presste er ihr einen Kuss in den Nacken und dachte an das Schlafzimmer, von dem aus man über das Nobelviertel Vomero blickte, hoch über dem Moloch Neapel, diesem Knäuel aus Problemen, diesem Konzentrat aus Müll, Gestank, Revierkämpfen, geschmuggelten Zigaretten, Prostituierten, Dealern, Nonnen, Krippenfiguren und zärtlich gepflegten Totenschädeln. Hier oben würde er in der Satinbettwäsche liegen, auf einer Wolke aus gutbürgerlicher Ordnung, mit der Frau, die er mehr als alles andere liebte, vielleicht sogar mehr noch als seine Stadt.
»Wollen wir nicht langsam wieder rein?«, fragte sie grinsend. »Wer weiß, was sie sonst noch anstellt?«
Er ließ Isabella los, und sie traten lächelnd ins Esszimmer.
Das Gespräch war verstummt, und die Schwiegereltern – er in einem dunkelblauen Zweireiher mit Einstecktuch und zur Krawatte passenden Socken, sie mit Seidenbluse, dezenten Diamantohrringen, Goldschmuck und fein dosierten Botox-Einlagerungen – starrten sie erwartungsvoll an. Ludovica grinste.
Für einen Moment dachte De Santis, er hätte sich getäuscht. Ihr war das Handy scheißegal, sie wollte einfach nur ihre Eltern bloßstellen und hatte das sorgsam gehütete Geheimnis ausgeplaudert.
»Zitronensorbet, du bist ein Engel«, rief der Schwiegervater. »Niemandem gelingt es wie dir.«
Entwarnung. Sie wussten nichts.
»Niemandem gelingt es wie Julia«, sagte Ludovica. Das war der Name der Putzhilfe.
»Sie hat mir nur den Schneebesen gehalten«, sagte Isabella.
Das Mädchen winkte ab, und betretenes Schweigen legte sich über die Tafel. De Santis griff zu seinem Weinglas und trank den letzten Schluck Falanghina, als sein Handy in der Hosentasche vibrierte. Er zog es hervor, erkannte die Nummer eines Kollegen und gleichzeitig, aus dem Augenwinkel, den säuerlichen Blick seiner Schwiegermutter. Er machte eine entschuldigende Geste und trat hinaus in die Diele.
»Franco?«, fragte eine männliche Stimme, es war Gennaro Pizzuoli, Ispettore und sein Untergebener.
»Ja.«
»Wir haben eine Leiche in Bagnoli.«
»Wo bist du?«
»Unterwegs zum Tatort.«
»Nicht zu Hause?«
»Ich hatte noch ein paar Akten aufzuarbeiten.«
»Am Sonntag?«
Pizzuoli war ein exzellenter Polizist, das heißt, er wäre einer gewesen, wenn er denn irgendwann auch mal zum Schlafen gekommen wäre. Er hatte vier Kinder und arbeitete im Pizzabringdienst seiner Frau mit, vor allem an den Wochenenden. Anders kamen sie finanziell nicht über die Runden. Dass er am Sonntag auf dem Revier war, passte gar nicht ins Bild. Es verhieß Probleme, neue Probleme.
»Fahr nach Hause, ich übernehme das.«
»Ich bin schon fast da.«
»Okay, ich übernehme dann vor Ort. Ist die Leiche schon identifiziert?«
»Ja. Es handelt sich um den Gemeindepriester von Sant’Anna. Don Sebastiano.«
»Weiß man etwas über die Umstände?«
»Erhängt im Glockenturm der Kirche, der Küster hat ihn gefunden.«
Es gehörte zu Pizzuolis Tugenden, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen. Mord oder Selbstmord, er wagte sich nicht mit Hypothesen vor.
»Gibt es Anzeichen von Fremdverschulden?«
»Bisher nicht.«
»Ich denke, ich brauche eine halbe Stunde.«
Als Franco zurück ins Esszimmer kam, waren die Sorbets verzehrt.
»Ich muss weg«, sagte er und sog geräuschvoll und hastig an seinem Strohhalm. Die Schwiegereltern schüttelten verkniffen die Köpfe. »Tut mir furchtbar leid«, fügte er hinzu, zog Isabella am Schulterblatt zu sich heran und küsste sie auf den feuchten Mund, der nach Weißwein und Zitrone schmeckte.
Ludovica quittierte die Szene mit angewiderter Miene. Mit einem festen Griff verhinderte er, dass seine Frau sich entwand, und holte sich einen Vorgeschmack auf das, was durch den lästigen Zwischenfall nun um ein, zwei Stunden aufgeschoben wurde.
»Ich bin so schnell wie möglich zurück«, sagte er. »Verzeih, Liebling. Signora,Signore«, er verneigte sich leicht, drückte seiner Tochter einen Kuss auf die Wange und zischte ihr leise, aber unmissverständlich ins Ohr: »Ein Ton, meine Teure, und du kannst das iPhone vergessen!« Dann ging er zur Tür und zog den Autoschlüssel aus der Hosentasche.
»Franco«, rief seine Schwiegermutter ihm nach. »Du wirst doch nicht mit dem Wagen fahren wollen. Du hast Wein getrunken. Du bist Polizist.«
»Auch wenn er kein Polizist wäre, könnte er nicht mehr fahren. Genau hier liegt das Problem: Die Kultur der Legalität fängt im Kleinen an«, setzte der Schwiegervater noch eins drauf.
Um einen Schwall idiotischer Gemeinplätze zu unterbinden, winkte De Santis ab, steckte den Autoschlüssel wieder ein und log: »Ich habe schon einen Wagen angefordert.«
Während er hinunter auf die Straße ging, tat er es tatsächlich. Er gab es ungern zu, aber seine Schwiegereltern hatten recht.
2
Ganze dreißig Minuten stand De Santis sich die Beine in den Bauch. Froh, dem Tischprotokoll entkommen zu sein, und zugleich verärgert, dass er nun noch mehr Zeit verlor. Er sehnte sich nach seiner Frau, seiner Tochter. Er brauchte keine Zeit zum Nachdenken, er brauchte Isabella. Sie würde ihren Freiheitsdrang bald ausgelebt haben und sich hoffentlich auf den Wert ihrer Ehe besinnen, und die pubertierende Ludovica … So wie aus dem kleinen, arglosen Bündel, das er mit seinen Dreimonatskoliken auf dem Arm gewiegt hatte, ein berechnendes Biest geworden war, so konnte es auch wieder ein folgsames, seinen Vater bewunderndes kluges Mädchen werden. Nicht sehr wahrscheinlich, aber auch nicht auszuschließen, dachte De Santis und steckte sich die dritte Zigarette an. Der Schweiß rann ihm den Rücken hinab, und er trat unter dem Zitronenbaum hervor, um dem Schatten des Palazzos zu folgen, der sich mit dem Lauf der Sonne verschob.
Ein Alfa Romeo kam mit Blaulicht, heulender Sirene und quietschenden Reifen um die Kurve und raste an De Santis vorbei, der gerade noch den Arm heben konnte. Krachender Rückwärtsgang, aufheulender Motor, dann rumpelte der Wagen auf den Gehweg und die Beifahrertür flog auf.
»Steigt ein«, sagte der Mann am Steuer, dessen Fülle sich über beide Sitze ergoss.
De Santis gehorchte, der Wagen schoss los, durch eine Wolke von verbranntem Gummi. Am Steuer saß Giuseppe, genannt »Beppe«, Bomba. Ein Künstlername, dachten die meisten, doch er hieß tatsächlich so. Einzelkind, siebenundzwanzig Jahre, einhundertvierzig Kilo Lebendgewicht, an dem angeblich eine Stoffwechselstörung schuld war. De Santis verschlug es den Atem, im Innenraum hing schwüle Luft, getränkt von einem schweren Parfüm. Er versuchte gleichzeitig, sich anzuschnallen, das Fenster zu öffnen und Beppe zu einem vernünftigen Fahrstil zu animieren.
»Hast du ein neues Aftershave?«, fragte er laut, um das lärmende Radio zu übertönen.
»Lasst das Fenster zu, die Klimaanlage läuft.«
Bomba hatte die neapolitanische Angewohnheit, alle Vorgesetzten im Pluralis Majestatis anzusprechen. Es war ihm einfach nicht abzugewöhnen.
»Nicht besonders gut.«
»Das Kühlmittel ist knapp, aber mit dem Motor kommt auch die Klimaanlage auf Touren.«
Während der Radiosprecher die Aufstellung des SSC Neapel für das heutige Heimspiel durchgab, raste Beppe Bomba die engen Straßen des Vomero hinab, verscheuchte andere Fahrzeuge und erreichte schließlich die Autobahn, wo er zwei Gänge höher schalten konnte. De Santis wurde auf dem Sitz hin und her geschleudert, Seeteufel, Sorbet und der Wein schwappten in seinem Bauch umher.
»Nicht nötig, dass du so hetzt. Der Mann ist bereits tot.«
Zur Linken öffnete sich das Panorama, man sah das blaue Meer, über dem gräulicher Dunst hing.
Bomba antwortete nicht, auch drosselte er das Tempo nicht. Im Radio wurde der Saisonauftakt der Serie A analysiert. Eine Enttäuschung. Der Präsident des SSC Neapel hatte den aufgebrachten Fans eine neue Ära versprochen, mit neuem Trainer und neuen Stürmern. Aber die erste Partie hatte die Mannschaft verloren, gegen Sassuolo, einen Provinzverein. Jetzt stand die Heimpremiere an. Mit den sechzigtausend Fans im Rücken sollte ein Sieg ein Leichtes sein. Ein Astrologe wurde zugeschaltet. Er hatte die Sternzeichen und jeweiligen Aszendenten der Spieler studiert, doch seine Prognose fiel nicht allzu günstig aus, denn ausgerechnet in der Innenverteidigung herrschte negative Energie. »Mars im dritten Haus. Es fehlen innere Ruhe und Gelassenheit. Wir werden unnötige Gegentore kassieren.«
De Santis fiel ein, dass sein Kollege zu den Besitzern einer Dauerkarte für die Fankurve gehörte. »Warum bist du nicht im San Paolo?«
Bomba zuckte mit den Achseln. »Die Zentrale hat mich angerufen. Ihr wisst, wenn die Pflicht ruft, stehe ich bereit.«
Das sah De Santis ein wenig anders. Trotzdem mochte er seinen Mitarbeiter mit dem kindlichen Grinsen, das über eine mysteriöse Form von Intelligenz hinwegtäuschte. »Er hätte doch Marin anrufen können, der geht sicher nicht zum Spiel.« Mario Marin war sein Vize, die Korrektheit und Dienstbeflissenheit in Person. Und Norditaliener.
»Der ist übers Wochenende bei seinen Eltern in Verona.«
Vor der Mautstation verscheuchten sie die Autos in der Schlange und ließen sich die Schranke öffnen.
»Du willst dir wirklich das erste Heimspiel entgehen lassen?«
»Also, ehrlich gesagt, Commissario, wollte ich Euch am Tatort absetzen und dann zum Stadion fahren. Wenn Ihr damit einverstanden seid. Ich würde Euch nach dem Spiel natürlich wieder abholen.«
Je weiter sie Richtung Westen kamen, desto dichter wurde der Verkehr. Scooter mit Fans und Fahnen, geöffnete Seitenfenster, Gesänge, Schals, Bierflaschen. Um das Stadion San Paolo herum waren alle Straßen verstopft, von wallenden SSC-Anhängern, von improvisierten Verkaufsbuden und Parkplatzanweisern. Hellblau war die Farbe des Vereins, hellblau waren die Flaggen an den Ständen der fliegenden Händler, die Trikots, Feuerzeuge, Schlüsselanhänger, Spielerporträts, Ohrringe, Gürtel, Mützen, Pantoffeln und Kaffeetassen verkauften. Dazwischen schoben sich Mannschaftswagen von Polizei und Carabinieri, Autos parkten auf den Gehsteigen und Verkehrsinseln in zweiter und dritter Reihe, von den Bahnhöfen strömten Menschenpulks herbei. Niemand ließ sich von einer Sirene beeindrucken, denn Sirenen heulten überall. Bomba schoss durch Nebenstraßen und über begrünte Seitenstreifen, riss an der Handbremse und dem Lenkrad. Er fuhr wie im Rausch, wie ein bekiffter Formel-1-Pilot.
Seine Wangen waren flammend rot, seine Augen glänzten. Trotz der Hitze trug er eine Windjacke, die er bis zum Kinn geschlossen hatte. Der Schweiß rann ihm in Strömen in den Kragen. Beppe Bomba hatte kein neues Aftershave, er hatte eine Fahne.
»Beppe, hast du getrunken?«, fragte De Santis.
»Nein, Signor Commissario, ich war mit meiner Mutter essen.«
Er legte sich schräg über Bombas Wanst und roch an seinem Atem. »Halt an.«
»Das war nur ein kleiner ammazzacaffè. Wirklich! Und ich habe den Auftrag, Euch zu fahren.«
»Ich bin längst wieder nüchtern. Weißt du, was passiert, wenn du erwischt wirst?«
»Niemand hält einen Streifenwagen für eine Alkoholkontrolle an.«
»Und wenn du einen Unfall baust?«
»Jetzt malt doch nicht gleich den Teufel an die Wand. Negative Gedanken ziehen das Unglück an.«
»Wer sagt das?«
»Ihr.«
De Santis war verunsichert. »Komm, halt hier an und steig aus, dann kommst du noch rechtzeitig zum Anpfiff«, sagte er.
Bomba fuhr rechts ran und sprang aus dem Auto. »Signor Commissario, das vergesse ich Euch nie. Wenn der SSC Neapel heute gewinnt, ist das Euer Verdienst.«
Der Commissario ging um das Fahrzeug herum, das ihm irgendwie merkwürdig vorkam, setzte sich ans Steuer und ließ das Fenster herab. Bizarre Logik, dachte er, aber gegen den Aberglauben der Neapolitaner kam man ebenso wenig an wie gegen den der Fußballfans. Plötzlich wurde ihm klar, was hier nicht stimmte: der Schriftzug »Polizia Penitenziaria«, Strafvollzug.
»Beppe, wieso haben sie dir keinen von unseren Wagen gegeben?«, rief er hinaus.
»Gut, dass Ihr mich daran erinnert. Der soll im Knast in Poggioreale abgeliefert werden. Aber das könnt Ihr ruhig auf dem Rückweg erledigen.«
»Auf dem Rückweg?«, rief De Santis, »Poggioreale liegt am anderen Ende der Stadt!«
»Sicher, nur …«
»Ist egal jetzt. Beeil dich, sonst verpasst du noch den Anpfiff.«
Bomba verschwand in der Menge der singenden Fans. Die Windjacke, die er im Nu abgestreift hatte, offenbarte jetzt ihren Zweck: Sie hatte das Trikot von Diego Maradona und die beiden Schals der Meisterschaftssaisons verborgen. Wehmut beschlich De Santis. Er war 1987 beim letzten Spiel, als alle Dämme brachen, im Stadion gewesen. Der erste Meistertitel für Neapel, der erste Meistertitel überhaupt für eine süditalienische Mannschaft, mit Maradona, dem besten Fußballer aller Zeiten, der Ikone der Stadt. Diego Armando Maradona, diese Mischung aus Laxheit und Genialität, dieser magische, göttliche Virtuose, der alle Anfeindungen, Spielmanipulationen und die finanzielle Übermacht des Nordens umdribbelt und die Stadt mit seinen Finten zum scudetto geführt hatte.
Beppe Bomba, der Ärmste, war da noch gar nicht geboren.
3
Kaum hatte er die Betonschüssel hinter sich gelassen, leerten sich die Straßen, nur hin und wieder sah De Santis verspätete Strandbesucher. Vater, Mutter, Kind mit Luftmatratzen und Sandeimerchen, die zu dritt auf einer Vespa saßen, oder Autos, aus deren offenen Fenstern die Angelruten ragten und Hip-Hop dröhnte. Sie alle flohen vor der Hitze ans Wasser.
Der Stadtteil Bagnoli, westlich von Posillipo, dem vorgelagerten Kap mit Steilküste, war wie Neapel selbst ein geografischer Glücksgriff. Die harschen Felsen fielen hier zu einem breiten, weiß schillernden Sandstrand ab, dahinter vulkanische Hügel mit Thermalquellen. Die Bucht wurde bewacht von den Inseln Procida und Ischia, die wie gutmütige Seedrachen aus dem Wasser ragten. Der Name »Bagnoli« stammte vermutlich von seiner ursprünglichen Funktion, dem Baden, und nur die respektlose, an destruktiven Wahnsinn grenzende Fantasie und Gier der Menschen hatten darauf verfallen können, hier eines der gewaltigsten Schwerindustriereviere Italiens anzusiedeln. Das Geschwür aus Schornsteinen, Molen und Werkhallen jagte pro Stunde eine Million Liter Ammoniak, Chlor, Sulfide, Phenole und Kohlenwasserstoffe in Meer und Himmel.
Dank dieses Wahnsinns hatte sich das elitäre Seebad in ein prosperierendes Arbeiterviertel verwandelt, und dann hatte man, als wollte man eben diese Arbeiter für den Hochmut des Pioniergeistes büßen lassen, Anfang der Neunzigerjahre angefangen, Teile des Werkes zu verkaufen und dann zu schließen. Längst waren die letzten Aktivitäten eingestellt, Bagnoli drohte sich in eine Geisterstadt zu verwandeln, bewohnt von Rentnern, die den guten alten Zeiten nachtrauerten und ihre kargen Pensionen mit den Jugendlichen teilten, die nicht wussten, warum sie hier geboren worden waren.
Unterhalb des Kaps von Posillipo, wo einst das Stahlrevier gelegen hatte, war nun eine riesige Brache. Das Zentrum des Viertels teilte eine verfallende Prunkstraße; Art-déco-Villen, Palmen, außen herum hässliche Wohnblocks aus den Nachkriegsjahrzehnten.
Vor der Sant’Anna-Kirche drängten sich Schaulustige und machten dem Streifenwagen nur unwillig Platz. De Santis parkte auf dem Fußgängerweg und stieg aus. Das Licht blendete, und er suchte seine Sonnenbrille. Dann zündete er sich eine Zigarette an und sah auf die Menge wild gestikulierender, lauthals schreiender Menschen.
Der Tod des Pfarrers hatte sich in Windeseile herumgesprochen, und nun war die Gemeinde zusammengeströmt, um einen Blick auf den Tatort zu erhaschen, Spekulationen auszutauschen, den Herrn anzurufen und auch ein wenig zu rüffeln. »Im Parlament sitzen genug Halunken, aber da hätten sie die Qual der Wahl gehabt. Lieber holen sie sich einen von uns, das ist einfacher«, murmelte eine gebeugte Alte. Die Menge scharte sich um den Rettungswagen, man sah Uniformen, Spruchbänder, Hunde bellten, Fernseher dröhnten, Autos versuchten, sich hupend einen Weg zu bahnen. Die Fahrer stiegen aus, fingen an zu diskutieren und mischten sich dann ebenfalls unter die Schaulustigen. Niemand schien von De Santis Notiz zu nehmen, dennoch spürte er die Abneigung. Die Staatsmacht war eingetroffen, die Sendboten Roms, die letzten einer langen Tradition von Usurpatoren.
Die Kirche selbst war ein Ausbund an Hässlichkeit, eine Art gespreizte, auf den Schalen balancierende Miesmuschel, neben der betongrau der Glockenturm in die Höhe ragte, der an den Pappkern einer aufgebrauchten Küchenrolle erinnerte. Auch im Kirchenschiff drängten sich die Leute. An den Kerzenleuchtern und Fensterrahmen waren handgemalte Transparente vertäut. »Arbeit für alle«, »Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott«, »Brot statt Lügen« stand darauf.
Als De Santis einen Vigile fragend ansah, erklärte der Mann: »Das ist dieses rote Gesocks. Nennen sich Arbeiterkomitee und halten die Kirche besetzt. Schon seit Wochen. Wenn es nach mir ginge …«
De Santis ließ sich zum ranghöchsten Beamten der Polizia Municipale führen und fragte: »Wo finde ich Ispettore Gennaro Pizzuoli?«
Der Kommandant verzog das Gesicht und zuckte mit den Achseln. »Bisher nicht gesehen.«
Was hatte das nun schon wieder zu bedeuten? Pizzuoli musste längst da sein.
»Und der Staatsanwalt?«
Eigentlich hätte er nach der Staatsanwältin fragen müssen, denn es war Sonntag, noch dazu Heimspiel des SSC Neapel, da würde man sicher zuerst Elvira Barbarossa anrufen, eine Frau mit kupferblonder Lockenmähne und der Ausstrahlung einer – ja, wie sollte er sie beschreiben? Er wusste es nicht. Er wusste nur, dass er die Juristin bewunderte. Wenn auf jemanden der Begriff unerschrocken passte, dann auf sie. Elvira Barbarossa war Sizilianerin, hatte in Palermo und London studiert, einen herausragenden Abschluss gemacht und seitdem, ohne Rücksicht auf ihr leibliches Wohl, ihre Karriere oder politischen Interessen, nur ein Ziel verfolgt: Schufte hinter Gitter zu bringen. Dass sie trotzdem Karriere gemacht hatte, war Zufall, ein sehr glücklicher Zufall, der sie nach Neapel geführt hatte, auf einen Posten, der sogar prestigeträchtig war – und ausgesprochen unbeliebt. Denn als Staatsanwalt in Neapel hatte man so gut wie keine Chance, sich nicht zu kompromittieren.
Ständig musste man taktieren und paktieren, musste seinen Vorgesetzten, und sei es nur zum guten Zweck, Honig ums Maul schmieren und ab und zu einen aufsehenerregenden Fall lösen, um nicht als Duckmäuser zu gelten. Elvira Barbarossas Fälle erregten alle Aufsehen, weil sie nicht nachgab, bis sie in einem vermeintlich banalen Mordfall auch die Hintermänner aufgedeckt hatte. Das war brandgefährlich. Daher war es auch eine Frage der Zeit, wann man sie eliminieren würde – trotz Begleitschutzes. »Es ist bei jedem eine Frage der Zeit«, hatte sie einmal grinsend zu De Santis gesagt, »das müssten Sie als Raucher doch wissen.«
Wieder zuckte der Beamte mit den Achseln. »Bisher ist niemand erschienen. Aber das hier ist der Küster«, stellte der Polizist ihm einen älteren Mann in einer grauen Strickjacke vor. »Er hat den Geistlichen gefunden.«
De Santis grüßte mit einem Nicken und fragte sich, wie der Mann bei der Hitze Wolle über das Hemd ziehen konnte.
»Ich darf vorausgehen.« Der Kommandant war etwa Anfang fünfzig, zackig und beschwingt, frische Bügelfalte in der Uniform, blütenweiß das Lederholster. Sein ganzes Berufsleben schien durch diesen Auftritt Sinn zu bekommen.
Als De Santis das Absperrband am Aufgang zum Glockenturm bemerkte, sagte er: »Gute Arbeit.«
»Danke. Ich habe versucht, auch die Kirche räumen zu lassen, aber keine Chance.«
Das Lob war verfrüht gewesen. Als De Santis am Fuß der Treppe ankam, hörte er Getrappel und Gescharre. Rettungssanitäter und Polizisten gingen auf den Stufen auf und ab. Ein umgestülpter Putzeimer war ebenfalls mit Signalband umwickelt.
»Ist wenigstens der Gerichtsmediziner schon da?«, fragte er.
»Nein.«
Falls es Spuren auf den Stufen gegeben hatte, waren sie zertrampelt. De Santis musste so schnell wie möglich die Kriminaltechnik anfordern, falls es Zweifel an einem Selbstmord gab.
Ein grauhaariger Mann in einem weißen Kittel kam ihm entgegen und stellte sich als Notarzt vor. »Ich habe den Exitus festgestellt. Wir haben die Leiche wegen der Ermittlungen dann nicht weiter bewegt.«
De Santis lobte auch ihn, Fehler waren menschlich, und Neapel war eine besonders menschliche Stadt. Zügig ging er die spiralförmige Treppe hinauf. Kälte wehte ihm entgegen, kroch an seinem schweißnassen Rücken hinab. Er gab dem Kommandanten ein Zeichen, den Turm räumen zu lassen. Während sich die Schritte und Stimmen in der Tiefe verloren und bald nur noch als verzerrter Hall aus dem Kirchenschiff drangen, stieg De Santis die letzten Stufen hinauf. Es war inzwischen nach drei. Ein, zwei Stunden, hatte er zu Isabella gesagt, illusorisch. Sollte er sie anrufen? Aber dann würde er noch ungeduldiger und gereizter werden. Er würde an ihre langen, dichten Locken denken, an ihre kühle Haut, die sich in der Satinbettwäsche bewegte. Vielleicht schlief sie schon. Scheiß Job, dachte er und holte tief Luft. Was er dann sah, verschlug ihm den Atem.
Er blickte auf einen widerwärtigen Satyr, ein aufgedunsenes, grobporiges Gesicht, buschige Augenbrauen und eine rötliche Knollennase über einer schwärzlichen, spitzen Zunge. Die Exkremente hatten Hose und Schuhe besudelt und verbreiteten einen Geruch, der De Santis’ vollen Magen in Aufruhr versetzte.
Wie alt mochte der Mann sein? Schwer zu schätzen. Man musste abstrahieren von seinem Gesichtsausdruck, dieser höhnischen Fratze, die Folge eines grausigen Kampfs gegen das Ersticken war, einer krampfhaften Anstrengung, die schließlich in der größtmöglichen Entstellung verharrt war. Fast jedes Mal überkam De Santis beim Anblick eines gewaltsam zu Tode gekommenen Menschen ein Gefühl von Sinnlosigkeit und Niedergeschlagenheit. Wozu das alles?, dachte er zuerst. Wozu sich abstrampeln und gegen den Verfall ankämpfen, wenn einen am Ende doch der Teufel holt?
Er hörte Schritte unten im Glockenturm, dann laute Stimmen. Der Kommandant der Vigili stritt mit einem anderen Polizisten. »Lassen Sie ihn durch!«, rief De Santis.
Es war sein Assistent, der ihn verständigt hatte. Laut keuchend kam Pizzuoli die Wendeltreppe hoch.
»Wo warst du die ganze Zeit?«
»Unterwegs, Commissario.«
»Du warst doch schon unterwegs, als ich losgefahren bin.«
»Du startest oben auf dem Vomero. Ich musste erst durch die ganze Stadt, alles ist verstopft wegen des Fußballspiels. Wir standen …«
»Schon gut«, sagte De Santis und musterte Gennaro Pizzuoli, der mit seinen achtunddreißig Jahren bereits graue Haare hatte, einen hageren Körper und Augenringe. Er wirkte noch überarbeiteter als sonst. Irgendetwas stimmte nicht. »Wie lange hast du heute Nacht Pizza ausgefahren?«
»Nicht so lange.«
»Und wieso warst du in der Questura?«
»Wie gesagt, ein Bericht, den ich noch fertig schreiben musste.«
»Für wen?«
Pizzuoli zögerte einen Moment. »Für den Chef.«
»Ich bin dein Chef.«
»Den Questore meine ich.«
Der Questore war der oberste Dienststellenleiter in Neapel, eine geradezu entrückte Führungsfigur, die mehrere Ebenen an DirigentiundVicequestorizwischen sich und dem Fußvolk eingerichtet hatte, zu dem sich auch De Santis als Leiter der Mordkommission IV zählte. Wie kam es also, dass Pizzuoli dem Questore Rapport erstatten musste? Worüber denn? Und warum wusste De Santis nichts davon?
Er schaute wieder auf den leblosen Körper.
»Gennaro, finde alles Wesentliche über die Biografie dieses Mannes heraus, Herkunft, die wichtigsten Stationen seiner Laufbahn, Alter, Freunde und so weiter. Unten steht der Küster, frag ihn oder den Vigile. Du erstattest mir kurz Bericht und gehst dann nach Hause.«
»Wieso?«
»Du kannst dich kaum noch auf den Beinen halten.«
»Das stimmt n…«
»Du hast mich verstanden.«
Pizzuoli ging. »Danke, Chef«, sagte er.
Der Kommissar wandte sich wieder der Leiche zu. Sie hing ganz oben im Glockenturm. Glatte, nackte Betonwände, ein blankes Metallgeländer. Auf den Treppenstufen sah man die Abdrücke unzähliger Schuhsohlen.
Dem Commissario fiel der umgestürzte Kübel wieder ein, an dem das Signalband hing. Er rief den Kommandanten. »Wieso haben Sie den Putzeimer gesichert?«
»Um den geht es gar nicht, den habe ich nur darübergestülpt.«
»Über was?«
»Einen Brief. Scheint wichtig zu sein.«
De Santis ging die Treppe hinunter und hob den Eimer auf. Darunter lag ein Blatt Papier, beschwert mit einem Stein.
»Haben Sie auch den Stein da hingelegt?«
»Nein, der lag schon darauf.« Der Kommandant kam langsam die Stufen hoch. »Habe ich einen Fehler gemacht?«
»Nein, im Gegenteil. Haben Sie den Brief gelesen?«
»Nun ja, nicht wirklich.«
»Und was steht darin?«
Der Kommandant, bei einer Indiskretion ertappt, senkte den Kopf. »Er bittet darin um Verzeihung«, sagte er.
»Wo haben Sie den Eimer gefunden?«
»Den hat mir der Küster gegeben.«
Mit seinem Handy fotografierte De Santis den Brief ab und starrte hinauf in den Turm. Der Priester hing an dem dicken, alten Hanfseil einer der schweren Glocken, die in Schräglage stand. Der Klöppel musste mindestens einmal geschlagen haben, als das Gewicht des Körpers das Seil nach unten zog. Ein doppelter Knoten.
Die Gesichtszüge wirkten aufgedunsen, als hätte er reichlich getrunken oder Medikamente geschluckt. Was hatte diesem Menschen Lebensmut und Glauben genommen? Das Elend, das Bagnoli seit der Schließung des Stahlwerks prägte? Der Kampf mit den Arbeitern? Private Probleme? Eine Krankheit? Die auch seine Physiognomie gezeichnet hatte?
Wo blieb denn nur die Staatsanwältin? Es passte nicht zu Elvira Barbarossa, dass sie sich verspätete. Sie hatte zu entscheiden, ob und in welchem Maße Ermittlungen eingeleitet wurden, die über die gerichtsmedizinische Untersuchung und eine grobe Inaugenscheinnahme des Tatorts hinausgingen. De Santis überflog den Brief.
»Liebe Natascha, verzeih mir«, begann er, und er schloss mit: »Leider weißich mir keinen Rat mehr, es gibt keinen anderen Ausweg.«
Das klang nach einem Abschiedsbrief. De Santis rief den Küster zu sich.
»Wer ist Natascha?«, fragte er.
»Die Haushälterin«, antwortete der Küster.
»Hat sie den Brief gefunden?«, fragte der Kommissar.
»Nein«, antwortete der Mann, verstummte und blickte zu Boden. Entweder war er störrisch oder ein wenig beschränkt. Er gab die Worte wie ein Sparschwein preis. Münze für Münze musste man durch den Schlitz angeln und bekam Lust, mit dem Hammer draufzuhauen.
»Wo ist sie?«
»Das weiß ich nicht.«
Wieso wandte der Priester sich an seine Haushälterin und nicht an die Gemeinde? Oder an Gott? Hatte er mit diesem Akt nicht seine Mission verraten? Seinen Glauben? Der Selbstmord war für die katholische Kirche eine Todsünde, für einen Priester ein absolutes Tabu.
War in einem so verzweifelten Augenblick für Don Sebastiano allein der Gedanke an die Haushälterin entscheidend? Weil er ihr zumutete, seine Leiche zu entdecken? Aber wieso hing er im Glockenturm? Wo der Küster viel eher hinkam als die Haushälterin?
Irgendetwas passte hier nicht zusammen.
»Ist sie zu Hause?«
»Nein, das glaube ich nicht«, antwortete der Küster.
»Wieso nicht?«
»Weil sie ausgezogen ist.«
»Wohin?«
»Weiß ich nicht.«
Der Mann machte De Santis verrückt.
»Ich muss später noch mit Ihnen reden, warten Sie bitte im Kirchenschiff«, sagte er und wandte sich ab.
Da niemand etwas vom Gerichtsmediziner oder der Staatsanwaltschaft gehört hatte, rief De Santis den Questore als obersten Dienststellenleiter an. Das Handy klingelte etliche Male, ehe sich die verschlafene, mürrische Stimme Raffaele della Piccas meldete. Offensichtlich hielt er jetzt, um halb vier, seinen Mittagsschlaf.
De Santis entschuldigte sich für die Störung und erklärte den Sachverhalt.
»Wenn es Selbstmord war, hat die Sache keine Eile«, meinte della Picca.
»Ich bin nicht sicher, dass es Selbstmord war. Aber ich stehe hier allein auf weiter Flur. Weder Pathologe noch Staatsanwalt sind bisher eingetroffen.«
»Dann warten Sie eben auf die beiden.«
»Wer von der Staatsanwaltschaft ist zuständig?«
»Ja, um Himmels willen, woher soll ich das denn wissen? Haben Sie dort schon angerufen?«
»Natürlich. Es meldet sich niemand.«
»Heute ist Sonntag.«
»Ich weiß.«
De Santis schwoll allmählich der Kamm. Ganz Neapel lag am Strand, im Bett oder saß im Stadion. »Die Spuren müssen gesichert werden, ehe hier alles zertrampelt ist.«
»Sie sagten, es gebe keine Anzeichen von Fremdverschulden.«
»Bei oberflächlicher Betrachtung. Mich macht allerdings der Fundort der Leiche stutzig.«
»Ich verstehe nicht recht.«
»Es ist ohnehin ungewöhnlich, dass ein Priester Selbstmord begeht. Aber dass er es nicht in seiner Wohnung, sondern im Glockenturm seiner Gemeindekirche tut und dann noch einen Abschiedsbrief demonstrativ am Fundort deponiert …«
»Es gibt einen Abschiedsbrief?«
»Ja.«
»Ist er echt?«
»Kann ich so nicht sagen. Ich finde es aber kurios, dass er auf der Treppe zu Füßen der Leiche lag.«
»Wo hätte er denn sonst liegen sollen?«
»Das Ganze wirkt sehr theatralisch. Noch dazu wendet sich der Priester in seinem Abschiedsbrief an die Haushälterin, die gar nicht da ist.«
»Wo ist sie denn?«
»Ausgezogen. Bisher weiß ich nicht, warum und wohin.«
»Sie meinen, die Haushälterin hat mit dem Tod zu tun?«
»Nein. Dass er sich jedoch an sie wendet, obwohl sie gar nicht mehr bei ihm wohnt, dass er sich im Glockenturm aufhängt und den Brief dort oben hinlegt, das macht mich stutzig.«
Raffaele della Piccas Atmen ging in ein Stöhnen über, das gleichzeitig Tadel, Ungeduld und Groll ausdrückte. »Sie wollen am heutigen Sonntag wegen solcher Spitzfindigkeiten den ganzen Apparat in Aufruhr versetzen? Weil Ihnen der Fundort der Leiche und der Abschiedsbrief nicht passen?«
»Ja.«
»Kommt nicht infrage. Sie warten, bis der Staatsanwalt eintrifft. Der entscheidet.«
»Und wer ist dieser Staatsanwalt?«
»Das sage ich Ihnen gleich.«
Della Picca legte auf und rief zehn Minuten später zurück. Er nannte einen Namen, den De Santis noch nie gehört hatte. Warum nicht Elvira Barbarossa, mit der er so gut harmonierte? Wollte man sie nicht behelligen am Sonntag? Hatte man stattdessen einem unbedarften Neuling den unangenehmen Termin aufgehalst? Oder hatte der Oberstaatsanwalt Angst vor Elviras burschikoser Art? Immerhin war die Kirche involviert, ein Priester, egal ob Mord oder Selbstmord, da musste man diplomatisch vorgehen und so tun, als wäre nichts gewesen. Dazu war Elvira Barbarossa bekanntlich nicht fähig.
De Santis saß fest. Er schrieb Isabella eine SMS, in der er sie vertröstete, und gab dem Kommandanten der Polizia Municipale seine Handynummer. »Rufen Sie mich an, sobald der Staatsanwalt eintrifft. Ich unterhalte mich unterdessen mit dem Küster.«
4
Als De Santis neben dem Mann in der grauen Strickjacke ins Freie trat, war der Ort wie ausgestorben. Ihm fiel ein, dass längst das Spiel lief. Die Leute saßen zu Hause oder in einer Bar, verfolgten die Übertragung im Radio oder im Pay-TV.
»Wer weiß, wie sich die Mannschaft heute schlägt«, sagte er, um den Küster in ein Gespräch zu verwickeln.
»Eins zu eins«, erwiderte dieser, immer noch merkwürdig teilnahmslos.
Der Küster führte ihn quer über den Platz zu einer trostlosen Querstraße, in der sich ein Wohnblock an den nächsten quetschte – unterschiedliche Farben und Verputze, aber dieselbe fantasielose Zweckmäßigkeit.
»Was wird jetzt?«, fragte der Küster. »Von meiner Rente aus der Fabrik können wir die Miete nicht bezahlen.«
Er schloss den Aufgang zu einem Gebäude aus den Sechzigern auf. Kein Aufzug, dafür ein mit schwarzen Schriftzügen verschmiertes Treppenhaus, in dem Musik und die Fußballübertragung widerhallten. Im zweiten Stock betraten sie eine enge Wohnung. Zwei Zimmer, Küche, Bad. Das Telefon hing neben Padre Pio im Flur an der Wand. Aus der Toilette zog eine Duftwolke von Waschlauge und feuchtem Kalk herüber. Der Geruch von De Santis’ Kindheit.
Die Frau des Küsters hatte dicke Krampfadern, die Zehen quollen aus den Badeschlappen, um die Äuglein zahlreiche Lachfalten. »Signor Commissario, ist Ihnen das eigentlich klar?«, rief sie. »Don Sebastiano! Ausgerechnet Don Sebastiano! Als ob wir nicht schon genug gestraft wären hier in Bagnoli!« Sie hielt De Santis am Ärmel fest und schüttelte ihn bei jedem Ausruf. »So ein guter Christenmensch, eine Seele von einem Priester, überall beliebt, mit einem Herz für Jung und Alt, Arm und Reich, Bucklig und Gerade. Ausgerechnet Don Sebastiano! Jetzt sagen Sie selbst!«
»Mach uns mal Kaffee!«, blaffte der Küster und führte den Gast ins Wohnzimmer. Ein stickiger Raum voller Polstermöbel, Spitzendeckchen, Familienfotos in Silberrahmen.
»Ich muss dringend mit der Haushälterin sprechen. Wann genau ist sie ausgezogen?«
Der Küster dachte nach und ruderte plötzlich mit den Armen. »Zwei Wochen, ungefähr, was weiß ich.«
»Und seitdem haben Sie die Signora nicht mehr gesehen?«
»Nein.«
Die Sache war ungewöhnlich. »Hat Don Sebastiano sie entlassen, oder wollte sie gehen?«, fragte De Santis weiter.
»Nein, nein, er hat ihr gekündigt.«
»Warum? War sie unzuverlässig?«
»Nicht dass ich wüsste.«
Verstohlen sah De Santis auf die Uhr. Inzwischen war es vier. Ob Isabella überhaupt noch auf ihn wartete? Wie gerne hätte er jetzt bei ihr im Bett gelegen, die kostbare Stunde der Intimität genossen, statt sich mit diesem trostlosen Fall herumzuschlagen. »Erzählen Sie, was heute passiert ist.«
Der Küster strich sich über die spärlichen Haare. »Also, ich gehe um acht Uhr die Kirche aufschließen. Und dann war da noch der ganze Saustall. Wir hätten heute eine Hochzeit feiern sollen, deshalb hatten die Arbeiter ja gestern aufgeräumt, angeblich. Aber Sie haben selbst gesehen, wie das hier aussieht.«
»Sie meinen die Besetzer.«
»Genau.«
»Wie stand Don Sebastiano zu dieser Aktion?«
»Anfangs hat er sie unterstützt. Aber irgendwann verlor er die Geduld. Er mochte die aggressiven Parolen und das Geschimpfe über die Kirche nicht. Als dann die lange geplante Hochzeit stattfinden sollte, wurde es ihm zu bunt. Die Braut stand vor der Tür, die Verwandtschaft des Bräutigams war aus Sizilien angereist, die Brautleute aus Mailand. Die arbeiten dort in der Bank. Die Hochzeitsgesellschaft, der Fotograf, alles war gebucht, die Blaskapelle, die Fußballmannschaft des Bräutigams …«
»Sie waren bei heute Morgen.«
»Normalerweise ist Don Sebastiano um halb neun da.«
»Diesmal nicht. Wann ist Ihnen das komisch vorgekommen?«
»So gegen halb zehn. Die Messe beginnt um zehn. Andere Priester treffen erst ein paar Minuten vorher ein, nicht aber Don Sebastiano.«
»Dann hätten Sie doch schon vorher misstrauisch werden müssen?«
Der Küster rutschte auf dem Sofa hin und her, schaute Hilfe suchend nach der Tür und schrie: »Rosà! Der Kaffee!«
»Ja, Heiland. So ein Unglück, mir ist die Kanne umgefallen. Aber kein Wunder. Warum musste ich auch nur so alt und schusselig werden? Hätte der Signore mich nicht früher abberufen können? Warum nicht mich, sondern ausgerechnet Don Sebastiano?«
Der Hausherr verdrehte die Augen.
»Also kam es öfter vor, dass er sich verspätete?« De Santis versuchte seinem Gegenüber zu helfen.
»Na ja, er hatte ziemlich viel Ärger. Da kommt es auf ein paar Minuten nicht an.«
»Mit wem hatte er denn Ärger?«
Der Mann zuckte mit den Achseln. Wie so oft. »Der Ort hier, die Leute, die Arbeitslosen … Der Herrgott hat uns die Zeit gegeben, damit wir uns so richtig schinden, damit wir merken, was für arme Sünder wir sind. Am Ende, wenn wir abberufen werden, ist es dann eine Erlösung. Nur wer von uns will schon sterben?«
»Don Sebastiano.«
Der Küster zuckte zusammen. »Sie meinen, es war Selbstmord?«
»Sie nicht?«
»Ich dachte, ein Unglück.«
»Er hing oben im Glockenturm an einem Seil, an einem soliden Knoten. Das war mehr als ein Zusammentreffen unglücklicher Umstände.«
Sichtlich verlegen schüttelte der Küster den Kopf. »Rosà, Himmel Herrgott, müssen wir uns den Kaffee aus der Bar bringen lassen?«
»Ich komme.«
Sie schlurfte mit einem Tablett herein, auf dem neben der Espressokanne, Zucker, zwei Tässchen und aufgeschäumter Milch auch ein Teller mit goldgelbem, maiskolbengroßem Gebäck stand: babà, die neapolitanische Spezialität aus in Rum getränktem Mürbeteig. »Hab ich frisch gemacht. Bitte, greifen Sie zu, Signor Commissario.«
De Santis winkte lächelnd ab. Der Duft war verführerisch, aber am Tatort war sein Magen zusammengeschnurrt.
»Nun lassen Sie sich nicht bitten, Sie können es sich erlauben. Mein armer Mann hat Diabetes, und meine Figur ist auch nicht mehr wie vor dem Krieg«, sie lachte heiser, »aber Sie sind so ein drahtiger, junger Bursche.«
»Beim besten Willen nicht, höchstens eine winzige Kostprobe.«
Zufrieden drückte die Frau ein Brotmesser in das Gebäck und servierte De Santis ein Stück, das immer noch so groß wie ein Hamburger war. Allerdings wäre es eine Todsünde gewesen, das Dessert zurückzuweisen, eine Beleidigung der Gastgeberin und ganz Neapels, denn der babà war ein Aushängeschild der Stadt, eines der vielen.
De Santis biss mit geschlossenen Augen hinein. Der Rum kitzelte die Zunge, die in weicher, flockiger Süße versank, und sein Magen entspannte sich, wurde weich und willfährig. Die österreichische Fremdherrschaft, der Neapel die köstlichen Mehlspeisen zu verdanken hatte, ja selbst der Zahnausfall des einstigen Hofkochs erwiesen sich als göttliche Fügung, die in der Erfindung dieses butterzarten Mürbeteigs gipfelten. »Ein Gedicht«, summte er.
Sie strahlte. »Ermanno, du darfst leider nicht. Zu dumm.« Trällernd schwebte sie hinaus, wobei sie immer wieder murmelte: »Mein armer Ermanno! Zu schade, dass er Diabetes hat, wirklich zu schade …«
De Santis schaute den Mann mit einem solidarischen Lächeln an.
Dieser suchte nach dem Ehering am Finger seines Gegenübers, sah ihn und nickte. »Na ja, Sie wissen Bescheid, Commissario.«
Franco De Santis behielt für sich, dass er getrennt lebte und dass es ihm seitdem noch mieser ging. Er suchte in seinen Taschen nach seinem Notizblock, fand ihn aber nicht – natürlich, er lag in seiner Wohnung – und kritzelte auf eine alte Quittung, dass Don Sebastiano in letzter Zeit offensichtlich von seinen festen Regeln abgekommen war. Da das Thema dem Küster sichtlich unangenehm war, probierte er es von der anderen Seite. »Worum ging es eigentlich bei der Besetzung der Kirche?«
»Wie Sie sicher aus der Zeitung wissen, steht ganz Bagnoli seit der Schließung der Schwerindustriebetriebe ohne Arbeit da. Irgendwann haben sie dann die Città della Scienza errichtet, einen Wissenschaftspark, mit Fördergeldern der EU und aus Rom, es waren alle möglichen Geldgeber beteiligt. Das sollte der Anfang einer flächendeckenden Nutzung werden. Mehrere Arbeitergruppen aus den ehemaligen Stahlwerken haben Genossenschaften gegründet und Vorverträge geschlossen mit den Betreibern, aber dann ist das Ganze in Flammen aufgegangen.«
Es war einer der mysteriösen Fälle der letzten Jahre. Unzweifelhaft Brandstiftung, Beweise gab es genug, nur leider keine Täter. Die Ermittlungen waren im Sande verlaufen. Man vermutete einen Racheakt der Camorra, die die Stadt bei der Auftragsvergabe außen vor gelassen hatte.
»Die Sanierung kommt einfach nicht in Gang, immer wieder wird sie wegen irgendwelcher bürokratischer Hürden verschoben, von den restlichen Projekten wie dem Strandbad oder dem Sport-, Wellness- und Innovationszentrum ganz zu schweigen. Unseren Leuten ist längst das Geld ausgegangen. Sie warten seit Jahren, wollen arbeiten und haben sogar Verträge in der Tasche, verdienen aber keinen Cent.«
»Wieso hat man ausgerechnet die Kirche von Don Sebastiano besetzt? Stand er im Ruf, mit den Bürokraten gemeinsame Sache zu machen?«
»Im Gegenteil. Don Sebastiano hat die Arbeiter schon immer unterstützt. Früher bei Demos, jetzt bei ihrem Protest.«
»Aber dann stand die Hochzeit an, die er unbedingt zelebrieren wollte.«
»Ja.«
»Darüber kam es dann zum Streit.«
»Nicht direkt. Es gab Diskussionen, und alle haben sich darauf geeinigt, dass der Streik ausgesetzt wird.«
»Heute geht er weiter?«
»So war es gedacht. Aber die meisten Arbeiter sind im Stadion, sie wollten gegen Abend wiederkommen.«
»Sie müssen den Leuten Bescheid sagen, dass die Kirche bis auf Weiteres versiegelt ist.«
Der Küster nickte, und sie erhoben sich.
»Ach ja, die Adresse der Haushälterin bräuchte ich bitte noch.«
»Die habe ich nicht.«
De Santis war erstaunt. »Sie muss doch ihre aktuelle Anschrift hinterlegt haben. Für Post, offene Rechnungen und dergleichen.«
»Tut mir leid, ich habe sie nicht.«
»Was ist mit der Handynummer?«
»Kann ich Ihnen geben.«
Umständlich nestelte der Küster ein altes Mobiltelefon aus der Hosentasche und suchte im Adressbuch. Schließlich diktierte er die Nummer, die De Santis in seinem eigenen Gerät speicherte.
»Wie war denn nun die Beziehung zwischen Don Sebastiano und seiner Haushälterin? Ging sie über ein reines Dienstverhältnis hinaus?«
Wieder zuckte der Mann mit den Achseln, eher ein Tick als eine Antwort.
Seine Frau lächelte übertrieben. »So ein guter Mensch«, sagte sie kopfschüttelnd.
Sie sagte »Mensch«, nicht »Priester«, und das schien ein weiterer Hinweis darauf zu sein, dass Don Sebastiano seine Pflichten großzügig auslegte. De Santis wählte Nataschas Nummer. Es meldete sich nur die Mailbox, der gewünschte Teilnehmer sei derzeit nicht erreichbar. Was sollte er jetzt tun? Die Dinge einfach laufen lassen und zu Isabella fahren? Sie hatte auf seine SMS nicht geantwortet, vielleicht war sie schon los auf einen Aperitif.
»Würden Sie mich in Don Sebastianos Wohnung begleiten?«, fragte er.
Der Küster nickte, wenig erfreut.
5
Als De Santis die Wohnung des Priesters betrat, schlug ihm ein Geruch nach Einsamkeit und Tristesse entgegen. Auf Möbeln und Fußboden stapelten sich Bücher und Papiere, dazwischen ungebügelte Wäsche, vergessene Einkaufstüten, Kram aller Art.
»Waren Sie schon mal in der Wohnung?«
»Natürlich.«
»Hat es hier immer so ausgesehen?«
»Früher war mehr Ordnung.«
Der Kommissar zog Einweghandschuhe über und ließ sich Nataschas Zimmer zeigen. Ein halb leerer Raum mit Gästebett und Schrank, dunklen Spuren von Bildern oder Fotos, die einst an den Wänden gehangen hatten, dazu der Geruch nach kaltem Zigarettenrauch. Natascha hatte wohl einige Jahre hier gelebt und war starke Raucherin gewesen. Daher die Spuren. Aber dieses Zimmer war aufgeräumt und wirkte, als wäre es seit Längerem nicht betreten worden.
»Haben Sie ein Foto von Natascha?«, fragte er den Küster.
»Nein.«
»Wie alt ist sie?«
»Vierzig, fünfzig.«
»Vierzig oder fünfzig?«
»Irgendwas dazwischen, denke ich.«
Also deutlich jünger als der Priester.
Sie wechselten ins Schlafzimmer. Dort stand ein Doppelbett, jedoch nur ein Nachtkästchen. Vielleicht mochte Don Sebastiano es bequem. Vielleicht hatte der Priester nicht alleine geschlafen, aber den Schein gewahrt.
Wann war er gestorben? Dem Rigor Mortis und den Verfärbungen der Haut nach zu urteilen war er schon mehrere Stunden tot. Vermutlich war es in der Nacht passiert. War er vorher im Bett gewesen? Eine Seite war zerwühlt. Die Matratze unter der Decke fühlte sich noch ein wenig warm an. Lag es an der Hitze des Tages, oder war es Körperwärme?
De Santis schlenderte durch die Wohnung. Sie war seit Tagen nicht geputzt worden. Auf den Möbeln lag Staub, aber es gab mehrere Abdrücke von Gegenständen, die offensichtlich bewegt worden waren. Auch auf dem Schreibtisch, auf dem benutzte Teetassen standen und Rechnungen sowie Notizen für Predigten lagen. Ungewaschene Kleider im Bad und auf dem Stuhl neben dem Bett. Der Herd war sauber, das Geschirr gespült. Im Kühlschrank der trostlose Anblick eines Junggesellenhaushalts: Käse, Wurst, Butter, alles in kleinen Packungen, dicht am Verfallsdatum oder darüber hinaus, hier und da Schimmelränder. Eine angebrochene Flasche Wein. Ob er seit dem Weggang der Haushälterin eine Putzhilfe hatte? De Santis fragte den Küster, der es nicht wusste. Es gab keine Hinweise auf übermäßigen Alkoholkonsum oder Finanzprobleme, auch keine Zigarettenstummel. Der Kommissar trat auf den kleinen Balkon und sah, dass die Nachmittagssonne über den Golf wanderte.
Zur Linken erhob sich der Felsvorsprung von Posillipo. Dahinter versteckt der Vomero das Haus, unter dessen Dach er jetzt so gerne mit Isabella gewesen wäre. De Santis schrieb ihr noch eine SMS. »Komme gleich.«
Er kehrte in die Wohnung zurück und versuchte, den widersprüchlichen Eindruck zu entschlüsseln. Irgendetwas entging ihm. Er hatte noch nie die Bleibe eines Gemeindepfarrers von innen gesehen, aber so hatte er sie sich nicht vorgestellt. Was stimmte hier nicht? Der Kontrast zwischen der Verwahrlosung und der gediegenen Einrichtung? Die Damastdecken auf dem Doppelbett? Das schwere Besteck in den Schubkästen? Die Ölgemälde an den Wänden? Don Sebastiano hatte nicht im Luxus gelebt, aber die Dreizimmerwohnung mit dem schweren Holzmobiliar machte einen fast großbürgerlich-komfortablen Eindruck, der nicht zu einem Priester passen wollte, der an der Basis kämpfte, Seite an Seite mit dem Proletariat.
Der Kommissar entdeckte einen Karton mit Fotos. Ein Gruppenausflug, Gottesdienste, Tauffeiern, Bilder aus Afrika. Dann ein Frauenporträt. Eine attraktive, nicht mehr ganz junge Frau. Sie blickte den Fotografen direkt an, mit einem stillen Lächeln, das gleichzeitig ernst und lebensfroh wirkte, nicht kokett oder herausfordernd.
»Ist das Natascha?«, fragte er.
Der Küster nickte.
Der Priester war deutlich älter gewesen als diese Frau. Hatte er sich in sie verliebt, war von ihr verlassen worden und hatte sich deshalb umgebracht? Hatte er sich daher in dem Brief an sie gewandt? Weil er ihr mit seiner Tat Schuldgefühle aufbürdete? Nur warum hatte er den Brief in den Glockenturm gelegt? Warum hatte er sich dort erhängt?
Zurück im Gästezimmer, in dem Natascha gelebt hatte, suchte De Santis nach Spuren ihrer Anwesenheit. Nichts. Das Bett war frisch bezogen, der Kleiderschrank sauber und leer, ebenso Nachttisch, Papierkorb und der kleine Sekretär.
Er legte sich auf den Boden und spähte unter das Bett, unter die Möbel, suchte nach Unebenheiten im Parkett. Der vergessene Staub und die Fußabdrücke, die er als Muster darin erkennen konnte, zeugten von dem Leben, das sich hier abgespielt hatte. Und das im Glockenturm geendet hatte.
Ein solch starkes Gefühl von Traurigkeit, von Empörung und Verzweiflung kam in ihm auf, dass er aufsprang. Er musste dringend an die frische Luft, sonst würde er verrückt. Manchmal dachte er, er sei ungeeignet für seinen Beruf. Er hatte nicht die nötige Distanz, spürte auf einmal ein so heftiges Mitgefühl mit dem Opfer – egal ob Opfer des Zölibats, des Liebeskummers oder eines Gewalttäters –, dass er eine Stinkwut auf den Küster, die Einwohner von Bagnoli und die Amtskirche entwickelte. Don Sebastiano hatte für die Leute hier gekämpft, und jetzt saßen sie vor dem Fernseher, weil Neapel spielte. Er lief zur Tür. Ein letzter Blick. Auf einmal wusste er, was hier nicht stimmte. Auf dem Schreibtisch standen ein Drucker und ein Modem. Aber wo war der Computer? Und wo Don Sebastianos Handy? Auf dem Schreibtisch lag auch kein Kalender.
»Wissen Sie, wo Don Sebastiano seine Termine notierte?«
Der Küster schüttelte den Kopf.