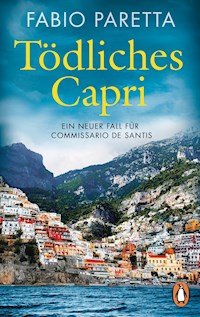7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Franco De Santis
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
La dolce morte: Franco De Santis ermittelt
Ein ganz normaler Frühlingstag in Neapel: Auf den Terrassen der Cafés genießen die Menschen das Leben, während in einer Seitenstraße eine Boutique ausgeraubt wird. Doch diesmal wird ein Schüler erschossen. Nur ein dummer Zufall, oder hatte jemand einen Grund, den Jungen zu beseitigen? Commissario Franco De Santis, der eine Tochter im Alter des Opfers hat, weigert sich, den Fall zu den Akten zu legen. Und stößt auf ein Netz aus Betrügereien, Schulden und Schwarzhandel im großen Stil. Alles deutet auf die Camorra hin, aber Franco De Santis lassen die Mitschüler des ersten Opfers Salvatore nicht mehr los. In ihren Augen liest er Frust, Hass – und Angst ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 416
Ähnliche
FABIO PARETTA ist das Pseudonym eines in Italien lebenden deutschen Autors, der seine große Leidenschaft für das Erzählen mit seiner Faszination für die Widersprüche seiner Wahlheimat Italien verbindet. Mit Die Kraft des Bösen schrieb er sein Krimidebüt um den neapolitanischen Commissario Franco De Santis. Trügerisches Neapel ist sein zweiter Roman. Fabio Paretta ist mit einer Italienerin verheiratet und hat zwei Kinder.
Die Kraft des Bösen in der Presse:
»Ein dichter und realitätsnaher Krimi zwischen den Villenvierteln auf dem noblen Vomero und den Wohnhöhlen in Neapels berüchtigter Altstadt.« Der Standard
»Mit Hingabe schildert Paretta die vielen Facetten dieser rätselhaften Stadt und die lebensechten Figuren, mit denen er seinen spannenden, finsteren, aber auch sehr sinnlichen Roman anreichert.« NDR Kultur
Außerdem von Fabio Paretta lieferbar: Die Kraft des Bösen (10050)
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook.
Fabio Paretta
Trügerisches Neapel
Ein Fall für Commissario De Santis
1
Es war dunkel. Die Grillen zirpten. Süßlich duftete das trockene Gras, das an seinen Hosenbeinen kratzte, manchmal roch man einen Hundehaufen. Am liebsten wäre er umgekehrt, aber er musste seine Angst überwinden. Ein für alle Mal. Da waren sie schon, ihre Stimmen. Sie jauchzten und grölten. Wie immer führte Pasquale das Wort, und seine beiden Kumpel lachten, wie es sich für Lakaien gehörte. Ein Feuerschein warf Schatten in die Baumkronen, der würzige Rauch zog in Schwaden um die Scooter, die im Hintergrund aufgebockt waren.
Tu es für Marco, sagte er sich, tu es für deinen Bruder. Und er ging weiter, mit zittrigen Beinen. Pasquale pinkelte gerade in die Glut, in der Hand eine Dose Bier, als Gianni aus der Dunkelheit trat.
»Du?«, fragte Pasquale. »Muss dringend sein, wenn deine Mamma dich um die Uhrzeit noch auf die Straße lässt. Problem gelöst?«
»Wir müssen noch mal reden«, sagte Gianni. Seine Stimme sollte fest und unbeeindruckt klingen. Wer Angst hat, der verliert, hatte sein bester Freund Schizzo zu ihm gesagt.
Gianni fasste unter seinen Kapuzenpulli und spürte das Metall, kühl und schwer fühlte es sich an. Beruhigend. Doch sein Puls hämmerte wie wild im Hals. »Ich hab getan, was ich konnte«, sagte er.
»Ach ja?«, erwiderte Pasquale, und sein Grinsen verzog sich zu einer fiesen Grimasse. »Eine Drei hatte ich gesagt. Und was hab ich gekriegt?« Pasquale kam immer näher, bis seine Nasenspitze die von Gianni berührte. »Was hab ich bekommen, du Vollidiot?«
Er schwieg. Kämpfte die Angst nieder. Durchhalten, sagte er sich. Tu’s für Marco. Und für Vanessa.
»Sag schon!«, schrie Pasquale.
Es klingelte in seinen Ohren, und er sagte: »Eine Fünf.«
»Siehst du. Eine Fünf. Du hast es verbockt.«
Du hast es verbockt, dachte Gianni. Du bist faul und renitent, bist nie in der Klasse und wenn, dann spielst du Call of Duty auf dem Smartphone. Warum kommst du überhaupt noch? Wozu brauchst du Abitur?
»Du hättest eine Drei kriegen müssen. Damit es nicht zu sehr auffällt, hab ich ein paar Fehler eingebaut …«
»Zu viele Fehler.«
»Nein. Zeig mir mal die Arbeit.«
»Meinst du, ich red Blech? Du hast mich beschissen.«
»Der Lehrer muss was gemerkt haben.« Gianni umklammerte den Griff und versuchte, die Fassung zu bewahren.
»Also hat mich der Lehrer beschissen? Meinst du das, ja?« Pasquale schob ihn langsam mit der Nasenspitze zurück. »Du bist genauso behindert wie dein Bruder«, sagte er und schlug Gianni die Bierdose gegen die Stirn. Der kühle Schaum schoss ihm übers Haar, lief ihm in die Augen und nahm ihm die Sicht.
»Du lässt meinen Bruder aus dem Spiel. Hast du mich verstanden?« Gianni war laut geworden. Wenn es um Marco ging, verlor er die Kontrolle. Marco, der sich nicht wehren konnte, dem selbst ein Riss im Asphalt Angst machte. Als er an den Vortag dachte, kochte die Wut in ihm hoch.
Pasquale sah ihn verblüfft an. Er überlegte, wie er Gianni bestrafen konnte für seine Aufmüpfigkeit.
Gianni dagegen dachte an den Vortag. Da vorne an der Straße hatte Marco gestanden. Auch wenn er aussah wie ein Koloss, war er doch wie ein hilfloses Kleinkind. Die Füße und Schultern nach innen gekrümmt und mit zittrigen Händen, als hätte er Parkinson. Vor Furcht gelähmt, starrte er in den Abgrund vor sich: ein gezackter Riss im Gehsteig, aus dem Grasbüschel wuchsen. Dann waren sie gekommen, waren über ihn hergefallen.
»Entspann dich, sie tun dir nichts«, sagte Gianni. »Sie wollen nur mit mir reden.« Er hatte sich getäuscht. Sie wollten sich zwar Gianni gefügig machen, aber abbekommen hatte es Marco. Zuerst tätschelten sie seinen Kopf. So fest, dass er bei jedem Schlag zusammenzuckte. Marco fing an zu schnauben und tiefe Laute auszustoßen. Mit geballten Fäusten und verkrampften Muskeln stand er da und starrte Löcher in den Asphalt. Als er versuchte, über den Riss im Asphalt zu springen, verlor er das Gleichgewicht und prallte auf Pasquale.
»Was ist?«, fragte Pasquale. »Machst du dir wieder in die Hosen? So wie dein Bruder?«
Er griff Gianni in den Schritt und quetschte ihm die Hoden. Der Schmerz schoss durch seinen Unterleib, bis in die Fingerspitzen. Er musste handeln, ehe es zu spät war. Das war seine letzte Chance. Er dachte an die Waffe in seiner Tasche, dann dachte er wieder an seinen Bruder. Wie sie ihn zu dritt ins Gebüsch gezerrt hatten. Weil er, Gianni, unfähig war. Feige. Aber damit war jetzt Schluss.
Mit einer fließenden Bewegung schüttelte Gianni den Schmerz aus den Gliedern und zog dabei die Pistole aus der Bauchtasche. Er richtete den Lauf auf Pasquale. Dieser blickte erstaunt, fast bewundernd. Oder amüsiert? Jetzt wurde seine Miene ernst. Er schien gemerkt zu haben, dass die Waffe echt war. Gianni entsicherte sie mit dem Daumen. Er hatte es ein Dutzend Mal geübt. Pasquale blieb einen Moment regungslos stehen. Ein Sprung und Gianni war bei ihm, fasste mit der Linken nach seiner Kehle und drückte ihm mit der Rechten die Mündung an die Stirn. Jetzt grinste er nicht mehr. Sogar seine Speichellecker schwiegen, die am Vortag noch gefeixt und gejubelt hatten, nachdem sie Marco die Klamotten vom Leib gerissen und sich an ihm vergangen hatten.
»He, Pasquale, schau dir das an! Der hat nicht nur Eier wie ein Eber, er kriegt auch einen Steifen.« Das Geäst der Büsche wippte im Rhythmus von Marcos heiseren Schreien. »Er spritzt ab! Pasquale, ich fass es nicht. Er lässt sich melken!«, schrie der Glatzkopf und lachte wie ein Bekloppter.
Die Schreie seines Bruders hallten in Gianni nach. Er richtete sich auf. »Ab heute wirst du dich weder mir noch meinem Bruder nähern. Du sprichst uns nicht mehr an und postest auch nichts auf Facebook über uns. Wenn du noch einmal unseren Namen in den Mund nimmst«, sagte Gianni, »bist du tot.« Aus dem Augenwinkel sah er, wie die beiden Lakaien sich vorsichtig um das Feuer schoben. Ein dicker, tätowierter Glatzkopf mit Zahnlücke und ein schmächtiger Schläger, der für sein Springmesser berühmt war. »Bleibt stehen, ihr Arschlöcher«, schob er nach. »Sonst drücke ich ab.«
Pasquale warf seinen Kumpels einen Blick zu, um sie zu beschwichtigen. Er hatte sich wieder gefangen und lächelte. Sein fieses, arrogantes Grinsen. »Ich wette, die ist nicht mal geladen«, sagte er.
»Oh doch.«
»Aber du traust dich nicht.«
Wieso sollte ich mich nicht trauen?, dachte Gianni. Dann merkte er, wie er unsicher wurde. Er lehnte Gewalt ab. Aber bei Pasquale ging es nicht anders. Er dachte wieder an seinen Bruder. Schon ein normaler Junge hätte das kaum ausgehalten, aber Marco? Er klammerte sich neuerdings am Bettrahmen fest, wenn er morgens in die Schule gehen sollte, und er sprach kein Wort mehr. Kein einziges.
Gianni versuchte, das Zittern seiner Hand in den Griff zu bekommen. Er musste nur abdrücken, dann war Ruhe. Aber dann wäre sein Bruder ganz allein.
Plötzlich verspürte er einen heftigen Schmerz in der Hand, und in seinen Hoden brannte es wieder wie Feuer. Pasquale hatte ihm das Knie in den Unterleib gerammt und die Waffe aus der Hand geschlagen. Gianni lag auf dem Rücken, die Glut versengte sein Ohr, und er blickte in den Lauf über sich.
Breitbeinig stand Pasquale da, zielte auf sein Gesicht und grinste noch immer. »Bist du sicher, dass sie geladen ist?«
»Ja.« Lass ihn abdrücken, dachte Gianni. Du stirbst nur einmal. Bis dahin bist du unsterblich, hatte Schizzo gesagt.
»Dann wollen wir mal sehen«, sagte Pasquale und zog langsam den Abzug durch.
»Meine Mutter weiß, dass ich hier bin«, sagte Gianni leise und bestimmt. Er schämte sich dafür, dass er jetzt an seine Mama dachte.
»Hahahaha.« Pasquale lachte, und seine Kumpels stimmten ein. »Deine Mutter? Vielleicht auch noch der Idiot von deinem Bruder?«
Ein hohles Klicken. Mehr kam nicht. Weil du’s bist, hatte Schizzo gesagt. Aber Munition, das kommt nicht infrage.
Pasquales Miene entspannte sich, er wirkte fast enttäuscht. Die beiden anderen starrten Gianni an, sie wollten mehr sehen.
»Geh heim zu deiner Mamma und deinem verblödeten Bruder. Und dann verschaff mir eine Drei in Mathe.«
Gianni stand auf und spürte den Urin, der warm an seinem zitternden Bein hinabfloss.
»Vergiss nicht: Dein Leben gehört mir«, fügte Pasquale zum Abschied an.
Gianni war schlecht, er wankte ein paar Schritte, versuchte zu rennen, doch dann kam ihm das Essen hoch. Er würgte und erbrach sich, fiel auf die Knie, um ihn herum Gelächter. Er robbte ein Stück, dann krabbelte er auf allen vieren davon.
2
Franco De Santis saß in der Rundung des Amphitheaters auf dem warmen Tuffstein, vor sich die Ruinen von Säulengängen und Tempeln, darunter das tiefblaue Meer. Möwen flogen wie Konfetti über die Klippen, das Pinienharz und die wilden Kräuter dufteten.
Fasziniert lauschte er der Brandung und sagte: »Ist das nicht ein Traum?«
»Ja, ein Traum, der Tausenden das Leben gekostet und Millionen in die Sklaverei geführt hat. Der Erbauer der Villa Pausilypon war Nutznießer eines tyrannischen Systems«, erwiderte Elvira Barbarossa nüchtern. »Allein der Zugangstunnel, ganze achthundert Meter mussten durch den Fels geschlagen werden …«
»Das ist zweitausend Jahre her.«
»Völkermord verjährt nicht.«
Himmel! Es war schon eine Herkulesaufgabe gewesen, die Staatsanwältin überhaupt zu diesem Ausflug zu überreden. Bitte neutrales Terrain, hatte sie gesagt. Daraufhin hatte er die Besichtigung arrangiert, nur für sie beide. Aber diese Frau in romantische Stimmung zu versetzen, schien schlichtweg unmöglich.
Sie verströmte einen besonderen Duft, der ihn an Zitronengras und Leder erinnerte, herb, betörend, vielschichtig, so wie sie nun einmal war. Allmählich beruhigte sich auch ihr Atem, ihre Brust unter der dünnen Sommerbluse hob und senkte sich, die Perlmuttknöpfe schimmerten. Er nahm ihre Hand.
»Was wird das?«, fragte sie und entzog sie ihm.
»Es hilft beim Entspannen.«
»Ihnen vielleicht.«
War das etwa Teil eines Spiels? Eine Art Prüfungsparcours wie im Märchen?
»Sie wissen, was Pausilypon bedeutet: Ruhe vor den Schmerzen der Seele. Fällt es Ihnen so schwer zu genießen?«, hakte er nach.
»Offensichtlich.«
»Vergessen Sie die Ungerechtigkeit und das Böse.«
»Kann ich nicht.«
»Für einen Moment.«
Er griff wieder nach ihrer Hand, und diesmal ließ er sie nicht wieder los. Trotz des zaghaften Widerstands, der abrupt nachließ. Vielleicht würde er sie tatsächlich noch überreden können, mit ihm essen zu gehen. In dem Restaurant, in dem er einen Tisch reserviert hatte und an dem sie wie zufällig vorbeikommen würden.
Franco De Santis mochte Elvira Barbarossa, seit er sie kannte. Anfangs hatte er die Staatsanwältin in ihr bewundert, dann hatte er auch die weiblichen Züge hinter ihrer kompromisslosen Fassade erkannt. Aus dem anfänglich starken Gefühl war ein immer stärkeres geworden, doch es schien schwächer als ihr Widerstand. So unberechenbar dieser war. Sie hatten erst einmal zusammen zu Abend gegessen, vor Monaten. Da hatte Elvira sich erstaunlicherweise in seine Wohnung einladen lassen, als wäre es das Selbstverständlichste von der Welt. Ohne Angst um ihren Ruf, ohne Angst vor dem, was sich daraus hätte ergeben können. Doch dann waren sie durch seine Tochter Ludovica gestört worden, und die Staatsanwältin hatte sich dezent verabschiedet. Seitdem war nichts mehr passiert zwischen ihnen. Im Gegenteil, Elvira Barbarossa schien jedem Tête-à-tête aus dem Weg zu gehen. Hin und wieder ein Kaffee in einer Bar, gemeinsam mit Kollegen, ein bisschen Small Talk über laufende Ermittlungen. Beim Weihnachtsfest der Polizia di Stato hatte er versucht, mit ihr zu tanzen. Doch sie hatte abgelehnt mit der Begründung, es sei nichts gegen ihn persönlich, sie tanze grundsätzlich nicht. Er sei angetreten, um ihre Grundsätze zu ändern, war seine Replik gewesen. Sie hatte süffisant gelächelt – und war gegangen.
Er legte die Hand auf ihren Bauch, den sanft geschwungenen Hügel, der sich gleichmäßig auf und ab bewegte.
»Was wird das?«, fragte sie wieder.
»Spüren Sie die Harmonie?«
»Wie kommt es eigentlich, dass wir hier alleine sind?«
Er schwieg. Die Villa mit ihren Thermalbädern, Amphitheatern, freskoverzierten Prachtbauten und dem einzigartigen Blick über den Golf war der betörendste Ort in dieser Stadt, die an betörenden Panoramen durchaus reich war. Man bewegte sich hier in der Schwebe zwischen Himmel und Erde, See und Fels, und wenn man zur richtigen Uhrzeit kam, versank die Sonne als riesiger roter Ball hinter Ischia im Meer. Genau jetzt war dieser Moment. Er lag außerhalb der offiziellen Öffnungszeiten. Da De Santis jedoch den Leiter des zuständigen Kulturvereins kannte und dieser Mann ihm eine Gefälligkeit schuldig gewesen war, saßen sie nun hier. Und zwar alleine.
Francos Handy klingelte. Es vibrierte in der Jacketttasche, aber seine Hände waren bleischwer. Der Augenblick sollte in Stein gemeißelt werden.
»Ihr Telefon«, sagte Elvira.
»Ich weiß.« Er hoffte, es würde verstummen.
Es verstummte nicht.
»Sie sollten antworten.«
»Ist nicht wichtig.«
»Woher wollen Sie das wissen? Und wenn es etwas Dienstliches ist?«
»Dann ist es auch nicht so wichtig. Nicht wichtiger als dieser Augenblick.«
»Werden Sie nicht pathetisch. Die Ruinen stehen hier schon seit zweitausend Jahren. Wir können jederzeit wiederkommen.«
»Sie wissen, dass wir das nicht können.« Er ging ran.
»Chef?«
Beppe Bomba, sein Untergebener. Verflucht. Es war also tatsächlich dienstlich.
»Was gibt’s?«
»Ein Überfall. Eine Streife von uns wurde nach Chiaia gerufen, in der Via Carlo Poerio hat jemand eine Boutique überfallen.«
»Sache des Raubdezernats.«
»Es hat einen Toten gegeben.«
Das hätte De Santis sich denken können. Wenn Bomba sich am Freitagabend meldete, dann aus gutem Grund.
»Wer ist es? Der Ladenbesitzer oder der Räuber?«
»Ein junger Kerl, eine Aushilfskraft wahrscheinlich.«
»Und der Täter?«
»Es waren zwei, vermutlich junge Männer, flüchtig mit einem Scooter.«
»Haben wir eine Personenbeschreibung?«
»Sie tragen Kapuzenpullis, einer grau, einer schwarz, außerdem Integralhelme.«
»Wann ist es passiert?«
»Vor etwa zehn Minuten.«
Die Via Carlo Poerio war nicht allzu weit entfernt. Man musste nur auf der anderen Seite des Kaps die Serpentinen Richtung Zentrum hinunterfahren und war da.
»Zeugen? Ein Kennzeichen?«
»Ja.«
»Haben die Kollegen eine Fahndung eingeleitet?«
»Ich weiß nicht, ich bin eben erst informiert worden.«
Warum Bomba, der Rangniederste? Und nicht er, der Chef der Mordkommission?
»Wie lautet das Kennzeichen?«
»Die Zeugin ist sich nicht hundertprozentig sicher. Es ging alles ganz schnell. Aber sie hat es in ihr Handy getippt.«
»Nun sag schon.«
»Moment«, er las zögernd ab. »EE …«
»Und weiter?«, fragte De Santis ungeduldig.
»Mehr hat sie nicht gesehen. Fünf Zahlen …«
Jedes Motorradkennzeichen bestand aus zwei Buchstaben und fünf Zahlen. Der Kommissar war aufgesprungen, Elvira Barbarossa stand neben ihm. Sie hatte das Gespräch mitgehört, und jetzt vibrierte auch ihr Handy. Während sie zum Ausgang liefen, sprach sie mit der Staatsanwaltschaft. Es ging um denselben Fall, dieselben Informationen.
»Um die Riviera di Chiaia und Via Carlo Poerio herum gibt es mehrere Überwachungskameras. Besorg dir die Aufzeichnungen, und dann gibst du das komplette Kennzeichen durch. Lös eine Fahndung aus«, wies De Santis Beppe Bomba an.
Sie legten auf. Inzwischen hatten der Kommissar und die Staatsanwältin den Tunnel erreicht. Sie tauchten in die kühle Finsternis ein und rannten Richtung Via Discesa Coroglio, wo De Santis’ Auto parkte.
Der Abend war im Eimer, aber wenigstens würden sie wieder zusammenarbeiten. Es gab keine bessere Staatsanwältin als Elvira Barbarossa in Neapel. Und keine faszinierendere Frau.
3
De Santis und die Staatsanwältin sprangen in den alten Alfa 147, und er jagte die Serpentinen hinauf, links das verlassene Industrierevier von Bagnoli, rechts die von üppiger Vegetation überzogenen Felsen. Chiaia lag zwar nur wenige Kilometer Luftlinie entfernt, aber vorher mussten sie durch die engen Straßen auf dem Kap, durch ein Konglomerat aus Restaurants, Bars und kleinen Läden, aus Art-déco-Villen und luxuriösen Wohnanlagen. Immer wieder öffnete sich das Panorama des Golfs unter ihnen, auf dem das Abendrot seine letzte Glut ausgoss.
Die Autos schlängelten sich durch die Via Posillipo, De Santis schlängelte sich durch die Autos und drückte dabei auf die Hupe. Sein Handy rutschte auf dem Armaturenbrett hin und her und wartete auf Bombas Anruf, der nicht kam.
»EE 214«, sagte Elvira Barbarossa, die schweigend auf den Verkehr gestarrt und sich jedes Kommentars über De Santis’ Fahrstil enthalten hatte.
Der Kommissar sah aus dem Augenwinkel einen Motorroller, der in der Gegenrichtung an einer roten Ampel stand. Zwei Passagiere mit Integralhelmen. Sie hatten bullige Oberkörper, wirkten nicht besonders groß, aber gut trainiert.
»Die Kleidung passt nicht«, sagte die Staatsanwältin. »Bunte Windjacken.«
»Die können sie zur Tarnung über die Kapuzenpullis gezogen haben«, erwiderte De Santis und bremste. Der Fahrer hinter ihm gestikulierte und fluchte.
»Wenn sie auf der Flucht sind, werden sie kaum bei Rot anhalten«, erwiderte Elvira.
»Vielleicht gerade deshalb. Um nicht aufzufallen. Eine Personenkontrolle ist das Mindeste.«
Der Kommissar blendete auf, setzte den Blinker und nutzte eine Lücke im Gegenverkehr. In drei Zügen hatte er gewendet, wobei er wieder wütendes Hupen, Gesten und Flüche provozierte. Der Scooter stand an der Spitze einer Kolonne, die vor einer Baustelle wartete. De Santis schob sich an der Schlange vorbei, zückte seinen Dienstausweis und öffnete das Handschuhfach, in dem das Holster mit der Beretta lag.
»Ducken Sie sich. Wenn wir die Richtigen erwischt haben, sind sie bewaffnet«, sagte er.
»Lag Ihre Pistole etwa in dem unbewachten Auto?«, fragte Elvira.
Er hatte sie vergessen, wenn er ehrlich war. Zum Glück, wie sich jetzt herausstellte. De Santis lehnte sich quer über seine Beifahrerin, presste den Ausweis an die Seitenscheibe und hielt den Lauf der Waffe daneben.
Die beiden Helme drehten sich kurz nach links. Die Visiere waren geschlossen, die Gesichter nicht zu erkennen. Der Fahrer gab Gas. De Santis ebenfalls.
»Schnell, rufen Sie die Zentrale an, die sollen ein paar Wagen zusammenziehen«, sagte er zu Elvira.
Der Motorroller fädelte sich geschmeidig durch die Baustelle, der Alfa war dafür zu breit. De Santis musste nach links über den Gehsteig ausweichen und die Fußgänger verscheuchen. Am Ende der Baustelle lenkte er auf die Fahrbahn zurück – und hatte den Scooter direkt vor sich.
Posillipo war keine gute Ecke, um sich zu verdrücken, denn auf dem Kap gab es nur wenige Straßen, und die meisten endeten im Meer oder in Sackgassen. Aber die beiden schienen sich gut auszukennen, kein Zögern, keine Diskussion. De Santis kam nicht näher. Wenn er Pech hatte, steuerten sie ein Schlupfloch an, durch das der Scooter gerade so hindurchpasste. Dass Motorroller in Neapel so beliebt waren, hatte viele Gründe. Manche davon waren kriminell.
»Wir brauchen eine Straßensperre auf der Westseite. Wenn sie dort die Serpentinen hinunterfahren, sitzen sie in der Falle.«
Abrupt bog der Roller rechts ab in eine enge Gasse. Wieder war De Santis verwirrt. Dort ging es ins Hinterland, sofern man eine der wenigen Verbindungen fand. Stammten die Räuber etwa aus einem Vorortbezirk und wollten zurück in ihre Basis?
Der Alfa brach mit dem Heck aus, und als der Kühler in die Gasse rutschte, kratzte das Blech an einer Hauswand entlang. Der Sozius blickte sich um und schrie dem Fahrer etwas ins Ohr. Der Scooter kämpfte sich durch das Gewirr immer enger werdender Gassen – zu eng für ein Auto.
»Sie entwischen uns«, sagte De Santis.
Da schoss ein Motorrad um die Ecke. De Santis blendete auf, blockierte die Straße mit der Fahrertür und schrie: »Da müssten Kabelbinder im Handschuhfach sein. Geben Sie her.«
»Sind Sie jederzeit auf Festnahmen eingestellt?«
»Nein, die Nummernschildhalterung ist kaputt.« Er steckte die Plastikstreifen ein, stieg aus und hielt dem Motorradfahrer seinen Ausweis unter die Nase. »Ich brauche Ihre Maschine.«
»Die gehört mir gar nicht …«
De Santis schob den Mann weg und schwang sich in den Sattel. »Die Formalitäten erledigt meine Kollegin«, rief er dem Mann über die Schulter zu.
Es war lange her, dass er das letzte Mal Motorrad gefahren war. Jetzt saß er auf einer alten Kawasaki 750 mit Rennlenker und kurzem Gasweg. Er musste nur ein bisschen drehen, und schon jaulte der Motor im hohen Drehzahlbereich. Mehrmals tippte De Santis mit der Fußspitze auf den Schalthebel, bis er im ersten Gang war, dann gab er Gas und ließ die Kupplung kommen. Früher als erwartet, schoss die Maschine los, das Vorderrad hob sich, und er wäre fast abgeworfen worden wie von einem buckelnden Hengst. Der Scooter war längst verschwunden. De Santis fuhr noch einmal an, langsamer diesmal, schaltete hoch, zweiter, dritter Gang. Allmählich bekam er ein Gefühl für die Kawasaki, auch wenn er mit dem Bauch auf dem Tank lag und den Kopf recken musste, um die feine Staubwolke zu verfolgen, die hinter einer Mauer aufstieg. Sie mussten durch einen Torbogen in einen Park geflüchtet sein. Er folgte, steuerte auf einen Kiesweg, geriet ins Schlingern und fing die Maschine ab, indem er das Gas aufdrehte. Er flog nun zwischen Büschen und Beeten hindurch, holte den Scooter mehr und mehr ein. EE 21 473. Zwei kräftige Kerle in zerlöcherten Jeans und Windjacken.
Der Sozius drehte sich um und brüllte dem Fahrer etwas ins Ohr. Vorsicht, dachte De Santis, womöglich lockten die beiden ihn in einen Hinterhalt. Er ließ das Motorrad in eine Oleanderhecke rollen und beobachtete den Park. Eine weitläufige, hügelige Rasenfläche, die von alten Pinien und Libanonzedern beschattet wurde. Dazwischen gepflegte Blumenrabatten, ein Springbrunnen, niedrige Hecken. Ein paar ältere Herrschaften saßen auf Bänken, eine junge Frau schob einen Buggy vorbei und sah sich erschrocken um. Zwei Kinder schaukelten nebeneinander und warfen sich am höchsten Punkt, wenn die Kette erschlaffte, ein kreischendes Lachen zu.
Der Scooter raste an der Außenmauer entlang und verließ den Park durch ein schmiedeeisernes Tor, der Sozius sprang ab und zog die Flügel zu. Kein besonders origineller Trick, aber ehe De Santis das Tor wieder geöffnet und die Kawasaki auf die Straße geschoben hatte, waren die beiden verschwunden. Er hatte die Orientierung verloren, kein Handy dabei und konnte weder eine Karte konsultieren noch Elvira anrufen. Wahrscheinlich kannte der Fahrer einen Schleichweg hinunter nach Fuorigrotta und weiter nach Soccavo. Mist!
Ich bin bald fünfzig, dachte De Santis, zu alt für solche Aktionen. Ein Wunder, dass ich mir mit dem Bock nicht das Genick gebrochen habe. Aber er war ein schlechter Verlierer, die Niederlage bohrte in ihm. Zwei Raubmörder, direkt vor seiner Nase. Und er hatte sie entkommen lassen.
Plötzlich hörte er einen Motor aufjaulen, und die beiden kamen ihm entgegen, er blendete auf und ging instinktiv in Deckung. Der Scooter wich aus, rutschte auf ein geparktes Auto zu, fing sich wieder.
Bravo, dachte De Santis, der Fahrer kann umgehen mit dem Ding. Aber die schnellere Maschine hatte er.
Er hängte sich wieder dran und gab Gas, schaltete in den vierten, in den fünften Gang, doch immer wenn er den Hintermann fast hätte greifen können, schlug der Scooter einen Haken. Die beiden waren ein eingespieltes Team, sie narrten ihn, und in De Santis stieg die kalte Wut hoch. Sollte er das Hinterrad rammen? Lieber nicht, sie fuhren besser als er.
Wieder schlug der Scooter einen Haken. Aber diesmal war es einer zu viel, denn er führte sie in eine Sackgasse, die in eine steile Treppe überging. Langsam ließ De Santis das Motorrad ausrollen und griff nach seiner Waffe.
Unvermittelt gab der Fahrer Gas und nahm die erste Stufe, das Hinterrad rutschte hin und her und spie dabei eine Wolke verbrannten Gummis aus. Wie auf einem Springpferd hüpften die beiden, den Scooter zwischen den schlanken Schenkeln, Stufe um Stufe höher. Was waren das für Typen? Trial-Fahrer? Zirkusakrobaten? Stuntmen? De Santis war abgestiegen und rannte hinterher, die Waffe im Anschlag.
»Stehen bleiben!«, brüllte er. »Polizei!«
Die beiden arbeiteten sich ruckweise die Treppe hinauf. So geschickt sie sich auch anstellten, sie waren langsamer als der Kommissar. Er erreichte sie und warf sich auf den Sozius, der zu schreien und zu zappeln anfing, während der Scooter zur Seite kippte. Die Stimme überschlug sich, kiekste.
Verdammt, dachte der Kommissar, das ist ja ein Mädchen! »Keine Bewegung!«, brüllte er.
Die Waffe … Wo hatten sie die Waffe?
Der Fahrer setzte die Flucht zu Fuß fort, während der Kommissar die zarten Handgelenke des Mädchens umfasste. Er drehte ihr den Arm auf den Rücken, fesselte ihre Hände mit einem Kabelbinder und tastete sie ab. »Wo ist die Pistole?«, fragte er, denn er fand sie nicht. Der andere hat sie, dachte er, oder er hat sie weggeworfen. Er wollte weiter, musste aber erst das Mädchen sichern. Mit einem zweiten Kabelbinder fesselte er sie an ein Verkehrsschild.
Der Fahrer hatte inzwischen einen ordentlichen Vorsprung. Er nahm je zwei Treppenstufen auf einmal und schleuderte eine Tüte über eine Tuffsteinmauer. De Santis atmete schwer, fünfundachtzig Kilo lasteten auf seinen Muskeln, der Teer der Zigaretten auf seinen Lungenbläschen. Er sah die knallenge Jeans, die sich vor ihm die Stufen hinaufkämpfte, die drahtigen Beine, den kräftigen, gerundeten Hintern. Sag mal, ist das noch eine Frau?, dachte er. Und eine verdammt schnelle dazu. »Stehen bleiben!«, brüllte er, hielt inne und reckte die Waffe. Er hatte Mühe, sich aufrecht zu halten. Seine Lunge stach.
Die Flüchtende zögerte einen Moment, sah zu, wie er sich am Geländer festklammerte.
»Ach, Scheiße«, murmelte er und schoss in die Luft.
Behände wie ein Äffchen kletterte sie über die Mauer und war verschwunden. De Santis steckte die Waffe in die Tasche und zog sich langsam an dem porösen Tuffstein hoch. Dahinter war ein Olivenhain, leicht abschüssiges Gelände. Er spähte hinüber, und auf einmal spürte er die Angst. Sein Herz raste, seine Gedanken überschlugen sich. Schusswechsel waren selten in seinem Beruf, aber einmal hatte er als junger Polizist einen Ladendieb verfolgt. Wie berauscht vom Rennen am Limit, war er dem Täter in eine Gasse in der Duchesca gefolgt, wo er ihn aus den Augen verloren hatte. Plötzlich hatte es geknallt. So laut, dass er eine Weile nichts mehr fühlte, sah und hörte. Dann ein dumpfer, heißer Schmerz an seiner Wange, etwas Scharfkantiges hatte ihn getroffen, nur ein Splitter von einem Ziegelstein, wie sich später herausstellte. Er hatte Glück gehabt. Aber irgendwann war das Glück aufgebraucht.
De Santis wollte den Flüchtenden ablenken, zog seine Jacke aus und schob sie als Zielscheibe auf die Mauer. Nichts tat sich. Er ließ sich herabsinken, rannte einige Meter weiter und kletterte ächzend über die Mauer, um sich auf der anderen Seite in die Tiefe fallen zu lassen. Er wollte sich abrollen, knickte jedoch mit dem Knöchel um und landete in einem Dornengebüsch. Auf einmal war es dunkel und kühl. Die Grillen zirpten, es roch nach feuchter Erde und Brombeeren, während in seinem Sprunggelenk das Blut pochte. In der Ferne hörte er eine Sirene und Stimmen. Der Kommissar lugte zwischen den Zweigen hindurch. Auf dem zarten Grün standen Oliven- und Orangenbäumchen fein säuberlich Spalier. Ein Zweig knackte, ein Schatten bewegte sich zwischen den Bäumen.
»Stehen bleiben, verdammt!«, brüllte De Santis. »Polizei!«
Die Gestalt stürzte.
Zwei, drei Sprünge, dann war er über ihr und bohrte ihr wütend den Lauf der Waffe in den Rücken. »Aufstehen, ganz langsam.«
De Santis klappte das Visier hoch. Tatsächlich. Noch ein Mädchen, vielleicht achtzehn, vielleicht jünger. Womöglich so jung wie Ludovica, seine Tochter.
»Was wollen Sie von mir?«, kreischte es.
Er tastete ihre Flanken ab.
»Finger weg! Ich bin minderjährig.«
Als er keine Waffe fand, zog er sie hoch und dirigierte sie über die Mauer. »Versuch ja nicht abzuhauen, sonst …«
»Sonst was? Wollen Sie mich vielleicht erschießen? Ich hab nichts getan.« Er fesselte auch ihr die Hände mit einem Kabelbinder. »Das werden Sie bereuen«, sagte sie.
Wortlos schob er sie die Treppe hinab, bis sie ihre Komplizin erreicht hatten. Diese kauerte schlotternd neben dem Verkehrsschild und weinte.
Die Fahrerin warf ihr einen vorwurfsvollen Blick zu und sagte: »Klappe halten.«
De Santis suchte die beiden noch einmal nach der Waffe ab. »Wo ist sie?«, fragte er.
»Wo ist was?«, fragte die Größere zurück. Sie schien die Anführerin zu sein.
»Die Waffe? Wo habt ihr sie entsorgt?«
»Was für eine Waffe?«, fragte sie schnippisch.
»Und die Tüte, die ihr weggeworfen habt? Was war da drin?«
»Welche Tüte?«
Er zog den beiden die Helme vom Kopf. Die Mädchen ähnelten einander fast wie Zwillinge, beide mit langen braunen Haaren, teurem Make-up und manikürten Fingern. Sicher nicht aus der Unterschicht.
»Wie heißt ihr?« Sie sagten jeweils ihren Namen. »Mach mal die Jacke auf«, sagte er zu der Größeren. Als sie nicht reagierte, brüllte er sie an: »Aufmachen!«
Betont langsam kam sie seiner Aufforderung nach. Ein grünes Sweatshirt kam zum Vorschein.
»Was hast du darunter?«
»Bist du auch noch ein Spanner, oder was?«
Er hätte sich fast vergessen, aber zum Glück kam Elvira Barbarossa angerannt. De Santis wandte sich zu ihr um und sagte: »Überprüfen Sie bitte, was die Mädchen für Kleidung tragen.«
»Ich bin Staatsanwältin.«
»Sie sind eine Frau, wenn ich das mache, gibt es Ärger.«
Er kletterte wieder über die Tuffsteinmauer und suchte nach der Plastiktüte, die das Mädchen auf der Flucht weggeworfen hatte. Sicher war Diebesgut darin, vielleicht sogar die Tatwaffe. Aber er fand sie nicht.
Als er zu den drei Frauen zurückkehrte, sagte Elvira Barbarossa: »Sie haben jeweils zwei T-Shirts, ein Top, ein Sweatshirt und die Windjacken an.«
»Wo habt ihr die Sachen her?«
»Aus unserem Schrank«, sagte die Anführerin.
Ihre Komplizin schwieg.
Wieder juckte es ihn in den Fingern. »Wo wart ihr in der letzten Stunde?«
»Wir sind rumgefahren.«
»Warum tragt ihr so viele Klamotten übereinander?«
»Es wird abends kalt. Unsere Eltern wollen nicht, dass wir uns erkälten.«
»Jetzt hör mir mal zu!«, schrie De Santis, doch dann sah er aus dem Augenwinkel die Staatsanwältin, die ihn erschrocken musterte. Er winkte ab und ging das Motorrad holen.
Zu viert kehrten sie zum Wagen zurück. Unterwegs stießen sie auf den Besitzer des Motorrades, der zuerst den Kommissar entgeistert ansah und dann skeptisch den Zustand seiner Maschine prüfte.
»Sie hat nichts abbekommen«, sagte De Santis. »Ich bin nur ein paar Kilometer damit gefahren. Danke noch mal.«
Gemeinsam verfrachteten sie die Mädchen in den Alfa und setzten die Fahrt Richtung Via Carlo Poerio fort. De Santis beorderte eine Streife in den Olivenhain. Sie sollte nach der Tüte suchen.
4
Während sie hinunter nach Mergellina fuhren, wich das Tageslicht der Dämmerung, die Straßenlaternen schalteten sich an, die Stadt schmiegte sich wie ein Teppich aus funkelnden Lichtern um den Golf und die Flanken des Vesuvs. Elvira Barbarossa überprüfte die Ausweispapiere der beiden Mädchen. Die Namen, die sie angegeben hatten, stimmten: Michela Santini und Eleonora Calamandrei, beide siebzehn, beide in der Via Scipione Capece zu Hause, so ziemlich die teuerste Adresse der Stadt, nicht weit vom Ort der Festnahme entfernt.
Sie erreichten die Riviera di Chiaia, die bourgeoise Promenade mit ihren Art-déco- und Stuckfassaden. Als sie in die Parallelstraße einbogen, fragte Michela, die Größere: »Was sollen wir hier?«
»Hier wurde eine Boutique ausgeraubt.«
»Was haben wir damit zu tun?«
»Das werden wir gleich feststellen.«
»Sie können uns nicht festhalten. Sie wissen wohl nicht, wer ich bin.«
De Santis starrte das Mädchen wutentbrannt an. »Doch. Du bist eine Tatverdächtige. Ladendiebstahl, bewaffneter Raubüberfall, Totschlag.«
»Was? Das geht uns nichts an. Wir sind minderjährig. Mein Vater …«
»Interessiert mich nicht«, erwiderte der Kommissar und stieg aus.
»Ich verlange, dass ich meine Eltern und einen Anwalt sprechen kann«, rief das Mädchen ihm hinterher.
Vor dem Haus in der Via Carlo Poerio 9 hatte sich eine Menschentraube gebildet, die gegen den Ring aus Absperrband und Uniformierten drängte. Agente Beppe Bomba, das einhundertvierzig Kilogramm schwere Unikum aus Francos Team, stand mit einem Notizblock auf der gegenüberliegenden Straßenseite und sprach mit einem Passanten. Mario Marin, De Santis’ schneidiger Vize, gestikulierte in dem Vakuum vor dem Ladeneingang, um die Einsatzkräfte zu dirigieren. De Santis und Elvira Barbarossa baten zwei Beamte, die Mädchen zu trennen und zu bewachen, und schoben sich durch die Menge.
Der Kommissar nahm Marin zur Seite: »Geben Sie mir einen Überblick.«
»Der Laden heißt Gentleman, der Inhaber ist ein gewisser Otello D’Astoli, das Opfer vermutlich Salvatore Ronga, eine achtzehnjährige Aushilfskraft. Mehrere Zeugen haben um etwa Viertel vor acht einen Schuss gehört. Die Täter sind mit einem Scooter Richtung Piazza dei Martiri geflüchtet.«
»Und dann?«
»Wissen wir nicht.«
Der Kommissar betrachtete die Via Carlo Poerio. Eine schmale Einbahnstraße, noble Boutiquen mit minimalistischer Auslage und edlem Design. Einladend, für Kunden wie für Kriminelle.
»Hat jemand gesehen, dass die beiden geschossen haben?«
»Nein.«
»Wo ist der Besitzer?«
»In seiner Wohnung.« Marin deutete die Fassade hinauf.
»Er wohnt direkt über dem Laden?«
»Im dritten Stock. Er scheint den Schuss auch gehört zu haben und ist sofort heruntergekommen.«
De Santis blickte hinauf. Stuckverzierte Simse, vier großflächige Fenster, beige Vorhänge. Geschlossen. Wie zum Zeichen der Trauer.
»Wo ist Pizzuoli? Wo die Spurensicherung?«
»Ispettore Pizzuoli müsste demnächst eintreffen. Er war gerade beschäftigt«, sagte Marin mit einem ironischen Unterton, der De Santis nicht gefiel.
So sehr der Kommissar sich auch bemühte, es war immer das Gleiche mit Mario Marin. Sein Vize war aus Norditalien gekommen und in Neapel mit einer hehren Mission angetreten: Er wollte der Stadt zu Rechtsstaatlichkeit und Effizienz verhelfen. Zwei Welten prallten aufeinander, und die Kräfteverhältnisse schienen klar. Aber inzwischen warteten De Santis und seine Kollegen schon seit einem Jahr, dass Neapel den zackigen Marin verschlingen und als kurioses Zwitterwesen wieder ausspucken würde, so wie es noch mit jedem Einwanderer und Eroberer geschehen war. Doch der Vizekommissar war von bewundernswerter Prinzipientreue. Wie ein Fels in der Brandung widerstand er allen Widrigkeiten, unverwüstlich, unerschütterlich und uneinsichtig. Manchmal flößte er De Santis Ehrfurcht ein, meistens ging er ihm jedoch auf die Nerven. Der einzige Trost war, dass Marin demnächst zu einem seiner unzähligen Lehrgänge aufbrechen würde. Dann waren sie ihn für zwei Monate los.
»Die Mädchen waren mit einem Scooter mit dem Kennzeichen EE 21 473 unterwegs. Sie hatten zahlreiche neuwertige Kleidungsstücke bei sich, vermutlich Diebesgut, und sie haben versucht, sich der Festnahme zu entziehen. Die beiden sind dringend tatverdächtig, das Nummernschild müsste daher auch in den Aufzeichnungen der Überwachungskameras auftauchen. Rekonstruieren Sie den Fluchtweg, die Uhrzeiten und dergleichen, und sorgen Sie dafür, dass die Mädchen nicht miteinander sprechen können, damit sie sich nicht abstimmen können.«
»Und Pizzuoli?«, entgegnete Marin leicht irritiert.
»Sobald er eintrifft, soll er Bomba bei den Befragungen unterstützen.«
Mario Marin setzte eine säuerliche Miene auf. Für ihn fiel wieder nur die langweilige Routine ab, obwohl er doch der Meinung war, er sei ein raffinierterer Psychologe als Pizzuoli. Das sah De Santis anders. Marin verstand kein Neapolitanisch, schon gar nicht die Zwischentöne.
Der Kommissar ließ sich Überschuhe und Latexhandschuhe geben, zog sie an und betrat die Boutique. Ein langer Schlauch, gesäumt von Antikholzregalen mit gedimmter Beleuchtung. Herrenmoden, edel und teuer. Links hingen Anzüge, Sakkos und leichte Mäntel, rechts Hemden und Pullover. Das Blaulicht des Streifenwagens tanzte über die Wände. Der abendliche Verkehrslärm, das aufgeregte Geschnatter der Schaulustigen und die Stimmen der Polizisten wurden durch die gepanzerte Tür gedämpft. Übrig blieb eine unnatürliche Stille. Der beißende Geruch von Schießpulver mischte sich mit dem süßlichen der Körperflüssigkeiten, die ausgetreten waren.
Langsam ging Franco De Santis über das Parkett und näherte sich dem leblosen Körper, der schräg vor dem Tresen lag, mit dem Kopf Richtung Ladentür. Lang ausgestreckt, mit ausgebreiteten Armen. Der Kommissar schätzte ihn auf etwa eins neunzig, muskulös, breitschultrig. Sein Antlitz war unversehrt, die blauen Augen waren vor Schreck aufgerissen, ungläubig, verwundert. Wäre nicht das kleine Loch auf der Unterseite des Kinns gewesen, hätte man den Jungen kaum für tot halten können. Und dann war da noch der Film aus Blut und Hirnmasse, der die Regale und den Fußboden im Rückraum des Ladens überzog. Der oder die Täter mussten ihm von unten in den Kopf geschossen haben. Ein einziger Schuss, wie ihn manchmal Selbstmörder setzten. Doch ein Selbstmord war es nicht. Denn in dem Fall hätte die Waffe neben ihm liegen müssen.
Ob die beiden Mädchen ihn getötet hatten? Waren sie fähig, einen Gleichaltrigen zu erschießen? Waren sie panisch geworden, weil er wie ein Hüne wirkte? Sie überwältigen wollte?
»O Gott, der ist ja fast noch ein Kind!« Elvira Barbarossa war hinter De Santis getreten.
Normalerweise wollte er für sich sein, um die ersten Eindrücke aufzusaugen, aber die Staatsanwältin störte ihn nicht. Im Gegenteil. Er nahm die Dinge dank ihr noch schärfer und deutlicher wahr. Auch seine Wut. Er suchte nach Anzeichen eines Kampfes. Es gab keine Kratzspuren oder Schürfwunden, weder im Gesicht noch an den Unterarmen. Vorsichtig nahm er die schlanken Finger des Toten mit den blonden Härchen in die Hand. Der Nagel am rechten Zeigefinger hatte einen Knick und wies ein kleines, dunkles Klümpchen auf. Vielleicht Schmutz, vielleicht eingetrocknetes Blut. Wenn sie Glück hatten, stammte es vom Angreifer. Er legte die Hand ab und betrachtete die Venen, die ein erhabenes Geflecht bildeten, perfekt und unverbraucht. Es erinnerte De Santis an Ludovica. Wie ein Wunder wirkten diese jugendlichen Schönheiten, die von einem Tag auf den anderen in die Höhe schossen, ihre kindlichen Gesichter in die Welt der Erwachsenen schoben und Ausschau hielten nach einer besseren Zukunft. Dieses Gesicht hatte die Flugbahn einer Pistolenkugel gekreuzt. Zufällig oder nicht?
Ein einziger Schuss. Die Schmauchspuren um das Einschussloch deuteten darauf hin, dass er aus nächster Nähe abgegeben worden war. Während eines Kampfes? War es Absicht gewesen?
De Santis erhob sich und beugte sich vor, um hinter den Tresen zu schauen, ohne durch die Blutspuren zu laufen. Die Kasse war geschlossen. Hatten sie nicht einmal Geld erbeutet? Hatte der Verkäufer das verhindert? War er deshalb gestorben? Aber wozu? Wenn er nur eine Aushilfe war?
Da entdeckte De Santis in den grauroten Sprenkeln, die Blut und Hirnmasse auf dem Boden hinterlassen hatten, die Abdrücke von Schuhen.
»Wir sollten hier nicht rumlaufen«, sagte er.
Elvira Barbarossa folgte seinem Blick, sah die Fußspuren und nickte. »Ich warte draußen.«
Der Kommissar kniete sich wieder über den Jungen. Er dachte an die Eltern, die Geschwister, die Freunde, die jetzt ahnungslos vor dem Fernseher saßen oder sich zum Ausgehen fertig machten. Freitagabend, Wochenende, die laue Luft lockte. Dann dachte er wieder an seine Tochter, und eine ängstliche Unruhe stieg in ihm auf. Ludovica wurde flügge, sie war aufmüpfig und neugierig auf alles, was verboten war. Wo sie sich wohl gerade herumtrieb? Morgen sollte sie zu ihm kommen, wie an jedem zweiten Wochenende.
Erneut fiel dem Kommissar die Stille auf. Trotz des Lärms auf der Straße war das Geschäft wie ein akustisches Vakuum. Warum? Was fehlte? Normalerweise rauschte oder brummte eine Klimaanlage, ein Computer, eine Spülung, irgendein Gerät lief in einem Laden immer. Hier nicht. War der Strom ausgefallen? Nein. Die Digitalanzeige der Kasse leuchtete, auch das rote Licht an der Überwachungskamera, die gut sichtbar hinter dem Tresen unter der Decke hing. Wenigstens das. Sicher waren die Täter maskiert gewesen, trotzdem würden die Bilder wichtige Details liefern: Körperbau, Alter, wie professionell die beiden vorgegangen, ob sie durch irgendetwas abgelenkt oder überrascht worden waren …
Die Spuren mussten so schnell wie möglich ausgewertet werden.
De Santis trat auf die Straße und sagte zu Marin: »Wo ist die Spurensicherung?«
»Müsste gleich eintreffen.«
»Sie soll sich zuerst auf die Videobilder und die Fußabdrücke konzentrieren. Erst danach dürfen sie den Gerichtsmediziner an die Leiche lassen.«
»Aber das widerspricht dem normalen Prozedere.«
»Ist mir egal. Ich glaube, dass die Spuren am Boden uns mehr verraten als die an der Leiche. Außerdem sind sie nicht so lange haltbar.«
Marin rümpfte die Nase. Sein Hirn, in dem die Dienstvorschriften gespeichert waren, kollidierte mal wieder mit De Santis. Und der Realität. Denn meist kam sowieso kein Gerichtsmediziner an einen Tatort, nicht in der neapolitanischen Wirklichkeit.
Bomba stand immer noch auf der anderen Straßenseite, einen Notizblock in der Hand, und redete mit Passanten. De Santis bahnte sich einen Weg zu ihm.
»Wer von uns war als Erster hier?«
Der Agente deutete auf einen Polizisten in Uniform. Er war von der Squadra mobile, ein junger Mann mit schwarzen Locken, der aufgeregt in sein Handy sprach.
De Santis begrüßte ihn und ließ sich das Wichtigste erzählen. Als er angekommen sei, sagte der Polizist, hätten schon ein paar Leute vor dem Eingang gestanden und durcheinandergerufen. Otello D’Astoli habe im Laden auf die Polizei gewartet.
»Der Mann war völlig außer sich, hat wild gestikuliert und geschrien: ›Er ist tot. Sie haben ihn umgebracht!‹ Ich bin zum Opfer gegangen, habe die Verletzung gesehen und seinen Puls gefühlt. Exitus. Daraufhin habe ich den Tatort abgeriegelt, den Besitzer auf die Straße geführt und auch keinen Sanitäter mehr hereingelassen, um keine Spuren zu verwischen.«
»Exzellente Arbeit«, sagte De Santis und dachte bei sich: Endlich mal ein Tatort, mit dem man arbeiten kann.
Ein altes Auto bahnte sich vorsichtig hupend einen Weg durch den Stau. Gennaro Pizzuoli, De Santis’ bester Ermittler, stieg aus. Blass, abgekämpft und mit violetten Augenringen.
»Ein Überfall?«, fragte er.
»Ja, ein Toter«, erwiderte De Santis. »Unterstütz bitte Bomba bei den Befragungen, Anwohner, Passanten, Nachbarn. Alle bis auf den Ladenbesitzer, den übernehme ich selbst. Ich muss nur zuerst mit den beiden Mädchen sprechen und die Eltern informieren.«
Er ging zu seinem Alfa zurück, neben dem ein junger Beamter wartete. Im Wageninneren tobte Michela Santini, schlug mit den Fäusten gegen die Türen und auf die Hupe.
De Santis riss die Fahrertür auf. »Was soll das Theater?«
»Sie haben kein Recht, mich wie eine Kriminelle zu behandeln.«
»Wo warst du zwischen halb acht und acht heute Abend?«
»Ich sage nichts ohne meinen Anwalt.«
»Du behauptest, du hättest mit dem Überfall nichts zu tun. Wenn du mir ein Alibi lieferst, kannst du vielleicht sofort nach Hause.«
»Ohne Anwalt sag ich kein Wort. Wo ist mein Handy? Ich will telefonieren.«
De Santis schlug die Tür zu und gab dem jungen Beamten ein Zeichen, die Bewachung wieder zu übernehmen. Eleonora Calamandrei saß in einem anderen Dienstwagen. Sie war blass, zittrig und hatte rot geweinte Augen. Vermutlich war sie leichter zu knacken. Der Kommissar setzte sich neben sie.
»Hör zu, es geht um ein Kapitalverbrechen. Ihr seid dringend verdächtig, und mit eurem Verhalten macht ihr die Sache nur noch schlimmer. Du solltest nicht auf deine Freundin, sondern auf die Polizei hören. Wo wart ihr zwischen halb acht und acht heute Abend?«
Eleonora zog die Schultern hoch. »Nicht hier.«
»Wo dann? Nenn mir einen Zeugen.«
Sie schwieg.
»Zeig mir mal deine Schuhsohlen.«
Sie rührte sich nicht, sondern stemmte die Füße fest auf den Boden. De Santis hätte ihr am liebsten ein Bein hochgerissen, aber dann hätte er sich ernsthafte Schwierigkeiten eingehandelt. Also gab er auf. Während er hier seine Zeit verschwendete, saßen die Eltern des toten Jungen ahnungslos zu Hause. Sie waren wichtiger als die beiden verwöhnten Gören.
Er stieg aus und sagte zu dem Polizisten: »Bringen Sie die beiden Mädchen getrennt zur Questura. Sie sind vorläufig festgenommen wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und des dringenden Verdachts des räuberischen Überfalls in Tateinheit mit Totschlag. Sie müssen erkennungsdienstlich behandelt werden. Ich brauche nicht nur die Fingerabdrücke, sondern auch die DNA und die Schuhprofile. Lassen Sie außerdem die Haut auf Kampf- und Kratzspuren sowie die Hände auf Schmauchspuren untersuchen und überprüfen Sie eventuelle Alibis … das Übliche.«
Dann ging er zu Pizzuoli und erklärte ihm, wo genau die Mädchen die Tüte über die Mauer geworfen hatten. »Wir brauchen sie unbedingt. Ich nehme an, dass die Waffe darin steckt, vielleicht auch Ware aus dem Laden.«
Ehe er in sein Auto stieg, betrat er die Boutique, die dem Eingang des Gentleman gegenüberlag. Michele Saronno, ein Glatzkopf Ende dreißig in engem Pullover und Jeans, kam hinter der Ladentheke vor.
»Sie haben den Überfall beobachtet?«, fragte De Santis.
»Ich habe nur die zwei Typen reinmarschieren sehen und mich gewundert, weil sie die Helme nicht abgenommen haben. Na ja, später habe ich begriffen, warum.«
»Sind Sie sicher, dass es Männer waren?«
Sein Gegenüber zögerte. »Ich denke, schon.«
»Warum?«
»Na ja, jetzt, da Sie fragen: Sicher bin ich nicht.«
»Haben Sie die beiden Mädchen gesehen, die wir verhaftet haben?«
Saronno nickte.
»Könnten sie es vom Körperbau her sein?«
Der Mann zuckte mit den Achseln. »Schwer zu sagen. Die Täter waren anders angezogen.«
»Achten Sie nicht auf die Kleidung. Die haben sie gewechselt. Stimmt die Größe?«
»Tut mir leid. Könnte sein. Vielleicht auch nicht. Ich dachte eher, dass es zwei Männer waren. Ein junger und ein alter.«
»Ein alter?«
»Na ja, so wie sie sich bewegt haben.«
»Beschreiben Sie bitte genau, was Sie gesehen haben.«
»Also, da hat ein Scooter vor dem Laden gehalten.«
»Modell?«
»Weiß ich nicht. Silbergrau, eine recht gewöhnliche Form.«
»Kennzeichen?«
»Keine Ahnung. Er hat gehalten, und ich habe mich wie gesagt ein bisschen gewundert, dass die beiden die Helme aufgelassen haben. Ich dachte, es wären Kuriere und sie hätten es eilig. Dann kam es mir komisch vor, dass nicht einer auf der Maschine bleibt. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ja, zuerst habe ich gedacht: Komisch, dass sie zu zweit reingehen. Dann dachte ich: Vielleicht ist die Ware so schwer, dass sie alle beide anpacken müssen. Aber sie haben kaum etwas getragen.«
»Kaum etwas? Was war es denn?«
»Eine Umhängetasche. Wären es Räuber, würde einer auf der Maschine sitzen bleiben, bei laufendem Motor, sagte ich mir. Vor allem würde der Alte sich nicht aus dem Sattel quälen. Dann habe ich mich wieder meinen Unterlagen zugewandt. Ich sitze an der Steuer, wissen Sie.«
»Und Sie sind sicher, dass die eine Person relativ alt war?«
»Ja. Das merkt man doch an der Geschwindigkeit und Geschmeidigkeit, mit der ein Mensch sich bewegt. Eigentlich war der Ältere der Grund, warum ich mir keine Sorgen gemacht habe. Für einen Überfall war er viel zu schlecht zu Fuß.«
»Wer hat den Scooter gefahren?«
»Na, der Alte.«
»Was ist dann passiert? Wie lange waren die beiden im Laden?«
Saronno schüttelte den Kopf. »Das haben mich alles Ihre Kollegen schon gefragt. Ein paar Minuten vielleicht.«
»Wann war Ihnen klar, dass es ein Überfall war?«
»Als ich den Schuss gehört habe.«
»Haben Sie erkannt, wer geschossen hat?«
»Nein. Man sieht nichts durch die Scheibe, wegen der Lichtreflexe. Außerdem war ich in meine Abrechnungen vertieft.«
»Und dann?«
»Ich habe den Kopf gehoben, bin hinter der Theke vorgelaufen und habe dann aber gezögert, auf die Straße zu treten, weil ich Angst hatte. Da kamen sie auch schon herausgelaufen. Sie diskutierten, sprangen auf den Motorroller und rasten davon.«
»Mit der Umhängetasche?«
»Ja.«
»Sind Sie sicher, dass es eine Umhängetasche war?«
»Ja.«
»Nicht zufällig eine Tüte?«
»Nein. Es war so eine wasserdichte Tasche aus einem Stück Lkw-Plane. Grau, glaube ich.«
»Haben Sie sonst irgendwelche Veränderungen an den beiden bemerkt?«
»Welche Veränderungen denn?«
»Verletzungen? Beute? Haben sie Ware mitgenommen? Haben Sie andere Leute gesehen? Den Ladenbesitzer oder einen Nachbarn? Passanten?«
»Nein, tut mir leid.«
De Santis verabschiedete sich und hinterließ seine Visitenkarte. Die Aussage war nicht sehr ergiebig. Aber ein Anfang.
5
Während der Kommissar zum Bahnhof und anschließend über die Autobahn Richtung Ponticelli fuhr, vorbei an verlassenen Industriegeländen, Ausfallstraßen und ruinösen Zweckbauten, stieg ein flaues Gefühl in ihm auf. Ihm stand die schlimmste Aufgabe bevor, die sein Beruf mit sich brachte. Er musste Eltern mitteilen, dass ihr Kind nicht mehr lebte. Umgebracht, »aus niederen Beweggründen«. Während er sich im spärlichen Abendverkehr treiben ließ und den Schlaglöchern auswich, dachte er über das Verbrechen nach. Einiges an dem Überfall kam ihm merkwürdig vor. Zum Beispiel die Lage des Geschäfts. Sicher, es lag in einer teuren Einkaufsstraße, was eine fette Beute versprach. Aber das galt für fast alle Läden in der Via Carlo Poerio. Die Boutique Gentleman allerdings lag strategisch ungünstig, fast zweihundert Meter von der nächsten Kreuzung entfernt. Die Straße war eng, eine Mausefalle. Die Täter waren ein hohes Risiko eingegangen, denn zwei Streifenwagen hätten gereicht, um ihnen in beide Richtungen den Weg abzuschneiden.
De Santis seufzte. Er nahm die Ausfahrt Barra/Ponticelli und tauchte in das Viertel ein, das wie ein Geschwür um einen dekadenten historischen Kern gewachsen war. Hochhäuser, kalte, funkelnde Klötze neben dem aufgeplatzten Asphalt. Nach der Erdbebenkatastrophe von 1980 hatte man hier auf der grünen Wiese Wohnsilos für Tausende obdachlose Familien aus der Innenstadt geschaffen. Sie waren aus Brennpunkten der Kriminalität hergezogen und hatten ihren Erfahrungsschatz vereint. Herausgekommen war ein explosives Gemisch, ein Melting Pot der Camorra.
Neapels Altstadt mit ihren Prachtfassaden aus dem Katholizismus und versunkenen Monarchien, die mit staatlichen Fördermitteln konserviert wurden, war etwas für Reiseführer und Privilegierte. Hier draußen lebte der Durchschnittsbürger. Franco De Santis liebte seine Stadt, ihre menschlichen, ihre zärtlichen und ihre hässlichen Züge. Hier gab es nur Letztere, hier hatte man die Brutalität in Beton gegossen. Und nun musste er dafür den Botschafter spielen. Er drückte auf den Klingelknopf, auf dem der Nachname Ronga stand. Der Kommissar hoffte im ersten Moment, niemand würde antworten, aber da krächzte schon eine Stimme aus der Sprechanlage.
»Ja?«
»Polizei«, sagte De Santis.
Der Türsummer ging ohne Nachfrage, als hätte man ihn bereits erwartet.
Er stieg die Treppenstufen hoch. Frische Wandfarbe, mit der man Graffiti übertüncht hatte, gewienerte Steinstufen, man war hier sichtlich um Ordnung und Sauberkeit bemüht. Im fünften Stock stieß er auf eine angelehnte Wohnungstür. Er klopfte. Stille, bis auf undeutliche Geräusche aus einem der hinteren Zimmer.
»Mein Name ist Commissario De Santis, darf ich eintreten?«, rief er.
Niemand reagierte. Vorsichtig schob er die Tür auf. Alle Lichter brannten, gedämpfte Stimmen. Die Einrichtung war schlicht und gepflegt. Kein Luxus. Sondern auch hier die Anstrengung, so etwas wie kleinbürgerliche Ordnung zu halten.
»Hallo?«