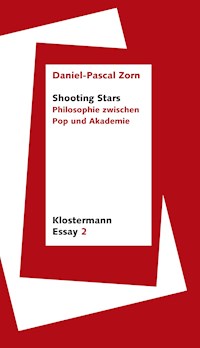29,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 29,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Die Postmoderne gehört zu den umstrittensten Epochen der jüngeren Philosophie. Sie wird für Misstände der Gegenwart verantwortlich gemacht. Aber kennen wir die Postmoderne wirklich? Daniel-Pascal Zorn führt den Leser durch die deutsche, französische und amerikanische Postmoderne. Er entfaltet das Panorama eines verlorenen Denkens, das wir gerade jetzt am nötigsten hätten. Wer heute etwas als fragwürdig auszeichnen will, verweist gerne auf die »Postmoderne». Ihre Vertreter gelten als Feinde der Wahrheit und als Fürsprecher einer zügellosen Beliebigkeit. Doch dieses Bild ist ein Trugbild. Daniel-Pascal Zorns Epos zur Postmoderne nimmt den Leser mit auf eine Höhenwanderung rund um die Gipfel des modernen Denkens. In Frankreich entwerfen Michel Foucault, Jacques Derrida, Gilles Deleuze und Jean-François Lyotard eine Kritik der Moderne als Abwehr des Absoluten. Doch sie sind nicht allein: In Deutschland ringen Theodor W. Adorno und Joachim Ritter mit der bürgerlichen Gesellschaft und in den USA entdecken Richard Rorty und Heinz von Foerster die Vielfalt des Menschen. Ein Panorama der umstrittenen Postmoderne – und zugleich ein kritischer Rückblick auf die Entstehung unserer Gegenwart.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 930
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Daniel-Pascal Zorn
Die Krise des Absoluten
Was die Postmoderne hätte sein können
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2022 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg
unter Verwendung einer Abbildung von © akg-images / SNA
Zeichnungen Vor-/Nachsatz: Vecteezy.com
Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-608-98349-4
E-Book ISBN 978-3-608-11846-9
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten
sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Prolog | Moment mal …
Ein Gegner, auf den sich alle einigen können
Spukt es in der Universität?
Etikettenschwindel
Prüfungen
X-Beine
Lektion in Demut
J’accuse!
Im Salon von Madame Davy
Eine völlige Fehldeutung von Descartes
Antithese
OK
Computer
Wilde Orchideen und Trotzki
Der Berg ruft
Eine Geschichte von der Postmoderne
I | Die Wissenschaft des Absoluten
1 | Auf der Suche nach dem verlorenen Geist
Todesursache Philosophiegeschichte
Zwischen Idealismus und Empirismus
Die Krise der Philosophie
Vive la France!
David Humes Erben
Der doppelte Empirismus
Das Theater des Geistes
Die Einheit von Natur und Kultur
Die Philosophie des Pluralen
Das deleuzianische Zeitalter
2 | Traumzeit
Davos am Bodensee
Der dichterische Traum
Theater unterm Nordlicht
3 | Moderne Kriegsführung
Der dunkle Schatten des Kolonialismus
Doppelleben
Die Niederlage des Philosophen
Das größte Phänomen der Phänomenologie
Geometrie und Literatur
Algerien im Widerstreit
4 | Philosophische Lehrjahre
Sagen, was einem aufgeht
Gestalten der Philosophie
In der Falle
Entfremdung
Philosophische Landschaften
Der unbewusste Revolutionär
Die schiefe Ebene des »Daseins«
Geschichtlichkeit als Problem
Sagen, was einen angeht
5 | Der Herr der Gegensätze
Freies Schweifen
Das geistige Tierreich
Geist oder Leben?
Warum Kant heute?
Das philosophische Schneckenhaus
Wundervolle Kollegialität
Der dritte Mann
Der Riss in der Welt
6 | Fatale Freiheit
… es kömmt darauf an, sie zu verändern
Der Zusammenbruch der Vernunft
Philosophie oder Weltanschauung?
Da capo
Anlass, nicht Ziel
Auf dem Weg zur Dialektik
Und der Hegel weiß Bescheid
Der Traum einer versöhnten Welt
7 | Cyberspace
Die Mensch-Maschine
Cross the border, close the gap
Fehlermeldung
Neustart
Eines und Vieles
II | Die Krise des Absoluten
8 | Alles auf Anfang
Das Problem der Vielfalt
Die ewige Aufklärung
Vernunft und Wille
Der Vater aller Dinge
Quo vadis, Moderne?
Die Furie des Verschwindens
Tertium non datur
Techniken der Unterdrückung
Die Macht der Unterscheidung
Philosophisches Saatgut
Die Elenden
Limbus
Die Krise des selbstherrlichen Geistes
Die dunkle Seite des Mondes
Ironie der Ironie
Im Fuchsbau der Innerlichkeit
Ein Spiel mit Masken
Der Kopenhagener Spion
Die Wiederholung
Atemschöpfen
Ungleiche Energien
9 | Gegenrevolution
Der Stein des Anstoßes
Ab mit dem Kopf!
Genealogie und Kritik
Radikal plural
Die Welt von innen sehen
Götter und Philosophen
6000 Fuß über dem Meere
Die anthropologische Illusion
Der Existentialismus ist ein Humanismus ist ein Marxismus
Der Tod des Menschen
Denken in der Gegenstromanlage
10 | Kataklysmus
Ausgedient
Die Kunst des Driftens
Reform, Reform, Reform
Die erste Tat der Philosophie
Die Anwesenheit eines Werkes
Exodus
O Šamaš
Das Umkippen des Bodens
11 | Dichte Beschreibung
Hegel’sche Meditationen
Zeitgenössische Klassiker
Pragmati(zi)smus
Intervention!
Die Möglichkeit der Möglichkeit
Pfeil und Pendel
Die Philosophie des Nicht-Alles
Eine Ethik der Vermittlung
Auf dem Weg zur Sprache
12 | Kambrische Explosion
Der ewige Rückfall
Was ist die Bedingung?
Hochrisikounternehmen
Zwischen Stalin und Struktur
Feldforschung
Gegen sich selbst anschwimmen
Ein Spiel mit unklaren Regeln
Matrjoschka
Deleuze hinter den Spiegeln
Zweitaktmotor
Maschinen-Mensch
III | Die Rückkehr des Absoluten
13 | Wechselfieber der Geschichte
Intellektuelle Proletarier
Hügel 937
Gescheiterte Hoffnungen
Nur noch ein Gott kann uns retten
Die Kunst, es nicht gewesen zu sein
Der geistige Bürgerkrieg
Ästhetik oder Geschichte?
Die Kassandra von Plettenberg
Im Zweifel für das Absolute
Gegenwärtige Entzweiung
14 | Eine List der instrumentellen Vernunft
Super-
GAU
1979: Eine neue Hoffnung
Eine unendliche Kette von Zeichen
Dabeisein ist alles
Der Feldherrenhügel
»Waffen besing ich …«
58-85
Theorie als Politik
Theorie als Markt
15 | Die Wiederholung
Populär
Das postmoderne Wissen
Kritik und Krise
Die Spielverderber
Epilog | Eine seltsame Vielheit
Anmerkungen
Prolog | Moment mal …
1 | Auf der Suche nach dem verlorenen Geist
2 | Traumzeit
3 | Moderne Kriegsführung
4 | Philosophische Lehrjahre
5 | Der Herr der Gegensätze
6 | Fatale Freiheit
7 | Cyberspace
8 | Alles auf Anfang
9 | Gegenrevolution
10 | Kataklysmus
11 | Dichte Beschreibung
12 | Kambrische Explosion
13 | Wechselfieber der Geschichte
14 | Eine List der instrumentellen Vernunft
15 | Die Wiederholung
Dank
Prolog | Moment mal …
Die Postmoderne ist an allem schuld. Darin sind sich gegenwärtige Intellektuelle, Philosophinnen und Denker einig. Sie ist schuld an der Forderung nach absoluter Freiheit ohne Rücksicht auf Verluste, an der unkritischen Haltung gegenüber dem Kapitalismus, am Verfall von Sitte und Anstand und an dem fehlenden Respekt vor der Autorität der Wissenschaften und der Tradition. Die Postmoderne ist der Ausgangspunkt für die Übel unserer Zeit, für die vier apokalyptischen Reiter Konstruktivismus, Relativismus, Moralismus und Identitätspolitik.
Für die Postmoderne ist die reale Welt nur eine Konstruktion, ein Effekt von Machtansprüchen und anonymen Strukturen, der keinen Zugriff auf eine gemeinsame Wirklichkeit mehr erlaubt: Konstruktivismus. Hier gibt es keine Wahrheit mehr, nur noch relative Meinungen, die versuchen, sich gegen andere Meinungen durchzusetzen: Relativismus. Weil dabei keine verbindlichen Maßstäbe mehr akzeptiert, Fakten und Tatsachen durch fiktive Vorstellungen und gedankliche Konstrukte ersetzt werden, gelingt die Durchsetzung von Meinungen nur noch mit moralischer Erpressung: Moralismus. Die Postmoderne leitet die Menschen dazu an, sich gegenseitig alles Mögliche und Unmögliche zu unterstellen, um den eigenen Willen durchzusetzen. Sie zersetzt die Gesellschaft, indem sie Minderheiten gegen die Mehrheit aufhetzt und ihnen einredet, wegen irgendwelcher Merkmale, die sie als Minderheit identifizieren, automatisch im Recht zu sein: Identitätspolitik. Die Postmoderne ist verantwortlich für politischen Aktivismus im Gewand der Theorie. Sie brachte die »Critical Race Theory«, für die alle Weißen Rassisten sind, und den »Dekonstruktivismus«, der jede Aussage in eine unendliche Anzahl von gleichwertigen Interpretationen auflöst. Auch Verschwörungstheorien und Fake News, political correctness und cancel culture, also die weit verbreitete Tendenz, unliebsame Meinungen zu unterdrücken, haben wir der Postmoderne zu verdanken.
Dass sich die Postmoderne dabei hinter solchen Wortungetümen wie »Dekonstruktivismus« versteckt, ist kein Zufall. Denn so kann sie sich einen wissenschaftlichen Anstrich geben, um die eigenen politischen Ziele durchzusetzen. Ihre Theorien klingen hochkompliziert und durchdacht. Aber wenn man sie sich genauer ansieht, fällt das Kartenhaus in sich zusammen. Dann zeigt sich, dass es sich nur um eine hochnäsige Form des Dadaismus handelt, eine bloße Simulation von wissenschaftlicher Gelehrsamkeit. Scharlatanerie, Taschenspielerei, eine Ideologie intellektueller Nepper, Schlepper und Bauernfänger, der immer wieder junge Leute auf den Leim gehen und ihr nach der Pfeife tanzen wie die Kinder von Hameln dem teuflischen Rattenfänger. Das ist kein Zufall, denn die Postmoderne ist ein großangelegtes Täuschungsmanöver der Marxisten, die nach ihrem politischen Scheitern nun die Kultur ins Visier nehmen und versuchen, die Welt …
… doch einen Moment. Das geht ein bisschen schnell, oder? Sie haben dieses Buch gerade erst angefangen zu lesen – und schon werden Sie mit abschließenden Urteilen darüber konfrontiert, was diese »Postmoderne«, um die es hier geht, alles angerichtet haben soll. Sogar die Marxisten haben die Finger im Spiel! Wenn Sie vorher gar nicht wussten, dass Sie sich für die Postmoderne interessieren, können Sie sich nun sogar über sie empören. Stundenlang. Und wenn Sie schon wussten, was die Postmoderne ist, dann haben Sie gerade entweder beifällig genickt, weil sie es ebenso sehen, oder Sie haben sich stirnrunzelnd über diese Beschreibung der Postmoderne gewundert. Solche Beschreibungen der Postmoderne sind blind. Auf dem Weg zu ihrer Darstellung sind sie über den Stein der Kritik gestolpert und meckernd liegengeblieben. Was die Postmoderne ist, bleibt verdeckt unter dem, was sie angeblich alles angerichtet haben soll. Fangen wir also nochmal von vorne an – diesmal etwas neutraler.
Die Postmoderne, das ist eine Epoche der Philosophiegeschichte. Oder: Die Postmoderne, das ist eine Schule von ein paar französischen Philosophen, die in den 1960er Jahren den theoretischen Aufstand geprobt haben. Oder auch: Die Postmoderne, das ist das Lebensgefühl einer Generation, die sich mit der modernen Welt so gut arrangieren kann wie es diese Welt gerne hätte. Schließlich, für die Leser des modernen Romans: Die Postmoderne, das ist die Gebrochenheit der Moderne als Ausdruck der Theorie. Das sagt Ihnen alles nichts? Das liegt daran, dass solche Beschreibungen leer sind. Wer die Postmoderne nicht kennt, dem sagen sie nicht viel. Wer etwas über sie weiß, dem sagen solche Sätze nichts Neues. Sie lassen sich beliebig mit Erzählung, Begriff, Epoche, Lebensgefühl und Theorie füllen.
Was die Postmoderne war, lässt sich aus verschiedenen Gründen nicht einfach sagen. Einer dieser Gründe ist, dass vieles von dem, was eingangs über die Postmoderne gesagt wurde, oft erst sehr viel später auf sie abgebildet wurde. Um zu erfahren, was die Postmoderne war, muss man – paradoxerweise – vergessen, was man über die Postmoderne zu wissen glaubt. Erst recht muss man es vergessen, wenn man erfahren will, was die Postmoderne hätte sein können. Fangen wir also ein drittes Mal von vorne an: Was ist die Postmoderne?
Ein Gegner, auf den sich alle einigen können
Ende der 1940er und Anfang der 1950er Jahre, in den Ruinen der alten und im Geist der neuen Welt, entsteht in Paris, Frankfurt, New York, Münster und Chicago eine Denkbewegung, die wenige Jahrzehnte später die akademische Welt diesseits und jenseits des Atlantiks auf den Kopf stellen wird. Die Protagonisten dieser Denkbewegung teilen den Erfahrungsraum, dessen Koordinaten durch die beiden Weltkriege bestimmt werden. Sie sind Mitläufer und Exilanten, Söhne von Kriegsgefangenen und Brüder von Widerstandskämpfern. Menschen, deren Kindheit in einer Welt stattfindet, die kurz darauf so vollständig und unwiederbringlich pulverisiert wird, dass die Erinnerung an sie alles ist, was bleibt. Manche von ihnen haben das Glück, den Krieg nur aus Zeitungen zu kennen. Andere müssen fliehen, um ihr Leben zu retten. Nicht alle schaffen es.
Die Denkbewegung, die sie miteinander verbindet, hatte im Laufe der Jahrzehnte viele Namen. Jeder dieser Namen trifft einen Aspekt, keiner trifft je das Ganze. Die meisten von ihnen sind abfällig gemeint: »Kulturmarxismus« zum Beispiel. »Konstruktivismus«, »Relativismus«, »Skeptizismus« oder »Nihilismus«, als eine sich steigernde Verurteilung von Irrationalismen, die man abzuwehren hat. Unverkennbar ist die Herkunft dieser Begriffe: es sind philosophische Kampfvokabeln, mit denen man seine theoretischen Gegner etikettiert, um sie loszuwerden. Sie alle lassen sich mit einem Begriff zusammenfassen, der so unklar wie polarisierend ist und der vielleicht gerade deswegen so polarisiert, weil er so unklar ist: die »Postmoderne«.
Die Offenheit, die sich in dieser Bezeichnung ausspricht, hat zu viel Verwirrung geführt. Die lateinische Vorsilbe »post-« bedeutet ja zumeist »nach« oder »hinter« – und so hat man »Postmoderne« oft beschreibend, im Sinn einer historischen Epoche verstanden: »Postmoderne« wäre dann »nach der Moderne« oder auch »hinter der Moderne«, im Sinne von »auf die Moderne folgend«. Ebenso kann man das »nach« als Ausdruck für die Aufeinanderfolge philosophischer oder auch künstlerischer Epochen verstehen, nicht als Beschreibung, sondern vielmehr als Forderung: nach der Philosophie, nach der modernen Literatur, nach der Kunst, die ihr Ablaufdatum überschritten hat, muss es eine postmoderne neue geben, die sich von ihr abhebt.
Verbindet man diese beiden Interpretationen miteinander, das beschriebene Zeitalter und die geforderte Nachfolge, dann erhält man die Formel, die bis heute die Gemüter erregt. Wenn die »Moderne« das Zeitalter der Aufklärung, des Liberalismus, der Vernunft ist, dann ist die »Postmoderne« das Zeitalter, das all diese Werte verabschiedet. Wenn die »Moderne« das Zeitalter der Rationalität und der Wissenschaft ist, dann bedeutet »Postmoderne« eine Abkehr von der Wahrheit und eine Rückkehr in einen vormodernen Irrationalismus, einen Flirt mit dem längst Überwundenen. »Postmoderne« wäre dann im Sinn verdreht, gleichbedeutend mit »Vormoderne«, zumindest aber mit den dunklen Seiten der »Moderne«. Ist diese »Moderne« das Zeitalter von Effizienz und der Rationalisierung von Prozessen, dann steht »Postmoderne« für Überflüssiges und Überschüssiges, für etwas, was man auch weglassen kann, was übersteht und deswegen gestutzt werden muss. Und wer schon die »Moderne« für ihre Abkehr von Tradition und alten, eben vormodernen Werten kritisiert hat, für den ist die »Postmoderne« die Apokalypse der Beliebigkeit.
Die »Postmoderne« ist der Gegner, auf den sich alle einigen können, selbst wenn sie sonst zueinander Gegenteiliges behaupten. Dabei stehen Heftigkeit der Ablehnung und Wissen über die Positionen, die man der »Postmoderne« zuordnet, meist in einem umgekehrt proportionalen Verhältnis zueinander. Das heißt: Je weniger einer über die »Postmoderne« weiß, desto entschiedener sind seine Urteile über sie. Je weniger eine von den »postmodernen« Autoren gelesen hat, desto sicherer ist sie sich, dass es sich nicht lohnt, sich mit diesem »Geschwurbel« zu beschäftigen.
Spukt es in der Universität?
Das wäre nun alles nicht besonders interessant, wenn nicht durch diese Art Vorurteil Entscheidendes verlorenginge. Das bedeutet nicht nur, dass sich mit einem einzigen Begriff ein kompletter Zeit- und Erfahrungsraum erledigen soll. Das ist auch bei Begriffen wie »Mittelalter« oder »Sklaverei« der Fall. Dass Entscheidendes verlorengeht, bedeutet vor allem, dass das, was in der anfangs so genannten Denkbewegung gedacht wird, den Übergang in diejenige Welt betrifft, in der wir heute leben.
Die »Postmoderne«, so wie sie hier verstanden wird, ist kein Sammelbegriff für irgendwelche durchgeknallten französischen Philosophen und auch kein Werturteil über den allgemeinen Sittenverfall. Sie bezeichnet, in bewusster Aneignung eines völlig unklaren Begriffs, einen Zeitraum von etwa 30 Jahren, in denen sich die Reste des alten europäischen Denkens mit den Tendenzen der nach dem Zweiten Weltkrieg neu anhebenden gesellschaftlichen und theoretischen Entwicklungen verbinden. Das, was übrig ist und das, was neu entsteht, gehen in ihr eine einzigartige Liaison ein, in der noch einmal, ein letztes Mal, alles auf den Tisch kommt.
Ein letztes Mal? Ja. Die »Postmoderne«, wie sie hier dargestellt wird, mag in ihren Ausläufern die akademische Bildung maßgeblich mitbestimmen. In dem, was sie eigentlich auszeichnet, scheitert sie aber. Sie geht unter, weil ihre Bedingungen immer noch diejenigen einer früheren Zeit sind, die zugleich mit ihr zugrunde geht. Den intellektuellen Freiraum, in dem sich Projekte wie die Macy-Konferenzen, die französische Reform-Universität oder die engagierte Gesellschaftstheorie entfalten konnten, gibt es nicht mehr.
Ende der 1970er Jahre endet die Zeit des engagierten Intellektuellen, so wie er sich am Ende des 19. Jahrhunderts erst als besondere Form des bürgerlichen Selbstverständnisses herauskristallisiert hat. Eine Gestalt der Geschichte nimmt den Hut. Es endet auch die Zeit der bürgerlichen Ästhetik als bestimmendes Paradigma des Progressiven, Hybriden und Extremen gleichermaßen. Es endet schließlich die kurze Zeitspanne, die nach dem Zweiten Weltkrieg noch einmal die Offenheit der Situation mit der Aufbruchsstimmung des Neuanfangs verbunden hat, die in den Ruinen der Vergangenheit den Geist der Zukunft erblickte. An ihre Stelle tritt die Aussöhnung von Elite und Masse an den Universitäten und von Kredit und Produktion für Arbeiter und Konsumenten.
Dieser Epochenbruch ist für uns, vierzig Jahre später, möglicherweise noch zu nahe, um ihn zu erkennen. Für die Allgemeinbildung verschwindet er unter Kontinuitäten. Auch der Historiker täte sich schwer damit, dreißig Jahre als historische Epoche auszuzeichnen. Aber ideengeschichtlich lassen sich die Grenzen dieser Epoche durchaus belegen.
Um 1950 beginnt die intellektuelle Geschichte der berühmt-berüchtigten »französischen Philosophie«, des sogenannten »Poststrukturalismus«. Sie endet mit dem intellektuellen Umschwung in Frankreich zu Beginn der 1980er, als die Neuen Philosophen sich verbitten, dass »französische Philosophie« gleichgesetzt wird mit Foucault, Derrida, Deleuze oder Lyotard. Um 1950 beginnt auch die Geschichte der Frankfurter Schule in der Bundesrepublik Deutschland. Es ist, auch wenn sie ihre Wurzeln in der Weimarer Republik hat, eine andere Frankfurter Schule. Ihr Einfluss auf die deutsche Bildungslandschaft ist mit diesem Neuanfang untrennbar verknüpft. Auch ein zunächst im Hintergrund verbleibender Kreis von Intellektuellen um den Münsteraner Philosophen Joachim Ritter begründet sich Anfang der 1950er Jahre und wird bis zum Ende des Jahrzehnts zur entscheidenden Prägung für später selber einflussreiche Männer werden.
Beide deutschen Schulen finden ihr Ende oder werden in etwas ganz anderes transformiert, beide noch vor 1980. Schließlich haben auch die in sich vielfältige intellektuelle Bewegung der sogenannten »Kybernetik« und die philosophische Theorierichtung des Neuen Pragmatismus beide ihre Wurzeln am Beginn der 1950er Jahre: in den Macy-Konferenzen und in Richard Rortys Dissertation über den Begriff der Möglichkeit, deren Grundgedanke alles weitere mitbestimmen wird. Die Kybernetik wird in den 1970er Jahren, nach einem fantastischen Start, sang- und klanglos untergehen. Sie wird abgelöst von effizienteren und weniger ambitionierten Perspektiven und wird so vollständig vergessen, dass die Protokolle der Macy-Konferenzen erst Jahrzehnte später wieder verfügbar sind. Der Neue Pragmatismus schließlich findet natürlich seine philosophischen Fortsetzungen. Das Projekt aber, das Rorty mit seiner offenen, pluralistischen Version von Philosophie angepeilt hatte, wird von einer härteren, klareren, mehr zum Zeitgeist der 1980er Jahre passenden liberalen Philosophie abgelöst, die Wissenschaftsanspruch und effiziente Gesellschaftssteuerung miteinander verbindet.
Als in den 1990er Jahren, nach dem Fall der Mauer und dem Ende des Kalten Krieges, noch einmal eine Art »postmodernes« Gespenst die Flure der Universitäten heimsucht, ist aus Theorie bereits Mythos geworden. Einzelne Sätze, in konkreten Situationen geäußert, werden zu Schlüsselsätzen ganzer Werke gemacht. Die intensive Denkarbeit und die zum Teil höchst diffizilen Überlegungen, die sich in den Texten finden, führen reihenweise zu hermeneutischen Kurzschlussreaktionen. Dem Foucault, hört man, geht es vor allem um »Macht« und dem Derrida, dem geht es um die »Schrift«, wobei man gar nicht so genau weiß, was damit gemeint ist. Wer es doch weiß, hört sich an wie diejenigen, die Mitte des 20. Jahrhunderts Hegel oder Heidegger nachgeahmt haben. Sie sprechen für die Nichteingeweihten eine seltsame Sprache, huldigen dem Derridadaismus. Deleuze wird zum Lieblingskind der neu entstandenen Medienwissenschaften, auch weil er sich in seinem Spätwerk sehr fürs Kino interessiert hat. Und Lyotard? Der hat doch diesen Text geschrieben: La condition postmoderne, zu Deutsch: Das postmoderne Wissen. Wer also wissen will, was »Postmoderne« ist, der liest es dort nach – oder eben bei Richard Rorty, der hat auch mal was zur »Postmoderne« geschrieben.
Knapp zehn Jahre, nachdem die »Postmoderne« als Zeit- und Freiraum sich für immer geschlossen hat, wird sie mit Bezeichnungen beklebt, in die Forschung eingespeist, philosophisch vermessen und wissenschaftlich »angewendet«. Großordinarien halten Vorlesungen, in denen man den Studierenden Gründe gibt, warum das alles nicht ganz so ernst zu nehmen ist. Andere sehen in der »Postmoderne« Vorkämpfer für ihre Idee von Emanzipation. Gemeinsam mit denen, die sich einzig im Kampf gegen die »Postmoderne« zusammenraufen und versammeln, legen sie Sinn, Vereinnahmung, Vorurteil und Polemik Schicht um Schicht auf die Texte, die Personen und ihr Denken.
Etikettenschwindel
Diese Schichten alle abzutragen und fein säuberlich voneinander zu unterscheiden, ist ein unmögliches Unterfangen, zumindest für einen einzelnen Text. Es ist der Forschung vorbehalten, die freilich ihre eigenen Sinnschichten mitbringt. Ebenso wenig lässt sich eine Geschichte »der« »Postmoderne« schreiben, als handle es sich um ein bequem sortiertes Feld mit klar erkennbaren Kategorien.
Man kann aber den Versuch machen, Texte, Personen und Denken auf eine bestimmte Weise anzuordnen. Im Zusammenschauen, Zusammensehen einiger weniger Aspekte dieser an Aspekten so reichen Theorielandschaft könnte so eine Ahnung dessen entstehen, was »Postmoderne« hätte sein können. Aber die bloße Zusammenschau ist eine theoretische Operation. Vielleicht könnte man also, statt »Geschichte« zu schreiben, eine Geschichte erzählen, die ebenso eine Geschichte des Denkens ist wie eine Geschichte der Personen, zu denen dieses Denken gehört. Eine solche Erzählung wäre ganz sicher keine »große Erzählung«. Sie wäre ein erstes, kein letztes Wort. Sie erhöbe keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit, nähme sich sogar manchmal, hier und dort, ein paar literarische Freiheiten heraus. Sie wäre eher eine Verschiebung von Denkrahmen, eine Möglichkeit, gewohnte Wege auf ungewohnte Weise zu gehen. Sie würde eine sehr begrenzte Auswahl treffen, die trotzdem – oder vielleicht auch gerade deswegen, weil sie begrenzt ist – Einsichten bereithält.
Eine solche Geschichte wäre eine Geschichte von verschiedenen Denkrichtungen. Diese Denkrichtungen sind heute beklebt mit Etiketten, die vorgaukeln, dass einleuchtende Bezeichnungen eine Auseinandersetzung überflüssig machen. Sie heißen »Poststrukturalismus«, »Frankfurter Schule«, »Ritter-Schule«, »Neuer Pragmatismus« und »Kybernetik« oder »Konstruktivismus«. Von 1950 bis 1980 stellen sich diese fünf Denkrichtungen als maßgebliche Einflüsse für die nachfolgenden Jahrzehnte heraus. In Deutschland, in Frankreich und den USA finden sie, oft ohne jede Kommunikation untereinander, zu gemeinsamen Problemstellungen und Lösungswegen. Dann wieder treffen sie sich, unerwartet, beäugen einander misstrauisch, gehen unvermutete Wahlverwandtschaften und Verbindungen ein. Sie schwingen zusammen getrennt voneinander. Die »Postmoderne« ist diese seltsame Vielheit und ihre Protagonisten sind der Grund dafür, warum wir sie heute als solche denken können.
Prüfungen
Die Hände schwitzen, das Herz klopft, die Gedanken rasen. Gleich ist der Moment gekommen, gleich kommt es darauf an. Jeder, der schon einmal eine Schule besucht, eine Ausbildung gemacht oder studiert hat, kennt diese Erfahrung. Für viele Menschen ist sie so existenziell, dass sie sich in ihren Alpträumen immer wieder mit ihr konfrontiert sehen: Die bereits geleistete, erfolgreich geschaffte Prüfung noch einmal ablegen, noch einmal durchleben müssen – und durchfallen. Das Versagen holt einen doch noch ein, die Zeit läuft unerbittlich ab, der Kopf ist leer. Alles ist wie weggeblasen. Zurück geblieben ist nur ein dumpfes, idiotisches Gefühl.
Da liegt ein weißes Blatt auf dem Tisch, so weiß und leer wie mein Kopf. Meine Augen lesen die Aufgabenstellung, immer wieder, doch ich begreife nichts. Stattdessen höre ich jedes Geräusch im Raum mit überdeutlicher Klarheit, höre Stühle rücken, Menschen husten und schniefen, die Uhr ticken, den Stift des Dozenten, der sich etwas notiert. Ich höre wie die anderen in einen Rhythmus geraten, der mich nicht erfasst, der mich vergessen hat: Lesen, nachdenken, sich über das Blatt beugen, schreiben, innehalten, nachdenken, wieder schreiben. Nur ich schreibe nichts. Ich denke nichts. Ein heißes Gefühl überkommt mich, ich schäme mich, bin hilflos, alleine, ahnungslos. Ich bin hier fehl am Platz, bin hier falsch, kann es nicht, ich kann nichts. Die Zeit ist abgelaufen. Stifte hinlegen, Hände unter den Tisch. Die Blätter werden eingesammelt. Der Dozent blickt mich beim Einsammeln meines leeren Blattes nicht an, sagt nichts, lässt sich nichts anmerken. Es läutet. Ich wache auf.
Auch Jackie sitzt vor einem leeren Blatt. Aber das ist kein Alptraum. Es ist die wichtigste Prüfung seines bisherigen Lebens. Jackie hat seine Heimat El-Biar in Algerien verlassen und die Straße von Gibraltar überquert, zwanzig quälende Stunden Seekrankheit.[1] Er hat die letzten anderthalb Jahre eingesperrt hinter den düsteren Mauern des Lycée Louis-le-Grand verbracht, um sich auf diese Prüfung vorzubereiten. Er hat mit den anderen im großen Schlafraum des Internats geschlafen und sich morgens mit eiskaltem Wasser gewaschen. Für genießbares Essen sind die Internatsschüler mehrfach auf die Barrikaden gegangen.
Die Zeit im Internat hat Jackie buchstäblich krank gemacht. Anfang des Jahres hat er es nicht mehr ausgehalten und ist nach El-Biar zurückgefahren, um sich von den Weinkrämpfen, der Einsamkeit, der Kälte und der heftigen Depression zu erholen, die ihn heimgesucht haben. Seit Ostern ist er wieder da. Er muss zwar nicht mehr ins Internat zurück, aber dafür sitzt er nun in einer Prüfung, von der er nicht weiß, wie er sie schaffen soll. Aufputschmittel, um nachts lernen zu können. Schlafmittel, um die dringend benötigte Ruhe zu finden. Jackie ist am Ende.
Paul-Michel geht es nur geringfügig besser. Zum dritten Mal sitzt er in der Französischprüfung, die eigentlich nur einmal stattfinden sollte.[2] Jede Prüfung dauert sechs Stunden, die ersten beiden wurden nachträglich annulliert. Nach insgesamt zwölf Stunden Prüfung liegen noch einmal sechs Stunden vor ihm.
Paul-Michel besucht die Vorbereitungsklasse in Poitiers, seiner Heimatstadt. Das letzte Jahr war turbulent, denn vor nicht einmal einem Monat endete der große Krieg. Er hat auch in Poitiers seine Spuren hinterlassen. Es mangelt an so ziemlich allem, im Winter vor allem an Heizmaterial. Paul-Michel hat mit anderen Schülern Holz bei der Miliz nebenan geklaut und ist nicht aufgeflogen. Im Sommer vor einem Jahr mussten die Schüler immer wieder Schutz suchen, wenn Bomber über der Stadt auftauchten. In den Wochen nach der Landung der Alliierten fällt die Schule aus.
Doch das bedeutet nicht, dass es keine Prüfung gibt. Paul-Michel gehört zu den eloquenten Schülern der Klasse. Er begeistert sich seit einigen Jahren für Philosophie und liest nach und nach all die Texte, die von den Lehrern behandelt werden. Er fertigt Kopien der Mitschriften aus den Vorjahren an und leiht seinen Mitschülern bereitwillig seine Notizen.
Nun sitzt Paul-Michel mit den anderen in der Prüfung für die Zulassung zum begehrten Stipendium der École Normale Supérieure. Sein Abitur hat er mit guten Noten abgeschlossen. Er musste seinen Vater, Paul Foucault, überzeugen, dass er nicht dieselbe Laufbahn wie er einzuschlagen gedenkt. Das heißt, Arzt oder Chirurg zu werden, so wie der Vater seines Vaters es schon war, der ebenfalls Paul Foucault hieß. Auch der Vater von Paul-Michels Mutter ist Chirurg. Eine Familie von Ärzten und Medizinprofessoren. Nur Paul-Michel will etwas anderes machen. Er will Geschichte und Literatur studieren.
X-Beine
Der Bildungsweg in Frankreich weist einige Besonderheiten auf. Nach dem baccalauréat, kurz »bac«, das dem deutschen Abitur entspricht, gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann direkt an die Universität gehen und studieren. Oder man besucht, oft während des Studiums, zwei weitere Klassen. Eine Art Oberstufe nach der Oberstufe, die dafür gedacht ist, die Aufnahmeprüfung für die Grandes Écoles vorzubereiten. Tatsächlich kann man an diesen Grandes Écoles selbst keine Abschlüsse machen. Dazu müssen auch die Schüler dieser Eliteeinrichtungen die Universität besuchen. Sie bekommen dafür eine Unterkunft und ein Stipendium für vier Jahre. Vor allem aber bekommen sie: Prestige, ausgezeichnete Lehrer, gute Beziehungen zu den anderen Schülern, Zugang zu intellektuellen Kreisen.
Die Geschichte der Grandes Écoles geht auf Napoleon zurück. Mit der Neugründung der Universitäten, die in der Revolution aufgelöst worden waren, schuf der französische Kaiser die Schulen, an denen die französische Beamtenelite ausgebildet werden sollte. Die Grandes Écoles sind also Staatseinrichtungen, die Ausbildung und Förderung anbieten, dafür aber eine enge Bindung an die staatlichen Interessen fordern. Das spezialisierte Beamtentum umfasst Ökonomen und Ingenieure, aber auch die Lehrkräfte, die am Lycée, dem französischen Gymnasium lehren und die Vorbereitungsklassen für die Aufnahmeprüfungen der Grandes Écoles unterrichten. Damit schließt sich der Kreislauf.
Entsprechend hart sind die Aufnahmebedingungen. Jedes Jahr werden von den Grandes Écoles nur wenige Plätze ausgeschrieben. Um diese Plätze konkurrieren dann Bewerber aus ganz Frankreich. Man kann die Vorbereitungsklassen an bestimmten Gymnasien besuchen, manche bieten nur die erste Klasse an, die man umgangssprachlich hypokhâgne nennt. Die zweite Klasse ist dann entsprechend die khâgne. Der Ausdruck selbst stammt wahrscheinlich von einem Spottbegriff ab, cagneux, »x-beinig«. Die Legende will es, dass die Studenten der militärischen Schulen, für die körperliche Ertüchtigung vorgeschrieben war, so die Studenten der humanistischen Schulen bezeichneten: als körperlich unbeholfene Geistesarbeiter.[3] Heute würde man vielleicht »Elfenbeinturmbewohner« sagen und über die Weltfremdheit der Geisteswissenschaftler schimpfen.
Weil die Gymnasien dadurch selbst in eine Art Wettbewerb eintreten, gibt es Gymnasien, an denen die Vorbereitungsklassen vielversprechender sind als an anderen. Die beiden Lycées Henri IV und Louis-le-Grand in Paris gelten als Spitzenreiter. Beide sind ehemalige kirchliche Einrichtungen: Das Lycée Henri IV ist eine ehemalige Benediktiner-Abtei, die während der Revolution säkularisiert wurde, das Louis-le-Grand ein ehemaliges Jesuiten-Collége. Paul-Michel wird, nachdem er in Poitiers gescheitert ist, sein Glück am Lycée Henri IV in Paris versuchen. Und Jackie ist den ganzen Weg von El-Bias in Algerien nach Paris gereist, um seine Chancen in der Prüfung durch den Besuch am renommierten Lycée Louis-le-Grand zu erhöhen.
Lektion in Demut
Doch es hilft nichts. Jackie rasselt durch die Prüfung. Das Blatt vor ihm bleibt leer. Jackie bricht die Prüfung ab.[4] Er hat bereits im Jahr zuvor sein Glück versucht und ist durchgefallen. Das ist nicht ungewöhnlich, viele brauchen einen zweiten Versuch. Ob er aber zu einem dritten zugelassen wird, ist fraglich. Außerdem steht der erste Studienabschluss, die licence, bevor. Jackie schafft sie gerade so. Das war nicht selbstverständlich: Ein Gutachten zu einer Studienarbeit im Fach Philosophiegeschichte liest sich wie »eine perfekte Karikatur« auf den späteren Philosophen:
»Brillanter Aufsatz, soweit er obskur ist … Exerzitium in Virtuosität, dem man die Intelligenz nicht absprechen kann, doch ohne nähere Beziehung zur Geschichte der Philosophie. … Soll wiederkommen, wenn er bereit ist, die Regeln zu akzeptieren und nicht zu erfinden, wo man sich informieren muß. Ein Durchfallen wird diesem Kandidaten von Nutzen sein.«[5]
Immerhin muss Jackie nicht mehr im Internat wohnen. Er hat ein kleines Zimmer in der Nähe des Jardin des Plantes gemietet und geht mittags mit seinen Freunden in einem Diätrestaurant essen. Es geht ihm geringfügig besser, er erholt sich langsam, aber noch immer liegt diese Prüfung vor ihm, drohend, weil endgültig. Einen vierten Versuch wird es nicht geben. Also lernt Jackie. Diszipliniert sich, geht es langsam an, erarbeitet sich nach und nach den gesamten Prüfungsstoff. Die Studenten helfen sich gegenseitig, wo sie die Schwächen ihrer Lehrer ausgleichen müssen.
Man darf sich diese Form des Lernens vorstellen wie bei einer typischen Fachprüfung. Auswendiglernen steht vor Kreativität. In den schriftlichen Prüfungen ist eine bestimmte Textform gefragt, die man mit sicherem Stil und den erwartbaren Argumenten auszuführen hat. Der Stoff ist vorgegeben und verschult, es geht vor allem darum, das Gegebene zu wiederholen.
An der Universität, dem einzigen Gradmesser für die eigenen Leistungen, werden Beurteilungen immer auch auf die Persönlichkeit bezogen. Fachliche und charakterliche Kompetenz sind miteinander verwoben. Das erzwingt eine Identifizierung mit dem Fach, erhöht aber auch die Wahrscheinlichkeit narzisstischer Kränkungen. Das gesamte Studium ist nicht nur eine Lektion in Demut, sondern vor allem eine Demütigung vielfältiger Art. Jackie wird immer wieder mit Lehrern konfrontiert werden, die ihm wegen seiner mangelnden Bereitschaft, sich an ihre Regeln zu halten, Unfähigkeit und Täuschungsabsicht unterstellen.
Paul-Michel hat sich mittlerweile mit seinem zweiten Versuch arrangiert. Seine Mutter ist überzeugt, dass er es am Lycée Henri IV in Paris schaffen wird. Poitiers ist nicht Paris. Der Junge muss in die Stadt. Dabei darf man sich nicht das Paris der späteren Jahrzehnte vorstellen. Der Krieg ist erst seit einem guten halben Jahr zu Ende. Immerhin muss Paul-Michel nicht ins Internat. Er mietet sich ein Zimmer und geht zur Schule.[6] Dort ist Paul-Michel ein Außenseiter. Er kommt vom Land, wohnt aber nicht bei seinen Eltern. Das ist ungewöhnlich, denn normalerweise wohnen die Schüler von außerhalb in den Internaten. Paul-Michel ist es aber ganz recht. Er ist gern allein. Das gibt ihm die Zeit, den Fehler vom Jahr davor auszumerzen. Paul-Michel lernt gewissenhaft für den zweiten Versuch.
Das Prüfungsverfahren ist denkbar einfach. Die Grandes Écoles stellen eine Anzahl Plätze zur Verfügung, dann wird geprüft und von Platz 1 bis, sagen wir, Platz 38 werden alle aufgenommen. Alle anderen ab Platz 39 gehen leer aus. Die Vorbereitungsklassen werden von Lehrern unterrichtet, die den Ausbildungsgang selbst durchlaufen haben. Die Konkurrenz unter den Gymnasien wiederum ergibt sich daraus, dass nicht alle Vorbereitungsklassen dieselbe Qualität aufweisen.
Deswegen versuchen die Studierenden, die Klassen an den prestigeträchtigen Lycées zu besuchen. Entsprechend lehren an diesen Lycées auch hervorragende Lehrer, die natürlich genau darauf achten, ob sie hervorragende Schüler in ihren Klassen haben. Dieser Zusammenhang begegnet im französischen Bildungssystem immer wieder: Lehrer und Schüler, die weniger durch eine inhaltliche Nachfolge, als durch eine formale Förderung einander verbunden sind.
Paul-Michel trifft am Lycée Henri IV auf einen Lehrer, der für seine ganze Generation bedeutsam werden wird. Jean Hyppolite gilt als derjenige, der zusammen mit Alexandre Kojève, Henri Lefebvre und Jean Wahl für eine Renaissance des deutschen Philosophen Georg W. F. Hegel im Frankreich der 1930er und 1940er Jahre verantwortlich ist. Als Paul-Michel in seine Klasse geht, leistet Hyppolite gerade seine Lehre im Dienst des Staates. Er hat die École Normale Supérieure, die Grande École für die Geisteswissenschaften, zusammen mit anderen Geistesgrößen wie Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty und George Canguilhem besucht. Alle vier Philosophen bleiben Konstanten für die Generation von 1925–1930.
Dieses Mal bestehen beide die Prüfung. Jackie im Jahr 1952, Paul-Michel sechs Jahre früher, im Sommer 1946. Wie sieht eine typische mündliche Prüfung für die École Normale Supérieure aus? Man bekommt einen Text und soll etwas dazu sagen. Nur was? Bleibt man zu nah am Inhalt, wiederholt man ihn nur und interpretiert ihn nicht. Das ist aber gefordert. Weicht man dagegen in der Interpretation zu weit vom Text ab, verfehlt man die Aufgabenstellung ebenso. Letztlich geht es darum, das zu treffen, was die Prüfer erwarten und das zu übertreffen, was die anderen dazu sagen.
Das sind lauter unmögliche Aufgaben, die aber erklären, was diese Prüfung für die Studierenden bedeutet. Jedem ist klar, dass hier keine echte Kompetenz abgeprüft wird. Es geht um einen formellen Akt, um das Durchlaufen eines Verfahrens, das von so vielen Variablen abhängig ist, dass es beliebig wird. Die Prüfer, die Professoren, die Lehrer sind – bis auf einige wenige Ausnahmen – in einem Bildungssystem sozialisiert worden, in dem es darum geht, für das Wohl des Ganzen auf das Eigene zu verzichten.
Eine seltsame Machtlosigkeit: Man weiß, dass das Wissen, das man zu wiederholen hat, überfällig ist, zum Teil auch falsch, dass es einem scholastisch und gedankenlos aufoktroyiert wird. Man beginnt, dieses Wissen zu verachten, an dem man gemessen wird, für das man die eigene Individualität aufzugeben hat. Die französische Philosophie, das ist erwartbares Improvisieren über Themen, die schon vor dreißig Jahren verstaubt waren. Als Student liest man die Texte derer, die zu dieser Zeit den gleichen Bildungsgang durchlaufen haben und liest in ihnen trotzige Angriffe auf ein Wissenssystem, das das Denken der Funktion unterordnet.
Diese Erfahrung prägt sich Generationen französischer Studierender ein. Ein staatlich verordneter Bildungskanon, gegen den man sich nicht auflehnen kann, ohne die eigene Karriere zu gefährden. Doch ganz so einfach ist es nicht. Eine weitere französische Besonderheit sorgt dafür, dass die Auflehnung gegen die staatliche Verordnung seit dem Ende des 19. Jahrhunderts ein Ventil bekommt. Sie erklärt auch, warum »französische Theorie« auf naturwissenschaftlich geprägte Philosophen so ausgesprochen »literarisch« wirkt. Dieser Eindruck ist nämlich ganz richtig.
J’accuse!
Die napoleonische Ordnung der französischen Gesellschaft sorgt dafür, dass zwischen den Druckzonen der bürokratischen Staatsorganisation und der eigentlichen Öffentlichkeit, in der diese Staatsorganisation immer wieder und mit durchaus turbulenten Folgen verhandelt wird, ein anhaltendes Sturmtief entsteht. Diese Krisenformation hat ihren exemplarischen Anfang in einer Auseinandersetzung, in der sich der Konflikt zwischen Öffentlichkeit und Staat unmittelbar zeigt: der sogenannten »Dreyfus-Affäre«.[7]
Ende des Jahres 1894 wird der jüdische Offizier Alfred Dreyfus wegen Geheimnisverrat an das Deutsche Kaiserreich des Landesverrats angeklagt. Der Fall schlägt in der Presse sofort hohe Wellen. Die französische Armee fürchtet einen Prestigeverlust und verurteilt Dreyfus im Schnellverfahren, unter anderem auf Basis eines dafür extra zusammengestellten Geheimdossiers. Als eineinhalb Jahre später der wahre Schuldige gefasst wird, strafversetzt man den ermittelnden Offizier nach Afrika. Der tatsächliche Verräter wird freigesprochen. Das bringt das Fass zum Überlaufen.
Die Dreyfus-Affäre verstrickt nicht nur die Institutionen des französischen Staates, die Justiz, das Militär und die Geheimdienste in einen Justizirrtum. Sie eröffnet auch die Frage, inwiefern sich die Dritte Französische Republik eigentlich als Republik und nicht als Polizeistaat definiert. 1898 erscheint der berühmte Brief »J’accuse …!«, »Ich klage an …!« des Schriftstellers Émile Zola an den Präsidenten. Er bringt die Frage nach den Werten der Republik auf den Punkt:
»Wenn man die Wahrheit eingräbt, so entwickelt sie eine solche Sprengkraft, dass sie an dem Tage, da sie durchbricht, alles zerstört. … [D]ie Tat, die ich vollbringe, ist nur ein revolutionäres Mittel, um den Durchbruch der Wahrheit und der Gerechtigkeit zu beschleunigen. Ich habe nur eine Leidenschaft, die der Aufklärung im Namen der Menschheit, die so viel gelitten hat und die ein Recht auf Glück besitzt.«[8]
Zola ist sich bewusst, dass er sich gegen einen übermächtigen Staatsapparat auflehnt. Er tut es trotzdem. Damit ist die Gestalt des »Intellektuellen« geboren, der sich im Namen von Wahrheit und Gerechtigkeit gegen Repression und Ungerechtigkeit auflehnt. Zugleich wird damit die Literatur zu einem Medium des politischen Eingriffs. Zola kann für die Wahrheit sprechen, weil er weder dem Staat noch dem journalistischen Mainstream angehört. Er ist ein Künstler, ein Außenseiter, aber einflussreich und kann dadurch Widerstand gegen die Obrigkeit mobilisieren.
Diesem Rollenmodell des französischen »Intellektuellen« eifern in den folgenden Jahrzehnten Dichter, Künstler, Philosophen nach. Sie werden immer wieder als »moralisches Gewissen« bezeichnet, tatsächlich sind sie aber ebenso Ideengeber und Anführer ganzer intellektueller Bewegungen. Der wohl bekannteste französische Intellektuelle des 20. Jahrhunderts gibt vor allem in der unmittelbaren Nachkriegszeit den Ton an: Jean-Paul Sartre gilt mit seiner Mischung aus deutscher und französischer Philosophie nicht nur als der neueste Schrei auf dem Theoriemarkt, sondern auch als politisches Gewissen, das den Gedanken der Unterdrückung in die Gesellschaft selbst überträgt und ihm ein radikales Konzept existenzialistischer Freiheit gegenüberstellt.
Doch die Intellektuellen sind nicht nur staatskritische Akteure. Sie stehen auch den massenmedialen Kampagnen kritisch gegenüber, die besonders im Fall Dreyfus Druck auf das Militär und die Politik ausüben – Hetzkampagnen von Seiten der Rechten, Antisemitismusvorwürfe von Seiten der Liberalen.
Zola klagt in seinem Brief die Staatsbeamten an, die den Ausgang der Affäre zu verantworten haben, aber er wettert auch gegen die »Schmutzpresse«, darüber, »daß jetzt dieses Gesindel über die Niederlage des Rechts und der schlichten Ehrlichkeit unverschämt triumphiert.«[9]
Der französische »Intellektuelle« gehört weder dem Staat noch der Öffentlichkeit im Sinne der von den Massenmedien adressierten Lesern an. Er repräsentiert vielmehr ein drittes Feld, das zwischen bildungsbürgerlicher Elite und Außenseitertum, Avantgarde und Hochkultur oszilliert. Dieses Feld differenziert sich immer weiter aus und führt schließlich zu Kunstformen, die vor allem für ihren eigenen Markt produzieren.
Diese »L’Art pour l’art«, »Kunst um der Kunst willen«, repräsentiert einerseits die Autonomie der Kunst gegenüber Staat und Öffentlichkeit. Insofern ist sie die Ressource für kommende Generationen, wenn es um Denkfiguren der Freiheit, der Unabhängigkeit und der Entfaltung von Möglichkeiten, aber auch der Revolution und des Umsturzes geht. Zum anderen wird dieser autonome Bereich selbst stilbildend. In ihm lagern sich verschiedene Schichten politischen Engagements ebenso ab wie die Bewegungen, mit denen die Kunst sich immer wieder selbst überschreitet.[10]
Damit ist dieses Feld der »Intellektuellen« selbst der Spannung ausgesetzt, in deren Vermittlung es allererst entstanden ist: Der Vielzahl von heterogenen Stilen, Blickpunkten, Denkweisen, die sich mit der Zeit zu Schulbildungen verfestigen und sogar ihren Weg in die Prüfungsanforderungen der Grandes Écoles finden, steht ein radikaler und ständiger Wille zur Überschreitung gegenüber, eine ständige Forderung nach Avantgarde. Eine Überschreitung, die sich nicht festlegen lassen will, die immer wieder einsetzt und die dadurch irgendwann selbst zu einem Problem, einer Sache des Denkens wird, die Dichter und Künstler ebenso inspiriert und herausfordert wie Wissenschaftler und Philosophen.
Ohne die Figur des »Intellektuellen« und ohne die Struktur seines Feldes versteht man nicht, worauf die jungen Geisteswissenschaftler zurückgreifen, die in den 1940ern und 1950ern das französische Bildungssystem durchlaufen. Für sie erscheint dieses Bildungssystem selbst wie eine Obrigkeit, gegen die es sich aufzulehnen gilt. Der »Marsch durch die Institutionen« ist ihre einzige Möglichkeit, weil sie sonst gnadenlos von diesem System aussortiert werden. Sie müssen es also durchlaufen – und sich damit die Mittel des Systems aneignen, mit denen sie dieses System später in Frage stellen werden. Und zwar durchaus in einer Radikalität, die auch zum Anspruch einer künstlerischen Avantgarde gehören könnte, wie sich zeigen wird.
Im Salon von Madame Davy
Jackie und Paul-Michel durchlaufen diesen Bildungsgang in seiner ganzen epischen Breite. Beide absolvieren ihr Studium an der École Normale Supérieure (ENS), knüpfen Kontakte und studieren bei Lehrern, die sie nach Kräften fördern. Sie werden an der ENS beide einem Tutor begegnen, der ihre gesamte Generation nachhaltig prägen wird: Louis Althusser.[11] Jackie hört auch eine Vorlesung in Experimentalphilosophie, die Paul-Michel anbietet, der bereits seit einem Jahr Assistent an der Universität Lille ist.
Anderen ist dieser Weg nicht vergönnt. Sie scheitern an der Aufnahmeprüfung für die ENS oder nehmen erst gar nicht an ihr teil. Zu den ersteren gehört Jean-François, der ein paar Jahre vor Jackie das Lycée Louis-le-Grand besucht hat.[12] Auch er ist, wie Jackie und Paul-Michel, von der Literatur und dem Engagement der »Intellektuellen« fasziniert. Aber anders als diese beiden hat Jean-François tatsächlich künstlerische Ambitionen. Eine Zeit lang überlegt er, Maler zu werden. Er schreibt Essays und Gedichte, mit zwanzig seinen ersten Roman.
Jean-François stammt aus einer aufstrebenden Familie, der Vater Weltkriegsveteran und Handelsvertreter, die Mutter ehrgeizige Hausfrau und Kriegswitwe. Jean-Pierre Lyotard kommt vom Land, aus einer armen Bauernfamilie. Trotzdem beherrscht er Latein und Altgriechisch und gibt diese Kenntnisse an seine Kinder, später auch an seine Enkel weiter. Insbesondere auf seinen Sohn Jean-François hält er große Stücke. Er soll einmal die akademische Karriere anstreben, die ihm verwehrt geblieben ist.
Den Krieg erlebt Jean-François noch unmittelbarer als der zwei Jahre jüngere Paul-Michel. Mit siebzehn Jahren solidarisiert er sich mit jüdischen Schülern, die antisemitischen Attacken ausgesetzt sind. Dass es an seiner Schule ein Netzwerk der Résistance gibt, erfährt er erst später. Ein Lehrer der Schule wird im selben Jahr von der Gestapo verhaftet, fünf Schüler zum Tode verurteilt und im kommenden Winter per Schießbefehl hingerichtet. Nach dem baccalauréat durchläuft Jean-François die Vorbereitungsklassen der hypokhâgne und der khâgne am Louis-le-Grand. Er scheitert an der Abschlussprüfung, vielleicht – wie er viel später überlegt –, weil er zu »literarisch«[13] schreibt. Das gleiche Problem haben auch Jackie und Paul-Michel, trotz der bestandenen Prüfung. Es zeigt, wie sehr sich die Schüler und Studenten an der Haltung der literarischen Avantgarde orientieren.
Jean-François studiert an der Sorbonne Philosophie. Er beschäftigt sich in seiner Diplomarbeit mit Zen-Buddhismus und Daoismus, mit der Stoa und den Epikureern. Hegel, Husserl und Heidegger hat er schon auf dem Louis-le-Grand gelesen. Früh konfrontiert mit dem Widerspruch zwischen Leben und Gesetz, zwischen zwei Ordnungssystemen, dem System der deutschen Besatzung und dem System des französischen Widerstands, dem französischen Bildungssystem und der künstlerischen Avantgarde, sucht Jean-François nach einem Ausdruck für diese Situation.
Ebenfalls auf der Suche nach Ausdruck ist der 16 Jahre alte Schüler Gilles. Er stammt aus einer mittelständischen französischen Familie.[14] Vater Deleuze wettert gegen den jüdischen Präsidenten Léon Blum, Mutter Deleuze gegen die Arbeiter, die den Strand bevölkern. Gilles’ großer Bruder George hat für die Résistance gekämpft und ist nach seiner Verhaftung durch die Gestapo auf dem Weg ins Konzentrationslager gestorben. Für seine Eltern ist George ein Held, ein Märtyrer.
Erst mit der Trennung von den Eltern, als Gilles die Schule in Deauville besucht, erwacht in dem Jungen Interesse. Vorher hat er vor lauter Langeweile Briefmarken gesammelt. Jetzt hängt er an den Lippen von Pierre Halbwachs, seinem Lehrer, der Gilles in die Welt der französischen Literatur einführt. Die enge intellektuelle Beziehung zwischen Schüler und Lehrer beunruhigt die Vermieterin von Gilles’ Unterkunft. Sie warnt ihn davor, sich mit einem homosexuellen Lehrer einzulassen. Ein Gespräch, das die Sache aufklären sollte, verläuft katastrophal und die Vermieterin informiert Gilles’ Eltern.
Als die Familie nach dem Waffenstillstand nach Paris zurückkehren kann, nimmt Gilles’ Freund Michel ihn mit in die Philosophieklasse an seinem Gymnasium, die der spätere Renaissance-Spezialist Maurice de Gandillac unterrichtet. Die beiden Freunde üben sich im philosophischen Dialog und lesen zusammen philosophische Texte. Zwei Jahre später lädt de Gandillac sie in den Salon von Marie-Magdeleine Davy etwas außerhalb von Paris ein. Madame Davys Salon versammelt Schriftsteller, Künstler, Widerstandskämpfer, untergetauchte Soldaten der Alliierten, Juden – und die wichtigsten Intellektuellen Frankreichs: Jean-Paul Sartre, Alexandre Kojève, Michel Leiris, Gaston Bachelard, Raymond Aron, Jean Wahl, Pierre Klossowski, Jean Hyppolite.
Auch die Gastgeberin ist eine Intellektuelle, und was für eine. Sie beherrscht ein Dutzend moderne Sprachen, aber auch Latein, Altgriechisch, Hebräisch und Sanskrit. Schon als Kind weigert sie sich, den gesellschaftlichen Erwartungen an eine Frau zu entsprechen: Sie kleidet sich wie ein Junge, spricht von sich im Maskulinum, klettert nachts an einem Seil aus dem Fenster, um im Park und am Fluss des Anwesens ihrer Großmutter herumzustreunen. Mit achtzehn studiert sie an der Sorbonne Philosophie und Geschichte und spezialisiert sich auf mittelalterliche Philosophie.
Ihr Salon ist damit ein Epizentrum der intellektuellen Bewegung. All das, was den französischen »Intellektuellen« in den Kriegsjahren auszeichnen kann, versammelt sich dort. Und Gilles ist in den folgenden Jahren mittendrin. Er diskutiert mit Pierre Klossowski über Nietzsche, besucht Veranstaltungen zu George Bataille, zur »Christlichen Zivilisation« und die öffentlichen Vorlesungen an den Pariser Ausbildungskrankenhäusern und Psychiatrien.
Im Jahr 1943 sitzen Gilles und Michel mitten im Besatzungswinter unter Decken und Kaninchenfellen und lesen mit roten Ohren Jean-Paul Sartres Mammutwerk Das Sein und das Nichts. Die französische Öffentlichkeit, auch die der »Intellektuellen«, wird das Werk erst im Kontext der Befreiung für sich entdecken. Am Wochenende gehen die Freunde in Sartres Stück Die Fliegen, werden aber von einem Fliegeralarm aus dem Theater getrieben. Während Bomben auf die Renaultwerke fallen, diskutieren die beiden das Stück. Dann kehren sie ins Theater zurück und schauen es sich zu Ende an.
Eine völlige Fehldeutung von Descartes
Jean-François ist fertig mit dem Studium. Nun muss er sich der zweiten großen Prüfung stellen, die das französische Bildungssystem für seine angehende Elite vorsieht: der agrégation. Wer sie besteht, darf an Gymnasien und in den Vorbereitungsklassen für die Prüfungen der Grandes Écoles lehren. Zugangsvoraussetzung für die agrégation ist die maîtrise, also der Studienabschluss, den man – wie die licence nach drei Jahren – nach fünf Jahren erwirbt.
Die agrégation besteht ebenfalls aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil. Der schriftliche Teil umfasst mehrstündige Prüfungen, in denen die Fähigkeiten, die man im Studium erworben hat, mit Blick auf die Lehre an den Gymnasien abgeprüft werden. Die Prüfung ist auch deswegen so streng, weil sich aus ihren Absolventen die Dozenten für die Abschlussklassen rekrutieren. Daher muss der Prüfungsverlauf sicherstellen, dass die Qualität gewahrt bleibt und sich das System selbst erneuern kann.
Jean-François schafft die schriftliche Prüfung, aber er versagt im mündlichen Examen.[15] Die Situation, so schreibt er später, schnürt ihm den Atem ab. Er lehrt bereits seit einem Jahr an einer Militärschule in Autun. Seit zwei Jahren ist er verheiratet. Wieder stößt er auf die Unvereinbarkeit zweier Ordnungen: Seine Frau, Andrée, ist zwar nur Halbjüdin, aber das reicht für die Familie, um sie abzulehnen. Zudem ist sie bereits vor der Hochzeit schwanger. Beim zweiten Anlauf gelingt Jean-François die Prüfung zur agrégation.
Im Jahr 1950 wird er nach Constantine in Algerien versetzt. Was er dort erlebt, wird sein politisches Engagement als »Intellektueller« ebenso motivieren, wie ihn der französische Kolonialismus mit endgültiger Härte vor das Problem stellt, mit dem er sich philosophisch sein ganzes Leben auseinandersetzen wird: Das Problem des Streits, der Unvereinbarkeiten und einander ausschließenden Ordnungen, in all seinen Facetten. Und die Frage nach der Pluralität, in der dieser Streit so aufgehoben werden kann, dass er keinen Schaden mehr anrichtet.
Auch Jackie und Paul-Michel scheitern an der Prüfung zur agrégation. Paul-Michel soll schriftlich auf die Frage »Ist der Mensch ein Teil der Natur?« antworten und dann zum Werk Auguste Comtes Stellung nehmen.[16] Er wird zur mündlichen Prüfung zugelassen, die sich eigentlich aus zwei Prüfungen zusammensetzt: einem Vortrag, den der Prüfling über ein gelostes Thema zu halten hat. Und eine vierteilige mündliche Prüfung, die aus einem weiteren Vortrag über ein vorgegebenes Thema und aus drei Texterläuterungen zu einem französischen, einem lateinischen und einem griechischen Text besteht. Als Paul-Michel zum Begriff der Hypothese vortragen soll, trägt er stattdessen zu den Hypothesen von Platons Parmenides vor und verliert sich darin. Zum wissenschaftlichen Begriff der Hypothese kommt er erst gar nicht.
Jackie bereitet sich penibel auf die Prüfung vor. Ein wichtiger Gesprächspartner ist für ihn Louis Althusser, der seine Studienarbeiten streng beurteilt, mit 7 von 20 möglichen Punkten. Zugleich macht er Jackie deutlich, worum es bei der agrégation geht: »Ich stelle die Qualität weder Deiner Erkenntnisse noch Deiner begrifflichen Intelligenz in Frage, auch nicht den philosophischen Wert Deines Denkens. Doch man wird sie im concours [der Prüfung, D. P. Z.] nur ›anerkennen‹, wenn Du in Darstellung und Ausdruck eine radikale ›Wende‹ vollziehst.«[17]
Im Klartext heißt das: Pass dich an. Die Gepflogenheiten, die Erwartungen der Prüfer, die unausgesprochenen Regeln der traditionellen Erwartungen brechen dir sonst das Genick. Althussers Rückmeldungen zähmen den Stil des jungen Philosophen. Sie markieren Grenzen, loben konzise Darstellung, mahnen allzu apodiktische Urteile an. Sie erziehen das ungestüme Denken eines jungen Lesers, der lieber Husserl und Heidegger als Descartes und Malebranche liest, zu einer einigermaßen systemkonformen Ausdrucksweise.
Trotz dieser Vorbereitungen gerät Jackie in die gleiche Krise wie schon vor der Prüfung zur Aufnahme in die ENS. Wieder nimmt er Aufputschmittel und Schlaftabletten, um den Lernstoff bewältigen zu können.[18] Bei der dritten schriftlichen Prüfung ist er am Ende: Er gibt nur eine Skizze ab. Es reicht für die mündlichen Prüfungen, aber dort versagt er auf ganzer Linie. Die Prüfer, die ihm extra einen Vertrauensvorschuss eingeräumt haben, können ihre Enttäuschung nicht verbergen. Maurice de Gandillac, der zu den Prüfern gehört, teilt Jackie die Gründe für die Beurteilung mit:
»Diese Gründe lagen in derjenigen Ihrer Interpretation, die eine völlige Fehldeutung Descartes’ zu enthalten schien, und in Ihrem mündlichen Vortrag, in dem Sie sich so bizarr auf einen Philosophen konzentrieren, der nun gerade so gut wie nichts über den Tod geäußert hat. … Vergessen Sie nicht, dass der ›Vortrag‹ im Rahmen der agrégation keine Übung in purer Virtuosität ist, sondern zunächst ein schulisches Pensum, das so beschaffen sein muß, daß Schüler es sich aneignen können …«[19]
Jean-François, Paul-Michel, Jackie – sie schaffen die agrégation erst beim zweiten Versuch. Sie sind dem Druck nicht gewachsen, der von ihnen fordert, ihre kreative Eigenständigkeit mit den formalen Regeln des akademischen Diskurses zu versöhnen. Diese Spannung wird sich auch in ihrem Denken niederschlagen. Immer wird es ihnen auf die eine oder andere Weise darum gehen, den etablierten Diskurs, die Schule, das Regelwerk in Frage zu stellen, herauszufordern, von ihm bewusst abzuweichen, um es als Regelwerk sichtbar zu machen.
Der Einzige, der die Herausforderung der agrégation beim ersten Anlauf meistert, ist Gilles. Der Eintritt in die ENS ist ihm verwehrt geblieben, trotz guter Leistungen verfehlt er die Zulassung.[20] Auch er hat am Louis-le-Grand die Vorbereitungsklassen besucht und sitzt in den Veranstaltungen von Jean Hyppolite. Er beeindruckt durch umfassende Belesenheit und ein scharfes Urteilsvermögen. Mit dem Descartes-Forscher Ferdinand Alquié diskutiert er über die Unterschiede von Descartes’ und Husserls Begriff des »cogito«. Am Lycée Henry IV hört er Vorlesungen von Jean Beaufret zu Heidegger, über den er sich lustig macht: Alfred Jarry, der Schöpfer des König Ubu, hätte Heidegger nicht nur verstanden, sondern vorweggenommen. Beaufret reagiert ungehalten.
Obwohl Gilles nicht zur ENS zugelassen ist, ergattert er ein Studienstipendium, das ihn finanziell absichert. An der Sorbonne schart er bald eine Gruppe Studierende um sich, die sich im Dandy-Stil kleiden: Anzug, weißes Hemd, Krawatte. Gilles trägt dazu immer einen Schal, der, wie später sein Hut, zu seinem Markenzeichen werden wird. Er hört Gaston Bachelards Vorlesungen über Wissenschaftstheorie und besucht Jean Wahls Seminare zum britischen Empirismus. Sein heimlicher Held ist aber der Philosophiehistoriker Martial Guéroult, der sich auf die Philosophie der Frühen Neuzeit spezialisiert hat.
Gilles überrascht seine Lehrer mit einem Denken, das sie zuerst erbleichen lässt, weil sie die üblichen Regelverstöße erwarten, eine Reaktion, die bald darauf in grenzenlose Bewunderung umschlägt. Der junge Philosoph beherrscht die Regeln der Akademie ebenso wie die kreative Regellosigkeit des intellektuellen Diskurses. Seine Vorträge sind mitreißend, provokant, kenntnisreich und immer nah am Text.
Für die agrégation müssen die angehenden Philosophielehrer Henri Bergsons Materie und Gedächtnis und Emile Durkheims Regeln der soziologischen Methode durcharbeiten. Ausgerechnet Bergson, gilt er doch bei den Studierenden als verstaubter, gestriger Mystiker ohne echten philosophischen Gehalt. Gilles sieht das anders. Ganz anders. Für ihn ist Bergson die wichtigste Entdeckung seit Sartre. Seine Freunde sind verunsichert.
Diese Verunsicherung wird Gilles sein Leben lang nutzen, um entgegen der aktuellen Theorieströmung – auch derjenigen, die Jean-François, Jackie und Paul-Michel mit zu verantworten haben – Denker ins Spiel zu bringen, über die gerade niemand redet. Sein erstes Buch schreibt er über David Hume und den britischen Empirismus, zu einer Zeit, als sich niemand für Empirismus interessiert. Dabei sind seine Interpretationen so innovativ, so neuartig, dass sie als Kontrapunkt der modischen Theorieströmungen das Interesse der anderen Philosophen wecken. Gilles denkt nicht gegen den Strom, um ein Unvermögen nachträglich zu kompensieren. Er denkt gegen den Strom, weil er begreift, dass Philosophie genau das bedeutet.
Nach der Zulassung darf Gilles am Gymnasium unterrichten. Er entnimmt die Beispiele, die er in philosophische Fragen verwandelt, der Lebenswelt seines jungen Publikums, ist humorvoll, kann spannend erzählen und gut erklären. Mit gerade einmal Mitte zwanzig ist er, egal wo er unterrichtet, der Lieblingslehrer seiner Schüler. Den Unterricht in seiner Vorbereitungsklasse beginnt er etwa mit einer Anekdote, etwas, was ihm angeblich widerfahren ist. Ein Witz, dem ein inszenierter Dialog folgt, in dem Gilles mit verstellten Stimmen die unterschiedlichen Rollen spricht. Er entfaltet vor der Schulklasse Schritt für Schritt das Problem, zeigt ihr, was daran philosophisch ist. Einem Schüler rät er, Sartre, auf den dieser in seiner Arbeit laufend Bezug nimmt, für mindestens ein Jahr zur Seite zu legen. Er soll stattdessen Platon und Kant lesen und dann erst wieder Sartre zur Hand nehmen. Warum?
»Andernfalls wirst Du festsitzen und nicht in der Lage sein, einen Schritt nach vorne zu machen. In einem bestimmten Sinn ist das der Moment um neu anzufangen, nicht dass Du nicht schon eine ganze Menge wüsstest, aber dieser Moment ist die Bedingung, damit das, was Du schon über die Philosophie weißt, Sinn machen und sich entwickeln kann.«[21]
Nicht jeder ist gerne Lehrer. Jean-François schon, er lehrt mehrere Jahre an verschiedenen Schulen. Jackie wiederum wird der Schuldienst in die Depression treiben.[22] Nach seinen Prüfungen erhält er ein Stipendium für einen Forschungsaufenthalt in Harvard. Dann wird er in Algerien zum Militärdienst eingezogen und gibt dort zwei Jahre lang in Koléa Unterricht in Englisch und Französisch. Als er zurück ist, erwartet er, direkt an der Universität übernommen zu werden. Jean Hyppolite hat ihm eine Stelle zugesagt, die nun aber doch nicht zustande kommt. Dafür muss er in Le Mans ein Jahr lang Gymnasialunterricht geben. Das tut er, aber auf dem Niveau von Universitätskursen und mit langen Ausführungen zu Kants Kritik der reinen Vernunft.
Leichter hat es da Paul-Michel. Er hat seine agrégation mit einem Thema bestanden, das ihn immer wieder beschäftigen wird: »Sexualität«.[23] Paul-Michel geht die Sache systematisch an: Natur, Kultur, Geschichte der Sexualität. Einer seiner Prüfer ist Georges Canguilhem, der ihn auch weiter fördern wird. Zu ihm geht Paul-Michel und erklärt ihm, dass Schuldienst nichts für ihn ist. Stattdessen bewirbt er sich bei der Fondation Thiers, für ein Stipendium in Verbindung mit dem nationalen Zentrum für wissenschaftliche Forschung (CNRS). Dort erwartet ihn eine Ausstattung wie aus dem 19. Jahrhundert: Kammerdiener, Billardzimmer, Park. Doch auch das ist nichts für ihn.
Nach einem Jahr im Haus der Fondation Thiers geht er als Assistent an die Universität Lille. Sein Ziel: Ein Studium der Psychologie und Psychopathologie. Zu Beginn dieses Studiums, so berichtet er später, hätte man ihn gefragt, ob er wissenschaftliche Psychologie oder Psychologie nach der Art von Merleau-Ponty betreiben wolle.[24] Seine Antwort fasst das Forschungsinteresse, das ihn zur ersten Entfaltung seines philosophischen Werks führen wird, bündig zusammen:
»Was daran Aufmerksamkeit verdient, ist nicht so sehr der Dogmatismus, mit dem die ›wahre Psychologie‹ definiert wird, als vielmehr die Verworrenheit und die fundamentale Skepsis, die die Frage voraussetzt. Ein erstaunlicher Biologe wäre, wer da fragte: Wollen Sie wissenschaftliche oder nicht-wissenschaftliche Biologie betreiben? … Man muss der Forschung Rechenschaft über die Wahl ihrer Art von Rationalität abfordern; man muß sie zu ihrer Grundlage befragen, von der man weiß, daß sie nicht die von der Wissenschaft konstituierte Objektivität ist.«[25]
Michel Foucault, Jacques Derrida, Jean François Lyotard und Gilles Deleuze finden so, jeder auf seine Weise, zu den Ausgangsproblemen, die ihr Werk bestimmen. Foucault wird sich immer weiter in die Voraussetzungen der Psychopathologie, dann der Humanwissenschaften vertiefen. Derrida wird sich mit der Kunst der Lektüre auseinandersetzen, an der er in den Prüfungen und im Studium immer wieder gescheitert ist. Er wird sie zu einem Ansatz entwickeln, der die Genauigkeit der lesenden Aufmerksamkeit auf die Spitze treibt. Lyotard wird sich lange Zeit lassen, bis er die Spannungen, in denen er sich und andere eingebunden sieht, auf den Begriff bringen kann. Und Deleuze wird seine Idee einer konkreten Vielheit, die ohne Institutionen und ohne metaphysische Ursprünge auskommt, immer weitertreiben und so eine Philosophie schaffen, die in unserer Gegenwart noch gar nicht angekommen ist.
Antithese
Während vier Studenten, aus denen einmal vier der bekanntesten und kontroversesten französischen Philosophen werden sollten, in ihren Prüfungen schwitzen, bahnen sich in Deutschland und den USA vier Projekte an, die die intellektuelle Landschaft der kommenden Jahrzehnte maßgeblich mitbestimmen werden. In Frankfurt und Münster richten sich politisch entgegengesetzte Lager in Schulen ein, die um einflussreiche Lehrerfiguren herum entstehen. In New York schlägt die Geburtsstunde der digitalen Revolution. Und in Chicago entdeckt ein junger Student die Philosophie.
1949 kehren Theodor W. Adorno und Max Horkheimer aus dem US-amerikanischen Exil nach Deutschland zurück. Ein Jahr später wird das Institut für Sozialforschung wiedereröffnet, zuerst in den Ruinen des von Bomben zerstörten alten Gebäudes, dann in einem Neubau des Architekten Alois Geifer, der wie der alte Bau im Stil der Neuen Sachlichkeit errichtet wird. Das frühere Café Marx wird in das Café Max – nach Max Horkheimer – umbenannt.
Das Institut für Sozialforschung existiert seit 1923 in Frankfurt, emigriert aber 1933 nach Genf, ein Jahr später nach New York. Die Mitglieder der Frankfurter Schule stammen zum Großteil aus wohlhabenden jüdischen Familien. Nicht alle schaffen es, dem faschistischen Europa zu entfliehen. Walter Benjamin plant, nach einer halsbrecherischen Flucht über die Pyrenäen, im katalonischen Grenzstädtchen Port Bou seinen Selbstmord, in der Annahme, er werde von den spanischen Behörden nach Frankreich zurückgebracht. Als den Flüchtlingen am nächsten Tag dann doch die Flucht durch Spanien ermöglicht wird, ist Benjamin bereits tot.
Auch das Exil hinterlässt seine Spuren. Schon in der Weimarer Republik gehörte der Widerspruch der eigenen Situation zur DNA des Instituts: Man finanziert die eigene Kritik am kapitalistischen System durch eben dieses System. In den USA verschärft sich dieser Widerspruch geradezu ins Absurde. Als Juden und Marxisten misstrauisch beäugt, als deutsche Intellektuelle und Exilanten kulturelles Ereignis, als Kritiker eines kulturkapitalistischen Systems stets der Subversion verdächtig, aber als Kenner der deutschen Strukturen wertvolle Geheimdienstmitarbeiter – diese spannungsvollen Verhältnisse prägen die Weltsicht der Frankfurter in den sechzehn Jahren des Exils maßgeblich mit.
Zurück in Deutschland wird die Frankfurter Schule vor allem in den 1950er Jahren zu einer maßgeblichen intellektuellen Instanz. Durch die in den USA verbliebenen Mitglieder Erich Fromm und Herbert Marcuse entfaltet sie auch an den liberalen US-amerikanischen Universitäten ihre Wirkung. Ende der 1950er tritt mit Jürgen Habermas eine eigensinnige zweite Generation auf den Plan, die mit einigen Grundkonstanten der älteren Vertreter bricht. Sie wird die Frankfurter Schule zu einer Schulformation machen, die bis in die Universitäten hinein deutsche Bildungsgeschichte schreibt.[26]
Zur gleichen Zeit bildet sich in Münster ein Gesprächskreis, der den widrigen Nachkriegsumständen geschuldet ist. Der Philosophieprofessor Joachim Ritter muss seine Veranstaltungen zunächst in seiner Privatwohnung abhalten, weil es im zerbombten Münster dafür keinen anderen Ort gibt. Sein Collegium Philosophicum zeichnet sich für die anwesenden Studierenden vor allem durch die gedankliche Freiheit aus, gegensätzliche Positionen gleichermaßen zu Wort kommen zu lassen. Ritter ist, anders als andere Ordinarien in der Philosophie, nahbar und stellt praktisch relevante Fragen: »Was geschieht hier?« Die Studierenden sind zur Beobachtung aufgerufen. Philosophiert wird vom Phänomen her, erst in ihm zeigt sich der theoretische Zugriff. Vielfalt ist Programm.
Joachim Ritter ist nicht in jeder Hinsicht so nahbar. Seine Rolle im Nationalsozialismus bleibt auch seinen Schülern ein Rätsel. Er gehört zu den Unterzeichnern des Bekenntnisses der deutschen Professoren zu Adolf Hitler vom 11. November 1933, ist in die NSDAP eingetreten und Mitglied in verschiedenen NS-Organisationen, darunter dem NS-Lehrerbund und der NS-Studentenkampfhilfe. Zugleich tut sich das System, an das er sich zweifelsohne anzupassen versucht, mit ihm schwer. Die Gestapo durchsucht seine Wohnung und beschlagnahmt Teile seiner Bibliothek. Denn Ritter hat eine Vergangenheit, die den Nationalsozialisten nicht passt.
In den 1920er Jahren ist er Assistent bei dem jüdischen Philosophen Ernst Cassirer, bei dem er 1925 über Cusanus promoviert und der sieben Jahre später seine Habilitation zu Augustinus betreut. 1927 heiratet Ritter Marie Johanna Einstein, die bereits ein Jahr später an den Folgen eines Unfalls stirbt. 1929 ist er einer der Protokollanten der berühmten Davoser Disputation zwischen Martin Heidegger und Cassirer. Zu dieser Zeit, Anfang der 1930er Jahre, rezipiert er intensiv Marx und hat Kontakt zu sozialistischen Widerstandsgruppen. Deswegen und wegen seiner ersten Ehe mit einer Jüdin, die so unglücklich endete, steht Ritter während der NS-Zeit unter ständiger Beobachtung.