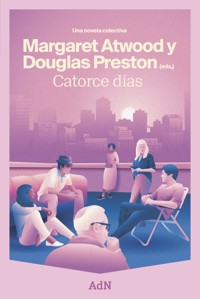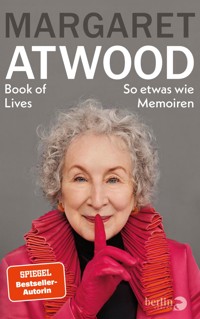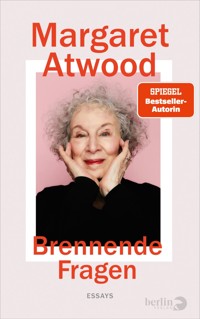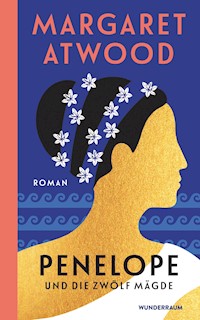19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: eBook Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach dem Lyrik-Sammelband Die Füchsin soll dieses Buch Margaret Atwoods Erzählungen ins rechte Licht rücken. Ohne Zweifel sind ihre Stories ein wesentlicher Teil ihres Werks, ihr Sinn für knappe Pointen und ironische Zuspitzungen machen sie zu einer Meisterin der kurzen Form. Dies ist der Versuch, einen großen Bogen über Margaret Atwoods diesbezügliches Schaffen zu spannen. Eine exklusiv für diese Sammlung geschriebene Geschichte und ein knappes Dutzend noch nie auf Deutsch erschienener Stories verleihen diesem Projekt zusätzliche Bedeutung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.berlinverlag.de
Übersetzung aus dem Englischen von Monika Baark, Charlotte Franke, Malte Friedrich, Anna Kamp, Helga Pfetsch und Brigitte Walitzek
© O. W. Toad 1977, 1983, 1987, 1990, 1991, 1992, 1994, 1996, 2006, 2009, 2012, 2015, 2017, 2020
© Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, Berlin/München 2021
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: Universal History Archive/UIG/Bridgeman Images
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Cover & Impressum
Das Auge des Himmels
Wenn es passiert
Der Sündenesser
Schmoren
Frauenromane
Schulfreunde
Erdbeeren
Rohmaterial
Blaubarts Ei
Scharlachroter Ibis
Suite der Entdeckungen
Freizone
Heimatlandung
Die Moorleiche
Tipps für die Wildnis
Rübenmittwoch
Die kleine rote Henne packt aus
Lasst uns dumme Frauen preisen
Ein harter Ball
Mein Leben als Fledermaus
Reinkarnation
Albträume
Vampirfilme
Die Fledermaus als tödliche Waffe
Schönheit
Dritthändig
Flasche
Der undurchdringliche Wald
Flasche II
Wintermärchen
König Baumstamm im Exil
Das Zelt
Die Kunst des Kochens und Auftragens
Das Labrador-Fiasko
Hauptleben
Die kriechende Hand
Die Marsianer erobern Kanada
Ungeduldige Griseldis
Editorische Notiz
Herkunftsnachweis der Texte im Einzelnen:
Das Auge des Himmels
Deutsch von Monika Baark
Ich wollte immer nur eins: meinen Frieden. Als ich auf der Farm lebte, konnte ich ihn haben, wann immer ich merkte, dass die Gereiztheit in mir aufstieg, wenn die schrille Stimme meiner Mutter an meinen Nerven zerrte oder mein Vater nach dem Essen zu laut schnarchte. Ich konnte meine Angelrute nehmen und mich am Flussufer entlang im Unterholz verlieren. Egal, ob ich etwas fing oder nicht.
Je größer ich wurde, desto mehr schien der Fluss zu schrumpfen. Er war nicht mehr rätselhaft und verborgen, sondern ein vertrauter Freund. Wir hatten keine Geheimnisse voreinander. Ich verbrachte immer noch Stunden am feuchten, zedernbestandenen Ufer. »Sie« fanden, ich verbrächte zu viel Zeit allein: Sie waren mir fremd und hatten kein Recht, über mich zu urteilen. Um diese Zeit herum bemerkte ich das erste Auge: das Auge einer Forelle, die ich gerade töten wollte. Sie sah mich mit solchem Entsetzen an, mit so vorwurfsvollem Blick, dass ich sie fallen ließ. Mir war kalt. Der Fisch machte einen instinktiven Satz Richtung Wasser – es war ja nur ein Fisch, dachte ich und fing ihn gerade noch rechtzeitig, und ich ließ mein Jagdmesser durch sein Hirn gleiten. Der Fisch starb, das Auge wurde glasig: Doch es blieb mir in Erinnerung.
Mit sechzehn schickten sie mich in die Stadt. Es hieß, dort seien bessere Schulen, aber mir war klar, dass sie mich loswerden wollten. Sie fürchteten mich. Am Bahnhof sagte ich Lebwohl und vergaß sie fast sofort. Mein Jagdmesser steckte in meiner Tasche. Auf der ganzen Reise hatte ich das Messer in der Hand. Es symbolisierte den Fluss.
Die Bahnhofsuhr in der Stadt sah mir zu. Ich sollte bei meiner Tante wohnen. Sie holte mich ab. Als ich sie sah, blieb mir das Herz stehen – ich war entsetzt. Denn sie hatte die Augen des Fisches, den ich getötet hatte – hinter ihren Brillengläsern war der gleiche starre, furchtsame, anklagende, durchscheinende Blick. Sie trug einen Hut mit einer roten Blume. Ich dachte an das Blut des Fisches und schrumpfte zusammen. Als wir den Bahnhof verließen, spürte ich den kalten Blick der Uhr, der sich durch meinen Rücken bohrte.
Meine Tante war eine nervöse Frau, die sich zuckend fortbewegte wie ein Huhn. Auch ihre Stimme war die eines Huhns. Das Haus war klein, eng: Noch zehn Jahre, und die Gegend wäre ein Slum. Wenn ich im Haus war, schien meine Tante unaufhörlich bei mir zu sein. Sie fürchtete mich und misstraute mir und wollte mich im Blick haben und jeden meiner Schritte kontrollieren. Andauernd stellte sie mir Fragen. Als sie mich am ersten Sonntag bat, mit ihr in die Kirche zu gehen, lehnte ich brüsk ab und sah die Angst wachsen. Kirchen machten mich noch unruhiger.
Ich hasste die Stadt: die dreckigen Straßen, den Rauch, die kleinen Rasenflecken und die Mülltonnen; ich hasste die Schule. Da ich gute Noten hatte, konnten sich die Lehrer nicht über mich beschweren, aber ich merkte ihnen ihre Besorgnis an. Ich freundete mich mit niemandem an. Nur einmal sprach mich ein anderer Schüler an: Der Kapitän der Footballmannschaft wollte mich anheuern. Ich bin sehr kräftig. Aber ich ließ ihn einfach stehen: Ich hasste es, mit Leuten zu reden. Ich spazierte zu dem winzigen Park in der Nähe der Schule, um mich zu sammeln. Dort waren weder Fluss noch Zedern – nur hier und da ein paar Ahornbäume und ein paar nackte Stellen im Gras –, kein guter Ersatz. Ich setzte mich auf die hölzerne Bank, holte mein Jagdmesser hervor und schärfte es. Der Griff war lose, doch die Klinge glänzte. Ich rammte es in den Boden, um die Stadt zu töten.
Der Park wurde meine Zuflucht. Im November verbrachte ich dort einen ganzen Tag, statt in die Schule zu gehen, reglos, mit Blick auf den Boden. Abends ging ich zurück zu meiner Tante, ich kam zu spät zum Essen. Das Radio lief – das Radio lief immer. Ich ging in die Küche. Dann schrie meine Tante mich an: Ich hatte sie noch nie schreien hören. Selbst ihr Geschrei war wie das eines Huhns. Doch ihre Augen … aus ihren Augen strahlte der Hass, die Angst, die Empörung all der Tiere, die ich jemals getötet hatte. Ich senkte den Blick … ich hatte Schlamm an den Schuhen. Meine Tante war ordentlich. Ich zog mein Jagdmesser und tötete meine Tante. Für einen kurzen Moment hatte ich die Befürchtung, dass sie nicht sterben würde, aber es war genauso einfach wie das Töten der Fische. Ihre Augen starrten mich aus dem Blut heraus an, während ich den Raum verließ.
Ich hätte ihr die Augen schließen sollen. Das war mein Fehler. Ich nahm den Zug nach Norden, mit meiner Weihnachtsfahrkarte; ich musste weg … das mit dem Auge würde keiner verstehen. Jetzt, wo meine Tante tot ist, dachte ich, wird es mich nicht mehr stören; aber ich hätte ihr die Augen schließen sollen, denn jetzt war es noch schlimmer.
Alles … einfach alles. Die Scheinwerfer der Autos, die Augen im Holz der Fensterbretter, die Uhren, die Glatze des Mannes vor mir. Auf der Farm wäre ich nicht sicher: Ich würde Geld stehlen und weiter nach Norden reisen müssen. Ich hatte mein Messer in der Tasche und grub mir jedes Mal, wenn ich mich erinnerte, die Klinge in den Daumen, damit der Schmerz die Augen vertrieb. Die Leute sahen mich an – ich muss blass gewesen sein –, aber ich tat, als merkte ich nichts. Ich stieg aus dem Zug aus: Ich konnte das Blut am Oberschenkel spüren, wie es durch die Tasche sickerte.
Sie waren überrascht, mich zu sehen. Ich ging nach oben und behielt dabei die Hand in der Tasche. Ich wusste, wo das Geld war. Ich kletterte aus dem Fenster und nahm den Zug nach Norden. Es war fast Tagesanbruch, da verließ ich den Zug und verkroch mich ins Gebüsch. Die Kälte war beißend; der Schnee war tief. Ich hatte vergessen, dass hier so viel Schnee liegen würde. In der Stadt war kein Schnee gewesen.
Ich hatte die Augen hinter mir gelassen. Ich hatte meinen Frieden, meinen Frieden. Sie würden mich niemals finden, ich war frei.
Wenn es passiert
Deutsch von Helga Pfetsch
Mrs. Burridge legt grüne Essigtomaten ein. Es sind jedes Mal zwölf Liter und ein kleiner Rest, und dann sind die Gläser alle. Im Laden sagt man ihr, in der Fabrik, wo sie hergestellt werden, würde gestreikt. Davon weiß sie nichts, aber man kann nirgends welche kaufen, und auch vorher haben sie schon doppelt so viel gekostet wie letztes Jahr; sie kann von Glück sagen, dass sie diese noch im Keller hatte. Sie hat eine Menge grüne Tomaten, weil sie gestern Abend im Wetterbericht gehört hat, dass strenger Frost erwartet wird, also hat sie Anorak und Arbeitshandschuhe angezogen und ist mit der Laterne in den stockdunklen Garten gegangen und hat alle abgepflückt, die sie sehen konnte, über hundert Liter. Sie kann die vollen Körbe selbst heben, aber sie hat Frank gebeten, sie ins Haus zu tragen; er brummt zwar, aber er mag es, wenn sie ihn bittet. Am Morgen hieß es in den Nachrichten, die Erzeuger seien schwer getroffen, und das würde den Preis in die Höhe treiben – nicht, dass die Erzeuger viel davon zu sehen kriegen, jeder weiß doch, dass die Geschäfte den Reibach machen.
Sie kommt sich reicher vor als gestern, aber andererseits kann man mit grünen Tomaten nicht viel anfangen. Durch das Einlegen ist der Berg kaum kleiner geworden, und Frank hat wie jedes Jahr gesagt, dass sie nie und nimmer vierundzwanzig Gläser grüne Essigtomaten essen, sie beide allein, jetzt, wo die Kinder aus dem Haus sind. Außer wenn sie zu Besuch kommen und mir Küche und Keller leer essen, setzt Mrs. Burridge im Stillen hinzu.
In Wirklichkeit hat sie immer zwei Chargen eingelegt, und die Kinder haben sie sowieso nie gemocht, es war Frank, der sie alle gegessen hat, und sie weiß genau, dass er es diesmal wieder tun wird, ohne es auch nur zu merken. Er isst sie gern zum Käsebrot, wenn er sich im Fernsehen die Eishockeyspiele anschaut, bei der Reklame geht er jedes Mal in die Küche und macht sich noch eine Scheibe, auch wenn er gerade ausgiebig gegessen hat, und zieht eine Spur aus Brotkrümeln und Tomatenstückchen vom Küchentisch über den Boden und den Wohnzimmerteppich bis zu seinem Sessel. Früher hat sich Mrs. Burridge immer darüber geärgert, besonders über die Krümel, aber jetzt beobachtet sie ihn mit einer Art Traurigkeit, sie hat früher einmal gemeint, ihr gemeinsames Leben würde ewig so weitergehen, aber ihr ist klar geworden, dass das nicht der Fall ist.
Sie hat nicht einmal mehr Lust, ihn wegen seines »Ersatzreifens« zu necken, auch wenn sie es trotzdem tut, weil ihm etwas fehlen würde, wenn sie es ließe. »Also wirklich?«, sagte sie mit ihrer schroffen, abgehackten, metallischen Stimme, die sie nicht ändern kann, weil alle sie von ihr erwarten, denn wenn sie anders sprechen würde, dächten sie nur, sie wäre krank, »futter du nur weiter so, da werd’ ich’s leicht haben, dich morgens aus dem Bett zu kriegen, ich brauche dir nur einen kleinen Schubs zu geben, und schon rollst du wie ein Fass die Treppe runter.« Und er antwortete mit seiner bedächtigen Stimme, als wäre er träge, obwohl er das nicht ist: »Ein bisschen Spaß muss der Mensch doch haben«, als wären Essigtomaten und Käse etwas leicht Anrüchiges, fast wie eine Orgie. Jedes Jahr behauptet er, sie hätte zu viel eingemacht, aber was würde das für ein Theater geben, wenn er eines Tages in den Keller hinunterginge und kein Glas mehr da wäre.
Mrs. Burridge legt seit 1952 selbst Essigtomaten ein – das erste Jahr, in dem sie den Garten hatte. Sie kann sich so genau daran erinnern, weil ihre Tochter Sarah damals unterwegs war und sie Mühe hatte, sich beim Unkrautjäten zu bücken. Als sie jung war, legten alle Leute ihr Essiggemüse selbst ein und kochten auch sonst ein und machten sich Vorräte. Aber nach dem Krieg hörten die meisten Frauen damit auf, man hatte mehr Geld, und es war einfacher, die Sachen im Laden zu kaufen. Mrs. Burridge hat nie damit aufgehört, obwohl die meisten ihrer Freundinnen fanden, dass sie ihre Zeit damit vergeudete, und jetzt ist sie froh darüber, sie ist in Übung geblieben, während die anderen es wieder ganz von vorn lernen mussten. Obwohl sie sich bei dem immer teurer werdenden Zucker nicht vorstellen kann, wie lange man sich die selbst eingemachten Sachen überhaupt noch leisten kann.
Auf dem Papier verdient Frank mehr Geld denn je; trotzdem haben sie, wie es scheint, weniger zum Ausgeben. Sie könnten die Farm vermutlich jederzeit verkaufen, an Leute aus der Stadt, die sie als Wochenendwohnung benutzen würden. Sie könnten einen Preis dafür kriegen, der ihr sehr hoch vorkommt, mehrere der Farmen südlich von ihnen sind so weggegangen. Aber Mrs. Burridge hat kein großes Vertrauen zum Geld; außerdem wäre es schade um das Land, und hier ist ihr Zuhause, sie hat alles so eingerichtet, wie sie es haben will.
Als der zweite Topf auf dem Herd steht und kocht, geht sie zur Hintertür, macht sie auf und steht da, die Arme über dem Bauch verschränkt, und sieht hinaus. Sie ertappt sich dabei, dass sie das neuerdings vier- oder fünfmal am Tag tut, und sie weiß nicht genau, warum. Es gibt da nicht viel zu sehen, nur die Scheune und das hintere Feld mit der Reihe abgestorbener Ulmen, die Frank, wie er immer wieder sagt, fällen will, und die Spitze von Clarkes Haus, die über den Hügel ragt. Sie weiß nicht recht, wonach sie ausschaut, aber sie hat die seltsame Vorstellung, dass sie vielleicht etwas brennen sieht, Rauch, der am Horizont aufsteigt, eine Rauchsäule oder vielleicht mehr als nur eine, weiter im Süden. Das ist ein so sonderbarer Gedanke, dass sie noch keinem davon erzählt hat. Gestern hat Frank sie in der Hintertür stehen sehen und sie beim Essen danach gefragt. Alles, worüber er mit ihr sprechen will, spart er sich bis zum Abendessen auf, auch wenn es ihm am Morgen einfällt. Er hat sich gewundert, warum sie länger als zehn Minuten in der Hintertür stand, ohne etwas zu tun, und Mrs. Burridge hat mit einer Lüge geantwortet, aber ihr war sehr unbehaglich dabei. Sie hat gesagt, sie hätte einen fremden Hund bellen hören, keine gute Ausrede, denn ihre eigenen Hunde waren in der Nähe gewesen und hatten nichts gemerkt – aber Frank ließ es gelten; vielleicht denkt er, sie wird auf ihre alten Tage allmählich wunderlich, und will die Aufmerksamkeit nicht darauf lenken, das sähe ihm ähnlich. Er verdreckt ihren schönen glänzenden Küchenfußboden zwar mit Matsch, aber er würde um keinen Preis jemanden kränken wollen. Mrs. Burridge stellt ein bisschen wehmütig fest, dass er trotz seiner Sturheit ein herzensguter und liebenswerter Mann ist, und für sie ist das wie eine Absage an einen lang gehegten, nie infrage gestellten Glauben – so wie den, dass die Erde eine Scheibe ist. Sie hat sich so oft über ihn ärgern müssen.
Als die Gläser abgekühlt sind, versieht sie sie wie immer mit Etiketten, auf denen Inhalt und Datum stehen, und trägt sie die Kellertreppe hinunter. Der Keller ist von der alten Art, mit Wänden aus Stein und einem Lehmboden. Mrs. Burridge hat gern alles ordentlich, sie bügelt auch ihre Bettwäsche noch – deshalb hat sie sich gleich nach der Hochzeit von Frank ein paar Regale bauen lassen. Das eingelegte Gemüse kommt auf die eine Seite, Marmelade und Gelee stehen auf der anderen und die Litergläser mit dem Eingeweckten im untersten Fach. Früher hat es ihr ein Gefühl von Sicherheit gegeben, all diese Vorräte im Keller zu haben; sie dachte dann bei sich: Wenn einmal ein Schneesturm kommt oder so und wir von der Außenwelt abgeschnitten sind, ist das nicht so schlimm. Jetzt gibt es ihr kein Gefühl von Sicherheit mehr. Stattdessen denkt sie daran, dass sie, wenn sie einmal plötzlich wegmuss, keines von den Gläsern mitnehmen kann, sie sind zu schwer zum Tragen.
Sie kommt nach dem letzten Gang die Treppe herauf. Es fällt ihr nicht mehr so leicht wie früher, ihr Knie plagt sie noch immer, seit sie vor sechs Jahren gestürzt ist, sie ist auf der zweitletzten Stufe gestolpert. Sie hat Frank tausendmal gebeten, die Treppe zu reparieren, aber er hat es nicht getan – das meint sie mit stur. Wenn sie ihn öfter als zweimal bittet, etwas zu tun, nennt er das Meckern, und vielleicht ist es das auch, aber wer soll es tun, wenn nicht er? Das kalte, leere Loch hinter dieser Frage kann sie nicht ertragen.
Sie muss sich bezwingen, nicht wieder zur Hintertür zu gehen. Stattdessen tritt sie an das Fenster nach hinten und sieht hinaus, von dort kann sie ohnehin fast dasselbe sehen. Frank geht zur Scheune hinüber, er trägt etwas, was wie ein Schraubenschlüssel aussieht. Die Art, wie er geht, langsamer als früher, leicht nach vorn gebeugt – von hinten sieht er aus wie ein alter Mann, wie viele Jahre geht er schon so? –, lässt sie denken: Er kann mich nicht beschützen. Sie denkt das nicht absichtlich, es kommt ihr einfach so in den Sinn, und es ist nicht nur er, sie alle sind so, sie haben die Kraft verloren, man sieht es an der Art, wie sie gehen. Alle warten sie, genau wie Mrs. Burridge, darauf, dass passiert, was immer es auch sein wird. Ob es ihnen bewusst ist oder nicht. In letzter Zeit, wenn sie zum Dominion Store in die Stadt gefahren ist, hat sie auf den Gesichtern der Frauen dort einen Ausdruck gesehen – sie kennt die meisten, sie kann sich nicht täuschen –, einen ängstlichen, verschlossenen Ausdruck, als fürchteten sie sich vor etwas, worüber sie aber nicht sprechen wollen. Sie überlegen, was sie tun werden, vielleicht glauben sie, dass sie gar nichts tun können. Dieser Ausdruck von Hilflosigkeit erbittert Mrs. Burridge, die immer praktisch gedacht hat.
Schon seit Wochen will sie mit Frank sprechen und ihn bitten, ihr zu zeigen, wie man mit dem Gewehr umgeht. Genau genommen hat er zwei Waffen, eine Schrotflinte und ein Kleinkalibergewehr; er hat im Herbst immer gern ein paar Enten gejagt, und dann sind da die Waldmurmeltiere, die man wegen der Löcher abschießen muss, die sie auf den Feldern machen. Frank fährt fünf- oder sechsmal im Jahr mit dem Traktor drüber. Immer wieder gibt es Verletzte, weil Traktoren umkippen. Aber sie kann ihn nicht bitten, weil sie ihm nicht erklären kann, warum sie es wissen muss, und wenn sie es nicht erklärt, wird er sie nur aufziehen. »Schießen kann doch jeder«, wird er sagen, »man braucht nur den Finger krumm zu machen, sonst nichts … ach so, du meinst, du willst auch treffen, tja, das ist was andres, wen willst du denn umbringen?« Vielleicht sagt er das auch nicht; vielleicht ist das nur die Art, wie er vor zwanzig Jahren geredet hat, bevor sie aufgehört hat, sich für Dinge außerhalb des Hauses zu interessieren. Aber Mrs. Burridge wird das nie erfahren, weil sie nicht fragen wird. Sie bringt es nicht über sich, zu sagen: Vielleicht stirbst du. Vielleicht gehst du fort, irgendwohin, wenn es passiert, vielleicht gibt es Krieg. Sie kann sich an den letzten Krieg erinnern.
Nichts hat sich draußen vor dem Fenster verändert, deshalb wendet sie sich ab und setzt sich an den Küchentisch, um ihre Einkaufsliste aufzustellen. Morgen ist der Tag, an dem sie in die Stadt fahren. Sie versucht, den Tag so zu planen, dass sie sich zwischendurch hinsetzen kann, sonst schwellen ihre Füße an. Das hat bei Sarah angefangen, ist bei den zwei anderen Kindern schlimmer geworden und hat sich nie wieder richtig gegeben. Ihr Leben lang, seit sie verheiratet ist, hat sie Listen von Dingen gemacht, die gekauft, genäht, gepflanzt, gekocht, bevorratet werden müssen; sie hat schon ihre Liste für das nächste Weihnachten fertig, alle Namen und die Geschenke, die sie für jeden kaufen will, und die Liste mit allem, was sie für das Weihnachtsessen braucht. Aber sie kann sich nicht richtig dafür erwärmen, es ist zu weit weg. Sie kann nicht an eine ferne Zukunft glauben, die geordnet ist wie die Vergangenheit, sie scheint nicht mehr die Kraft dafür zu haben; es ist, als ob sie sie für den Moment aufspart, wenn sie sie brauchen wird.
Sogar mit der Einkaufsliste hat sie Schwierigkeiten. Statt sich auf den Zettel zu konzentrieren – sie schreibt auf die Rückseite der abgerissenen Blätter des Kalenders, den Frank ihr jedes Jahr zu Neujahr schenkt –, schaut sie sich in der Küche um, betrachtet all die Dinge, die sie zurücklassen muss, wenn sie fortgeht. Das wird das Schwerste sein. Das Porzellan von ihrer Mutter, ihr Silberbesteck, obwohl das Muster altmodisch und das Silber abgegriffen ist, die Eieruhr in Form eines Huhns, die Sarah ihr geschenkt hat, als sie zwölf war, die Salz- und Pfefferstreuer aus Keramik, grüne Pferde mit durchlöcherten Köpfen, die eins der anderen Kinder von der Messe mitgebracht hat. Sie denkt daran, die Treppe hinaufzugehen, denkt an die Laken, die gefaltet in der Kommode liegen, an die ordentlich in den Regalen gestapelten Handtücher, an die gemachten Betten, die Quiltdecke, die ihrer Großmutter gehörte, und sie möchte weinen. Auf ihrem Schreibtisch das Hochzeitsbild, sie in einem glänzenden Satinkleid (der Satin war ein Fehler gewesen, er hatte ihre Hüften betont), Frank in dem Anzug, den er seither nicht mehr getragen hat, außer bei Beerdigungen, das Haar an den Seiten zu kurz geschnitten, oben mit einem überraschenden Schopf wie ein Specht. Die Kinder, als sie klein waren. Jetzt denkt sie an ihre Töchter und hofft, dass sie keine Kinder bekommen; es ist nicht mehr die richtige Zeit dafür.
Mrs. Burridge wünscht sich, jemand würde etwas Genaueres sagen, damit sie besser planen kann. Jeder weiß, dass etwas passieren wird, man merkt es beim Zeitunglesen und Fernsehen, aber keiner weiß genau, was es sein wird, keiner kann es mit Sicherheit sagen. Sie hat aber ihre eigenen Vorstellungen davon. Zuerst wird es einfach ruhiger werden. Sie wird das komische Gefühl haben, dass irgendetwas nicht stimmt, aber es wird ein paar Tage dauern, bis sie es erfassen kann. Dann wird sie feststellen, dass die Flugzeuge nicht mehr in Richtung Malton Airport über sie hinwegfliegen und dass die Geräusche von der fünf Meilen entfernten Straße fast verschwunden sind, die man deutlich hört, wenn die Bäume ihr Laub verloren haben. Das Fernsehen wird kein Wort darüber verlauten lassen, ja, das Fernsehen, das jetzt voll ist von schlimmen Nachrichten, von Streiks, Rohstoffknappheit, Hungersnöten, Arbeitslosigkeit und Preissteigerungen, wird sanftmütig werden und beschwichtigen, und im Radio wird es viel klassische Musik geben. Dann etwa wird Mrs. Burridge merken, dass die Nachrichten zensiert werden, wie während des Krieges.
Mrs. Burridge ist sich nicht sicher, was als Nächstes geschehen wird; das heißt, sie weiß, was geschehen wird, aber sie ist sich nicht sicher über die Reihenfolge. Sie vermutet, dass es Benzin und Öl sein werden: Der Mann, der das Öl liefert, wird einfach nicht zur gewohnten Zeit vorbeikommen, und eines Morgens wird die Tankstelle an der Ecke geschlossen sein. Nur das, keine Erklärungen, denn natürlich wollen sie – sie weiß nicht, wer »sie« sind, aber sie glaubt seit jeher an ihre Existenz –, sie wollen nicht, dass die Leute in Panik geraten. Sie bemühen sich weiter, alles normal erscheinen zu lassen, womöglich haben sie mit diesem Programm schon begonnen, und das ist der Grund, weshalb alles noch normal erscheint. Zum Glück haben sie und Frank den Dieseltank im Schuppen, er ist drei viertel voll, und sie brauchen die Tankstelle sowieso nicht, sie haben ihre eigene Benzinpumpe. Sie lässt Frank den alten Holzherd hereinholen, den sie unter der Scheune abgestellt haben, als sie sich den Heizkessel einbauen und die elektrische Leitung legen ließen, und dieses eine Mal dankt sie dem Himmel für Franks Angewohnheit, Dinge aufzuschieben. Sie hat ihm jahrelang in den Ohren gelegen, den Herd auf die Müllkippe zu bringen. Er fällt die abgestorbenen Ulmen, endlich, und sie verheizen sie im Herd.
Die Telefonleitungen reißen bei einem Sturm, und keiner kommt sie reparieren; so zumindest folgert Mrs. Burridge. Jedenfalls ist das Telefon tot. Mrs. Burridge macht es nichts weiter aus, sie hat das Telefon sowieso nie gern benutzt, aber es gibt ihr doch das Gefühl, abgeschnitten zu sein.
Ungefähr zu dieser Zeit erscheinen immer wieder Männer auf der hinteren Straße, der Schotterstraße, die am Tor vorbeiführt, in der Regel gehen sie allein, manchmal zu zweit. Sie scheinen in Richtung Norden unterwegs zu sein. Die meisten sind jung, in den Zwanzigern, würde Mrs. Burridge schätzen. Sie sind nicht gekleidet wie die Männer hier in der Gegend. Es ist so lange her, seit sie jemand auf dieser Straße gehen sah, dass sie unruhig wird. Sie macht jetzt die Hunde los, sie hatte sie nachts immer angekettet, seit einer von ihnen an einem frühen Sonntagmorgen einen Zeugen Jehovas gebissen hatte. Mrs. Burridge hat nichts mit den Zeugen Jehovas im Sinn – sie gehört der Staatskirche an, aber sie achtet deren Beharrlichkeit, zumindest haben sie den Mut, zu ihren Überzeugungen zu stehen, was mehr ist, als man von manchen Mitgliedern ihrer eigenen Kirche sagen kann, und sie kauft immer einen Wachtturm. Vielleicht haben sie die ganze Zeit über recht gehabt.
Etwa um diese Zeit nimmt sie auch eines der Gewehre, sie denkt, dass es die Schrotflinte sein wird, weil sie damit eine größere Chance hat, etwas zu treffen, und versteckt sie mit den Patronen unter einem Stück Dachpappe hinter der Scheune. Sie sagt Frank nichts; er wird das Kleinkalibergewehr nehmen. Sie hat den Platz schon ausgesucht.
Sie wollen das bisschen Benzin, das sie noch haben, nicht verschwenden, deshalb machen sie keine unnötigen Fahrten. Sie fangen an, die Hühner zu essen, etwas, worauf Mrs. Burridge sich nicht freut. Sie hasst das Ausnehmen und Rupfen, und den größten Zorn auf Frank überhaupt hatte sie damals, als er und Henry Clarke beschlossen, in die Truthahnzucht einzusteigen. Sie taten es, trotz allem, was sie dagegen einzuwenden hatte, und sie musste dann mit den Truthähnen fertigwerden, die ausbrachen und ihr den Garten zerscharrten und nicht zu fangen waren, in ihren Augen waren es die dümmsten Vögel, die Gott geschaffen hatte, und sie musste einmal in der Woche einen Truthahn rupfen und ausnehmen, bis glücklicherweise die Truthahnpest ein Drittel der Tiere ausrottete, was reichte, um die beiden Männer so zu entmutigen, dass sie den Rest mit Verlust verkauften. Es war das einzige Mal, dass sie richtig froh darüber war, zu erleben, wie Frank bei einem seiner Experimente Geld verlor.
An dem Tag, an dem der elektrische Strom ausfällt und nicht mehr wiederkommt, wird Mrs. Burridge das Gefühl haben, dass es nun ernst wird. Mit einer Art Fatalismus weiß sie, dass das im November geschehen wird, wenn die Tiefkühltruhe voller Gemüse ist, aber noch bevor es kalt genug ist, die Packungen draußen gefroren aufzubewahren. Sie steht da und betrachtet die Plastikbeutel mit Bohnen und Mais und Spinat und Karotten, wie sie tauen und aufweichen, und denkt: Warum konnten sie nicht bis zum Frühjahr warten? Die Verschwendung von Nahrung und auch von ihrer harten Arbeit erbittert sie am allermeisten. Sie rettet, was sie kann. Während der Wirtschaftskrise, erinnerte sie sich, hieß es immer, die Leute auf dem Land seien besser dran als die in der Stadt, weil sie zumindest zu essen hatten; das heißt, sofern sie ihre Farm halten konnten, aber sie ist nicht mehr so sicher, dass das stimmt. Sie fühlt sich belagert, isoliert, wie jemand, der in einer Festung eingeschlossen ist, obwohl niemand sie belästigt hat, tatsächlich ist seit Tagen niemand bei ihnen vorbeigekommen, auch keiner der einsamen Wanderer.
Ohne Elektrizität können sie dann auch kein Fernsehen mehr empfangen. Die Rundfunkstationen bringen, sofern sie überhaupt senden, nur Musik, die Mrs. Burridge nicht im Mindesten beruhigend findet.
Eines Morgens geht sie zur Hintertür und sieht hinaus, und da sind die Rauchsäulen, genau da, wo sie sie zu sehen erwartet hat, weit im Süden. Sie ruft Frank, und sie stehen da und schauen. Der Rauch ist dick und schwarz, ölig, als ob etwas explodiert wäre. Sie weiß nicht, was Frank denkt; sie selbst sorgt sich um die Kinder. Seit Wochen hat sie keine Nachricht von ihnen, aber wie sollte sie auch. Schon seit einiger Zeit wird keine Post mehr zugestellt.
Eine Viertelstunde später fährt Henry Clarke mit seinem Halbtonner in den Hof. Das ist sehr ungewöhnlich, denn in der letzten Zeit ist niemand mehr irgendwohin gefahren. Ein anderer Mann ist bei ihm, und Mrs. Burridge erkennt in ihm den Mann, der vor vier oder fünf Jahren drei Farmen weiter eingezogen ist. Frank geht hinaus und spricht mit ihnen, und sie fahren hinüber zur Benzinpumpe und fangen an, den Rest des kostbaren Benzins in den Lastwagen zu pumpen. Frank kommt zurück zum Haus. Er sagt ihr, dass weiter unten an der Straße irgendetwas nicht stimmt, sie wollen hinfahren und nachsehen, und sie soll sich keine Sorgen machen. Er geht ins hintere Zimmer, kommt mit dem Kleinkalibergewehr heraus, fragt, wo die Schrotflinte ist. Sie sagt, sie wisse es nicht. Er sucht danach, vergeblich – sie hört ihn fluchen, er flucht nicht in ihrer Gegenwart –, bis er aufgibt. Er kommt heraus, küsst sie zum Abschied, was auch ungewöhnlich ist, und sagt, er werde in ein paar Stunden zurück sein. Sie sieht zu, wie die drei in Henry Clarkes Lieferwagen wegfahren, in Richtung Rauch; sie weiß, dass er nicht zurückkommen wird. Sie meint, es müsste ihr mehr ausmachen, aber sie ist gut vorbereitet, sie hat ihm im Stillen schon jahrelang Lebewohl gesagt.
Sie geht wieder ins Haus und schließt die Tür. Sie ist einundfünfzig, ihre Füße tun weh, und sie weiß nicht, wo sie hinsoll, aber ihr ist klar, dass sie nicht hierbleiben kann. Es wird jetzt viele hungrige Menschen geben, und diejenigen, die es so weit aus den Städten hinaus schaffen, werden jung und zäh sein, ihr Haus ist ein Leuchtturm, der Wärme und Essen signalisiert. Es wird umkämpft werden, aber nicht von ihr.
Sie geht nach oben, sucht im Schrank und zieht ihre derbe Hose und die beiden dicksten Pullover an. Unten sucht sie alle Lebensmittel zusammen, die leicht genug sind, dass sie sie tragen kann, Rosinen, Blockschokolade, getrocknete Pflaumen und Aprikosen, einen halben Laib Brot, etwas Milchpulver, das sie in einen Gefrierbeutel füllt, ein Stück Käse. Dann holt sie die Schrotflinte hinter der Scheune hervor. Sie denkt einen Moment daran, die Tiere zu töten, die Hühner, die Jungkühe und das Schwein, damit es später nicht jemand tut, der nicht weiß, wie man es macht; aber sie weiß selbst nicht, wie man es richtig macht, sie hat noch nie im Leben etwas getötet, Frank hat das immer getan, deshalb begnügt sie sich damit, die Tür zum Hühnerhaus und das Gatter zum hinteren Feld zu öffnen. Sie hofft, dass die Tiere fortlaufen, aber sie weiß, dass sie es wahrscheinlich nicht tun werden.
Sie sieht sich ein letztes Mal im Haus um. Nachträglich steckt sie noch ihre Zahnbürste in das Bündel: Sie mag das Gefühl von ungeputzten Zähnen nicht. Sie geht nicht in den Keller hinunter, aber sie hat ein Bild vor Augen: ihre sorgfältig verschlossenen Flaschen und Gläser, rot und gelb und purpurn, zerbrochen auf dem Boden, in einer klebrigen Pfütze, die wie Blut aussieht. Die, die kommen, werden verschwenderisch sein, was sie nicht selbst essen können, werden sie vernichten. Sie denkt daran, das Haus selbst anzuzünden, bevor jemand anderes es tun kann.
Mrs. Burridge sitzt an ihrem Küchentisch. Auf die Rückseite des Kalenderblattes, es ist von einem Montag, hat sie Haferflocken geschrieben, in ihrer gleichmäßigen Schulmädchenschrift, für die sie immer eine gute Note bekam und die sich seither kaum verändert hat. Die Hunde sind ein Problem. Nach einigem Überlegen kettet sie sie los, aber sie lässt sie nicht weiter als bis zum Tor: Sie könnten sie in einem entscheidenden Moment verraten. Sie geht in ihren schweren Stiefeln nach Norden und trägt den Anorak über dem Arm, weil es noch nicht kalt genug ist, ihn anzuziehen, sowie das Paket mit Nahrungsmitteln und die Schrotflinte, die sie vorsorglich geladen hat. Sie kommt am Friedhof vorbei, wo ihr Vater und ihre Mutter, ihre Großmutter und ihr Großvater begraben sind; früher stand hier die Kirche, aber sie ist vor sechzehn Jahren abgebrannt und dichter an der Straße wiederaufgebaut worden. Franks Verwandte liegen auf dem anderen Friedhof, bei ihm geht es zurück bis zum Urgroßvater, aber sie sind Anglikaner, was ihm jedoch nichts mehr bedeutet. Außer ihr ist niemand auf der Straße; sie kommt sich ein bisschen lächerlich vor. Was, wenn sie sich irrt und Frank doch zurückkommt, was, wenn in Wirklichkeit gar nichts los ist? Backfett schreibt sie. Sie will einen Zitronenschaumkuchen für Sonntag machen, wenn zwei der Kinder zum Essen aus der Stadt kommen.
Es ist fast Abend, und Mrs. Burridge ist müde. Sie ist in einer Gegend, an die sie sich nicht erinnern kann, obwohl sie auf derselben Straße geblieben ist und es eine Straße ist, die sie gut kennt; sie ist sie viele Male mit Frank gefahren. Aber gehen ist nicht dasselbe wie fahren. Auf der einen Seite ist ein Feld, keine Häuser, auf der anderen ein Waldstück; ein Bach fließt durch ein Kanalrohr unter der Straße hindurch. Mrs. Burridge kniet sich hin, um zu trinken: Das Wasser ist eiskalt und schmeckt nach Eisen. Später wird es Frost geben, das spürt sie. Sie zieht den Anorak und die Handschuhe an und biegt in den Wald ein, wo man sie nicht sehen kann. Dort wird sie ein paar Rosinen und etwas Käse essen und versuchen, sich auszuruhen, während sie darauf wartet, dass der Mond aufgeht, damit sie weiterwandern kann. Jetzt ist es ganz dunkel. Sie riecht Erde, Holz, faulendes Laub. Plötzlich wird ihr Blick von einem roten Flackern eingefangen, und bevor sie umkehren kann – wie kann das so schnell passieren? –, nimmt es Form an, es ist ein kleines Feuer, weiter rechts, und zwei Männer kauern daneben. Sie haben sie auch gesehen: Einer von ihnen steht auf und kommt auf sie zu. Er lächelt und zeigt die Zähne; er denkt, es wird leicht sein mit ihr, einer alten Frau. Er sagt etwas, aber sie kann sich nicht vorstellen, was er sagt, sie weiß nicht, wie Leute reden, die so angezogen sind.
Sie haben ihre Flinte entdeckt, ihre Augen sind darauf geheftet, sie wollen sie. Mrs. Burridge weiß, was sie tun muss. Sie muss warten, bis sie nahe genug heran sind, dann muss sie die Flinte heben und die beiden Männer erschießen – ein Lauf für jeden –, und sie muss auf die Gesichter zielen. Sonst werden die Männer sie töten, daran zweifelt sie nicht. Sie wird schnell sein müssen, was sehr schlimm ist, weil ihre Hände sich dick und hölzern anfühlen. Sie hat Angst, sie will den lauten Knall und auch das rote Bersten nicht, das folgen wird, sie hat noch nie in ihrem Leben getötet. Sie hat keine Vorstellung, wie es danach weitergeht. Man weiß nie, wie man sich in so einer Lage verhält, bis es tatsächlich passiert.
Mrs. Burridge schaut auf die Küchenuhr. Auf ihre Liste schreibt sie Käse, sie essen jetzt mehr Käse als früher, wegen der Fleischpreise. Sie steht auf und geht zur Küchentür.
Der Sündenesser
Deutsch von Helga Pfetsch
Das ist Joseph, in rotbraunen Lederpantoffeln, die an den Fersen heruntergetreten, an den Zehen abgestoßen sind, dazu trägt er eine schmuddelige Strickjacke in Schlammgelb, die nach Ausverkaufsware riecht, er zieht an seiner Pfeife, sein Haar wird langsam grau und dünn, und seine Aussprache ist so schön und präzise und britisch wie eh und je.
»In Wales«, sagt er, »vor allem in den ländlichen Gegenden, gab es ein Wesen, das als Sündenesser bekannt war. Wenn jemand im Sterben lag, schickte man nach dem Sündenesser. Die Angehörigen kochten ein Essen und stellten es auf den Sargdeckel. Natürlich hatten sie den Sarg schon fertig: Wenn sie sich einmal darauf eingestellt hatten, dass man im Begriff war, das Zeitliche zu segnen, hatte man in dieser Sache kaum mehr eine Wahl. Anderen Versionen zufolge wurde die Mahlzeit auf den Körper des Verstorbenen gestellt, was vermutlich zu eher schludrigen Essmanieren geführt haben dürfte. Wie auch immer, der Sündenesser verzehrte jedenfalls sein Mahl und bekam noch einen Geldbetrag dazu. Man glaubte, dass alle Sünden, die der Sterbende zu Lebzeiten angehäuft hatte, von ihm genommen und auf den Sündenesser übertragen wurden. Auf diese Weise wurde der Sündenesser von den Sünden anderer Leute ganz aufgebläht. Er häufte eine so schwere Sündenlast auf sich, dass keiner etwas mit ihm oder vielmehr ihr zu tun haben wollte; eine Art Syphilitiker der Seele, könnte man sagen. Man vermied es sogar, sie anzusprechen, außer natürlich, wenn es Zeit war, sie zu der nächsten Mahlzeit zu rufen.«
»Sie?«, sage ich.
Joseph lächelt, dieses schiefe Lächeln, bei dem die Zähne in der einen Mundhälfte sichtbar werden, der Hälfte, die nicht mit der Pfeife beschäftigt ist. Ein ironisches Grinsen, wölfisch, was greift es auf? Was habe ich diesmal preisgegeben?
»Ich stelle sie mir als alte Frauen vor«, sagt er, »obwohl es wahrscheinlich keinen Grund gibt, warum es nicht Männer gewesen sein sollten. Sie konnten sein, was sie wollten, solange sie nur willens waren, die Sünden zu essen. Notleidende alte Wesen, die sonst keine Möglichkeit sahen, Leib und Seele zusammenzuhalten, meinen Sie nicht? Eine Art altersbedingte geistige Hurerei.«
Er blickt mich an und grinst weiter, und ich erinnere mich an bestimmte Geschichten, die ich über ihn gehört habe, über ihn und Frauen. Er hätte drei Frauen, damit geht’s schon los. Mit mir hat er allerdings nie etwas gehabt, obwohl er immer sehr ausgedehnt versucht, mir in den Mantel zu helfen. Aber warum sollte ich mir Gedanken machen? Ich bin kein bisschen anfällig für so was. Außerdem ist er mindestens sechzig, und die Strickjacke schreit echt zum Himmel, wie meine Söhne sagen würden.
»Es brachte allerdings Unglück, eine von ihnen zu töten«, sagt er, »und es muss noch andere Einschränkungen gegeben haben. Im Grunde genommen denke ich, dass das Sündenessen viel für sich hat.«
Joseph ist nicht einer von der Sorte, die in einfühlsamem, nachsichtigem Schweigen warten, wenn man plötzlich verstummt oder nichts mehr zu sagen weiß. Wenn du ihm nichts erzählen willst, dann erzählt er eben, verdammt noch mal, dir was, und zwar meistens das Langweiligste, was ihm gerade einfällt. Ich habe schon alle Einzelheiten über seine Blumenbeete und seine drei Frauen erfahren und darüber, wie man im Keller Callas züchtet; auch über den Keller habe ich schon alles erfahren, Führungen könnte ich durch den machen. Er sagt, er findet, dass es gesund für seine Patienten ist – er bezeichnet sie nicht als »Klienten«, bei Joseph wird nicht um den heißen Brei geschlichen –, wenn sie erfahren, dass auch er ein menschliches Wesen ist, und wir erfahren es, weiß Gott, er quasselt und quasselt, bis dir endlich dämmert, dass du ihn nicht dafür bezahlst, dass er über seine Topfpflanzen redet und du zuhörst, sondern dass du ihn dafür bezahlst, dass du über deine redest und er zuhört.
Gelegentlich allerdings teilt er einem wirklich etwas mit. Ich hebe meine Kaffeetasse hoch und überlege, ob dies wohl eine solche Gelegenheit ist.
»Na gut«, sage ich, »ich beiße an. Warum?«
»Das liegt auf der Hand«, sagt er und zündet dabei, Rauchwolken speiend, seine Pfeife wieder an. »Erstens müssen die Patienten warten, bis sie sterben. Eine echte Lebenskrise, keine Verstellung und keine Erfindungen. Erst dann dürfen sie einen belästigen, erst wenn sie beweisen können, dass es ihnen ernst ist, sozusagen. Zweitens springt noch eine ordentliche Mahlzeit für jemand dabei raus.« Er lacht gepresst. Wir wissen beide, dass die Hälfte seiner Patienten sich nicht darum schert, ihm sein Honorar zu zahlen, nicht einmal das Geld, das die Regierung ihnen dafür gibt. Joseph hat die Angewohnheit, Leute zu übernehmen, die keiner sonst auch nur mit einer Kneifzange anfassen würde, nicht weil sie zu krank, sondern weil sie zu arm sind. Mütter, die von der Sozialhilfe leben, und so weiter; üble Kreditrisiken, wie Joseph selbst. Er ist einmal, als er in einer Klapsmühle arbeitete, gefeuert worden, weil er einen Betriebsrat organisieren wollte.
»Und denken Sie an die Zeitersparnis«, fährt er fort. »Ein paar Stunden pro Patient, alles in allem, im Gegensatz zu zweimal wöchentlich über Jahre und Jahre – und beides mit dem gleichen Endergebnis.«
»Das ist reichlich zynisch«, sage ich missbilligend. Normalerweise bin ich die Zynische, aber vielleicht überrundet er mich, um mich zu zwingen, aus dieser Ecke hervorzukommen. Zynismus ist, laut Joseph, eine Abwehrstrategie.
»Man brauchte ihnen nicht einmal zuzuhören«, sagt er. »Nicht ein einziges Wort brauchte man sich anzuhören. Die Sünden werden ja auf das Essen übertragen.« Plötzlich sieht er traurig und müde aus.
»Wollen Sie damit sagen, dass ich Ihre Zeit vergeude?«, sage ich.
»Nicht meine Zeit, meine Beste«, sagt er. »Ich habe endlos Zeit!«
Ich interpretiere es als Herablassung, genau das, was ich am allerwenigsten ertragen kann. Trotzdem werfe ich nicht die Kaffeetasse nach ihm. Ich bin nicht so zornig, wie ich es früher einmal gewesen wäre.
Wir haben viel Zeit darauf verwendet, auf diesen Zorn. Er rührte nur daher, dass ich die Wirklichkeit so unbefriedigend fand. Das war mein Problem. So unfertig, so schlampig, so sinnlos, so endlos. Ich wollte, dass alles einen Sinn hat.
Ich dachte, Joseph würde versuchen, mich davon zu überzeugen, dass die Realität in Wirklichkeit doch wunderbar und bestens sei, und dann versuchen, mich der Realität anzupassen, aber das tat er nicht. Stattdessen stimmte er mir zu, fröhlich und auf der Stelle. Das Leben sei in fast jeder Hinsicht ein Riesenhaufen Scheiße, sagte er. Das war axiomatisch. »Stellen Sie es sich vor als eine verlassene Insel«, sagte er. »Sie sitzen dort fest, und jetzt müssen Sie entscheiden, wie sie am besten damit fertigwerden.«
»Bis ich gerettet werde?«, sagte ich.
»An Rettung brauchen Sie gar nicht erst zu denken«, sagte er.
»Das kann ich nicht«, sagte ich.
Diese Unterhaltung findet in Josephs Büro statt, das genauso schäbig ist wie er selbst und nach unausgeleerten Aschenbechern, Füßen, seelischer Not und zweimal geatmeter Luft riecht. Aber sie findet auch in meinem Schlafzimmer statt, am Tag der Beerdigung. Der Beerdigung von Joseph, der doch nicht endlos Zeit hatte.
»Er ist von einem Baum gefallen«, sagte Karen, als sie es mir mitteilte. Sie war dazu persönlich hergekommen, statt anzurufen. Joseph traute Telefonen nicht. Der größte Teil einer Botschaft bei jedem Kommunikationsakt werde nonverbal mitgeteilt, sagte er.
Karen stand auf meiner Türschwelle und vergoss Tränen. Sie war auch eine der Seinen, eine von uns; über sie hatte ich ihn gefunden. Inzwischen bilden wir ein ganzes Netzwerk, es ist, wie wenn man einen Friseur weiterempfiehlt, wir haben ihn von Hand zu Hand weitergereicht, wie das sprichwörtliche Auge um Auge. Intelligente Frauen mit abtrennbaren Ehegatten oder überbegabten Kindern mit nervösen Ticks, intelligente Frauen in zerrütteten Lebensumständen und alle überglücklich, jemanden zu finden, der uns nicht vormachte, dass wir einfach viel zu intelligent seien und uns einer Gehirnoperation unterziehen sollten. Intelligenz sei ein Plus, behauptete Joseph. Wir sollten erst einmal sehen, wie es den Dummen erginge.
»Von einem Baum?«, fragte ich, schrie es fast.
»Zwanzig Meter, auf den Kopf«, sagte Karen. Sie fing wieder an zu weinen. Ich hätte sie am liebsten geschüttelt.
»Was zum Kuckuck hatte er denn auf einem zwanzig Meter hohen Baum zu suchen?«, fragte ich.
»Er hat ihn ausgelichtet«, sagte Karen. »Es war in seinem Garten. Der Baum hat seinen Blumenbeeten das Licht genommen.«
»Dieses alte Arschloch«, sagte ich. Ich war stinksauer auf ihn. Das war Fahnenflucht. Wie konnte er nur glauben, er sei berechtigt, auf einen zwanzig Meter hohen Baum zu steigen und damit unser aller Leben aufs Spiel zu setzen? Bedeuteten seine Blumenbeete ihm mehr als wir? »Was sollen wir nur tun?«, sagte Karen.
Was soll ich nur tun? ist die eine Frage. Sie kann immer durch Was soll ich nur anziehen? ersetzt werden. Für manche Leute ist das dasselbe. Ich wühle mich durch den Schrank auf der Suche nach den schwärzesten Sachen, die ich finden kann. Was ich anziehe, wird der nonverbale Teil der Kommunikation sein. Joseph wird es vermerken. Ich habe das grässliche Gefühl, dass ich in dem Bestattungsinstitut aufkreuzen werde und feststellen muss, dass sie ihn in seiner scheußlichen gelben Strickjacke und diesen ordinären rotbraunen Lederpantoffeln aufgebahrt haben.
Ich hätte mich gar nicht so anzustrengen brauchen mit dem Schwarz. Es ist nicht mehr erforderlich. Die drei Ehefrauen tragen Pastelltöne, die erste Blau, die zweite Flieder, die dritte, augenblickliche, Beige. Ich weiß eine Menge über die drei Ehefrauen, aus jenen schlechten Tagen, wenn mir nicht nach Reden zumute war.
Karen ist auch da, in einem Kleid mit indischem Muster, sie schnieft leise vor sich hin. Ich beneide sie. Ich möchte gerne Schmerz empfinden, aber ich kann gar nicht richtig glauben, dass Joseph tot ist. Es kommt mir vor wie ein Streich, den er uns spielt, wie eine Anekdote, aus der wir etwas lernen sollen. Verstellung und Erfindungen. Schon gut, Joseph, würde ich gern rufen, wir wissen es jetzt, du kannst rauskommen! Aber nichts passiert, der verschlossene Sarg bleibt verschlossen, keine Rauchwölkchen steigen daraus hervor, um anzuzeigen, dass Leben darin ist.
Der verschlossene Sarg ist die Idee der dritten Ehefrau gewesen. Sie findet es würdiger, wird gemunkelt, und wahrscheinlich ist es das auch. Der Sarg ist aus dunklem Holz, geschmackvoll, ohne protziges Zierwerk. Niemand hat ein Essen gekocht und es auf den Sarg gestellt, niemand hat davon gegessen. Kein notleidendes altes Wesen, das die Rüben und den Kartoffelbrei verschlingt und mit ihnen die dunklen Geheimnisse aus Josephs Leben. Ich habe keine Ahnung, was Joseph wohl auf dem Gewissen gehabt hat. Trotzdem empfinde ich dies als eine Unterlassung: Was ist dann wohl aus Josephs Sünden geworden? Sie schweben um uns, in der Luft, über den gebeugten Köpfen, während ein männlicher Verwandter von Joseph, der mir unbekannt ist, uns allen erzählt, was für ein guter Mensch er war.
Nach der Beerdigung gehen wir zu Joseph nach Hause, ins Haus der dritten Ehefrau, zu dem, was man früher den Leichenschmaus nannte. Doch jetzt nicht mehr: Heutzutage ist es Kaffee und ein Imbiss.
Die Blumenbeete sind gepflegt, um diese Jahreszeit wachsen Gladiolen darauf, sie verblassen schon und sind ein wenig zerzaust. Der Ast, derjenige, der abgebrochen ist, liegt noch auf dem Rasen.
»Ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass er in Wirklichkeit gar nicht da war«, sagt Karen, als wir den Gartenweg hinaufgehen.
»Nicht wo war?«, frage ich.
»Da«, sagt Karen, »im Sarg.«
»Um Gottes willen«, sage ich, »fang bloß nicht damit an.« Diese Art von sentimentalem Kitsch kann ich bei mir selbst noch ertragen, gerade eben so, solange ich ihn nicht laut äußere. »Tot ist tot, das würde er sagen. Man muss sich mit dem Hier und Jetzt befassen, erinnerst du dich?«
Karen, die einmal einen Selbstmordversuch unternommen hat, nickt und fängt wieder an zu weinen. Joseph ist Experte für Leute, die Selbstmordversuche unternehmen. Er hat noch keinen von ihnen verloren.
»Wie macht er das bloß?«, habe ich Karen einmal gefragt. Selbstmord gehört nicht zu meinen Süchten, deshalb wusste ich es nicht.
»Er lässt es nach etwas ungeheuer Langweiligem klingen«, hatte sie gesagt.
»Das kann nicht alles sein«, sagte ich.
»Er bringt einen dazu, sich vorzustellen«, sagt sie, »wie es ist, wenn man tot ist.«
Leute bewegen sich leise umher, im Wohnzimmer und im Esszimmer, wo der Tisch steht, von der dritten Frau mit einem silbernen Samowar und einer Vase mit rosa und gelben Chrysanthemen gedeckt. Nichts zu sehr nach Beerdigung Aussehendes, kann man ihre Überlegungen förmlich hören. Auf der weißen Tischdecke stehen Tassen, Teller, Plätzchen, Kaffee, Kuchen. Ich weiß nicht, warum man davon ausgeht, dass Beerdigungen hungrig machen, aber es ist wirklich so. Wenn man noch kauen kann, weiß man, dass man am Leben ist.
Karen steht neben mir und stopft sich ein Stück Schokoladenkuchen in den Mund. Auf der anderen Seite steht die erste Frau.
»Ich hoffe, Sie sind nicht eine von den Verrückten«, sagt sie unvermittelt. Wir kennen uns eigentlich gar nicht. Sie wurde mir nur von Karen bei der Beerdigung gezeigt. Sie wischt sich die Finger an einer Papierserviette ab. An ihrem lichtblauen Revers steckt eine goldene Brosche in der Form eines Vogelnests mitsamt den Eiern. Sie erinnert mich an die Highschool, Filzröcke mit applizierten Katzen und Telefonen, eine Welt der Nachbildungen.
Ich überlege mir meine Antwort. Meint sie Klientin, oder will sie wissen, ob ich vielleicht wirklich nicht ganz bei Trost bin?
»Nein«, sage ich.
»Dachte ich mir«, sagt die erste Frau. »Sie sehen nicht danach aus. Aber von denen haben viele so ausgesehen, es hat ja nur so gewimmelt davon. Ich hatte Angst, dass es zu einem Zwischenfall kommt. Als ich noch mit Joseph zusammenlebte, hat es immer solche Zwischenfälle gegeben, Anrufe um zwei Uhr früh, immer brachten sie sich um, warfen sich auf ihn, man glaubt es nicht, was sich da abspielte. Einige waren ihm förmlich hörig. Wenn er ihnen befohlen hätte, den Papst zu erschießen oder so was, dann hätten sie es getan, ohne mit der Wimper zu zucken.«
»Er wurde sehr geschätzt«, sage ich vorsichtig.
»Wem sagen Sie das«, sagt die erste Frau. »Die hatten die Vorstellung, er wäre Gott persönlich, ein paar von denen. Und ihn hat das noch nicht mal gestört.«
Die Papierserviette reicht nicht aus, sie leckt ihre Finger ab. »Zu süß und fett«, sagt sie. »Von der.« Sie ruckt mit dem Kopf in Richtung der zweiten Frau, die schmächtiger als die erste ist und eine Spur ziellos an uns vorbeigeht in Richtung Wohnzimmer. »Mach doch, was du willst, hab’ ich schließlich zu ihm gesagt. Ich will doch nur mein bisschen Ruhe und Frieden, bevor ich ins Gras beißen muss.«
Obwohl er zu süß und fett ist, nimmt sie noch ein Stück Schokoladenkuchen. »Von ihr stammt diese spinnige Idee, ein paar von denen sollten aufstehen und ein bisschen was über ihn erzählen, direkt bei der Trauerfeier. ›Bist du denn total übergeschnappt?‹, hab’ ich zu ihr gesagt. ›Es ist zwar deine Beerdigung, aber wenn ich du wäre, würde ich mir doch mal klarmachen, dass ein paar von den Leuten vielleicht nicht so normal sind wie andere.‹ Zum Glück hat sie auf mich gehört.«
»Ja«, sage ich. An ihrer Backe klebt Schokoladenguss. Ich überlege, ob ich es ihr sagen soll.
»Ich hab’ getan, was ich konnte«, sagt sie, »wenn’s auch nicht viel war, aber immerhin. Ich hab’ ihn irgendwie gemocht. Man kann zehn Jahre nicht einfach aus seinem Leben ausradieren. Ich habe die Plätzchen mitgebracht«, fügt sie ziemlich selbstgefällig hinzu. »Das Mindeste, was ich tun konnte.«
Ich senke den Blick auf die Plätzchen. Sie sind weiß, ausgestochene Sterne und Monde, die mit farbigem Zuckerguss und Silberkügelchen verziert sind. Sie erinnern mich an Weihnachten, an Feste und Feierlichkeiten. Es sind Plätzchen, wie man sie backt, um jemandem eine Freude zu machen, um einem Kind eine Freude zu machen.
Ich habe mich lange genug hier aufgehalten. Ich sehe mich nach der dritten Frau um, die hier die Verantwortung für alles trägt, um mich zu verabschieden. Schließlich sehe ich sie, sie steht in einer offenen Tür. Sie weint, was sie bei der Beerdigung nicht getan hat. Die erste Frau steht neben ihr und hält ihre Hand.
»Ich lasse es so, wie es ist«, sagt die erste Frau, an niemand Bestimmten gerichtet. Über ihre Schulter kann ich in das Zimmer sehen, offenbar Josephs Arbeitszimmer. Es dürfte einiges an Energie kosten, diesen Ramschladen unangetastet, unaufgeräumt zu lassen. Ganz zu schweigen von den Begonien, die auf dem Fenstersims dahinwelken. Doch es wird sie überhaupt keine Energie kosten, weil Joseph in diesem Zimmer ist, unvollendet, eine riesige Kiste voller Krimskrams. Er sperrt sich dagegen, sich zusammenpacken und wegschaffen zu lassen.
»Wen hassen Sie am meisten?«, fragt Joseph. Und dies mitten in einem Vortrag, den er mir über die richtige Auswahl eines Vogelbads für den Garten gehalten hat. Natürlich weiß er, dass ich keinen Garten habe.
»Ich habe absolut keine Ahnung«, sage ich.
»Dann sollten Sie es herausfinden«, sagt Joseph. »Ich für mein Teil hege einen unerbittlichen Hass gegen den Jungen, der neben uns wohnte, als ich acht war.«
»Und warum?«, frage ich, erleichtert darüber, aus der Zange gelassen zu werden.
»Er hat meine Sonnenblume abgepflückt«, sagt er. »Ich bin im Slum aufgewachsen, wissen Sie. Wir hatten so eine Art Hof vor dem Haus, aber der war aus massiver Schlacke. Trotzdem habe ich es geschafft, dort diese eine kümmerliche Sonnenblume zu ziehen, Gott weiß wie. Ich stand jeden Morgen ganz früh auf, nur um sie anzusehen. Und der kleine Scheißkerl pflückt die einfach ab. Aus reiner gemeiner Bosheit. Eine Menge späterer Missetaten habe ich vergessen und vergeben, aber wenn mir dieser kleine Saukerl morgen über den Weg liefe, würde ich ihm ein Messer zwischen die Rippen jagen.«
Ich bin schockiert, wie Joseph es beabsichtigt hat. »Er war doch nur ein Kind«, sage ich.
»Das war ich auch«, sagt er. »Die frühen Verletzungen sind am schwersten zu vergeben. Kinder kennen keine Barmherzigkeit; die muss man erst lernen.«
Will Joseph hier wieder einmal beweisen, dass er ein menschliches Wesen ist, oder ist die Absicht, dass ich etwas über mich selbst erfahren soll? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Manchmal sind Josephs Geschichten Parabeln, aber manchmal sind sie auch nur reines Gesabber.
In der Diele lauert mir die zweite Frau auf, die mit den fliederfarbenen Strähnen. »Er ist nicht gefallen«, flüstert sie.
»Wie bitte?«, sage ich.
Die drei Frauen haben eine Familienähnlichkeit – sie sind alle blond und ziemlich nichtssagend –, aber an dieser ist noch etwas anderes, ein Glitzern in den Augen. Vielleicht ist es Gram; oder vielleicht hat Joseph nicht immer einen ganz strikten Trennungsstrich zwischen seinem persönlichen und seinem Berufsleben gezogen. Die zweite Frau hat einen schwachen Geruch von Klientin an sich.
»Er war nicht glücklich«, sagt sie. »Ich habe das gemerkt. Wir haben uns immer noch sehr gut verstanden, wissen Sie.«
Ich soll daraus schließen, dass er gesprungen ist, das will sie. »Mir schien er ganz in Ordnung«, sage ich.
»Er konnte gut den Schein wahren«, sagt sie. Sie schöpft Atem, sie ist im Begriff, mir etwas anzuvertrauen, aber was das auch für Offenbarungen sein mögen, ich will sie nicht hören. Ich will, dass Joseph so bleibt, wie er schien: stabil, fähig, weise und normal. Ich brauche seine Dunkelheit nicht.
Ich gehe zurück in meine Wohnung. Meine Söhne sind das Wochenende über fort. Ich überlege, ob ich mir die Mühe machen soll, für mich allein etwas zu kochen. Es lohnt sich kaum. Ich gehe in dem zu kleinen Wohnzimmer herum und hebe Sachen auf. Nicht mehr die von meinem Ehemann: Wie es sich für Halbgeschiedene schickt, wohnt er woanders.
Einer meiner Söhne hat gerade die Dusch-und-Rasierphase erreicht, der andere noch nicht, aber beide hinterlassen jedes Mal, wenn sie durch ein Zimmer gehen, ein ganzes Warenlager. Eine Art Badewannenschmutzrand von Gegenständen – Socken, Taschenbücher, die in der Mitte aufgeschlagen und mit der Schrift nach unten liegen gelassen worden sind, Brote, aus denen ein Stück herausgebissen ist, und seit Kurzem Zigarettenkippen.
Unter einem schmutzigen T-Shirt finde ich die Hare-Krishna-Broschüre, die mein jüngerer Sohn vor einer Woche mit nach Hause gebracht hat. Ich hatte schon Sorge, dass dies ein Schub jugendlichen religiösen Wahns sei, aber nein, er hatte ihnen nur einen Vierteldollar gegeben, weil sie ihm leidtaten. Er war schon als Kind einer, der tote Rotkehlchen begrub. Ich nehme das Heft mit in die Küche, um es in den Müll zu werfen. Auf dem Titelblatt ist ein Blatt von einem Flöte spielenden Krishna, umringt von bewundernden Jungfrauen. Sein Gesicht ist leuchtend blau, was mich an Leichen denken lässt: Manche Dinge haben nicht in allen Kulturen dieselbe Bedeutung. Wenn ich weiterlesen würde, könnte ich herausfinden, warum Fleisch und Sex schlecht für den Menschen sind, gar nicht so übel, wenn man es recht bedenkt: keine zu Tode erschrockenen Kühe mehr, keine Scheidungen mehr. Ein Leben der Abstinenz und des Gebets. Ich stelle mir vor, wie ich an einer Straßenecke stehe, in fließende Gewänder gehüllt, und eine Glocke läute. Selbstlos und entrückt, frei von Sünde. Sünde, das ist diese Welt, sagt Krishna. Diese Welt ist das Einzige, was wir haben, sagt Joseph. Sie ist das Einzige, was Ihnen zur Verfügung steht. Das geht nicht über Ihre Kräfte. Sie werden nicht gerettet werden.