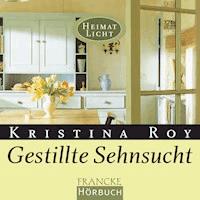Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Folgen Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch erzählt bewegende, wahre Geschichten von Kindern, die ohne ein richtiges Zuhause aufwachsen mussten. Jahrelang lag das Schicksal der heimatlosen Hausiererkinder und Landstreicher auf meinem Herzen – ihr Elend ließ mich nicht los und trieb mich immer wieder ins Gebet. Ich bat Gott, mir einen Weg zu zeigen, ihnen nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern auch Liebe und Geborgenheit zu schenken. Im Jahr 1901 wurde dieser Herzenswunsch Wirklichkeit: Ein Bruder und seine Frau erklärten sich bereit, gemeinsam mit mir ein Heim zu eröffnen. So fanden die ersten 15 Kinder eine neue Zuflucht, in der sie christliche Erziehung und Fürsorge erfuhren. Mein größtes Gebet bleibt jedoch, dass solche Asyle eines Tages nicht mehr nötig sein werden – dass Kinder in stabilen, liebevollen Familien aufwachsen und nicht aus Not ihre Eltern verlieren müssen. Doch bis dahin soll dieses Heim ein Ort der Hoffnung und des Neubeginns sein. Kristina Roy
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 176
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Landstreicher
Wahre Geschichten
Kristina Roy
Impressum
© 1. Auflage 2021 ceBooks.de im Folgen Verlag, Langerwehe
Autor: Kristina Roy
Cover: Caspar Kaufmann
ISBN: 978-3-95893-274-6
Verlags-Seite und Shop: www.ceBooks.de
Kontakt: [email protected]
Dieses eBook darf ausschließlich auf einem Endgerät (Computer, eReader, etc.) des jeweiligen Kunden verwendet werden, der das eBook selbst, im von uns autorisierten eBook-Shop, gekauft hat. Jede Weitergabe an andere Personen entspricht nicht mehr der von uns erlaubten Nutzung, ist strafbar und schadet dem Autor und dem Verlagswesen.
Dank
Herzlichen Dank, dass Sie dieses eBook aus dem Verlag ceBooks.de erworben haben.
Haben Sie Anregungen oder finden Sie einen Fehler, dann schreiben Sie uns bitte.
ceBooks.de, [email protected]
Newsletter
Abonnieren Sie unseren Newsletter und bleiben Sie informiert über:
Neuerscheinungen von ceBooks.de und anderen christlichen Verlagen
Neuigkeiten zu unseren Autoren
Angebote und mehr
http://www.cebooks.de/newsletter
Inhalt
Titelblatt
Impressum
Dank
Newsletter
Die Landstreicher
Die Kinder der Hausierer
Geborgen
Lebendig begraben
Eine verlorene Seele
Kein Raum
Nachwort
Letzte Seite
Die Landstreicher
Am unteren Ende des Dorfes Hrabowa stand eine alte Hütte. Jahre hindurch hatte sie der Familie Zabuschka gehört. Nun war der letzte Bauer gestorben. Seine Kinder waren irgendwo in aller Welt zerstreut; er selbst hatte sie durch sein wüstes Trinkerleben vertrieben, so dass keines mehr nach der alten Heimat fragte – und da die Gemeinde nicht wusste, wo die Erben waren, ließ sie die Hütte einfach verkommen, verkaufen konnte sie sie nicht, und ein Mieter fand sich nicht, denn wer hätte wohl sein Geld in diese verfallene Hütte stecken mögen. Endlich meldete sich eines Tages ein hergelaufener Schleifer, den alle unter dem Namen „Onkel Imrich“ kannten.
Der erklärte sich bereit, die Hütte so weit instand zu setzen, dass ihm das Dach nicht über dem Kopfe zusammenfiele. Man gab sie ihm, und er setzte sogleich die zerbrochenen Fensterscheiben ein, denn auch von ihm galt das Sprichwort: „Neunerlei Handwerk – zehnfache Not.“ Dieser Mensch verstand alles auszubessern, von Haus aus hatte er das Uhrmacherhandwerk gelernt. Aber als Geselle hatte er sich den Schleifern angeschlossen und ging nun mit ihnen. Sie waren zu dritt: Der alte Weltschow, der die amtliche Befugnis für das Handwerk besaß, der jüngere Gruschta, der Regenschirme reparierte und dabei Planeten1 verkaufte. Auf den Jahrmärkten kannten die Leute seine wundertätigen weißen Mäuschen, die jedem das gewünschte Glücksbrieflein zogen. Nun, und der dritte im Bunde war Onkel Imrich, der Uhrmacher. Weil die drei immer beisammen waren, gaben ihnen die Leute den Beinamen: „Die drei Könige.“ Warum hätten sie sie auch nicht so nennen sollen?
Denn wenn ein Mensch nur seinen eigenen Willen durchsetzen darf und er sonst nach niemandem zu fragen braucht, so ist er ja ein regelrechter König. Wenn sie Geld verdienten, vertranken sie es, gar oft aber hungerten sie auch – wie es eben kam. Sie schliefen in Scheunen und Heuschobern. Gruschka, der Mäuselmann, übernachtete auch öfters im Arrest einer Gemeinde, wohin ihn die Handjäger mitunter einlieferten. Er konnte es nämlich nicht mit ansehen, wenn irgend etwas umherlag oder an einem Gartenzaun hing. Sein Ordnungssinn war so entwickelt, dass er alles, was die Harmonie störte, am liebsten gleich mitnahm. Sah er auf dem Felde einen Krautkopf oder eine Rübe, oder ein Häufchen Kartoffeln, die nicht hübsch in Reih und Glied standen, so brachte er das sogleich in Ordnung, – nur schade, dass die Bauern dafür sehr wenig Verständnis besaßen, so dass der arme Teufel für seine Ordnungsliebe manche dicke Suppe auslöffeln musste und öfters mit dem Gefängnis Bekanntschaft machte, denn die Welt ist leider böse.
– Aber die Freundschaft der drei Könige war wirklich mustergültig. Weltschow war wie ein Vater unter ihnen, vor ihm hatten sie auch Respekt, obwohl ihnen an der öffentlichen Meinung durchaus nichts lag. Doch was er sagte, war den beiden jüngeren heilig. Aber ach – alles auf der Welt geht einmal zu Ende. Es war in einem sehr kalten Winter, als sich der alte Weltschow eine böse Erkältung zuzog. Der Schankwirt, in dessen Schuppen die drei damals hausten, ließ ihn ins Krankenhaus schaffen. Dorthin kam Imrich ihm alsbald nach, Weltschow konnte die schwere Lungenentzündung nicht überstehen – er starb. Aber vor einem Tode gab er beiden Kameraden noch eine ernste Ermahnung und verteilte seine Habseligkeiten unter sie. Imrich erhielt den Schleifstein samt allem, was dazu gehörte, der Mäuselmann allerlei Kleinigkeiten und einen noch guten Schafpelz. Das Geld gab Weltschow dem Priester, der ihm die Sterbesakramente reichte, für ein christliches Begräbnis. Gruschka ließ sich, nachdem er sein Teil erhalten, nicht mehr im Krankenhaus blicken, und so war nur Imrich bei Onkel Weltschows Tode anwesend. Zu diesem sagte er:
„Imrischko, lass das Trinken sein! Du kannst doch so gut Uhren reparieren, auch schleifen; mach dich in irgendeinem Dorfe ansässig! Ich war schon zu alt dazu, um ein besseres Leben anzufangen, aber wenn ich nüchtern war, hat mir oft das Herz darüber wehgetan, dass wir nur solche Landstreicher sind, den anderen Leuten zum Spott. Besonders um dich hat es mir oft leidgetan. Du bist noch jung, und wenn unser Herrgott dich von dieser Krankheit gesund macht, so versprich mir, dass du ein anständiges Leben unter den Menschen anfangen willst und nicht länger mit dem Mäuselmann umherstreichen wirst. Er wird dies Leben wohl nicht mehr lassen können, und er ist doch nur ein Dieb!“
Imrich legte seine Hand in die kalte, feuchte Hand des Greises, und zwei große Tränen rannen während dieses Gelöbnisses über seine eingefallenen Wangen. Obwohl es schien, als ob ihn diese Krankheit auch mitnehmen wolle, überwand er sie schließlich, und seinem Versprechen gemäß machte er sich in jenem Hüttchen in Hrabowa ansässig, dessen Besitzer sich auch irgendwo in der Welt herumtrieben. Das Krankenhaus hatte er zwar noch schwach, aber gesund verlassen, und weil er sich dort das Trinken abgewöhnt hatte, fühlte er sich körperlich wie ein neuer Mensch. Wenn er jetzt an sein früheres Leben zurückdachte, empfand er etwas wie Scham. Er hatte von Weltschow gelernt, auch dem Vieh zu helfen, und das war gut, denn damit verdiente er doch etwas, bevor sich die Leute dazu entschlossen, ihm Uhren zur Reparatur anzuvertrauen und ihm etwas zum Schleifen zu bringen. Nur war es ihm in der wüsten Hütte sehr einsam zumute. Weltschow fehlte ihm überall, denn dieser Mann hatte ihn gern gehabt – das hatte Imrich gefühlt, und diese Liebe war es gewesen, die ihn, den Uhrmacher, mit dem alten Scherenschleifer verbunden hatte, so dass er imstande gewesen war, Jahre hindurch dessen Leben zu teilen. Ja, Weltschow war eben der erste Mensch gewesen, der Imrich Liebe erwiesen hatte, und der Mensch kann nun einmal ohne Liebe nicht leben. Jeder strebt dahin, wo er sie findet. Gar mancher, der in einem Palast geboren wurde, hat in irgendeiner armen Hütte geendet, und zwar nur deshalb, weil er dort, wo er hingehörte, keine Liebe gefunden hatte.
So war ein halbes Jahr ins Land gegangen, und seine früheren Gefährten hätten Onkel Imrich kaum wiedererkannt. Er hatte solange gearbeitet, bis er sich anständig kleiden konnte. In der Hütte stand nun eine Bank, die an den Wänden entlang lief. Davor ein alter Tisch aus Eichenholz, an der Wand eine Truhe und in der Ecke ein altes Bett. Betttücher und Decken hatte er noch vorgefunden, Stroh hatte er sich angeschafft, und weil er der Nachbarin das Spinnrad gerichtet, hatte sie ihm das Bett in Ordnung gebracht. Eine andere Nachbarin war zu ihrem Sohne in die Stadt übergesiedelt und hatte ihm allerlei von ihren Sachen überlassen, auch ein ziemlich gutes Federbett. Das hätte ihr in Hrabowa, wo es so viele Gänse gab, ja doch kaum jemand abgekauft, und mitnehmen konnte sie es auch nicht, weil ihr Sohn, wie sie erzählte, ein großer Herr war und die Schwiegertochter eine noble Dame! Imrich hatte ihr geholfen alles einzupacken und nach dem Bahnhof zu schaffen – so hatten sie einander gedient.
Nach und nach richtete sich unser Schleifer ein, wie ein Robinson von Hrabowa. Hier gab ihm niemand mehr Spottnamen. Seitdem er ein wenig besser gekleidet und immer sauber gewaschen war, sah man erst, dass er eigentlich ein hübsches Gesicht hatte. Das Schönste daran waren die großen, traurigen Augen. Er war von kleiner Gestalt, denn sein Rücken wies einen kleinen Höcker auf, der ihn am Wachstum gehindert hatte. Ach, dieser Höcker war eigentlich die Ursache seines verfehlten, unglücklichen Lebens. Um dieses Höckers willen, die Folgen eines von den Angehörigen nicht beachteten Unfalls in seinem ersten Lebensjahre, hatte ihn die eigene Mutter, die noch vier gesunde, hübsche Kinder hatte, zurückgesetzt. „Der hässliche Bucklige“, so hatten sie ihn daheim genannt, weil der Knabe von Kind auf sein Leid in sich verschließen musste, hatte er sich zu einem bösartigen, neidischen Charakter entwickelt. Er tat allen Menschen zum Trotz, was er nur irgend konnte und wurde dafür geschlagen, und das erweckte in ihm den Wunsch, groß und stark zu werden und sich dann an allen zu rächen. In der Schule lernte er zwar gut, aber um seines boshaften Wesens willen war er Mitschülern und Lehrern verhasst. Er war zwar klein, aber stämmig und heimtückisch, dabei ein Raufbold, der alles, was er nur konnte, mutwillig zerstörte. So kam er in die Lehre.
Sein Vater hatte ihn zu einem Schuhmacher gegeben, aber dort brannte er durch, und fand schließlich eine Lehrstelle bei einem Uhrmacher, von daheim ließ man ihm sagen, er möge ihnen nicht mehr unter die Augen kommen. Das ließ sich der Knabe gesagt sein. Sein Handwerk machte ihm Freude. Er hatte einen strengen Meister, den die anderen Lehrjungen einen bösen Mann nannten, aber zu Imrich war er nicht böse. Er sah, dass der Junge einen scharfen Verstand hatte und behielt ihn in der Lehre, vielleicht wäre aus dem Jüngling etwas Ordentliches geworden. Als er nach vier Jahren bei dem Meister Geselle wurde, war er bereits über achtzehn Jahre. Allein die anderen Gesellen gönnten Imrich die Gunst seines Meisters nicht. Sie ersannen alle möglichen Spottnamen für ihn und reizten ihn, so dass es zu Streitigkeiten, ja sogar zu Schlägereien kam. Endlich blieb dem Meister nichts übrig, als Imrich zu entlassen. Seit jenem Tage begann für ihn das Leben auf der Landstraße – er konnte nirgends mehr festen Fuß fassen. Zum Militär nahmen sie ihn seines Gebrechens wegen nicht. Nachdem er mehrere Jahre solch ein Landstreicher gewesen, hatte er sich den Scherenschleifern angeschlossen und mit Weltschow gelebt. Und obwohl es ein elendes, armseliges Leben gewesen, war er wenigstens nicht mehr allein. Er hatte doch etwas von der Wärme des Familienlebens empfunden. Heute ging es ihm äußerlich besser, er fing an, sich den anderen Menschen zu nähern und ihnen zu gleichen, aber diese furchtbare Einsamkeit und Verlassenheit, für die der Mensch nicht geschaffen ist, bedrückte ihn. Wenn er namentlich des Nachts nichts anderes vernahm als seine eigenen Atemzüge, dann ward es ihm in seiner Verlassenheit so traurig, ach so traurig zumute!
Eines Tages trug er seine frisch geschliffenen Messer nach L. und fand die Bäuerin, der sie gehörten, in großer Entrüstung. Der Hund hatte ihr alle Kartoffeln aufgefressen, die sie für ihre Schweinchen zugerichtet hatte. „Wenn es wenigstens noch mein eigener Hund wäre!“ klagte sie ihm in ihrer Erbitterung. „Aber solch ein hergelaufener Landstreicher! Den Winter über habe ich ihn aus Mitleid hier gelassen, er hat mir leidgetan, denn bei solchem Unwetter erbarmt einen ja auch die stumme Kreatur. Seit dem Frühjahr habe ich ihn schon drei Grenzraine weit fortgejagt – und immer wieder kommt er daher und richtet nur Schaden an!“ Der angeklagte Missetäter stand in der Nähe und spitzte die Ohren, wedelte mit dem Schwänze und blickte bald die Bäuerin, bald den fremden Zuhörer erwartungsvoll an.
„Ein Landstreicher!“ tönte es Imrich in den Ohren. Jener wohlbekannte Name, der ihn durchs Leben begleitete.
„Ärgert euch nicht, Bäuerin!“ suchte er die Erzürnte zu beruhigen. „Gebt mir ein Stückchen Brot, damit ich Zahraj fortlocken kann. Ich will ihn mit mir nehmen. Hrabowa liegt noch weiter, von da wird er nicht zurückkommen.“
Die Frau willigte gerne ein. Sie gab dem Schleifer und auch dem Hunde eine gute Mahlzeit, damit jener nicht hungrig aus ihrem Hause ginge, und blickte ihnen durchs Fenster nach, wie sie gemeinsam das Dorf verließen.
Aber Imrich jagte den Hund nicht über den vierten Grenzrain. Als Zahraj in seiner Hütte vertrauensvoll zu seinen Füßen kauerte, beugte er sich zu ihm herab und sagte, als ob der Hund ihn verstehen könnte: „Auch du gehörst niemandem zu, so wie ich, wir wollen beisammenbleiben!“ Und sie blieben beisammen.
Und sie vertrugen sich gut! Gab es etwas zu essen, dann aßen sie sich satt, und war einmal nichts da, dann waren sie auch zufrieden. Zahraj gehorchte seinem Herrn und tat alles, was er ihm nur von den Augen absehen konnte. Das Tier fühlte es, dass dieser Mensch es liebgewonnen hatte, und der Mensch fühlte, dass das Tier an ihm hing. Nun war wenigstens jemand da, der Onkel Imrich willkommen hieß, wenn er mit seiner Arbeit heimkehrte. Das war ein Gebell, ein Springen! Ach, der Hund wusste gar nicht, was er vor Freude tun sollte! Und das einsame, von Menschen verstoßene Herz, das oft wie ein harter Stein gewesen, begann aufzuleben und wärmer zu schlagen. Zwar war es nicht das, wonach sich der Knabe und später der Jüngling so heiß gesehnt hatte, es konnte weder sättigen noch den schmerzlichen Durst stillen, aber es waren doch wenigstens Brosamen, wenigstens Tröpfchen …
*
Im Herbst bekam Imrich den Auftrag, die Sägen und Äxte der Holzfäller zu schleifen. Sie hatten ihn dazu in den Wald gerufen, wo sie gerade arbeiteten, und gaben ihm für seine Arbeit allerlei Holzabfälle. Als sie dann mit ihrem Bauholz zu Tale fuhren, nahmen sie ihm auch sein Bündel bis zur Hütte des Waldhüters mit, von wo er es dann bequem heimtragen konnte. Einem der Holzfäller hatte er die Uhr repariert und dieser, ein Maurer, hatte ihm dafür den alten Sparherd und den noch älteren Kachelofen in seiner Hütte umgebaut, so dass die beiden einsamen Bewohner, als die kalten Winde wehten und der erste Schnee fiel, sich glücklich priesen, dass sie hübsch im Warmen sitzen durften. Die Leute brachten dem Schleifer und Uhrmacher Arbeit genug, er selbst hatte sich auch aus den umliegenden Dörfern allerlei Reparaturen heimgebracht, so dass er mehr als zwei Wochen das Haus nicht zu verlassen brauchte. Unter diesen Reparaturen aus der Umgebung war auch eine große alte Uhr, deren Gläser und Verzierungen sorgfältig in Papier eingehüllt waren, damit nichts zerbrochen würde. Imrich ordnete und glättete das Papier. Er war froh, dass er hier endlich einmal etwas zu lesen bekam, die Glücksbriefchen des Mäuselmanns und Weltschows altes, schon ganz zerrissenes Gebetbuch waren das letzte gewesen. Dies hier war schönes, weißes Papier mit deutlichem Druck – es musste irgendetwas Heiliges sein, denn es war viel von Gott und seinem lieben Sohn, dem Herrn Jesus Christus, die Rede. Von diesem hatte Weltschow in seiner letzten Krankheit auch gerne gesprochen und nur bedauert, dass er so wenig von ihm wusste.
„Vielleicht kann ich hier etwas über ihn erfahren“, dachte Imrich. Und er las wirklich etwas sehr Schönes, von jenem Schächer, der dort am Kreuze zur Rechten des Sohnes Gottes gehangen und sein schmerzvolles Sterben mit angesehen hatte. Imrich wusste noch von der Schule her, dass der Sohn Gottes am Kreuze gestorben und dass er unschuldig gewesen war. Hier erfuhr er aber mit einem Male, dass der Heiland für solche verlorenen Menschen gestorben, wie jene beiden waren, die nun zu seiner Rechten und zu seiner Linken hingen. Nur eines war ihm sehr verwunderlich: es war, als ob der Mensch, der dies hier geschrieben, sein, Imrichs ganzes bisheriges Leben geschildert hätte. Auch diesen Schächer hatte niemand liebgehabt. Er war immer zurückgesetzt worden – bis er zum Schluss ein Landstreicher wurde und unter Räuber geriet.
In seiner Kindheit hatte er sich immer geprügelt, und als er herangewachsen war, hatte er gestohlen und gemordet – und da hatten sie ihn festgenommen und an dies Kreuz gehängt. Solch ein Tod stand ihm bevor von den Menschen. Aber welch ein Lohn erwartete seine elende, sündige Seele, die nun vor Gott treten sollte?! Hier stand geschrieben, wie rein und heilig, wie gut, aber auch wie gerecht Gott ist! Und dann stand hier von Jesus Christus geschrieben, welch eine Herrlichkeit bei Gott er verlassen hatte, bevor er auf diese Welt gekommen, wie er auf Erden umhergegangen war und wohlgetan, wie er an Heiligkeit Gott geglichen – und doch hing er hier neben jenen Übeltätern – er, der Reine, Unschuldige! Aber, so stand hier: „Da wir noch Sünder waren, ist Christus für uns Gottlose gestorben.“ Also, für solche, wie jene beiden Schächer waren, und wie wir Leute auf Erden sind. Imrich konnte sich von diesem Blatt gar nicht trennen – nur schade, dass die Menschen ihn störten und die Arbeit rief. Er freute sich, dass der nächste Tag ein Sonntag war, diesen wollte er ganz dem Lesen widmen. Das tat er auch. Aber es ging sehr langsam, denn er musste erstens die Worte langsam zusammensetzen und dann über das Gelesene lange nachdenken.
Aber ach – wer beschreibt seinen Kummer? Das Ende der Geschichte war in den Papieren nicht zu finden, er konnte nicht zu Ende lesen, was der Sohn Gottes mit den Worten gemeint hatte: „Heute wirst du mit mir im Paradiese sein.“ – Lange saß der einsame Mann ganz traurig da, die zusammengefalteten Papiere vor sich auf dem Tisch. Er beachtete kaum, dass Zahraj anschlug und bellte, dass jemand vor der Tür den Schnee abschüttelte und die Schuhe reinigte; er blickte erst auf, als sich die Tür öffnete und ein lauter Gruß ihn störte. Ein junger Mann in städtischem Pelz stand in seiner Stube. Der verwunderte Scherenschleifer erhob sich, um ihn zu begrüßen.
„Verzeihen Sie, dass ich Sie beim Lesen störe“, entschuldigte sich der Ankömmling. „Ich habe noch einige Kilometer Weges vor mir, und als ich aus Ihrem Kamin Rauch aufsteigen sah, sehnte ich mich danach, mich ein wenig zu erwärmen, was Sie mir hoffentlich erlauben werden?“
„O wärmen Sie sich nur, aber legen Sie den Pelz und die Gummischuhe ab“, erwiderte Imrich. Ein Weilchen später saß der unerwartete Gast am Tisch, zog eine Thermosflasche und einen Trinkbecher sowie ein Stück weißes Gebäck hervor und bat um die Erlaubnis, essen zu dürfen, weil er schon tüchtig hungrig sei. Dabei erzählte er, wohin er gehen wolle. Als er satt war, bemerkte er, dass seine Flasche noch zur Hälfte voll war. Fröhlich nötigte er Imrich, den Kaffee auszutrinken, da er ihn nicht mittragen wollte. Wo er hinkäme, brauche er nichts, da er erwartet würde. Onkel Imrich musste sich sein Töpfchen holen und trinken, und auch für Zahraj blieb noch etwas Kaffee und Küchen übrig. Inzwischen betrachtete der Gast die Uhr und nahm auch die Zeitung zur Hand. „Was haben Sie denn da? Das scheint ja ein christliches Blatt zu sein? Der, welcher die Uhr hineingewickelt hat, schätzt es wohl nicht sehr.“
„Wohl kaum, mein Herr, aber ich lobe es um so mehr“, seufzte Imrich. „Niemals hätte ich so etwas Schönes gelesen, wäre es mir nicht ins Haus gekommen. Aber es ist sehr, sehr schade, dass das Ende fehlt, und so werde ich es niemals erfahren.“
„Darüber brauchen Sie nicht zu trauern, dem können wir abhelfen.“ Der Gast zog aus seiner Brusttasche eine reine Postkarte mit Freimarken hervor und setzte sich wieder an den Tisch. „Haben Sie in Hrabowa eine Post?“
„Ja“, entgegnete Imrich verwundert.
„Wie ist Ihr Name?“
„Imrich Kamenar.“
Der Gast schrieb ein Weilchen. „So, das nehmen Sie mit aufs Postamt! In einigen Tagen haben Sie alle Nummern dieses Jahrgangs hier, damit können Sie sich den Winter über die Zeit vertreiben, wenn Ihnen das Blatt so gut gefällt.“
„Aber das ist sicher teuer, umsonst werden die Leute das Blatt nicht versenden, und ich habe kein Geld.“
„Es kostet nur 12 Kronen im Jahre, fürchten Sie sich nicht, ich will es für Sie bezahlen.“
Wer hätte das Imrich gesagt, welch eine Freude ihn noch an diesem Sonntage erwartete! Er konnte es kaum glauben, dass die Zeitung wirklich kommen würde, aber der gute, freundliche Herr sah doch nicht danach aus, als ob er ihn nur zum Besten halten wollte. Seine Hoffnung betrog ihn nicht. Ein paar Tage später kam ein ganzes Päckchen jener Zeitungen, und auch jener Artikel von dem Schächer war dabei. Nun konnte er doch noch das Ende und viel Gutes und Schönes außerdem lesen. Es war, als wäre mit diesen Zeitungen neues Leben in das Hüttlein gekommen. Ach, es gibt keinen besseren Freund, als ein gutes Buch, namentlich für einsame Menschen.
Die Leute bezahlten ihren Schleifer nicht mit Geld, denn sie hatten selbst keines, sondern die Bäuerinnen gaben ihm Fett, Metzelsuppe, Sauerkraut und andere gute Dinge. Onkel Imrich musste seine Zeit nicht mit Kochen versäumen, er brauchte das Essen nur aufzuwärmen; so fand er manche freie Stunde zum Lesen. Zahraj lebte in diesen Tagen ordentlich auf. Sein Fell wurde dichter und bekam neuen Glanz, wäre er nicht schon an der Schnauze grau gewesen, so hätte man ihn für einen jungen Hund halten können. Nur eines erschien ihm ganz verwunderlich, und er konnte es mit seinem Hundekopf nicht begreifen, dass gerade jetzt, wo es ihnen beiden doch so gut ging, sein Herr oft so traurig war. Gar oft hörte er ihn seufzen, zweimal sogar weinen – was mochte ihm nur fehlen? Jede Augenoperation ist schwer, aber am schwersten ist es wohl, wenn der Vater des ewigen Lichtes einem Menschenkinde die geistlichen Augen öffnet.