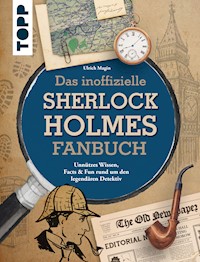12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei packende Thriller in einem E-Book.
Die Lava.
Explosiv - Eine Vulkan-Katastrophe in der Eifel. Im 2. Weltkrieg ist ein britischer Bomber in den Laacher See in der Eifel gestürzt. An Bord: Bomben mit einem Bakterium, das sich bei hohen Temperaturen vermehrt und absolut tödlich ist. Jeder Versuch, die Bomben zu bergen, ist bislang gescheitert. Nun droht der Vulkan unter dem See wieder aktiv zu werden. Joe Hutter, ein britischer Experte, arbeitet mit der Vulkanologin Franziska Jansen fieberhaft an der Lokalisierung der Bomben. Das Projekt läuft unter strengster Geheimhaltung, doch noch eine andere Macht ist an den Waffen interessiert ...
Ein Thriller über eine Katastrophe, die schnell zur Wirklichkeit werden könnte.
Der Fisch.
Der Tod lauert im Bodensee. Taucher verschwinden spurlos, eine Fähre sinkt unter mysteriösen Umständen. Carl, der am Bodensee forscht, entdeckt auf dem Echolot etwas, das er für einen riesigen Fisch hält. Als er seine Entdeckung veröffentlichen will, stellt man ihn kalt. Mit einer Journalistin ermittelt er im Geheimen weiter. Anscheinend treibt im Bodensee ein Seeungeheuer sein Unwesen. Doch wo kommt es her? Und was hat es vor? Als Carl die Wahrheit erkennt, ist es fast zu spät, um die Katastrophe noch abzuwenden ...
Ein Öko-Thriller - packend und beklemmend zugleich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 858
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Informationen zum Buch
Die Lava:
Explosiv: Eine Vulkan-Katastrophe in der Eifel.
Im 2. Weltkrieg ist ein britischer Bomber in den Laacher See in der Eifel gestürzt. An Bord: Bomben mit einem Bakterium, das sich bei hohen Temperaturen vermehrt und absolut tödlich ist. Jeder Versuch, die Bomben zu bergen, ist bislang gescheitert. Nun droht der Vulkan unter dem See wieder aktiv zu werden. Joe Hutter, ein britischer Experte, arbeitet mit der Vulkanologin Franziska Jansen fieberhaft an der Lokalisierung der Bomben. Das Projekt läuft unter strengster Geheimhaltung, doch noch eine andere Macht ist an den Waffen interessiert. Ein Thriller über eine Katastrophe, die schnell zur Wirklichkeit werden könnte.
Der Fisch:
Der Tod lauert im Bodensee
Taucher verschwinden spurlos, eine Fähre sinkt unter mysteriösen Umständen. Carl Ghuimin, der am Bodensee forscht, entdeckt auf dem Echolot etwas, das er für einen riesigen Fisch hält. Als er seine Entdeckung veröffentlichen will, stellt man ihn kalt. Mit einer Journalistin ermittelt er im Geheimen weiter. Anscheinend treibt im Bodensee ein Seeungeheuer sein Unwesen. Doch wo kommt es her? Und was hat es vor? Als Carl die Wahrheit erkennt, ist es fast zu spät, um die Katastrophe noch abzuwenden. Ein Öko-Thriller – packend und beklemmend zugleich.
Informationen zum Autor
Ulrich Magin, Jahrgang 1962, ist Sprachwissenschaftler und lebt in Stuttgart. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich mit Geschichten über Seeungeheuer, mit der Historie des Bodensees und den Veränderungen des Öko-Systems. Als Aufbau Taschenbuch erschien von ihm bisher "Der Fisch".
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTER DER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Ulrich Magin
Die Lava & Der Fisch
Zwei Thriller in einem E-Book
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Informationen zum Autor
Die Lava
August 1942
Teil I
1
2
3
4
Teil II
1
2
3
4
5
Teil III
1
2
3
4
Morgen
Nachbearbeitung: Fakten und Fiktionen
Die Halifax
Die Suche nach dem Wrack
Der Vulkan
Gruinard Island
Danksagung
Der Fisch
Prolog
8. September
4. Oktober
1. Teil - Fische
1 - 21. März
2 - 26. März
2. Teil - Lichter
3 - 4. Mai
4 - 23. Mai
3. Teil Stille
5 - 25. Mai
6 - 26. Mai
4. Teil - Vorbereitungen
7 - 27. Mai
8 - 28. Mai
5. - Teil - 0811
9 - 29. Mai
10 - 1. Juni
6. Teil - Jagd
11 - 2. Juni
12 - 3. Juni
7. Teil - Die Tiefe
13 - 4. Juni
14 - 5. Juni
Epilog
10 Jahre später, Sommer
Dank
Lesetipps
Impressum
Weitere E-Book Sammelbände von Aufbau Digital:
Orientierungsmarken
Cover
Inhaltsverzeichnis
Die Lava
Der Fisch
Impressum
Ulrich Magin
Die Lava
Thriller
Erneut
für Susanne
und meine Eltern
in Liebe
Was ist aus der Leiche geworden,
die du letztes Jahr gepflanzt hast?
Blüht sie schon?
(Thomas Sterne Eliot: The Waste Land)
August 1942
Die Wogen des Atlantiks rollten träge heran und brachen sich mit lautem Donnern an den schwarzen, mit Seetang überwucherten und mit kleinen Muscheln verkrusteten Klippen der Insel. Das Tosen der Brecher war noch auf dem Festland zu hören, es klang wie lauter Kanonendonner des Krieges. Seemöwen kreisten und schrien, und zwischen den Donnerschlägen hörte man das Blöken der achtzig Schafe.
Wind zog auf, eine starke Brise, und fegte den Morgennebel fort. Die Insel war nicht eben groß, man konnte sie in etwa einer Stunde bequem zu Fuß umrunden, sie hob sich auch kaum über die See. Ein paar wenige verkrüppelte, von den heftigen Böen gebeugte Bäume und Sträucher krallten sich in den Moorboden zwischen Gneis- und Granitfelsen, auf denen Flechten wucherten, graublau und feucht. Die Rinde der Bäume war noch ganz schwarz von der Nässe des Nebels. Gras bedeckte den Boden, und auf dem Gras weideten die Schafe.
Ein winziges Eiland, aber es lag dennoch ideal: weitab von größeren Städten, es gab nicht einmal ein Dorf in der Nähe, hier, so weit oben im Norden. Den Einheimischen galt es seit Jahrhunderten als verwunschen. Es sollte dort spuken, der einbeinige Seemann ging um und der große schwarze Hund mit den Augen, die glühten, als wären sie aus feurigen Kohlestücken. Einer wollte sogar den Todesengel gesehen haben, wie er in einer stürmischen Nacht seine Schwingen über die Insel breitete, aber das war ein Säufer gewesen.
Selten verirrte sich ein Fischer auf das Eiland, um eine Robbe zu schlagen oder Schutz vor einem plötzlichen Sturm zu suchen. Zwei Wochen zuvor war ein Hütehund, der Collie des alten Patrick Grant, zur Insel geschwommen und nicht wieder zurückgekehrt. Dann reisten zwei Leute an, Uniformierte, aus London, wie man hörte, und die Regierung hatte Grant entschädigt; die beiden redeten lange mit ihm, worüber, dazu schwieg er. Und dann waren die Warntafeln aufgestellt worden. Nun standen Schilder in regelmäßigen Abständen am Ufer, die das Betreten verboten. Ein Wachposten ging den immer gleichen Kreis entlang der Küste, um aufzupassen.
Gruinard Island lag inmitten der sanften gleichnamigen Bucht, ein schwarzer, mit grünen Tupfern bedeckter Fleck in der See. Am Festlandufer saßen ebenfalls Wachposten, die Maschinengewehre im Arm, und entlang der Küste wusste man, dass man sich besser nicht näherte oder nachfragte, was auf der Insel geschah. Es war wichtig, und das musste reichen. Wichtig war vieles jetzt im Krieg, und auch in Schottland fürchtete man deutsche Angriffe oder eine Invasion der Hunnen, und wenn der kleine Fleck Erde dazu beitrug, den wahnsinnigen Diktator von Schottland fernzuhalten, dann war das besser so.
Die Männer nahmen das Donnern der Brandung und das Rauschen der Wogen längst nicht mehr wahr, wie das Möwengekreische stellte es die gewohnte Kulisse dar. Aber ihre feinen Ohren bemerkten sofort, wenn ein Schaf nicht mehr blökte. Darauf achteten sie. In ihren schweren Schutzanzügen bewegten sie sich langsam und gebeugt wie vorsintflutliche Ungeheuer über das von der Sonne ausgedorrte Gras der Insel, das noch feucht vom Morgennebel war. Sie gingen vorbei an den Holzpflöcken, an denen die Reste der zerborstenen Metallhülsen baumelten. Mit einer großen Zange griff einer von ihnen nach einem Schafskadaver, hob ihn an und legte ihn vorsichtig zu den anderen auf den kleinen Holzkarren, den sein Hintermann zog. Ein dritter nahm ein Notizheft und trug fein säuberlich die Nummer des Schafs und den mutmaßlichen Todeszeitpunkt ein. Man konnte nicht immer anwesend sein, wenn es passierte, selbst wenn man wusste, dass es passierte. Manche tote Schafe fand man zufällig, weil sie sich zum Sterben hinter einen Felsen zurückgezogen hatten oder weil man nicht erkannt hatte, dass es bald soweit sein könnte. Es gab über achtzig Schafe.
Aber die sorgsamen Notizen waren wichtig. Jedes Schaf musste eingetragen werden, denn nicht alle erhielten dieselbe Dosis.
Es stank grässlich nach verbranntem Fleisch. Die drei Männer näherten sich schweigend dem Scheiterhaufen, der seit mehreren Tagen in einer Mulde neben der höchsten Erhebung der Insel brannte wie ein Signalfeuer für Seeleute, die den Kurs verloren haben. Sie kippten mit gemeinsamen Kräften den Karren um; ein eingeübter, oft erledigter Arbeitsgang. Die Ladung aus Tierkadavern ergoss sich in die Flammen. Eine Möwe ließ sich auf einem der toten Schafe nieder und begann, in eine frische, offene Wunde zu picken, stob aber auf und flog davon, als ihr das Feuer zu nahe kam. Sie gesellte sich zu den anderen ihrer Schar, die kreischend weite Kreise über dem Meer zogen.
Der erste Mann gab den anderen ein Signal, und alle drei drehten der Qualmsäule den Rücken zu.
Wenn das so weitergeht, wird es Zeit, dachte der Mann mit dem Notizblock, dass unsere Spezialanfertigungen endlich eintreffen. Wir brauchen bald die Verbrennungsöfen.
Die Männer gingen bedächtig bis zu der Seite der Insel, die dem Festland zugewandt war, und luden dort ein weiteres verendetes Tier auf den Karren. Es blickte sie seltsam gläsern an, es musste eben gerade gestorben sein. So viele waren es an einem einzigen Tag noch nie gewesen! Der eine Mann schüttelte verwundert den Kopf, zog seinen Block hervor, schrieb die Nummer ab, die mit blauer Farbe auf das Schaffell gemalt worden war, und trug das Sterbedatum und die Uhrzeit ein. Wieder wandten die Arbeiter sich der Säule aus Feuer und Rauch zu, die wie ein Wegweiser über ihnen stand. Die Räder des Karrens versanken in einem Schlammloch, doch zu dritt schafften sie es, das Fuhrwerk wieder flott zu machen und zum Inselberg zu ziehen, zum Scheiterhaufen.
Sie kippten das Schaf auf den brennenden Holzstapel. Es fing Feuer, sein Kopf trennte sich vom Körper und rollte den Haufen hinab. Einer der Männer trat ihn mit dem linken Fuß in die Flammen zurück.
Er spähte nach oben in den Himmel und meinte, heute könne trotz des Nieselregens doch noch ein schöner Tag werden, gut, um abends angeln zu gehen, da sah er, dass die beiden anderen entsetzt in die bleckenden Flammen starrten.
»What’s that?«
Der Mann im Schutzanzug prallte förmlich zurück vor dem, was er sah.
Etwas geschah, was ihre schon ungewöhnliche Arbeit noch ungewöhnlicher machte.
Das Schaf verfärbte sich, nicht schwarz, wie die anderen Schafe, nicht aschgrau, nein, es durchlief alle Regenbogenfarben; die Sehnen und Muskeln, das Fell und der Kopf schäumten auf und vernichteten sich in einem Augenblick selbst. Es sah so aus, als stülpe sich das tote Tier von innen nach außen, als explodiere es und als würde gleichzeitig das Äußere nach innen gezogen.
Derjenige der Männer, der zuvor alle Tode in sein Notizbuch eingetragen hatte, holte mühsam eine Kamera mit Farbfilm aus seinem Umhang, um die Szene zu dokumentieren. Die Kamera schnurrte wie eine Katze, die sich auf dem Kaminsims ausruht, und fing die Bilder ein, die sich vor ihr abspielten. Möwen lachten.
»Wir müssen hier weg!«
»Wir müssen Vollum verständigen!«
»Was geschieht hier?«
Was immer sich vor ihren Augen abspielte – es war kein Milzbrand.
Der Mann mit der Kamera eilte, so schnell er konnte, auf einen kleinen Schuppen zu, um zum Feldtelefon zu gelangen. Doch er kam dort nicht an.
Er röchelte, er stolperte, er fiel auf den Moorboden, mitten in eine Pfütze, zuckte noch, aber eher automatisch, nicht so, als sei noch Leben in ihm, dann sackte sein Schutzanzug in sich zusammen.
Als einer der wachhabenden Soldaten ihn wenig später fand, konnte er die flachen Überreste der beiden anderen sehen, auf dem Boden ausgestreckt, nicht weit von dem ersten Mann entfernt. Dann begann auch er zu husten, er krümmte sich, hielt sich den Bauch, stürzte zu Boden und schlug auf einem Gneisbrocken auf. Der war scharfkantig genug, um seinen Schutzanzug zu zerreißen, doch da war längst nichts mehr im Schutzanzug, was auf den Soldaten hingedeutet hätte, und auch der Schutzanzug zerfraß sich wie von selbst.
Am Horizont bauschten sich große, graue Wolkenberge auf, eine Wand aus triefend nasser Wolle, ein weiterer Ausläufer eines Atlantiktiefs, das seine Fluten auf die Insel entladen sollte. Die Möwen zogen aufs offene Meer, und weiter draußen sprang ein Delfin aus den Wogen, bis er ganz über dem Wasser war, drehte sich dann und glitt in die Meerestiefen zurück. Die Schafe spürten das aufziehende Unwetter und drängten sich dichter zusammen. Sie blökten ängstlich, als der erste Blitz durch den schwarzen Himmel fuhr.
Die Ablösung der Mannschaft kam, als der Regen aufhörte.
TEIL I
Die Erde wirft Blasen wie das Wasser.
(William Shakespeare: Macbeth)
1
Heute
Der Laacher See, ein stilles Gewässer am östlichen Rande der nördlichen Eifel, imponiert nicht durch seine Größe, wie etwa der Bodensee oder der Genfer See, er beeindruckt auch nicht durch grandiose, steil ins Wasser abfallende Klippen oder schroffe Berge wie der Gardasee oder der Comer See – dennoch weisen seine fast kreisrunde Form und die ihn sanft und grün umringenden Hügel eine ganz eigene Magie auf, und die malerisch an seinem Ufer gelegene mittelalterliche Benediktinerabtei zieht wie ein Magnet jeden Tag zahllose Ausflugstouristen an.
Vor rund eintausend Jahren wurde das Kloster gegründet, von Mönchen, die hier Abgeschiedenheit und Ruhe suchten. Einsamkeit und Stille herrschen noch heute, vor allem spät am Abend und früh am Morgen – kein Dorf säumt die Ufer, und am Rand des Sees führt nur ein Fußweg, keine Straße entlang.
Eigentlich der perfekte Ort, um gestresste Manager zu entspannen – und doch: Dieses stille Wasser trog tatsächlich, und in der Tiefe lauerte ein Ungeheuer, gefährlicher als eine Atombombe, unberechenbar wie ein Steppenbrand.
Genauer betrachtet: zwei Ungeheuer. Von beiden ahnten die Menschen nichts, die verträumt den Uferweg entlang spazierten, das romanische Gebäude besichtigten oder sich darüber aufregten, dass es von Amts wegen verboten wurde, auf dem See Tretboot zu fahren.
Gott würfelt nicht, hatte Albert Einstein einmal so treffend bemerkt. Aber er spielt gern mit Feuer: Der Erdboden, auf dem wir stehen, ist nur eine dünne Kruste, die zerbrechlich auf einem glutflüssigen Kern schwimmt. Und an manchen Stellen wallt das geschmolzene Gestein nach oben, mit verheerenden Folgen.
Einer dieser Orte war der Laacher See.
Seit zehn Jahrtausenden füllte Wasser den Trichter, den ein explodierter Berg hinterlassen hatte. Seit zehn Jahrtausenden sammelte sich Sediment im See.
Sand, den der Regen in den See schwemmte, Asche von Waldbränden, Blüten, Blätter und Zweige rieselten zu Boden. Wenn im Frühling das Eis schmolz, das im Winter die Oberfläche des Sees überzog, fiel ein Regen aus feinem Staub zum Seegrund herab. Mal verlor ein Mönch seinen Angelhaken, mal ein Besucher einen Knopf. Der See bewahrte alles auf.
Der Regen aus Staub, Sand, Ton und organischem Material bildete feine Schichten, die sich wie die Ringe eines Baumes eine nach der anderen auf dem Seegrund ablagerten. Anhand der Blütenpollen zeigten sie selbst die Jahreszeiten an, in denen sie entstanden waren. Den Boden des Sees stellte so eine im Verlauf von Jahrtausenden gewachsene unebene, graue und einförmige Fläche dar.
Dennoch war diese stille, geduldige, scheinbar unerschütterliche Beständigkeit und Einförmigkeit nur eine Seite der Medaille.
Denn aus einer großen, mit zähflüssigem, heißem Gestein gefüllten Kammer, keine vierzig Kilometer unter der Nordosteifel, drückte sich Magma langsam nach oben, quälte sich in Schründe und Klüfte, fraß das harte Gestein weg und nagte sich immer weiter in Richtung Erdoberfläche.
Fünf Meter unter dem Seespiegel erzitterte der Hang, winzige Gasblasen quollen aus dem Sand und blubberten nach oben. Ein kleiner Kiesel, gerade so groß wie das vordere Glied eines Daumens, löste sich vom Untergrund und rollte die Schräge hinab, riss einige welke Blätter mit sich, erzeugte ein feines Sandrieseln, eine Lawine im Miniaturformat, die langsam, aber stetig den flachen Abhang hinunter in die Tiefe floss, dabei noch mehr Sand und noch mehr Kiesel, schließlich auch handtellergroße Steine mit sich schleifte. Schlamm, Lehm und Ton verteilten sich wie eine gewaltige, träge Wolke.
Unten am Boden setzte sich diese Wolke – der Sand in Minuten, der feine Schlamm erst nach Stunden – und bedeckte den Grund mit einer mehrere Zentimeter starken Schicht.
Oben, dort, wo die Lawine ihren Ursprung hatte, erzitterte der Schlamm wie ein Wackelpudding, dann platzte er auf, und aus dem Riss stiegen weitere Gasblasen auf. Wasser, das vom heißen Magma zum Kochen gebracht worden war, wellte aus dem Grund heraus, schließlich wühlte es sich aus einem trichterförmigen Loch, sickerte allmählich in den See und verteilte sich dort.
All das war nur ein weiteres Anzeichen für den Hot Spot, eine besonders heiße Stelle im flüssigen Magmakern der Erde. In Jahrmillionen schieben sich die Kontinentalplatten auf ihrem Weg über den Globus über solche Hot Spots. Diese erhitzen wie ein Bunsenbrenner das Gestein, das über sie gewälzt wird, bis es so dünn ist, dass sich das Erdinnere nach außen stülpt und ein Vulkan ausbricht.
Dieser Hot Spot hatte bereits eine lange Spur der Verwüstung hinter sich gelassen, von den Karpaten über das Riesen- und das Erzgebirge, das Fichtelgebirge, die Rhön und den Vogelsberg bis zum Siebengebirge am Rhein. Vor 13 000 Jahren war der Laacher See, ein Supervulkan, in einer der gewaltigsten Explosionen in der Geschichte der Menschheit geborsten, und noch viertausend Jahre später brach ein Vulkan dort aus, wo sich heute das Maar von Ulmen befindet.
Und gerade eben, in diesem Augenblick, bereitete sich der Laacher See mit der ihm eigenen, von den Geologen in Jahrtausenden gemessenen Geschwindigkeit auf eine neue Eruption vor.
Sicher, in der vergangenen Nacht hatte heftig die Erde gebebt, so heftig wie seit Menschengedenken nicht mehr, und die Anrainer aus ihrem wohlverdienten Schlaf gerissen. Und dennoch ahnten die Menschen nichts von den Vorgängen unter ihren Füßen. Sie schlenderten den Uferweg entlang, fütterten die Enten mit Brotresten, blinzelten müde in die Sonne, saßen auf Holzbänken und blickten schläfrig auf das Wasser, stiegen aus Bussen und Autos, erzählten, scherzten, küssten sich oder stritten sich, joggten oder lasen Zeitung – ganz gleich, was sie gerade taten, an einem zweifelten sie alle nicht: dass der Laacher See ein stilles, idyllisches, friedliches Gewässer war.
Manche Katastrophen brechen plötzlich herein, ohne Vorwarnung.
Franziska Jansen war die Jüngste und erst seit kurzem in der Fachschaft gewesen. Sie hatte als Erste gehen müssen. Die Uni wollte Elite-Uni werden – mit marktorientierter Forschung. Wer braucht da eine Vulkanologin, die gerade erst ein halbes Jahr zuvor das Studium abgeschlossen hatte? Also wurde sie entlassen.
Sie durchlief die üblichen Stadien: Verzweiflung, Trauer, dann friedvolle Akzeptanz des Zustands, schließlich vorsichtig skeptischer Optimismus. Es dauerte über sechs Monate, bis sie wieder das Gefühl hatte, auf eigenen Beinen zu stehen.
Dann merkte sie, dass sie schwanger war. Und noch während der Schwangerschaft fand sie heraus, dass sie die Hormone zwar betäuben, nicht aber darüber hinwegtäuschen konnten, dass sie und der Vater ihres Kindes viel zu unterschiedliche Vorstellungen über ein gemeinsames Leben hatten. Sie entdeckte, dass die Überstunden ihres Mannes mit einer Kollegin tatsächlich stattfanden, aber sich meistens in der Horizontalen abspielten. Dann kamen die geheimnisvollen Anrufe, die Frau, die sich angeblich verwählt hatte, wenn sie ans Telefon ging, unverhoffte Geschäftstermine ihres Partners, seine stockenden, ausweichenden Entschuldigungen.
Als ihre Tochter Clara auf die Welt kam, war Franziska wieder allein.
Mittlerweile war Clara ein kluges, artiges, aufgewecktes Mädchen – vielleicht sogar zu artig; sicher weil Franziska ihre ganze Liebe und Aufmerksamkeit ausschließlich ihr gewidmet hatte.
Nach ihrer Entlassung stand Franziska erst einmal auf der Straße. Einer Vulkanologin stehen nicht allzu viele Arbeitsplätze zur Verfügung, und wer nicht so abenteuerlustig war, nach Mittel- oder Südamerika oder Afrika zu gehen – und mit einem sechs Monate alten Kind ist man selten abenteuerlustig –, der kann nur darauf hoffen, dass irgendwo an einer der wenigen Universitäten in Deutschland etwas frei wird. Oder in der Privatwirtschaft – Franziskas Chance war ein Vulkanpark, der Forschung, Tourismus und Entertainment verband, das ScienceCenter Eifel.
Sie hatte den Job angenommen, weil er sich gerade bot; sie durfte nicht allzu wählerisch sein. Überhaupt fand sie es am einfachsten, sich treiben zu lassen, abzuwarten, bis eine Chance sich bot. Und die Kraft, die alle anderen dafür verbrauchten, Pläne zu schmieden, die dann doch misslangen, weil man eben nicht alles beeinflussen kann, nutzte sie dazu, Möglichkeiten optimal zu ergreifen.
Seit viereinhalb Jahren arbeitete Franziska nun im Science-Center. Sie mochte ihren Job und erledigte ihre Aufgaben gewissenhaft und gern. Sie fühlte sich wohl. Hier forschten Geologen und Vulkanologen, aber ein großer Teil ihrer Tätigkeit bestand darin, den Touristen die Eifelvulkane näherzubringen. Dafür flossen Mittel von Bund und Ländern, es war eine der typischen Ehen, die Wissenschaftler mit dem Kommerz eingehen, um forschen zu können.
Also führte Franziska – neben ihrer eigentlichen, wissenschaftlichen Arbeit über den letzten großen Ausbruch des Laacher Sees – Touristen durch die Eifel. Eine Tour umfasste gewöhnlich den Besuch der drei Gmündener Maare, dann das Pulver- oder Totenmaar mit seiner romantisch am See gelegenen weißgetünchten Kapelle, den Geysir von Wallenborn und schließlich als Höhepunkt den Laacher See. Wie oft schon hatte sie den Touristen erklärt, dass der See kein Maar war – ein Maar ist das Ergebnis einer unterirdischen Verpuffung von Wasser, die den darüber liegenden Boden in die Luft sprengt. Ein Maar sitzt deshalb nicht oben auf einem Berg wie ein Krater, sondern liegt wie von einer Backform ausgestanzt vertieft in der Ebene. Der Laacher See aber war nicht einmal ein Kratersee, sondern eine Caldera – hier war ein mächtiger Berg, größer als der Vesuv, im Verlaufe einer einzigen, ungeheueren Eruption explodiert! Der Laacher See, so friedlich und beschaulich, war ein richtiges Monster, das unter dem Boden schlummerte. Wir laufen hier, pflegte sie zu sagen, auf einer dünnen Eisschicht, die jederzeit brechen kann. Und dann deutete sie jedes Mal auf das Blubbern im See. Auch wenn die meisten Menschen den Unterschied zwischen Maar, Kratersee und Caldera vermutlich nach fünf Minuten schon wieder vergessen hatten – das Blubbern verstanden sie.
Franziska lief wie eigentlich fast jeden Tag das gesamte Ufer des Sees wie stets im Uhrzeigersinn ab. Sie ging am Parkplatz vorbei geradewegs zum Wasser, nach links entlang des Ufersaums zu einem kleinen Platz mit Pier, an dem Touristen auf Bänken saßen und sich sonnten.
Sie kam langsamer voran als sonst, weil Clara jede Blüte einzeln betrachten musste, und ging auch langsamer, damit ihre Tochter mit ihr Schritt halten konnte. Der Weg führte am flachen Ufer entlang, mit den Bäumen und dem Wasser rechts, den Weiden links, dann über eine Wiese, direkt hinter dem Veitskopf, einem uralten Lavastrom, am Campingplatz vorbei. Von irgendwoher klang dumpfe Schlagermusik herüber. Die Menschen lagen im Gras und sonnten sich.
Franziska schritt hinein in einen wilden, urwüchsigen Wald, der den steilen Hang der Kraterwand emporkletterte. Hier befanden sie sich unterhalb des Lydiaturms, einem Platz, der eine ideale Aussicht auf den ganzen Kratersee bot.
Sie erreichten den Lorenzfelsen, einen alten, hoch aufragenden Lavastrom. Hier war es ruhiger, obwohl der Wind die Stimmen der Ausflügler noch herübertrug. Es dauerte ein paar weitere hundert Meter, bis der Wald das Geschnatter endgültig verschluckte. Sie hatten den See nun zu drei Vierteln umrundet.
Ein Windstoß verwuschelte das Wasser in eine raue Fläche mit Tausenden von Kräuseln, Rippeln im Wasser wie Rippel im Meeressand, welche die Sonnenspiegelungen zum Flirren brachten.
Es roch nach frischen Frühlingsblüten, nach Baumharz und feuchtem Laub. Franziska wollte die Mofetten kontrollieren, Stellen im Wasser, an denen Gase aus dem Erdinneren nach einer langen Wanderung durch Spalten und Klüfte schließlich aus dem See austraten. Wie bei Mineralwasser oder Limonade sprudelten kleine Blasen hervor. Manche dieser Stellen befanden sich draußen im See, ein oder zwei konnte man bequem vom Ufer aus erkennen, weil das Wasser dort wie in einem Topf wallte, den man zum Eierkochen auf den Herd gesetzt hat. Selbst im Winter, wenn der See zufror und eine weiße Schicht aus Schnee das Eis überzog, blieben diese Quellen frei.
Es waren keine Menschen zu sehen. Der breite Trampelpfad verlief ohnehin etwas weiter oben, aber die große Hitze, die schon jetzt im Mai herrschte, sorgte dafür, dass die Touristen sich in der Umgebung des Klosters aufhielten. Bis hierher schafften sie es selten, da lief allenfalls gelegentlich ein Jogger vorbei.
Franziska schmeckte den Staub, den jeder Schritt auf dem trockenen Weg aufwirbelte. Sie genoss, dass es für die Jahreszeit viel zu heiß war. Überall konnte man im See Leute schwimmen sehen, obwohl das strikte Schwimm- und Tauchverbot seit Jahren galt. Aber es war schon so heiß, dass alle aus der Region, besonders aus der nahen Stadt Koblenz, zum See drängten. Leserbriefe an die Lokalzeitungen hatten auch schon wortreich ein Ende des Verbots eingefordert.
Hier war ein richtiger Urwald: Schwere, dicke Stämme bogen sich tief über den Trampelpfad, umgestürzte Baumstämme moderten, mit Pilzen übersät, vor sich hin.
Franziska sah, als sie an den Mofetten angekommen waren, sehr genau hin. Sie wollte wissen, ob das Erdbeben, das die Region erschüttert hatte, etwas an den Blasen und Bläschen verändert hatte. Tatsächlich – da blubberte es kräftig im See, viel stärker als gewöhnlich, und ein leichter Schwefelgeruch lag über dem Wasser. Clara hustete, verstummte dann aber mit einem Mal. Es gluckste und gluckerte, wo die Mofetten am Tag zuvor ganz ruhig vor sich hingeblubbert hatten. Es gab keinen Zweifel: Die Gasproduktion nahm zu. Mehrere sehr große Blasen, fast handtellerbreit im Durchmesser, platzten auf der Seeoberfläche auf. Dann stank es stark nach Schwefel.
Erklärungen dafür gab es einige: Am wahrscheinlichsten war, dass sich die Schründe im Gestein, durch die das Gas aufstieg, einfach durch die Erdbewegungen vergrößert hatten. Oder aber das Magma, das heiße, glühende Flüssiggestein des Erdkerns, kochte zur Oberfläche hoch und hatte nicht nur die Erdstöße verursacht, sondern war auch der Grund der verstärkten Gasemission.
Ein Ansteigen des Magmas bedeutete zugleich eine erhöhte Gefahr für einen Vulkansausbruch. Franziska war klar, dass die meisten Menschen im Rheinland nicht einmal wussten, dass sie auf einem Pulverfass saßen – dem größten Supervulkan Europas, einem der größten Vulkane der Welt. Tatsächlich war der letzte Ausbruch des Laacher Sees die gewaltigste vulkanische Eruption gewesen, die Menschen je erlebt hatten. Spuren der ausgeworfenen Gesteine fanden sich von Spanien bis Schweden, Archäologen datierten ihre Funde sogar danach, ob diese aus der Zeit vor oder nach diesem Ausbruch stammten. Damals waren die Eifel und das Rheinland bereits besiedelt gewesen, nomadische Jäger und Sammler hatten die ersten Dörfer errichtet. Diese Dörfer hatte der Ausbruch allesamt unter einer sieben Meter starken Gesteinsschicht begraben. Dann hatten Schlammlawinen den Rhein zu einem gewaltigen See gestaut – als dieser Damm gebrochen war, hobelte eine Riesenflut alle menschlichen Siedlungen vom Niederrhein bis in die Niederlande einfach fort. Es war nicht auszudenken, was geschehen würde, sollte der Laacher See wieder ausbrechen.
Den Touristen erklärte Franziska bei Führungen immer: Der Vulkan sei nicht erloschen, er sei nur inaktiv. Er ruhe nicht einmal wirklich, denn die Stellen, an denen die Gase emporstiegen, zeigten, dass er noch immer rege sei.
Nun hatte sich in der Nacht das Erdbeben ereignet. Die Möbel waren gerutscht, das Geschirr hatte geklirrt. Am Morgen lief vor ihrer Wohnung ein kleiner, aber langer Riss diagonal über die Straße. Das Wasser des Sees hatte geschwappt, einige Jollen aus ihrer Verankerung gerissen und ans Ufer getragen. Clara, ihre Tochter, war weinend aufgewacht und zu ihr ins Bett geschlüpft. Sie hatte sich mächtig erschrocken. Aber das Erdbeben selbst war harmlos, verglichen mit dem Vulkanausbruch, der ihm möglicherweise folgen konnte.
Als Franziska den See ablief, die aufgekratzte Tochter an der Hand, konnte sie überall Zeichen der Erdstöße sehen: umgestürzte Bäume, feine Risse im Boden – und die Blasen, die größer, in größerer Anzahl und schneller als gewöhnlich aus dem See stiegen.
Franziska maß die Stärke des Gasaustritts, Clara spazierte am See entlang, und als sie zurückkam, war ihre sonst so lebhafte Tochter plötzlich ganz still geworden. Und so blieb es dann. Den ganzen restlichen Tag saß das Kind verschüchtert herum, starrte in die Luft, brachte kaum den Mund auf. Und das bei einem Kind, das man normalerweise praktisch festbinden musste, wenn man in Ruhe eine Tasse Kaffee trinken wollte!
Clara wirkte noch immer verstört, als Franziska sie ins Bett brachte. Irgendetwas hatte die Kleine erschreckt – nur was?
Franziska legte die rechte Hand flach auf die Tischplatte, hob den Zeige- und den Mittelfinger leicht an und klopfte jeweils zweimal mit den Nägeln auf das Holz. Nicht einmal, nicht dreimal – stets zweimal, das war ein richtiger Tick von ihr; sie tat das immer, wenn sie nachdenken musste oder nervös war.
Hinter Franziska ging die Tür auf. Clara kam herein, rieb sich die Augen.
»Mama, ich kann nicht schlafen!«
»Was ist denn?«
»Ich träume so schlecht!«
»Hast du Angst davor, dass die Erde wieder wackelt?«
»Gibt es denn noch einmal ein Erdbeben?«, wollte Clara wissen. »Das kann man nicht sagen. Hast du dich sehr erschreckt?«
Clara spielte die Tapfere, obwohl sie laut geschrien hatte, als ihre Bilderbücher aus dem Regal gehüpft waren. »Nein, das war lustig!«
»Wovor hast du dann Angst?«
»Vor dem Teufel …!«
»Vor dem Teufel?«
»Im See ist der Teufel herausgekommen, und der hat gestunken.« Sie hielt sich die Nase zu.
Franziska erinnerte sich daran, dass Clara während ihrer Messungen allein am Ufer weiterspaziert war. Ihre Tochter kannte die Stelle, deshalb hatte sie sich nichts dabei gedacht. Aber als Clara zu ihr zurückgerannt kam, hatte sie so seltsam geblickt – und war seitdem so untypisch stumm geblieben.
»Wie sah er aus, der Teufel?« Franziska hoffte, der Furcht ihrer Tochter so besser auf die Spur zu kommen.
»Der hatte … der war … das war so eine ganz große Blase, ganz gelb, und dann ist die aus dem Wasser gekommen und hat gebrüllt, und dann hat es gestunken wie Streichhölzer, wenn man die ausbläst.«
»Das war eine Blase?«
»Das war der Teufel, wo den Wassermann immer ärgert.«
Jetzt dämmerte es Franziska. Clara hatte ein Kinderbuch: die Geschichte des kleinen Wassermanns, eines grünen Gnoms mit Entenfüßen und roten Wuschelhaaren, der in seinem Teich ganz gemütlich lebte, bis der böse Teufel kam und ihm mit großen Wasserblasen ärgerte. Der kleine Wassermann und sein bester Freund, Gerald der Goldfisch, vertrieben dann gemeinsam den bösen Kerl. So also war Clara auf den Teufel gekommen!
»Wenn Mama bei dir ist, hast du dann auch Angst vor dem Teufel?«
»Wenn du da bist«, meinte Clara und schmiegte sich eng an Franziska, »kann mir der Teufel nichts tun.«
»Weißt du was? Dann gehst du wieder in dein Bett, und ich wache hier und passe auf, dass der Teufel nicht noch einmal kommt!«
Clara nickte. Sie konnte die Augen ohnehin kaum noch offen halten.
»Wenn wir morgen an den See gehen, zeigst du mir die Stelle, wo der Teufel herausgekrochen ist?«
Clara biss die Lippen zusammen und nickte stumm. Mit Mama war das wohl halb so schlimm. Trotzdem: »Was mache ich denn, wenn der Teufel wiederkommt?«
»Der kommt nicht wieder, mein Schatz. Glaub mir! Was du da gesehen hast, Clara, war sicher kein Teufel. Den Teufel gibt es gar nicht, und wenn doch, ganz sicher nicht in unserem See«, sprach Franziska beruhigend auf ihre Tochter ein. »Ich muss das wissen, ich werde dafür bezahlt, dass ich alles über den See weiß.«
Clara schaute sie jetzt beruhigt an.
»Das war sehr wahrscheinlich bloß eine große Luftblase.«
Nur: Für Franziska stellte eine riesige, stinkende Gasblase eine weitaus größere Gefahr dar als ein Wasserteufel.
»Wirst du mir morgen zeigen, wo du die Blase gesehen hast?«
Clara nickte.
Unter Reginald MacGinnis’ wachsamen Augen kniete Joe Hutter vor der Pilotenkanzel. Die Anstrengung war ihm deutlich anzusehen, konzentriert verzog er das Gesicht. Er durfte keine Fehler machen. Das heftige Erdbeben der letzten Nacht saß ihm noch in den Knochen. Langsam und vorsichtig, immer wieder kurz innehaltend, hebelte Joe Hutter die Metallplatte ab, die den Bombenschacht vom Gang trennte. Dieses Mal hatte er Glück: Es befanden sich noch alle Bomben in ihren Verankerungen, die Mannschaft hatte sie nicht abgeworfen, bevor sie in den See gestürzt war.
Eine der Griffzangen bewegte sich, öffnete sich – er musste beim Aufhebeln unabsichtlich einen Kurzschluss oder sonst etwas in der Elektronik ausgelöst haben. Eine der Bomben senkte sich, löste sich dann aus ihrer Verankerung und fiel sanft auf den Boden des Schachts.
Joe öffnete erstaunt den Mund. Er konnte das Unglück nicht mehr aufhalten. Die Bombe erzeugte zuerst ein metallisches Geräusch, dann detonierte sie. Ein rotes Licht blinkte hektisch. Das war das Ende der Welt.
Hutter schlug enttäuscht mit der Faust auf den Boden und wischte sich dann den Schweiß aus der Stirn. Er kauerte vor seinem Computerbildschirm und kämpfte sich durch eine simulierte Darstellung des Flugzeugrumpfs in verschiedenen Helligkeitsstufen, von grell über düster bis zu fast finster. Niemand wusste, welche Lichtverhältnisse dort unten vorherrschten, wie tief das Flugzeug in den Schlamm auf dem Seegrund gesunken sein mochte. Joe tastete sich virtuell durch das Wrack, prüfte die Ausstiegstüren, näherte sich den Kisten, die eventuell im Gang standen, untersuchte Risse in der Außenhaut, lernte, die Eingänge zu der Bombenkammer zu identifizieren und zu öffnen. Jede Simulation veränderte die Parameter. Mal schaffte er es, mal nicht. Dieses Mal hatte er es nicht geschafft. Wieder nicht.
In der Realität, später, am echten Wrack, durfte er auf keinen Fall versagen.
Joe Hutter mochte es nicht, in der vordersten Reihe zu stehen, er blieb lieber unnahbar im Hintergrund. An der Universität war er einer der besten in seinem Fach, der Biochemie, gewesen, und deshalb hatten ihn Reginald MacGinnis’ Männer angesprochen. Es handelte sich um sein drittes Projekt mit MacGinnis als Chef; er kannte mittlerweile dessen Ecken und Kanten. Hutter tauchte hervorragend, diese besondere Qualifikation garantierte ihm bei dieser Aktion eine Vorzugsbehandlung. MacGinnis sprach öfter mit ihm als mit den anderen; manchmal wirkte es auf Hutter sogar so, als öffnete sich MacGinnis ihm ein wenig. Aber natürlich waren auch die anderen im Team wichtig.
Andrew Neal, ein Zweimetermann, kam herein, die Tasche wie üblich voll mit Probengläschen. Er entnahm an bestimmten Stellen jeweils zur gleichen Uhrzeit Wasser, verpackte die Proben und schickte sie zur Analyse nach Koblenz. Er untersuchte die Seeufer und zählte die Zahl der toten Fische, die angeschwemmt worden waren. Heute hatte er keine gefunden, ein gutes Zeichen. Er achtete auf die Enten, Schwäne und Blesshühner – zeigten sie ein ungewöhnliches Verhalten, wirkten sie schlapper oder kränker als sonst? All das konnten Hinweise sein. Auch die toten Fische und – vorgestern – eine tote Ente wurden zur Untersuchung an ein Labor geschickt. Bis jetzt waren sie immer an natürlichen Ursachen gestorben.
Neal stammte wie Joe Hutter aus Schottland, allerdings nicht aus der größeren Stadt Inverness – er hatte in Glasgow studiert, kam irgendwo aus dem hohen Norden, aus der Gegend der Isle of Skye, wo man bis vor ein paar Jahren noch den Sabbat geehrt hatte, wo sonntags keine Fähre fuhr und keine Kneipe öffnete.
Der andere im Team, der Nordengländer, ein Computerspezialist, stammte – aus Nordengland eben. Er redete wenig, und niemand sprach viel mit ihm.
Über zehn Minuten lang hatte MacGinnis sie an diesem Morgen mit einem Vortrag über Geheimhaltung drangsaliert: Niemand darf wissen, dass wir hier sind. Niemand darf wissen, warum wir hier sind. Und: Keine Freundschaften außerhalb des Teams.
Und innerhalb des Teams am besten auch nicht, dachte Joe.
Dann trat er den nächsten virtuellen Tauchgang an. Es ist wie beim Schachspiel, das sagte Gerd Schmidtdresdner seine Erfahrung: Am wichtigsten sind Strategie und Überraschung. Du musst dem Gegner immer voraus sein, stets bereits drei Schritte weiter in die Zukunft planen als er. Alles war bestens überlegt und vorbereitet. Er hatte ein Setting geschaffen, das den Mann überraschen würde. So konnte er strategisch vorgehen und durch gezielte, getarnte Fragen mehr in Erfahrung bringen, als er schon wusste. Er hatte, so stellte er zufrieden fest, die Karten perfekt gemischt.
Sie hatten sich in einer Bar im Bahnhofsviertel verabredet. Die Scheiben waren schon ganz stumpf vom Rauch, Licht floss nur zögerlich hinein. Mit dem Nichtraucherschutz ging der Wirt recht lässig um. Auf dem Tisch wellte sich eine vergilbte alte Decke. Sie war schmutzig, übersät von Brandlöchern, die Generationen von Zigaretten darauf hinterlassen hatten.
Es bereitete Schmidtdresdner Vergnügen sich auszumalen, wie sein Auftraggeber sich in dieser schmuddeligen Umgebung verhalten würde. Der sprach immer, als habe er eine heiße Kartoffel im Mund. So ein feiner Pinkel, ohne Probleme, jemand, der mit dem goldenen Löffel im Mund aufgewachsen war. Er kommt bestimmt im Maßanzug, zugeknöpft, steif. Wissen Sie, wird er sagen, dachte Schmidtdresdner amüsiert, ich bin sonst eher selten in solchen Bars.
Die Kneipe war gut besucht, trotzdem befand sich unter diesen Schnapsnasen kein Zeuge, den ein Gericht gerne befragen wollte. Das waren heruntergekommene Typen, unglaubwürdig. Falls sie in ihrem Suff überhaupt etwas mitbekamen.
Der Mann wird Wein bestellen und Bier bekommen. Nestelt dann nervös an seiner Krawatte. »Den Wein, den Sie gewöhnlich trinken, werden Sie hier nicht bekommen«, wollte Schmidtdresdner ihn dann süffisant necken. Er musste unbedingt die Oberhand behalten.
Gerd Schmidtdresdner lächelte zufrieden, als er wartete und sich all das vorstellte.
Er zog eine Zeitung aus seiner Tasche, legte sie auf den Tisch und strich sie glatt. Danach blätterte er bis zum Sportteil vor. Alles sollte ganz natürlich aussehen. Er tat so, als sei er nur deshalb in die Kneipe gekommen, um die Zeitung zu lesen. Aber er wartete.
Doch er konnte sich nicht auf die Sportmeldungen konzentrieren. Und je länger er auf seinen Auftraggeber wartete, desto wütender wurde er.
Er wartete, bis es draußen dunkel geworden war.
Der Mann kam nicht, versetzte ihn.
»Verzeihung, sind Sie Gerd Schmidtdresdner?«
Die Stimme klang anders als am Telefon und merkwürdig vertraut. Da stand nicht der Mann, es war der Kellner mit einem großen braunen Umschlag.
»Das ist eben für Sie abgegeben worden.«
Schmidtdresdner griff nach dem Umschlag und riss ihn sofort auf. »Von wem denn?« Er sah zu dem Mann hoch.
Der Kellner zuckte mit den Schultern. »Wie soll er schon ausgesehen haben?«, maulte er. »War ’n Mann eben.«
»Ein Ausländer?« Schmidtdresdner stand halb auf, stützte seine geballten Fäuste auf die Tischkante. »War es ein Ausländer?«
»Keine Ahnung.« Den Kellner ließ Schmidtdresdners Gefühlsausbruch kalt, er reagierte mit Gleichgültigkeit. »Das kann ich Ihnen nicht sagen. Der Mann war sehr kurz angebunden.«
Gerd Schmidtdresdner versuchte erst gar nicht, dem Kellner einen Geldschein zuzustecken – es fruchtete vermutlich ohnehin nichts. Der Mann wusste nicht mehr, er tat nicht nur so. Eine reine Geldverschwendung, seiner Erinnerung nachhelfen zu wollen.
Sie sahen sich eine Sekunde gelangweilt in die Augen. Dann drehte sich der Ober um und stapfte fort. Das ging ihn alles nichts an.
Schmidtdresdner betrachtete den Inhalt des Umschlags. Es handelte sich um Anweisungen. Und ein Bündel Geld. Solche Summen überweist man nicht einfach. Sonst ließen sich die Transaktionen zurückverfolgen. Solche Beträge wechseln, in Umschläge verpackt, den Besitzer.
Die Leute am Nachbartisch lachten laut auf, einer bestellte noch ein Bier. Schmidtdresdner spähte zu ihnen hinüber. Nein, sie hatten nichts bemerkt.
Schmidtdresdner stopfte den Umschlag in seine Jackentasche und sprang plötzlich auf. Er eilte zum Ausgang der Kneipe, lief heraus auf die Straße. Er suchte sie ab, vom Kiosk über Dennis Computershop bis zum 99-Cent-Laden.
Doch im Gewühl, das unter den Straßenlichtern dahinhuschte, fand er niemand, der sein geheimnisvoller Auftraggeber hätte sein können.
Er trat mit den Fuß gegen einen Laternenmast.
Schmidtdresdner war wütend. Hätte er gewusst, was die nächsten Tage noch bringen würden, er hätte sich seine Wut aufgespart, für später.
2
»She’s lost control again, she’s lost control.«
Der Raum war spartanisch eingerichtet: ein großer Konferenztisch, mehrere Bürostühle, Seitentische entlang der Wände für die technischen Apparate. An den Wänden hingen großformatige Konstruktionszeichnungen verschiedener altmodischer Flugzeugtypen, bei denen einzelne Stellen mit Rotstift markiert waren, mit kleinen Berechnungen oder Sachinformationen, die jemand daneben gekritzelt hatte.
»She’s lost control …«
Joe Hutter sah seine beiden Kollegen kurz an. Als sie nickten, drehte er die Lautsprecher noch weiter auf und tänzelte leicht zu den harten Rhythmen der Musik. Er stand vor den Risszeichnungen eines englischen Bombers und zeichnete Sollbruchstellen und potenzielle Bruchstellen ein.
Seine Kollegen machten ihre Auswertungen, wippten mit den Füßen mit und hörten nicht, als MacGinnis eintrat und die Stirn kraus zog.
Er ging geradewegs zu seinem Platz, ließ seinen massigen Körper auf einen Bürostuhl fallen und strich sich dann erst einmal andächtig durch den rotblonden Vollbart, der struppig in alle Richtungen abstand wie bei einem alten Seebär, bis er sich sicher war, dass er die Aufmerksamkeit aller hatte. Er wischte sich die Schweißperlen aus der Stirn, neigte sich dann seufzend nach vorn und klappte seinen Laptop auf.
»… lost control again …«
»Wer hat diesen Lärm angestellt, und wer macht diesen Krach wieder aus?« Reginald MacGinnis wirkte fast noch missmutiger als sonst. Wahrscheinlich war er wieder die halbe Nacht zu einem angeblich guten französischen Restaurant gefahren, hatte aber seiner Meinung nach nur durchschnittliches Essen erhalten.
Joe Hutter schmunzelte. Die Szene erinnerte ihn an viele ähnliche, die sich bei ihm zu Hause abgespielt hatten, wenn sein ernster, calvinistischer Vater ihn wegen seiner Punkmusik getadelt hatte. Musik machte fröhlich, also war Musik strikt verboten. Er hatte seinen Vater, Gott habe ihn selig, niemals lachen gesehen – aber oft schreien, er solle diese teuflische Musik sofort abschalten.
»Das ist kein Krach, das ist Joy Division«, wehrte sich Joe Hutter halbherzig. Er erhaschte einen Blick auf MacGinnis’ breites, ledriges Gesicht mit den tiefsitzenden, wachen Augen und dem wirren roten Vollbart, eilte zum Player und schaltete die Musik ab. Man widersprach dem Chef nicht.
Vermutlich wollte MacGinnis kein Lied über Kontrollverlust hören. Es ging ja im Gegenteil darum, völlige Kontrolle über die Situation zu erlangen, das Problem schnell, effektiv und professionell zu lösen – und keine Spuren zu hinterlassen, nicht im Gelände, nicht in der Erinnerung der Menschen, vor allem nicht bei den Medien. Was sicher auch kein so einfaches Unterfangen würde, wenn er daran dachte, dass irgendwann der Schwerlastkran aufgestellt werden musste, dass man den Touristen irgendeine Geschichte vorsetzen musste, dass eigentlich niemand außer der deutschen Regierung, der britischen Regierung und ihrem Dienst je erfahren durfte, was geschehen war.
We’ve lost control again, dachte Joe, there’s no control again.
»Nun hören Sie mal, was ich Ihnen an Musik vorspielen werde!« MacGinnis zeigte mit dem erhobenen Zeigefinger in die Luft wie ein Oberlehrer. Er beugte sich über seinen Laptop und wählte die betreffende MP3-File.
Zuerst hörte Joe nichts. Das Bild des Monitors wurde auf eine Leinwand projiziert. Dort erkannte er parallele Striche, die zuerst ganz sanfte Zacken ausbildeten. Dann wurden die Zacken wie bei einem EKG immer deutlicher, schossen in Ober- und Unterlängen. Und da hörte er die Musik, die MacGinnis abspielte.
Es war zuerst nur ein leiser und brummender Ton, dann ein knurrender, immer lauter werdender langgezogener und jaulender, fast klagender Laut.
»Walgesänge?«, fragte Joe. »Sind wir jetzt bei Greenpeace?«
»Nein, es gibt in deutschen Seen keine Wale«, antwortete MacGinnis mit finsterer Stimme und ohne eine Miene zu verziehen, so, als hätte Joe seinen Einwurf tatsächlich ernst gemeint.
Nun begannen auch Joes Kollegen zu tuscheln. Sie waren zu dritt, eine kleine Gruppe unter MacGinnis, dem erfahrenen Leiter, der schon so manche heikle Mission mit Bravour erfüllt hatte. Wie viele Menschen mochten ihm sein Leben verdanken? Und wie viele ihren Tod? Joe wusste es nicht, er hatte MacGinnis nie danach gefragt. Vermutlich schlummerte hinter dessen übertrieben harter Oberfläche ein weicher, vielleicht sogar sentimentaler Kern. Aber als Chef mit absoluter Weisungsgewalt konnte er ihn nur dann akzeptieren, wenn er so wenig Privates wie möglich von ihm erfuhr. MacGinnis war ein absoluter Profi, der an den meisten Brandherden der Welt aktiv gewesen war. Es hatte nie ein Gerücht gegeben, zumindest hatte Joe nie davon gehört, dass MacGinnis auch nur ein einziges Mal versagt hatte. Es war sicher, dass MacGinnis ein Geheimnis barg.
Der klagende Ton wurde immer lauter, als hätte MacGinnis den Tonregler auf die höchste Stufe gestellt, und endete dann plötzlich mit einem kratzenden Geräusch, als zöge man eine Nadel quer über eine alte Vinylplatte. Auf dem Monitor sah man nur noch gerade Linien, die sich ab und an leicht und rundlich hoben, wie das friedliche Atemgeräusch eines Babys.
Sie alle blickten MacGinnis fragend an.
»Das«, sagte er in seinem professoralsten Gelehrtenduktus, »waren die hörbaren Schwingungen der Erde. Was hier jault, ist der Laacher Vulkan.«
Jetzt verstanden sie – es hatte also doch mit dem Auftrag zu tun.
»Normalerweise«, fuhr der Chef fort, »hören Sie immer ein Hintergrundbrummen oder -rauschen. Was unsere Messinstrumente hier aufgezeichnet haben, ist etwas anderes. Es stammt von vorgestern, von dem Tag vor dem Erdbeben, ist also noch sehr frisch. Heute haben wir nur ein Rauschen aufzeichnen können. Aber dieser kleine Tonausbruch ist unseren Experten wohlvertraut. So hört sich ein Vulkan an, kurz bevor er ausbricht. Das könnte uns hier auch bevorstehen. Wann genau, können wir aber nicht sagen. Es kann noch Monate dauern oder Wochen oder Tage. Sie wissen, was das bedeutet.«
Sie wussten es: Die Zeit wurde vielleicht bald schon knapp.
Jetzt musste Joe Hutter funktionieren. Jeder Fehler war fatal, Emotionen fehl am Platz. Die Schwere der Aufgabe und die möglichen Konsequenzen durften ihn nicht beirren. Es hing so viel davon ab, das Flugzeug zu finden und es zu bergen. Jeder Fehler, hämmerte er sich immer wieder ein, jede Verzögerung könnte den Tod von Hunderttausenden Menschen verursachen.
Hutter bewunderte MacGinnis – nicht dafür, was er sein Leben lang getan hatte, das waren vermutlich Schweinereien gewesen, die man sich gar nicht vorstellen wollte, sondern wie er es getan hatte. Hutter konnte es jeden Tag ganz deutlich an seinem Chef beobachten: Er war nüchtern, fast kalt, aber immer ganz bei der Sache. Kühl, dennoch mit Feuereifer. Da lag ein Knistern im Raum. Schaute er nicht immer so missmutig drein, als wäre er gerade beleidigt worden, hätte man das Gefühl haben können, er habe überhaupt keine Emotionen. Doch MacGinnis blickte selbst dann missmutig, wenn sie einen Erfolg verzeichnen konnten. Trotz aller zur Schau getragenen gleichgültigen Misanthropie wirkte MacGinnis häufig so, als vibriere er innerlich. Es schien, als wäre es nur eine Frage der Zeit, bis er wie ein Choleriker explodierte. Doch er explodierte nie. Vielleicht war das Beherrschtheit, vielleicht auch nur Resignation.
Es hieß, dies hier sei MacGinnis letzter Auftrag vor seiner Pensionierung. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es nicht. Das wäre auch ungewöhnlich gewesen. Aber MacGinnis selbst hatte so etwas einmal angedeutet.
Als Joe am Tag zuvor mit einem kleinen Echolot, einem Fish-Finder, eine Struktur im See lokalisiert hatte, strahlte er über das ganze Gesicht. Endlich ein Ergebnis! Als sich dann herausstellte, dass es sich nur um einen zerborstenen Lavastrom unter Wasser handelte, konnte jeder die Enttäuschung in seinem Gesicht ablesen.
MacGinnis aber hatte ihn nur mit derselben Mischung aus Missmut, Enttäuschung und Weltekel angeblickt, die er immer zur Schau trug – und ihn dann aufgefordert weiterzusuchen.
»Es geht hier nicht um Ihre Befindlichkeiten«, musste sich Hutter anhören, »es geht um die Halifax!«
Hutter betrachtete die Karte mit den Markierungen. Eines der Kreuze interessierte ihn – es lag ufernah, etwa gegenüber der Abtei im seichten Wasser. Nichts wies darauf hin, dass es die Halifax sein konnte – die wurde ganz woanders vermutet –, aber nachzusehen schadete nichts.
»Ich gehe tauchen!«, verabschiedete sich Hutter. Als er sah, dass MacGinnis die Augenbrauen kurz anhob, fügte er schnell militärisch hinzu: »Melde mich ab zum Tauchgang.«
Er verließ den Raum und trat in den Flur.
Überall lag transparente Plastikfolie auf dem Boden ausgebreitet, die von weißen Farbflecken übersät war. Jemand hatte den Putz von den Wänden geklopft. Er lief um das Handwerkszeug herum, das man dazu benutzt hatte, und öffnete die Tür.
»Betreten verboten – Renovierungsarbeiten« las er auf dem Schild draußen. Alles wirkte so, als würde in dem Flur nach dem Erdbeben kräftig gearbeitet – die perfekte Tarnung.
Joe lächelte. Er wusste es besser.
Joe Hutter hörte ein Knarren hinter seinem Rücken und drehte sich um. Es war Andrew Neal, der die Tür öffnete. Neal bückte sich unter der niedrigen Öffnung durch und folgte ihm.
»Ich komme mit«, meinte er. Neal, über zwei Meter groß, dünn, fast schon ausgemergelt, nickte Hutter zu. Er war, trotz seiner erst vierzig Jahre, schon schlohweiß. »Ich habe eben einen Augenzeugen angerufen, er wartet schon unten auf uns. Dann kannst du immer noch tauchen gehen.«
Andrew Neal und Joe Hutter navigierten das Boot mit gedrosseltem Außenbordmotor allmählich zu der Stelle auf der Seeoberfläche, die Andreas Trattmann schon vom Ufer aus angezeigt hatte. Sehr weit draußen war das nicht, aber die langsame Fahrt sollte auch Trattmanns Orientierung dienen.
Der alte Herr, ein rüstiger Mittsiebziger, saß auf der Querbank und betrachtete abwechselnd zuerst amüsiert Neal und dann aufgeregt die Uferlinie. Sie schien ihm gleichzeitig so vertraut und so verändert. Die Zeit wischt über das Gewohnte und verwandelt es in etwas Fremdes, sie löscht Erinnerungen oder fügt sie hinzu, und zum Schluss weiß man selbst nicht mehr, was tatsächlich stimmt. Hier aber war Trattmann sich sicher, es musste nur diese auffällige Gratlinie in den Hügeln um den See wieder erscheinen, und er hatte die richtige Stelle gefunden. So wie sich die Hanglinien beim allmählichen Vorangleiten verschoben, konnte es nicht mehr lange dauern. Die beiden Briten merkten, wie die Aufregung in ihm aufstieg.
Seinen Brief an die Lokalzeitung hatte er schon ein Jahrzehnt zuvor geschrieben, als das Flugzeug Schlagzeilen in der ganzen Region gemacht hatte. Er hatte beschrieben, wie er als Kind beim Angeln in das klare Wasser des Sees heruntergeschaut hatte, von seinem kleinen, klapprigen Ruderboot, und da – direkt unter sich – auf dem grauen Boden den silbrig glänzenden Rumpf des Bombers gesehen hatte, ein Atlantis der Eifel.
Andrew Neal war beim Recherchieren auf diesen Brief gestoßen. Zwar sollte sich die Episode in den 1950er Jahren ereignet haben, es handelte sich dennoch um die jüngste gute Sichtung der Halifax – sah man von einem anonymen Augenzeugen ab, der das Wrack von einem Linienflugzeug aus erspäht haben wollte.
Neal hatte Trattmann angerufen. Der alte Mann freute sich ehrlich über die Aufmerksamkeit. Er beschrieb so präzise, wie seine Erinnerung ihm das erlaubte, die Entfernung zum Ufer, zum Anlegesteg mit den Booten, die auffällige Kerbe, die zwei Hügel der Kraterwand, von diesem Platz aus betrachtet, gebildet hatten.
Andrew Neal notierte sich alles eifrig, stieß aber mehr als einmal an seine Grenzen. So gut war sein Deutsch nicht, dass er jedes Wort verstand, und Trattmann sprach in einem rheinischen Dialekt, der selbst für Mulden, Kerben und Wasserqualitäten eigene Begriffe kannte.
»Wissen Sie was? Ich zeige es Ihnen am besten selbst!«, meinte Trattmann am Ende des Telefonats, und so hatte er jetzt bereits auf dem Parkplatz gewartet, trotz der Wärme und des zu erwartenden heißen Mittags in einen Wollmantel gehüllt, den Hut auf den Kopf und voller Erwartung. »Wann geht es los?«
So schaukelten sie gemächlich über den See, und Trattmann hielt das Ufer immer genau im Auge, bis er plötzlich die Hand hob und laut verkündete: »Hier ist die Stelle!«
Hutter und Neal schnellten beide auf ihrer jeweiligen Bordseite vor, um in die Seetiefe zu schauen. Erschrocken klammerte sich Trattmann mit beiden Händen an seine Holzbank, um nicht aus dem schaukelnden Boot zu stürzen. »Nur mal langsam«, schrie er ängstlich auf.
»Sind Sie sicher wegen der Stelle?«, wollte Neal wissen.
Trattmann besah sich noch einmal alles ganz genau, dann nickte er. »Ja, ich bin mir sicher.«
Joe Hutter vermaß die präzisen Koordinaten mit dem GPS. Es war keine Stelle, die das Echolot als potenziell interessant ausgewiesen hatte.
»Man sieht nichts«, erklärte Joe. »Das Wasser ist hier so tief, dass man kaum bis auf den Grund schauen kann. Ich schätze« – er warf einen kurzen Blick auf die Karte – »mindestens zwölf Meter. Selbst bei dem klarsten Wasser wäre das schwierig, aber wegen der Hitze sind oben schon so viele Algen, die die Sicht trüben, dass es völlig aussichtslos ist, irgendetwas zu erkennen.«
»Ich bin mir aber sicher«, antwortete Trattmann zögerlich. »Meine Eltern haben die Maschine damals gesehen, als sie brennend in den See stürzte. Aber es ist auch schon lange her. Ich glaube, dass der See an der Stelle nicht so tief gewesen ist, vielleicht höchstens halb so tief.« Er betrachtete nachdenklich den Horizont. »Doch, hier muss es gewesen sein. Wissen Sie genau, dass sich der Seeboden nicht in der Zwischenzeit gesenkt hat?«
Joe zuckte mit den Schultern »Ich bin kein Geologe.«
Trattmann wirkte ratlos. »Es müsste hier flacher sein.« Er zeigte mit seiner ausgestreckten Hand auf die Kerbe, die zwei sich schneidende Hügelseiten bildeten. »Hier war es. Es war gegen Ende Winter, und das Wasser war klarer. Vielleicht hat der Grund deshalb näher gewirkt …«
Andrew Neal holte die Unterwasserkamera aus ihrer Schutzhülle und rastete ihre Ösen in ein Tragseil ein. »Wir lassen die Kamera jetzt herunter und schauen nach.«
Er klappte den Laptop auf und knipste ihn an. Der Monitor fuhr langsam hoch, und schließlich sah man darauf den blauen Himmel und vereinzelte Wolkenbällchen, dann die Bootswand, Trattmann, schräg ins Bild ragend, dann eine braune Brühe.
Schließlich befand sich die Kamera im See. Der Monitor zeigte erst eine blaue, dann eine grüne Färbung, dazwischen Luftbläschen, die sich von der Kamera lösten, und Schwebeteilchen, die vorbeitrieben und kurz im Sonnenlicht aufflackerten.
Als acht Meter der Leine abgewickelt waren, ging Neal langsamer und vorsichtiger vor. Mittlerweile lieferte die Kamera nur noch Bilder, die eine amorphe graue Masse zeigten. Einmal schwamm kurz ein Fisch vorbei.
Es wurde dunkel.
»Es werde Licht«, verkündete Neal und schaltete die Lampe an. Vor der Linse schraubte sich ein Lichtstrahl ins Dunkel, aber der See war hier so voller Plankton, dass sie die Sicht bereits nach ein paar Dutzenden Zentimetern verloren.
Neun Meter, zehn Meter, elf Meter. Der Boden kam plötzlich in Sicht, eine platte, graue Fläche ohne Erhebungen.
Trattmann blickte enttäuscht auf den Monitor. »Da ist nichts!«
Neal zog die Kamera vorsichtig wieder herauf, tauschte den Platz mit Hutter und senkte das Gerät ebenso achtsam auf der anderen Bootsseite wieder hinab. Trattmann erbleichte. Das andauernde und nun heftigere Schaukeln und Wanken des Motorboots machten ihm zu schaffen. »Vielleicht«, meinte er zaghaft, »lag die Stelle doch näher am Ufer.«
»Wir lassen nun den Motor wieder an«, erklärte Hutter, »fahren zurück in Richtung Ufer und behalten immer die Kerbe im Blick. Sie schauen auf den Bildschirm und geben Bescheid, sobald Sie etwas erkennen.«
Unter anderen Umständen wäre es eine Freude gewesen, im hellen Sonnenlicht bei den warmen Frühsommertemperaturen über die spiegelglatte Oberfläche des Sees zu schweben, die Kraterwand mit ihren Büschen, Bäumen und Wiesen vor Augen. Hutter war ungemein angespannt. Trotzdem stiegen plötzlich Urlaubsgefühle in ihm auf. Warum auch sollte ich die letzten paar Tage vor dem Weltuntergang nicht genießen?, fragte er sich.
»Halt!«, schrie Trattmann plötzlich.
Joe musste sofort an die deutschen Soldaten in den Kriegsfilmen denken, die er in seiner Jugend jeden Samstag im Fernsehen angeschaut hatte. Die riefen auch immer »Halt!«, bevor sie einen britischen Soldaten über den Haufen schossen. Wie alt war dieser Mann eigentlich im Krieg gewesen? Egal, jetzt half er, und es ging nicht mehr um alte Rechnungen, die ohnehin längst beglichen waren.
Neal stoppte den Motor, das Schiff glitt noch einige Meter weiter voran. Doch das war kein Problem: Das Flugzeug maß schließlich mehr Fuß, als diese Strecke betrug.
Es brauchte eine quälend lange Zeit, bis die Kamera aus der Pendelbewegung, in die der plötzliche Stopp sie gebracht hatte, zur Ruhe kam. Der Scheinwerfer beleuchtete eine ebene Stelle im See, die in ihrer Konturlosigkeit dem Seeboden glich, den sie gerade betrachtet hatten.
Schließlich bemerkte Neal in der äußersten Ecke des Blickwinkels etwas Eigentümliches.
»Hier«, rief er aufgeregt, »dreh die Kamera nach Osten. Da! … Siehst du es?«
Joe ruderte das Boot sacht zurück, um dem Umriss näher zu kommen. Sie erkannten rostige Teile auf dem Bildschirm, die aus dem Schlamm ragten. Ein Rahmen, der noch einige wenige Glassplitter festkrallte. Handelte es sich etwa um die Pilotenkanzel?
Es war schwierig, bei der beschränkten Sicht und eingeschränkten Bildqualität einen Überblick zu behalten. Das Blech erschien dünn, fast wie Folie, kaum wie die Haut, die man auf das Gerippe eines Flugzeugs spannt. Tarnfarben, ja, aber irgendwie falsch.
Joe hielt die Hände im Wasser und versuchte damit die Richtung zu steuern, in die das Boot auf dem See trieb. Weitere Blechteile kamen in Sicht, und aus der Flut der chaotischen Eindrücke und Details, die immer wieder auf dem Monitor aufblitzten, schälte sich nach und nach ein festes Bild heraus: Es handelte sich nur um ein Autowrack, einen Lastkraftwagen.
Wie kam ein Lastwagen – der Tarnfarbe nach vermutlich ein amerikanisches Modell – an dieser Stelle in den See? Er konnte schließlich nicht von einer Brücke gestürzt sein.
Neal schien Hutters Gedanken zu erraten: »Der See friert im Winter zu. Vermutlich ist er darübergefahren und eingebrochen.«
Neal beschäftigte ein weiteres Problem: Auch diese Stelle war mit dem Echolot untersucht worden, aber er hatte hier nichts registriert. Was war, wenn der Bomber so fest und tief im Schlamm steckte, dass er ihn mit seinen Methoden gar nicht aufspüren konnte? Dann war seine Arbeit hier sinnlos.
Der Vormittag entmutigte alle: Joe, weil er das Wrack nicht gefunden hatte. Trattmann offenbar, weil er nun seiner Erinnerung misstrauen musste. Neal, weil er das Gefühl hatte, er habe versagt; mehr noch, weil er die Angst hatte, sein Team könnte hier versagen.
Schweigend fuhren sie zum Anleger zurück.
Joe und Neal verabschiedeten sich von Trattmann und dankten ihm herzlich. Es war nicht seine Schuld. Wer erinnerte sich nach sechzig Jahren schon noch so präzise? Und vielleicht hatte er sich ja schon damals getäuscht.
Immerhin – es war einen Versuch wert gewesen. Ab jetzt sollten Messergebnisse sprechen, die Suche mit dem Boot hatte schon genug Zeit gekostet. Mehr Zeit, als ihnen eigentlich zur Verfügung stand.
Zurück in seiner Wohnung, zählte Andreas Trattmann das Geld, das ihm der freundliche Herr mit dem ostdeutschen Akzent dafür gegeben hatte, dass er ihm den echten Ruheplatz des Bombers auf einer Landkarte gezeigt hatte: ganze einhundert Euro. Diese Engländer habe ich ganz schön an der Nase herumgeführt, dachte Trattmann, die suchen jetzt an einer völlig falschen Stelle! Denn auch dafür hatte der nette Herr ihn bezahlt.
Joe Hutter konzentrierte sich ganz auf seine Aufgabe. Der Auftrag des gesamten Teams lautete, die Menschheit zu retten. Das klang so überdreht pathetisch, und Joe Hutter lachte selbst, wenn er daran dachte. Dennoch: Es stimmte.
Nach dem Fiasko auf dem See zog er die Dokumentenkladde erneut aus dem Regal und blätterte darin. Er übersprang die Fotos vom Seeufer – nun war er ja hier und benötigte sie zur Orientierung nicht mehr. In Schottland hatten ihn die grünen Uferwiesen an den Loch Lomond erinnert; hier, im Krater, sah alles anders aus.
Er studierte die Informationen über die Handly Page Halifax Mk. II BB 214 und ihren letzten Flug.
Sie war am 29. August 1942 um 20:37 Uhr vom Fliegerhorst Elsham Wolds in North Lincolnshire gestartet, an der englischen Ostküste, mit Ziel Nürnberg. Besatzung: sieben Mann. Bombenfracht: vier 1000-Pfund-Bomben und eine 500-Pfund-Bombe mit TNT oder Amatol. Das war die offizielle Version: Er wusste es besser. Leider. Sonst hätte er ruhiger schlafen können.
Hutter nahm die amtlichen britischen Unterlagen in die Hand. Am 30. August um 0:10 Uhr hatte sich die Halifax in 9 000 Fuß Höhe über der Hohen Acht befunden, einem Berg in der Nähe des Nürburgrings. Deutsche Jagdflugzeuge beschossen sie dreimal, bis Fritz Schellwat, der Pilot einer Messerschmidt Me 110 vom Fliegerhorst Mendig, traf. Der Pilot der Halifax erkannte, dass sie nicht mehr nach England zurückkehren konnten. Er versuchte, den Bomber mit einer Restgeschwindigkeit von vermutlich über 160 km/h in der Nähe des Klosters im Laacher See zu landen. Bei dem Versuch aber brach der Schwanz des Flugzeuges ab und prallte auf den Boden. Der Bomber schlug auf der Wiese vor dem Kloster Maria Laach auf, und die Halifax schoss wie eine Rakete weiter in den See.
Drei Soldaten, an Fallschirmen hängend, meldeten die Deutschen. Bei einem versagte der Fallschirm, ein anderer wurde tot aus dem See geborgen. Von zwei Besatzungsmitgliedern fehlte jede Spur, sie blieben verschollen. Vermutlich waren sie mit dem Bomber in den See getaucht. Die zwei Männer, die tot geborgen wurden, lagen heute auf dem Soldatenfriedhof Rheinberg. Einer der Bordkanoniere hatte überlebt und später den ganzen Hergang des Absturzes schriftlich aufgezeichnet.
Auch die Deutschen hatten alles notiert. Im Kriegstagebuch des Luftgaukommandos 12, beim Luftgau-Nachrichten-Regiment 12, verzeichnete man im Band 1 (feindliche Abschüsse) unter dem Datum des 29. Augusts 1942, es sei »eine 4-mot Maschine, Typ noch nicht festgestellt, in den Laacher See« gestürzt. Unter der Rubrik »Besatzung« las Hutter: »7 Mann, 3 Mann gefangen.«
»Will noch jemand Tee?«
Hutter schüttelte den Kopf, er hatte bereits eine dampfende Tasse vor sich stehen.
»Willst du ein Truthahnsandwich, Hutter?«, fragte Neal.
Joe schnitt angewidert eine Grimasse. »Nein!«
»Lassen Sie ihn doch in Ruhe, Neal«, maulte der Nordengländer und biss herzhaft in sein Schinkensandwich, »Sie wissen doch, dass Hutter ein Körnerfresser ist.«
Die Maschine war mit knapp 19 Flugstunden noch brandneu gewesen. Die Landung wurde im flachen Uferbereich bei der Abtei versucht, daher lag das Wrack in Ufernähe, in wenigen Metern Wassertiefe. Das Heck war offenbar abgerissen, der Rest konnte zerbrochen sein.
Es gab jede Menge Augenzeugen, die das Wrack gesehen haben wollten – warum es so unauffindbar war, warum Expedition nach Expedition vergeblich danach suchte, ließ sich mit diesen Berichten schwer in Einklang bringen.