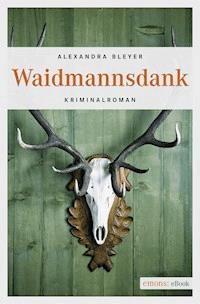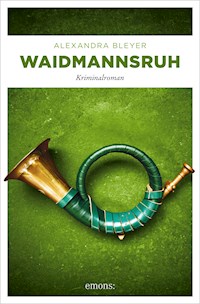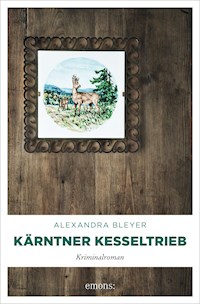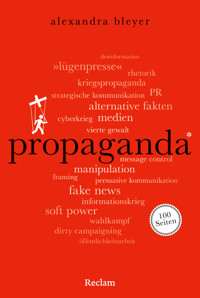Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Sepp Flattacher
- Sprache: Deutsch
Urig, grantig, herrlich bissig. Von wegen Ruhe im Mölltal: Nicht genug, dass sich der kauzige Aufsichtsjäger Sepp Flattacher an den frischen Wind im Jagdverein gewöhnen muss. Dass er noch dazu unlautere Machenschaften im Revier entdeckt, bringt ihn auf die Palme – oder besser gesagt: die Lärche. Da hat Sepp eigentlich weder Zeit noch Lust, sich um einen Mörder zu kümmern, der einem ganz persönlichen Abschussplan zu folgen scheint.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alexandra Bleyer ist (natürlich mit einem Jäger) verheiratet und lebt mit ihrer Familie am Millstätter See in Kärnten. Die promovierte Historikerin ist Autorin mehrerer populärer Sachbücher. In ihren in Kärnten angesiedelten Jägerkrimis geht es mit viel schwarzem Humor nicht nur Vierbeinern an den Kragen.
Alle Personen und Handlungen sind frei erfunden und keinesfalls als Abbild der im Mölltal lebenden »echten« Menschen zu verstehen. Etwaige Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen sind zufällig und unbeabsichtigt; ebenso spiegeln die aus der Perspektive der Romanfiguren geäußerten Vorurteile beispielsweise gegenüber deutschen Nachbarn oder Demenzerkrankungen weder reale Verhältnisse noch die persönliche Meinung der Autorin wider.
Im Anhang findet sich ein Glossar zu Dialektausdrücken und Begriffen aus der Jägersprache.
© 2018 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: cydonna/photocase.de
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Christine Derrer
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-424-7
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Dieser Roman wurde vermittelt durch die Agentur für Autoren und Verlage, Aenne Glienke, Massow.
Nix håbn is a rinkes Leben.
Kärntner Sprichwort
1
Die Zusatzräume im Erdgeschoss hatten ihre Vorteile. Nicht nur, dass die Polizeiinspektion Obervellach damit einen zeitgemäßen barrierefreien Zugang gewährleisten konnte, nein, viel angenehmer empfand Revierinspektor Martin Schober die Distanz, die zwischen der eigentlichen Inspektion im Obergeschoss und der Dependance lag. Diese ließ sich zwar nur in wenigen Höhenmetern messen, war aber ausschlaggebend, wenn man mit einem Kollegen wie Gerhard Koller Dienst hatte. Sie machte den Unterschied aus, ob man relativ entspannt von einem Tagdienst nach Hause ging – oder seine Stirn wiederholt gegen die Wand schlagen wollte.
Gerhard oder der cholerische Koller, wie er in Kollegenkreisen genannt wurde, hatte heute Innendienst gehabt und das Telefon betreut. Zur Freude aller, aber wirklich aller anderen auf der Polizeiinspektion, zog sich Gerhard dazu gern in den unteren Journaldienstraum zurück, an den sich noch ein Büro zur Einvernahme anschloss. Dort hatte Gerhard seine Ruhe für was auch immer – und seine Kollegen hatten Ruhe vor ihm. Eine Win-win-Situation, wie man so schön sagte.
Allerdings stand um neunzehn Uhr der Dienstwechsel bevor. Ordnungsgemäß und pflichtbewusst hatte Gerhard das Telefon umgeschaltet und war für die Dienstübergabe heraufgekommen. Da die Uhr erst zwanzig vor sieben zeigte und Kerstin Moser, die ihn ablösen würde, noch Zivilkleidung trug, war es eben Gerhard, der das Telefon abhob.
Viel bekam Martin von der hiesigen Seite des Gespräches nicht mit, denn er ergänzte vor Dienstschluss noch schnell einen Akt, wozu er tagsüber aufgrund mehrerer Einsätze nicht gekommen war, und ging dann in den Aufenthaltsraum hinüber. Gleich darauf stieß Kerstin, inzwischen in Uniform, zu ihm. Sie band sich die Haare zu einem lässigen Pferdeschwanz zusammen.
Als sie sich über einen Verkehrsunfall austauschten, polterte Gerhard in den Aufenthaltsraum, griff sich eine Tasse und drosch die Kastentür zu, dass es fast die Scharniere zerriss.
»Geht’s noch?«, fauchte Kerstin ihn an.
»Ein so ein Irrer! Da drehst ja durch, wirklich wahr. Meint der, wir haben keine anderen Probleme? So ein Vollidiot!«
»Krieg keinen Koller!«, frotzelte sie.
»Krieg keinen …« Gerhard schnappte nach Luft. »Ich soll keinen Koller kriegen?«
Ernst nahm den Gerhard, wenn er seinen Rappel hatte, auf der Dienststelle keiner mehr. Und das brachte diesen nur noch mehr in Rage. Ein Teufelskreis. Aber ehrlich: Der Gerhard erinnerte stark an das Rumpelstilzchen, wenn er mit knallrotem Kopf ausflippte und vor Zorn beinahe auf und ab hüpfte. Martin setzte sich auf die Eckbank und stützte das Kinn in die Hand, um sein Grinsen hinter den Fingern verbergen zu können.
»Ich sag’s euch: Der ist paranoid! Der hat nicht mehr alle Tassen im Schrank!«
»Von wem redest du überhaupt?«, fragte Martin.
»Von einem zweiten Michelitsch!«
Ach herrje. Otto Michelitsch war jedem auf der Polizeiinspektion ein Begriff. Er war ein Witwer von beinahe siebzig Jahren und zunehmend verwirrt. Dennoch sträubte er sich mit Händen und Füßen dagegen, in ein Heim oder auch nur in ein Betreutes Wohnen zu ziehen. Sein Sohn und seine Schwiegertochter, die sich um ihn kümmerten, hatten ihre liebe Not mit ihm, zumal Michelitschs Temperament fast wie das von Gerhard Koller war. Wenn man ihn am Telefon hatte, musste man sich auf eine Schimpftirade allererster Klasse gefasst machen, wobei sich seine Beleidigungen selten gegen die Polizei richteten, sondern mehr gegen seine Angehörigen, von denen er sich bestohlen und verfolgt fühlte.
»Ein zweiter Michelitsch? Und wer soll das sein?«, wollte Kerstin wissen.
»Ein gewisser Gerfried Ragger«, antwortete Gerhard. »Weißt, was der anzeigen wollte?«
»Hm, der Michelitsch behauptet ja gern, dass ihm seine Schwiegertochter Essen aus dem Kühlschrank fladert.« Dass er deswegen den Notruf wählte, fand Martin zwar nervig, aber im Grunde harmlos.
»Schlimmer! Ragger ist felsenfest davon überzeugt, dass ihn jemand umbringen will. Und weißt, warum? Ha?« Voller Empörung sah Gerhard von einem zum anderen. »Weil er sich einbildet, dass jemand heimlich in sein Haus eingedrungen ist und die Zeitung umgeblättert hat! So ein Vollkoffer, ein dämlicher.« Koller lief immer noch auf Hochtouren.
Kerstin lachte laut auf. »Geh, nimm das doch nicht so ernst! Es rufen doch ålle Ritt Durchgeknallte bei uns an. Da musst schon drüberstehen.«
»Hat er gesagt, wer ihm nach dem Leben trachtet?«
Gerhard verschluckte sich an seinem Kaffee. »Sollen wir jetzt mit der Spurensicherung anrücken, Martin? Fingerabdrücke nehmen? Der gehört doch ins Irrenhaus!«
Martin dachte an Otto Michelitsch, der vor etwa einem halben Jahr den Diebstahl seiner Brieftasche mit vierhundert Euro angezeigt hatte, überzeugt, sein Sohn Markus hätte das Geld entwendet. Entsprechend verbal aggressiv hatte er sich gegenüber dem Beschuldigten verhalten. Schließlich hatte der Sohn selbst verzweifelt auf der Dienststelle angerufen. Martin war dann mit Kerstin in Michelitschs Wohnung gefahren, wo sie die Brieftasche nach kurzer Nachschau in einer Kommode im Flur gefunden hatten, samt vollzähligem Inhalt, versteht sich. Als sich Martin unter vier Augen mit Markus Michelitsch unterhalten hatte, berichtete der ihm beinahe entschuldigend, dass sein Vater dement wäre.
»Du, der Michelitsch hat Alzheimer. Der macht das nicht absichtlich«, klärte er Gerhard auf. »Vielleicht ist Ragger auch –«
»Na und? Ich lass mich doch nicht tratzn! Meinst, der Notruf ist dafür da? Ha? Der Michelitsch hat heute drei Mal angerufen, und jetzt auch noch der Ragger! Zwei von der Sorte pack ich nicht. Mir reicht’s!«
»Mir a!«, polterte Kommandant Georg Treichel. »Sind wir im Kindergarten oder was? Was soll das Gschra, Gerhard?«
»Dem Michelitsch muss man das Telefon wegnehmen. Der bringt mich in den Wahnsinn«, kollerte Gerhard.
»Er ist dement«, wiederholte Martin. »Er weiß nicht, was er tut. Da kann er kaum dafür verantwortlich gemacht werden, oder?«
Da war Gerhard aber ganz anderer Meinung; Kerstin mischte sich in das Gespräch ein, das an Lautstärke zunahm.
»Ja, das mit der Demenz ist ein zunehmendes Problem«, stellte Treichel stimmgewaltig fest. »Und was machen wir mit einem Problem?« Erwartungsvoll sah er mit einem aufgesetzt breiten Lächeln, das ansteckend wirken sollte, aber seine Mitarbeiter eher irritierte, in die Runde. Nach kurzem Zögern hob er schwungvoll die linke Faust, in der rechten hielt er ein Blatt Papier. »Wir lösen es!«
Martin hoffte, dass die Nachwehen des Führungskräfteseminars mit Schwerpunkt Mitarbeitermotivation, das der Chef letzte Woche besucht hatte, bald abklangen. Die einstudierten Floskeln und Gesten – wahrscheinlich von einem sauteuren Experten entwickelt – passten nicht zu einem Urgestein wie Georg Treichel. Martin wünschte sich seinen authentischen Kommandanten zurück.
»Das trifft sich gut, ich habe heute ein Mail vom Innenministerium bekommen. Die haben ein neues Projekt vorgestellt: ›Einsatz Demenz‹. Eine Schulung –«
»Damit wir lernen, dass Tepate tepat sind, oder was?«
»Jetzt rede ich, Gerhard«, antwortete Treichel unaufgeregt. »Da steht, dass die Krankheit in der Bevölkerung noch enorm zunehmen wird. Es kann nicht schaden, wenn wir uns damit befassen und«, er schielte auf den Mailausdruck in seiner Hand, »mehr Kompetenzen im Umgang mit an Demenz Erkrankten erlangen.«
»Willst uns auf Schulung schicken oder was? Wenn’s in ein schönes Wellnesshotel geht, bin ich dabei«, meinte Kerstin und rieb sich schon die Hände.
»Schulung ja, Hotel nein. Das ist ein Anleinkurs.«
»Oh, oh … online«, spielte Kerstin grinsend auf den aufgelegten Versprecher an. Ja, der Treichel und die Fremdwörter, das würde wohl nie was werden.
»Genau. Das könnts euch dann in euern Bildungspass eintragen. Hm.« Er studierte das Papier. »Das sollten wir alle machen. Wenn mindestens siebzig Prozent der Bediensteten der Dienststelle den Kurs erfolgreich absolviert haben, gibt’s ein Zertifikat!«
»Und das picken wir uns dann aufs Klo? Ohne mich! Das tue ich mir nicht an!«
Glücklicherweise verzichtete Treichel auf das im Seminar Erlernte und besann sich auf die seinem Wesen entsprechenden, ursprünglichen Methoden der Mitarbeitermotivation. Andere Kommandanten würden vielleicht ihren Rang hervorkehren; Ober sticht Unter, wie man beim Bundesheer sehr schnell gelernt hatte. Treichel genügte es, nah an Gerhard heranzutreten. Mindestens fünfundzwanzig Zentimeter Größenunterschied – von der Gewichtsklasse ganz zu schweigen – reichten aus, um jedem zu zeigen, wer hier der Silberrücken war und wer zu wem aufschauen musste.
»Gerhard, dir wird das am wenigsten schaden.«
»Was müssen wir da machen?«, fragte Kerstin.
»Ein Lernprogramm zum Thema Demenz und dann folgt ein Wissenscheck. Bei dem müssts mindestens fünfundsiebzig Prozent erreichen, dann habts bestanden.«
Gerhard zog sich einen Stuhl hervor und setzte sich rittlings darauf. »Das kenn ich schon. Seitenlanges Blabla und dann gibt’s einen Kreuzerltest wie jeden Sonntag in der ›Kronen Zeitung‹. Den bestehst mit a bisserl Hausverstand von allein, da brauchst kein Lernprogramm!«
»Noch besser.« Treichel grinste nicht, er fletschte die Zähne. »Du kannst uns gleich zeigen, wie’s geht. Jetzt, sofort. Ich schreib dir sogar eine Überstunde, wenn’s sein muss.«
»Ist das eine Dienstanweisung?«
»Nein, natürlich nicht. Das geschieht alles auf rein freiwilliger Basis. Alles eine Frage des Willens … und du willst ja auch über Weihnachten freihaben, oder?«
»Den Schas mach ich mit links.«
Treichel reichte ihm den Ausdruck mit dem Link, über den er sich einloggen konnte, und Gerhard marschierte in den Journaldienstraum. Treichel folgte ihm ein paar Sekunden später.
Als der Uhrzeiger auf sieben stand, hätte Martin eigentlich nach Hause gehen können; ohne lange zu überlegen schickte er Bettina ein SMS, dass es später werden würde.
»Wie geht’s euch beiden, alles klar?«, erkundigte sich Kerstin, die das mitbekommen hatte.
»Es könnte nicht besser sein.«
»Feierts bald euren ersten Jahrestag?«
Martin lachte. »Das ist schwierig. Wir wissen nicht, welches Datum wir da nehmen sollen.«
Die Beziehung zu Bettina war recht holprig gestartet, mit Offs und Ons, wie man heute sagte. Er konnte nicht genau sagen, ab wann sie fix zusammen waren. Bei ihm eingezogen war sie ebenfalls nach und nach, ohne dass große Worte gefallen waren. Erst ein Kulturbeutel im Bad, dann eine Garnitur Wechselgewand, wenn sie bei ihm übernachtete. Erst hatte er ihr ein Fach im Kleiderkasten frei gemacht; jetzt war er froh, wenn er überhaupt eines für seine Sachen fand. Sie mussten unbedingt zusehen, dass sie einen ordentlichen Jahrestag schufen, fand Martin. Der Hochzeitstag würde sich ganz wunderbar eignen.
»Du strahlst wie ein neuer Euro, wenn du an sie denkst.« Kerstin knuffte ihn in die Rippen. »Liebe muss schön sein. Wenn ich groß bin, kauf ich mir auch ein Kilo.«
»Wachsen wirst wohl nicht mehr«, erwiderte Martin gespielt ernst.
»Nein. Aber heuer bin ich ein Vierteljahrhundert alt geworden …«
»Torschlusspanik?«
»Tick, tack, tick, tack.«
»Das waren ganz gemeine Fangfragen!«, beschwerte sich Gerhard, der hinter Treichel in den Aufenthaltsraum zurückkehrte.
»Nur siebzehn Prozent hast erreicht.« Treichel stellte sich hinter einen Stuhl und stützte seine Hände darauf ab. »Leitln, ich bin dafür, dass wir das machen, nicht nur wegen dem Michelitsch. Seids dabei?«
»Yes, Sir, yes!«, brüllte Kerstin zackig.
Martin gab ebenfalls seine Zustimmung.
»Klasse! Wenn wir das Gütesiegel von der Uni kriegen, spendier ich euch an Backhendlschmaus.«
Scheiß auf Expertenseminare: Treichel beherrschte die Mitarbeitermotivation aus dem kleinen Finger.
»Von welcher Uni ist das?«, fragte Kerstin.
Treichel grinste verschämt. »Lachts jetzt nicht. Ich hab’s vergessen.«
2
Teixl eine! Das gibt’s doch nicht!
Sepp Flattacher hob langsam den Kopf vom Gewehr und starrte das Hirschtier an, das keine vierzig Meter von ihm entfernt verhoffte und ihn fragend anblickte.
Er blinzelte.
Das Tier bewegte sich nicht. Völlig ungerührt vom lauten Tuscha stand es weiterhin breit da. Nicht der geringste Hinweis auf ein Schusszeichen.
Sepp war ebenso festgefroren. Seine linke Hand umklammerte noch immer den in den Boden gerammten Stock, den er als Auflage verwendet hatte, um einen vermeintlich todsicheren Schuss abzugeben. Das hat’s noch nie gegeben. Das konnte es nicht geben. Das durfte nicht sein!
Gfalt!
Er, Sepp Flattacher, hatte ein Hirschtier auf vierzig Meter nicht getroffen!
Dessen Lauscher zuckten.
Ein nicht unweit abgegebener Schuss erlöste Sepp aus seiner Schreckstarre. Völlig ferngesteuert knickte er seine Ferlacher Bockbüchsflinte und schob eine neue Patrone ein. Doch bevor er das Gewehr erneut anlegen konnte, schnaubte das Hirschtier und sprang durch das dichte Gebüsch ab.
»Treffen liegt bei Villach, und Villach ist nicht da! Ha, hast gfalt? Ausgerechnet du?«
Und ausgerechnet der Brugger Toni hatte es mitbekommen, der ein paar Meter weiter den Forstweg hinauf abgestellt worden war. Statt auf seinem Stand zu bleiben, schlenderte er in aller Ruhe ganz gemütlich zu ihm her.
Zugegeben, Toni gehörte zu jener Handvoll Mitglieder des Jagdvereins Hubertusrunde, die Sepp noch am ehesten ertragen konnte. Sofern er keinen Rausch hatte, konnte man halbwegs normal mit dem Toni reden. Aber wenn Sepp einmal in seinem langen Leben ein peinliches Malheur passierte, wollte er gar keine Zeugen.
»Bist zu hoch abgekommen, Sepp?«
Und er wollte vor allem nicht darüber reden.
»Oder«, Toni keuchte entsetzt, »hast eppa gemuckt?«
Scharf sog Sepp die Luft ein. Er und mucken! Er hatte Nerven wie … wie … Eisenbahnschwellen, da kniff er beim Abdrücken doch nicht die Augen zusammen. Nein, er hatte kein Problem damit, durchs Feuer zu schauen! Als ob er sein Ziel jemals aus dem Blick verlieren würde. Er nicht! Eine Frechheit war’s vom Toni, so etwas auch nur zu vermuten.
»Also? Was war? Ha?«
Toni verstand nur eine klare Sprache. »Halt doch dei bledePappm!«
Die Hubertusjagd war für Sepp gelaufen. Langsam packte er seine Sachen zusammen. Am liebsten wäre er nach Hause gefahren, um seine Wunden zu lecken. Wie konnte er faln? Er! Auf vierzig Meter! An jedem anderen Tag des Jahres hätte er das Weite gesucht.
Doch am heutigen 3. November folgte auf die traditionelle Treibjagd die ebenso traditionelle Hubertusmesse in der Obervellacher Schattseiten. Das war ein Pflichttermin für jeden gestandenen Jäger, der die grüne Tracht mit Stolz trug. Da hätte es keines SMS – oder drei – durch Irmgard Leitner bedurft, die ihre Schäfchen ermahnt hatte, ja zu kommen. In rund zwei Wochen konnte sie ihren ersten Jahrestag als Obfrau feiern. Sepp erinnerte sich nur zu gut daran, wie sie im letzten November davon gesprochen hatte, frischen Wind in den Jagdverein bringen zu wollen. Von wegen frischer Wind. Ein Wirbelsturm war’s! Darauf hätte Sepp verzichten können.
Warum konnte nicht alles so bleiben, wie es immer gewesen war? Kruzitürken, sie waren ein Jagdverein; sie wollten jagen. Punkt. Was brauchten sie da Öffentlichkeitsarbeit, und warum sollten sie netzwerken? Aber nein, Irmi hatte ihren Sturschädel durchgesetzt und beispielsweise erreicht, dass sich der Jagdverein mit einem eigenen Stand am großen Erntedankfest der Marktgemeinde Obervellach beteiligte. Es gab ein zünftiges Hirschgulasch, das Irmi im gusseisernen Kessel am Dreibein über offener Flamme gekocht hatte. Das war gar nicht schlecht gewesen, also, das Gulasch. Da hatte sich Sepp sogar einen zweiten Teller genehmigt. Aber ehrlich gesagt hätte er das Essen mehr genossen, wenn ihm nicht die anderen Jäger zu dicht auf den Leib gerückt wären. Und auf die vielen Besucher, die das Spektakel mit Umzug und Tamtam angelockt hatte, hätte er gut und gern auch verzichtet. Das Gulasch, a resche Semmel dazu und ja, die Irmi. Das wär’s gewesen.
Wenig später zeigte sich bei der Streckenlegung, dass weder die Mitglieder der Hubertusrunde noch die zur Treibjagd eingeladenen Jagdgäste viel Anblick gehabt hatten.
»Bescheiden ist sie, die Strecke«, meinte Jagdleiter Karl Hartmann bedächtig. »Aber solange kein Treiber dabei liegt, ist’s immer gut. Haha!«
»Viel ist nicht«, gab Toni seinen völlig überflüssigen Senf dazu. »Wir hätten ja ein Stück mehr, wenn der Sepp –«
»Hardigatte!«, unterbrach Sepp ihn hastig. »Wer hat den Schmalspießer da geschossen? Wer?«
Er zeigte auf einen jungen Hirsch, der wie die anderen erlegten Tiere auf Fichtenästen gebettet am Boden lag. Die Schulter wies einen sauberen Schuss auf.
»Ähm … das war ich.« Vinzenz Hinteregger hob zaghaft die Hand.
»Ah, unser Herr Kassier«, schoss sich Sepp auf den Übeltäter ein.
»Was passt denn nicht?«
»Was nicht passt? Sag, gehst du in deinem Job auf der Raiffeisenbank auch so schlåmpat mit Zahlen um? Kennst den Unterschied zwischen zwanzig und dreißig, Vinzenz?«
Umringt von den anderen Jägern und unter Beschuss, kam die Antwort als vorsichtige Frage heraus. »Ja?«
»Und, wie viel hat der Schmalspießer auf?«
»Ähm …«, stotterte Vinzenz.
»Ähm? Ist das deine kompetente Antwort, wenn wer wissen will, wie viele Zinsen es gibt? Reini, geh her da und sag’s uns.«
Reinhard Hader, mit Mitte zwanzig mit Abstand der Jüngste in der Runde und erst seit letztem Winter auf Sepps Fürsprache hin Jagdvereinsmitglied, beugte sich über den Hirsch und kniff ein Auge zu. »Fünfundzwanzig, nein, eher dreißig Zentimeter.«
»Und was haben wir ausgemacht für die heutige Treibjagd? Wie viel dürfen die Schmalspießer maximal aufhaben?« Sepp kam so richtig in Fahrt.
»Zwanzig Zentimeter«, kam es sofort wie aus der Pistole geschossen.
Mit Reinis Antworten zufrieden, nickte Sepp. Immerhin war der Jungjäger durch seine harte Schule gegangen, war sozusagen sein Lehrbua gewesen. Von der Pike auf hatte Reini bei ihm das Waidwerk gelernt.
»Siehst den Unterschied, Vinzenz?«
»Das ist doch keine große Sache. Die paar Zentimeter –«
»Ein paar Zentimeter mehr oder weniger entscheiden, ob du a Prinz bist oder a Prinzessin!«, schnauzte Sepp Vinzenz an.
Bockig wie ein kleines Kind schob der Schuldige sein Kinn vor.
»Jetzt lasst uns kein Drama daraus machen«, mahnte Irmi, deren Stimme als Obfrau immerhin auch ins Gewicht fiel.
Sepp sah sie an und bemerkte zu seinem Ärger, dass sich der Wichtschas Haribert Maierbrugger unter die Umstehenden gemischt hatte und sich auffällig unauffällig an Irmi heranschob. Der Herr Rechtsanwalt hatte im Jagdverein keine offizielle Funktion und würde, solange Sepp ein Wörtchen mitzureden hatte, auch nie was werden. Allerdings versuchte er bei jeder Gelegenheit, sich vor Irmi aufzuplustern.
»Juristisch gesehen, also vom Jagdgesetz her, fallen die Schmalspießer alle in dieselbe Kategorie«, riss er, wie zu erwarten war, groß die Klappe auf.
»Na und? Wir haben vereinbart, dass heute zwanzig Zentimeter die Obergrenze sind. Oder brauchen wir keine Regeln mehr? Schießt ab jetzt jeder, was er will? Nicht mit mir als Aufsichtsjäger!«
»Nun, so viel drüber ist der Hirsch ja nicht. Da kann man sich beim Ansprechen schon vertun«, versuchte sich Karl als Streitschlichter.
»Ein echter Jäger hat ein ordentliches Augenmaß.« Sepp wandte sich an Reini: »Sei so guat und hol eine Zeitung.«
Er ignorierte die hitzige Diskussion der anderen, wie genau man auf hundert Meter durchs Zielfernrohr einschätzen konnte, ob das Geweih fünf Zentimeter mehr oder weniger lang war. Erst als Reini zurückgehetzt kam und ihm die »Kleine Zeitung« in die Hand drückte, ergriff Sepp wieder das Wort.
»Schau her da, du Schlåmpatatsch«, forderte er Vinzenz auf. »Das sind zwanzig Zentimeter« – er hielt die Zeitung quer, dann stellte er sie auf – »und das dreißig. Den Unterschied sieht man.« Sepp rollte die Zeitung zusammen und knallte sie dem anderen vor die Brust.
»Geh, Sepp, du bist ein so ein I-Tüpfel-Reiter!«, klagte Vinzenz. »Ein bisserl mehr –«
»Bewirb dich als Verkäufer beim Spar. Hinter der Wursttheke kannst fragen, ob’s a bisserl mehr sein darf. Bei mir gibt’s das nicht.«
»Und? Der Hirsch liegt da. Jetzt können wir nichts mehr machen.« Als Jagdleiter machte Karl alles andere als eine gute Figur. Entscheidungsfreudigkeit und Durchsetzungskraft waren noch nie seine Stärken gewesen. Aber wozu gab es eine Obfrau?
»Irmi, ich beantrage, dass wir den Vinzenz vereinsintern ein Jahr auf männliches Schalenwild sperren, damit er’s sich merkt.«
»Was?«, schrie Vinzenz.
»Ist das nicht etwas übertrieben, Sepp?«, zauderte Irmi.
»Keineswegs. Es geht schließlich um unsere Zukunft. Aber von vorausschauender Planung hat ein Bankmensch wie der Vinzenz natürlich keine Ahnung. Sonst täten die ganzen Banken ja nicht dauernd tschare gehen.«
»Also wirklich«, protestierte Vinzenz halbherzig.
»Schauts euch den Schmalspießer an. So ein starkes Stück und so viel auf! Das war ein Zukunftshirsch. Mit zehn Jahren wäre das ein Einserhirsch gewesen. Oder interessiert das außer mir keinen?« Er verschränkte die Arme vor der Brust und starrte einen nach den anderen an.
»Wissts was, der Vinzenz zahlt eine Runde und es passt«, schlug Karl vor.
Die anderen nickten zustimmend; niemand heftiger als Toni Brugger.
»Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen!«, beharrte Sepp.
»Reden wir ein anderes Mal weiter, Sepp«, wiegelte Irmi ab. »Schauts, der Herr Pfarrer will mit der Messe anfangen.«
Tatsächlich schaute der Pfarrer, der mit seinem weißen Talar und der giftgrünen Stola aus der dunkelgrün gewandeten Masse geradezu herausstach, zu ihnen und klopfte vorwurfsvoll auf sein linkes Handgelenk. Dann zog er sich mit den beiden Ministrantinnen in das kleine, von einem hölzernen Jägerzaun gebildete Viereck zurück, in dem sich die Hubertuskapelle befand. Sie war dem Anlass entsprechend mit Nadelbaumzweigen sowie Tirkntschurtschen geschmückt.
Etwas Gutes hatte die Sache mit dem Schmalspießer: Das von Sepp gfalte Hirschtier juckte niemanden mehr.
Mit den anderen schlenderte er zu den vor der Kapelle aufgestellten Bierbänken, die sich langsam füllten. Dabei hätte ihn der Maierbrugger fast über den Haufen gerannt. Ungläubig beobachtete er, wie der Herr Doktor – natürlich in der ersten Reihe – umständlich ein aufblasbares Ansitzkissen auf der Holzbank platzierte. Dann faltete er eine grau karierte Decke nochmals zusammen.
Sepp trat an ihn heran. »Was wird denn das, wenn’s fertig ist?«
»Hm?« Maierbrugger legte die Decke fein säuberlich auf das Sitzkissen. »Du, die Bank ist so hart …«
Oh. Mein. Gott. Maierbrugger verlieh der Bezeichnung »Weichei« eine ganz neue Bedeutung.
»Spielst jetzt Prinzessin auf der Erbse? Genierst dich nicht vor den anderen Leuten?«, maulte Sepp ihn an. »Sollen wir eppa für deinen knochigen Hintern die Hochsitze mit Polstersesseln ausstatten?«
Der Herr Rechtsanwalt nahm seine Brille ab, prüfte den Durchblick – der fehlte ihm eindeutig! – und setzte sie wieder auf.
»Äh … aber, Sepp, was denkst denn.« Er lachte verlegen. »Das ist doch nicht für mich.«
Sepps Brauen zuckten hoch. Nicht für …
»Irmi!«, rief Maierbrugger und winkte ihr zu. »Ich habe einen Platz für dich reserviert.«
»Geh, sie braucht auf der Bierbank doch kein Kissen«, schimpfte Sepp.
Die Irmi war eine gestandene Jägerin. Doch statt ihm beizupflichten, stemmte sie die Hände in die Hüften und funkelte ihn geradezu böse an.
»Was soll denn das heißen? Willst sagen, dass ich gepolstert genug bin?«
»Was?« Sepp rieb sich den plötzlich schweißnassen Nacken. »A wanscheTudl bist.«
»Na, Irmi ist doch nicht dick!«, warf Maierbrugger im Ton größter Empörung ein.
»Nein, gmiatlich habe ich gemeint. A wansche Tudl eben. Wie sich’s ghört. Nicht so ein Knochengestell, bei dem der Fetzn lei anstandshalber mitgeht.«
Sie presste die Lippen zusammen, schüttelte den Kopf und setzte sich auf die von Maierbrugger ausgepolsterte Bank.
»Ma, wie bequem. Danke, Haribert! Du bist halt ein Kavalier der alten Schule. Gentlemen gibt’s heute leider viel zu selten.«
Wenn Maierbrugger noch näher an Irmi heranrücken würde, würde er auf ihrem Schoß sitzen. Dass der mehr von der verwitweten Jägerin wollte, sah ein Blinder.
»So was Ånghabiges«, murmelte Sepp verärgert und ging zur hintersten Bank.
Ein wenig mehr Abgeschiedenheit täte der Hubertuskapelle Sepps Meinung nach gut. So war das Ensemble zwischen der Waldschenke Hadt und einem großen Nutzbau eingepfercht. Nur wenn man sich richtig hinstellte, konnte man die Gebäude ausblenden und die Kapelle – wie es sich gehörte – mit Bäumen als Hintergrundmotiv genießen. Umso schöner war jedoch der Ausblick, den man von hier über Obervellach hatte, bis hinunter zum Danielsberg. Eine eindrucksvolle Kulisse, die er jetzt leider nicht in Ruhe genießen konnte.
Toni spielte heute Klette. Verschwörerisch stieß er ihm den Ellenbogen in die Rippen. »Der Maierbrugger jagt Stöckelwild. Stöckelwild! Verstehst?«
Nur gut, dass Sepp als ehemaliger Eisenbahner Erfahrung darin hatte, lästige Menschen wie Toni beinhart zu ignorieren. Das war eine seiner ersten Lektionen gewesen, als er vor vielen Jahren zu den Österreichischen Bundesbahnen gekommen war. Wer seine Ohren nicht auf Durchzug schalten konnte, war am Schalter schlichtweg verloren. Wann fährt der nächste Zug? Wartet der Anschlusszug auch sicher? Vielleicht noch Extrawünsche wie eine Sitzplatzreservierung im Nichtraucherabteil? Oder die im hysterischen Tonfall geäußerte Standardfrage am Gepäckschalter: Wo ist mein Koffer?
»Man muss die Leute zu mehr Selbstständigkeit erziehen«, hatte Fritz Klampferer, der in den sechziger und siebziger Jahren am Villacher Hauptbahnhof den hoffnungsvollen Nachwuchs einschulte, täglich gepredigt. »Sonst hat man nie seine Ruhe.«
Ja, der Klampferer, der war schon ein Vorbild gewesen. Der hatte nicht einmal aufgeschaut von seinem Kreuzworträtsel, wenn eine Kundschaft vor ihm stand und etwas wissen wollte.
Die monotone Leier des Pfarrers half Sepp beim Abschalten. Mit geschlossenen Augen atmete er tief durch und stellte sich die entscheidende Frage: Warum zum Teufel hatte er das Hirschtier nicht getroffen? Stimmte etwas mit seinem Gewehr nicht, war die Optik beschädigt? Die Montage? Anders konnte sich Sepp den Fehlschuss nicht erklären. Ehebaldigst würde er das am Schießstand überprüfen.
»Und jetzt stimmen unsere geschätzten Jagdhornbläser aus dem Katschtal noch ein Liadle an«, verkündete der Hegeringleiter und klang dabei weit salbungsvoller als zuvor der Pfarrer.
»Noch ans?« Toni stöhnte laut genug auf, dass sich sogar die Leute in der ersten Reihe nach ihm umdrehten.
»Pst! Reiß di zåm«, zischte Sepp ihm zu.
Er fühlte Irmis vorwurfsvollen Blick; er brannte förmlich auf seiner Haut. War er denn seines Jagdkameraden Hüter? Mit zusammengekniffenen Lippen griff er in die Jackentasche, zog sein Frakale heraus und bot es dem anderen an.
»Pfui Teifl! Ist das wieder dein grauslicher Enzianschnaps?«
Eindeutig: Toni und er hatten schon viel zu viele Treibjagden zusammen erlebt. Nur unerfahrene Jagdgäste und neue Treiber – oder schier Verzweifelte – griffen nach Sepps mittlerweile schon berüchtigtem Schnapsflascherl.
»Willst oder willst nit?«
Toni griff zu.
Endlich sprach der Hegeringleiter die erlösenden Worte: »Jetzt gehen wir zum gemütlichen Teil über.«
Bedauerlicherweise hatte die Waldschenke als Jausenstation zugesperrt; heute hatte sie nur ausnahmsweise anlässlich der Hubertusmesse ihre Pforten geöffnet. Und richtig gemütlich fand Sepp den gemütlichen Teil nicht, den er pflichtschuldig zwischen seinen Vereinskollegen Karl und Toni absaß. Der einzige Lichtblick am Tisch war Reini. Karl hatte zwar auch Vinzenz eingeladen, sich zu ihnen zu setzen, aber nach einem Blick auf Sepp hatte der doch eins und eins zusammengezählt und sich einen weit, weit entfernten Platz gesucht.
Das war nicht Sepps Tag. Nicht einmal das Essen war ihm vergönnt.
»Was hör ich? Du hast ein Tier verfehlt?«
Dröhnte Karls Stimme immer so laut? Warum konnte Toni nicht einfach den Mund halten, sein Bier saufen und Sepp in Ruhe lassen?
Stattdessen setzte er noch eins drauf: »Ja, auf sechzig, siebzig Meter!«
Sepp schaufelte sich eine Gabel voll Sauerkraut in den Mund. Er sah keinen Grund, Toni zu korrigieren. Seine Jagdkameraden hatten es eindeutig nicht mit Längenangaben, was ihm in diesem Fall nur recht sein konnte. Vierzig Meter! Noch peinlicher ging es fast nicht.
»Ist das zu fassen!« Karl schüttelte den Kopf wie der verstaubte Wackeldackel, der seit Ewigkeiten auf seiner Hutablage saß. Jedes Mal, wenn Sepp zufällig hinter Karl fuhr, zipfte ihn das Glumpat an.
»Geh, das ist doch keine große Sache«, mischte sich Reini ein. »Es hat doch schon jeder was verfehlt. Was soll’s?«
Karl nickte bedächtig. »Bei jedem lassts amål noch. Wir werden hålt a nit jünger, ga, Sepp?«
Vom Selchwürstl hatte er ein zu großes Stück erwischt; fast blieb es Sepp im Hals stecken. Er schluckte schwer.
»Die Optik muss was haben«, murmelte er. »Oder vielleicht war die Ladung von der Patrone nicht in Ordnung. Ein Fabrikfehler.«
»Hm.« Karl schürzte die Lippen und stierte ihn an. »Warst schon beim Augenarzt? Ich mein, es ist ja ganz normal, wenn man in unserem Alter eine Brille trägt. Ich mein, ich brauch nur eine zum Lesen. Aber –«
»Meinen Augen fehlt nix!«
»Na, musst ja nicht gleich angfressen sein.«
Sepp warf das Besteck auf den Teller und wischte sich den Mund ab.
»Bei solchen Waidkameraden muss man an Grale kriegen, ist doch wahr.«
Abrupt stand er auf. Beim Gehen kam er an dem Tisch vorbei, an dem Irmi und Maierbrugger saßen und die Köpfe zusammensteckten. Sepp runzelte die Stirn. Seinen Ohren fehlte zum Glück genauso wenig wie seinen Augen.
»… dem Nachwuchs unser jagdliches Wissen vermitteln …«, hörte er Irmi sagen.
»… wer wird die Aufsicht …«
Was, Aufsicht? Der Aufsichtsjäger im Jagdverein war immer noch er! Wenn Maierbrugger glaubte, er könnte Sepp aufs Abstellgleis schieben, hatte er sich getäuscht.
»… großartig, wenn du das mit mir zusammen übernimmst, Haribert …«
Aber sicher nicht!
Ohne zu zögern, trat Sepp an den Tisch heran, zog einen freien Stuhl heraus und ließ sich darauf niederplumpsen. »Vergessts nicht, dass ich auch noch da bin!«, knurrte er böse.
»Sepp? Ich hätte nicht gedacht, dass dich die Nachwuchsförderung interessiert.« Ganz unschuldig tun konnte die Irmi.
»Im Gegenteil, die liegt mir sehr am Herzen. Schau dir an, was aus meinem Reini geworden ist.«
Als ob Sepp nicht danebensitzen würde, wandte sich Maierbrugger mit gesenkter Stimme an Irmi. »Meinst denn, dass der Sepp dafür geeignet –«
»Besser als du bin ich allemal! Wem willst denn du was über die Jagd beibringen? Du hast doch keine Ahnung vom Tuten und Blasen. Ich jage seit fünfzig Jahren. Ich hab schon mehr vergessen, als du jemals glernt hast!«
»Hast denn nächsten Donnerstag Zeit, Sepp?«, fragte Irmi.
»Selbstverständlich.«
»Das ist der Vorteil, wenn man in Pension ist«, stichelte Maierbrugger. »Ich bin als Anwalt in meiner Kanzlei ja noch voll eingeteilt.«
»Dann ist es für dich eh besser, wenn du dich um deine Paragrafen kümmerst und ich mit der Irmi … das … die Nachwuchsförderung übernehme.«
»Gut, dann treffen wir uns am Donnerstag um neun auf dem Parkplatz vor dem Gemeindeamt, Sepp.«
Sepp grinste. Den Juristenheini hatte er elegant in die Schranken verwiesen.
»Ach, und wegen der Homepage für den Jagdverein«, hob Maierbrugger an.
»Was brauchma als Verein eine Homepage?«, brauste Sepp auf.
Maierbrugger sah ihn über seine Brille hinweg oberlehrerhaft an. »Irmi will eine für die Öffentlichkeitsarbeit.«
»Wir müssen uns als Verein präsentieren. Dazu gehört im 21. Jahrhundert nun mal ein Webauftritt«, erklärte Irmi.
»Das haben wir noch nie gebraucht und –«
»Sepp, sei doch nicht so åltfatrisch!«
Unsinn! Er war keineswegs der Zeit so hintennach wie der Obfraustellvertreter Karl Hartmann, der sich als gelernter Maurer was darauf einbildete, noch nie in seinem Leben einen Computer angefasst zu haben. Sein Enkel hatte ihm ein Seniorenhandy gekauft, und selbst mit dem war Karl überfordert. Hingegen war Sepp, bevor er sich im Alter von zweiundfünfzig Jahren von den ÖBB in den Ruhestand verabschiedet hatte, noch dazu gezwungen gewesen, sich im Berufsleben mit der modernen Technik auseinanderzusetzen und einen PC zu bedienen. Auch das Internet war ihm nicht fremd. Nur hatte er nie das Bedürfnis verspürt, sich privat einen Computer anzuschaffen. Er konnte gut ohne WWW, E-Mail und weiß der Kuckuck was leben. Mochten andere davon schwärmen, wie praktisch es doch war, sich Unterlagen zu mailen oder Fotos am Smartphone zu erhalten – solange er ohne den Schas auskommen konnte, würde er das tun.
»Ohne Internet läuft heutzutage nichts mehr«, bemerkte Maierbrugger.
»Dann geh doch im Internet auf die Jagd und überlass den Wald den echten Jägern.«
Der Wirt trat zu ihnen heran und fragte nach weiteren Wünschen.
»Eine Runde noch, geht auf mich«, antwortete Maierbrugger. »Für den Sepp hier bitte einen Asbach Uralt. Der passt zu ihm.«
So ein Arsch! Dabei war Sepp gerade mal sechs Jahre älter als der zweiundsechzigjährige Maierbrugger. Und die Irmi war siebenundfünfzig. Das wusste Sepp, weil er – rein zufällig – beim Durchblättern der Jagdvereinsunterlagen über ihr Geburtsdatum gestolpert war und es sich gemerkt hatte.
»Weißt, Irmi, die Homepage-Programmierung könnte ich übernehmen. Ich kenn mich gut mit dem Computer aus«, machte Maierbrugger auf jung und dynamisch.
Lächerlich machte er sich damit!
Maierbrugger holte sein Smartphone heraus und zeigte Irmi ein paar Seiten anderer Jagdvereine.
»Das schaut doch gut aus. Oder was meinst du, Sepp?«, versuchte Irmi ihn miteinzubeziehen.
Richtig provokant und sichtlich widerstrebend hielt Maierbrugger ihm das Handy für den Bruchteil einer Sekunde unter die Nase. Am liebsten hätte Sepp es ihm aus der Hand gerissen und in seinem Glas versenkt!
»Liebe Irmi, darf ich dich nächste Woche mal auf ein exquisites Steak ins Restaurant GrillKunst einladen? Dann können wir in Ruhe die Details besprechen, nur« – Maierbrugger beugte sich weiter vor und zeigte Sepp die kalte Schulter – »wir zwei.«
»Gern«, stimmte sie sofort und mit einem Lächeln zu.
Sepp klopfte mit seinen Fingerknöcheln auf den Tisch und verabschiedete sich knapp.
Das Stamperl mit dem Asbach Uralt ließ er stehen.
Das passte nicht zu ihm.
3
Blut ist dicker als Wasser. Bla, bla, bla. Irmi versuchte mit diversen Strategien der Selbstmotivation, sich die Situation schönzureden. Aber wenn sie ganz ehrlich war, trieb sie allein das Pflichtgefühl an diesem Sonntagnachmittag nach Leutschach.
Ihr Großonkel Gerfried Ragger feierte heute seinen fünfundachtzigsten Geburtstag und hatte sie in den letzten Tagen mehrmals angerufen, um nachzufragen, ob sie wohl käme. Ganz untypisch war es für ihn, zum Telefon zu greifen, und er hatte einen nahezu ängstlichen Eindruck gemacht. Vom Sterben hatte er geredet, aber das war in seinem Alter wohl auch nachvollziehbar.
Im eigentlichen Sinn feiern würde der alte Griesgram kaum. Warum er sie also unbedingt dabeihaben wollte, konnte sie sich nicht erklären. Aus seinen Andeutungen, dass er dringend unter vier Augen mit ihr reden müsste, war sie nicht schlau geworden. Mit dem Alter wurden sie eigen, die Leute. Dennoch gehörte es sich, ihm die Aufwartung zu machen und ihm zu gratulieren.
Nachdem sie vor dem Stall eingeparkt hatte und ausgestiegen war, sah sie nachdenklich zur Keusche hinüber, die seit sie zurückdenken konnte, den Altbauern als Auszugsstiberl gedient hatte. Früher hatte es ihre Großmutter bewohnt, nun lebte Gerfried darin. Es war ein wenig abseits gelegen; um es zu erreichen, musste man den Gemeindeweg überqueren sowie einen hölzernen Steg über den schmalen Bach, der vom Pfaffenberg herunterrann. Von der hiesigen Seite konnte man gar nicht mit dem Auto zufahren. Als damals für die Großmutter die Rettung gebraucht wurde, musste diese über die Gratschacher Seite herauf- und über den Grund des Nachbarn fahren. Das Auszugsstiberl war in traditioneller Blockbauweise errichtet worden, das Holz beinahe schwarz, wovon sich die mit weißem Kalk gestrichenen Fugen umso markanter abhoben. Mit den grünen Balken vor den winzigen Fenstern war es ein richtiges Knusperhäuschen.
Irmi hob den schweren Geschenkkorb vom Rücksitz, überlegte kurz, ging dann aber zuerst ins Haupthaus. Sie war auf dem Gehöft der Familie Ragger vulgo Lerchbauer aufgewachsen. Wirklich zu Hause hatte sie sich hier jedoch nie gefühlt, sondern ein bisserl wie ein Fremdkörper. Dabei war sie keine Zuagraste, sondern wie ihre Mutter Linde eine geborene Ragger. Irmi war eine ledige Tochter. Nicht, dass das etwas Besonderes gewesen wäre. In Kärnten waren außerhalb des Ehebetts beziehungsweise vor der Hochzeit geborene Kinder – man sprach auch von einer Kärntner Hochzeit, wenn die Braut zumindest schwanger vor den Altar trat – eher die Regel als die Ausnahme. Das wäre nicht das Problem gewesen.
Das Problem war, dass es eine Hochzeit hätte geben sollen. Linde Ragger war eine stolze, junge Bauerntochter; auf leichtfertige Bettgeschichten hätte sie sich nie eingelassen. Zur Freude ihrer Eltern und auch der künftigen Schwiegereltern war sie mit einem benachbarten Bauernsohn verlobt, der als Ältester einmal den dortigen Hof übernehmen sollte. Eine gute Partie. Mehr noch: Linde hatte Oswin ihr Herz geschenkt, und er hatte ihr seine Liebe geschworen. Verständlich, dass sie mehr als unschuldige Zärtlichkeiten austauschten, oder? Sie wollten ja heiraten, so bald wie möglich. Doch dazu kam es nie.
Erst sehr viel später, als Irmi alt genug war, entschieden Antworten einzufordern, hatte sie herausgefunden, was passiert war. Noch jetzt zerriss es ihr das Herz, als sie sich daran erinnerte, wie sich die Mutter damals die Hände vors Gesicht geschlagen und bitterlich zu weinen begonnen hatte.
»Jetzt sag doch. Ich habe ein Recht darauf, es zu erfahren! Habt ihr euch gestritten?« Weltklug, wie man sich nur als Teenager fühlte, hatte Irmi beharrlich nachgebohrt. »Hat er eine andere gehabt … oder du …?«
»Nichts davon.«
Ein Feld. Ein fruchtbares Feld im Tal unten war schuld gewesen. Die Mutter hatte es ihr sogar gezeigt, mit eigenen Augen hatte Irmi das Stück Dreck gesehen, das so viel Leid verursacht hatte. Oswins Vater hatte es als Teil der Mitgift gefordert, Irmis Großvater Rochus Ragger hatte es nicht hergeben wollen. Immer wieder war der Hochzeitstermin verschoben worden, da sich die Familienoberhäupter nicht einig werden konnten. Selbst als Linde schon hochschwanger war, hatte keiner der beiden Bauern nachgegeben.
»Dann ist’s nix geworden mit der Hochzeit«, hatte die Mutter unter Tränen geflüstert, Irmi hatte mitgeheult.
»Aber warum hat Oswin« – Papa hatte sie ihn nicht nennen wollen – »sich nicht durchgesetzt? Wenn er dich geliebt hat und du ihn?«
Schluchzend hatte sie in den Armen ihrer Mutter gelegen. Sie hatte es nicht begreifen können. Überwand Liebe nicht alle Hindernisse? Was zählte ein blödes Feld, wenn zwei Menschen zusammen sein wollten? Sie hatte so eine Wut im Bauch gehabt, so eine Mordswut. Wenn es möglich gewesen wäre, hätte sie ihren Erzeuger schon damals zur Rede gestellt, ihm seine Schwäche vorgeworfen und ihm auf den Kopf zugesagt, was für ein feiger Hund er gewesen war, dass er sich nicht gegen seine Eltern durchgesetzt und für seine Linde gekämpft hatte! Sie hasste ihn! Sie verachtete ihn. Nur sagen konnte Irmi ihm das nicht mehr, ihrem leiblichen Vater, den sie wie jeden x-beliebigen Nachbarn gegrüßt hatte, der ihr nie ein Vater gewesen war, denn Oswin war bei einem Traktorunfall tödlich verunglückt. Doch vor ihrer Mutter hatte sie ihren Zorn nicht zurückhalten können.
»Ach, Irmi, er hat ja auch nix dafür können. Sein Vater war der Bauer, und er bestand darauf, dass er das Feld kriegt.«
»So ein gieriger Arsch!«
»Ein Scheit allein brennt nicht. Er wollt das Land haben, meine Eltern wollten es nicht hergeben. So war’s.«
Irmi hatte ihre Mutter bei der Schulter gepackt und ihr ins Gesicht gesehen. »Und du? Warum hast du nicht versucht, Oma und Opa umzustimmen?«
Wenn Irmi früher etwas haben wollte, ließ sie nicht locker, wie bei den Plateauschuhen, die sie bei einer Freundin gesehen hatte. Da ging es nur um dumme Schuhe. Wie hartnäckig würde sie erst sein, wenn die große Liebe auf dem Spiel stand?
»Was glaubst denn du? Alles habe ich versucht, alles.« Der Mutter war die Stimme weggebrochen. »Gebettelt und geweint und ihnen alles versprochen. Alles hätte ich gegeben …«
An den Großvater konnte sich Irmi nicht erinnern; wenn er aber Großonkel Gerfried ähnelte, dann musste er ein kalter, barscher Mann gewesen sein. Sie konnte sich gut vorstellen, dass er zu stur war, um ein Feld herzugeben, obwohl er genug Land hatte.
Und die Großmutter, Maria Ragger? Ja, sie war streng und kannte nichts als Arbeit. Sie war eine harte Nuss, aber durchaus zu knacken, wie Irmi wusste, als sie an die Plateauschuhe in ihrem Kasten dachte. Sie hatte so lange gepenzt, bis ihr die Oma das Geld dafür in die Hand gedrückt hatte, um endlich ihren Frieden zu haben.
»War denn die Oma nicht auf deiner Seite? Sie hat sich doch beim Opa für dich eingesetzt, oder nicht?« So wie Irmi das von ihrer Mutter kannte, die sich für sie stark machte und die sie nie, nie, nie im Stich lassen würde. »Nein?«
Irmi hatte geschluchzt und verständnislos den Kopf geschüttelt. »Aber es ging doch um deine große Liebe! Und … und mich auch … ich bin ja auf die Welt gekommen 1961 …«
Die Mutter hatte ihr über den Rücken gestreichelt, und ihre nächsten Worte hatte sie fast nicht verstanden, so leise hatte die Mama gesprochen.
»Liebe vergeht, Hektar besteht. Das haben s’ gesagt, deine Großeltern.«
Das Geständnis, dass Irmi der Mutter mit so viel Beharrlichkeit entlockt hatte, erwies sich als zweischneidiges Schwert. Einerseits wusste sie mehr über ihre Herkunft, andererseits fiel es ihr schwer, nun der Oma noch unbeschwert entgegenzutreten. Noch schwerer war es, das Versprechen zu halten, dass die Mutter ihr abgerungen hatte: Kein Wort darüber zur Oma. »Das alles ist lange her und vorbei. Es hat keinen Sinn, alte Wunden aufzureißen.«
Aber manche Wunden verheilten nicht. War es das offene Gespräch mit ihrer pubertierenden Tochter gewesen, das Linde Ragger darin bestärkte, sich vom Elternhaus abzunabeln? Sie hatte wenig später eine Anstellung bei der Oberkärntner Molkerei in Spittal gefunden und, mit Irmi im Schlepptau, dem heimatlichen Hof ein für alle Mal den Rücken gekehrt. Das musste 1975 gewesen sein.
Nur einen einzigen Menschen hatte Irmi damals vermisst: Edeltraud Ragger.
Umso mehr freute sie sich, dass sie Traudl jetzt und noch dazu allein in der großen Küche antraf. »Grias di!«
»Irmi!« Traudl zog sie in eine rasche Umarmung und schniefte. »Ma, du hast dich lang nicht sehen lassen.«
»Na, so lange ist es nicht her …«
»Ostern war’s.«
»Tatsächlich.«
Ach herrje. Wie schnell die Zeit verging.
»Muss ja nicht immer ein Feiertag oder ein Geburtstag sein, damit wir uns sehen, oder?«, sagte Traudl und zuckte die Schultern. »Na, in unserem Alter werden es bald die Begräbnisse sein. Da kommt dann die Familie zusammen, wenn sonst schon nie.«
Traudl hatte recht, wie Irmi sich mit schlechtem Gewissen eingestand. Wenn es keinen besonderen Anlass gab wie den heutigen Geburtstag Gerfrieds, mied sie den Lerchbauer. Bevor sie jedoch – durchaus passend zum tristen Novembertag, an dem sich die Sonne nicht zeigen wollte – noch weiter in düsteres Sinnieren abgleiten konnte, stieß sie Traudl mit dem Ellenbogen an.
»Ganz recht, Tante«, antwortete sie und zwinkerte.
»Ich geb dir gleich eine Tante!«
Irmi lachte und holte Kaffeehäferln aus dem Schrank. »Aber du bist und bleibst doch meine Tante. Meine Lieblingstante!«
Als Kinder hatten sie sich schwergetan, die Verwandtschaftsverhältnisse am Hof zu durchblicken, bis Großonkel Gerfried an einem Winterabend ein liniertes Blatt Papier genommen und einen groben Stammbaum skizziert hatte.
»So, schauts genau her«, hatte er gesagt. »Das erklär ich euch nur ein Mal! Da fangen wir an, mit meinem Vater, Franz, da teilt es sich.«