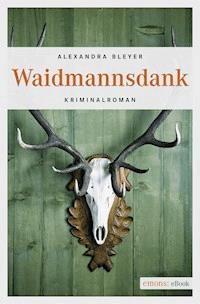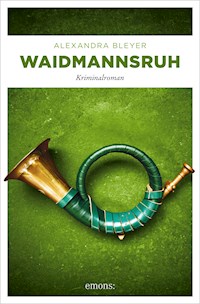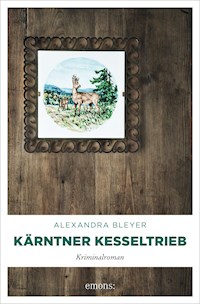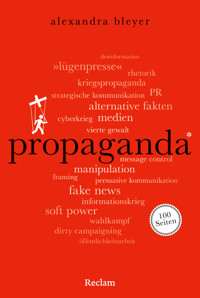Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sepp Flattacher
- Sprache: Deutsch
Schwarzhumorig, skurril und mit viel authentischem Lokalkolorit. Neben Aufsichtsjäger Sepp Flattacher will ein großkopferter Wiener einziehen. Um diese Katastrophe zu verhindern, verbrüdert sich das Mölltaler Urgestein sogar mit seinem verhassten "zuagrasten" Nachbarn Heinrich Belten. Gemeinsam blasen die beiden ehemaligen Streithähne zum Abwehrkampf. Doch was als a Hetz und a Gaudi beginnt, wird schnell tödlicher Ernst – denn das organisierte Verbrechen fällt ein ins Mölltal ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 403
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alexandra Bleyer ist verheiratet (natürlich mit einem Jäger) und lebt mit ihrer Familie am Millstätter See. Die promovierte Historikerin ist Autorin mehrerer populärer Sachbücher. In ihren in Oberkärnten angesiedelten Jägerkrimis kann sie ganz ungestraft mörderische Energien freisetzen.
Alle Personen und Handlungen sind frei erfunden und keinesfalls als Abbild der im Mölltal lebenden »echten« Menschen zu verstehen. Etwaige Ähnlichkeiten mit realen Personen sind zufällig und unbeabsichtigt; ebenso spiegeln die aus der Perspektive der Romanfiguren geäußerten Vorurteile beispielsweise gegenüber deutschen Nachbarn oder Wienern keineswegs reale Verhältnisse wider. Wer im Mölltal lebt, kennt es; wer es nicht kennt: Kommen Sie ruhig und lernen Sie es kennen!
Im Anhang findet sich ein Glossar zu Dialektausdrücken und Begriffen aus der Jägersprache.
© 2017 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: willma…/photocase.de
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, Tobias Doetsch
Lektorat: Christine Derrer
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-244-1
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Dieser Roman wurde vermittelt durch die Agentur für Autoren und Verlage, Aenne Glienke, Massow.
Beim Jagan tuat man mehr dasitzen wie dalafn.
Prolog
Die Kapuze seines grauen Sweatshirts über den Kopf gezogen, drückte er sich in einen Hauseingang. Wie ein Dieb. Er warf einen ungeduldigen Blick auf sein Smartphone. Kurz nach zweiundzwanzig Uhr. Er beobachtete das Lokal auf der gegenüberliegenden Straßenseite und trat unruhig von einem Fuß auf den anderen.
Geduld gehörte nicht zu seinen Stärken. Sein Vater hatte ihn oft dafür kritisiert und ihm vorgehalten, wie gut er es doch hatte und wie undankbar er wäre.
Ja, er kannte die Zeiten nicht mehr, als man sich an jeder Schlange anstellte und erst später fragte, wofür eigentlich; als man in den Geschäften nicht aus fünf verschiedenen Joghurts auswählen konnte, sondern froh war, überhaupt eines zu bekommen.
Pah, Geduld war etwas für Feiglinge, für Schwache! Er wusste, was er wollte; und was er wollte, das wollte er sofort. Und er verstand es, es sich zu nehmen.
Er befingerte das Springmesser in seiner Hosentasche. Im rückwärtigen Hosenbund steckte eine Pistole, denn er war darauf vorbereitet, sich sein Recht zu erkämpfen. Er war nicht schwach wie sein Vater, der bei billigem Schnaps und eine filterlose Zigarette nach der anderen qualmend von den Sorgen und Nöten in der damals noch kommunistischen Tschechoslowakei erzählte, nur um im gleichen Atemzug der guten, alten Zeit nachzutrauern.
Zwei Hardcore-Säufer, die sich die letzte Ölung des heutigen Abends gegeben hatten, torkelten aus dem Lokal. Er leckte sich über die rissigen Lippen. Zu gern hätte er sich jetzt eine Zigarette angezündet. Doch das Leben in den Straßen Bratislavas hatte ihn gelehrt, vorsichtig zu sein. Nur Idioten waren so dumm, sich in der Dunkelheit verbergen zu wollen und sich durch eine rot glühende Zigarette zu verraten. Er war nicht dumm. Er war schlau wie ein Fuchs. Er war Lišiak.
Endlich kam er heraus, Gejca Horváth, und machte sich zu Fuß auf den Heimweg. Er löste sich aus dem Schatten und folgte ihm. Mit gut fünfzig Jahren war Gejca fast doppelt so alt wie er und gehörte zum alten Eisen, doch seine Instinkte waren die eines räudigen Wolfes. Unvermutet wirbelte Gejca mit einem blanken Messer in der Hand herum.
»He, ruhig Blut. Ich bin’s!« Er schob die Kapuze ein wenig zurück.
Gejcas Augen weiteten sich kurz, bevor er sie zusammenkniff. »Du hast vielleicht Nerven, hierherzukommen! Ich will mit deinem Scheiß nichts zu tun haben!«
»Na komm, Alter, lass mich nicht hängen! Wir sind doch Freunde!«
»In unserem Geschäft gibt’s keine Freunde! Das solltest du am besten wissen, Ju–«
»Lišiak! Ich bin Lišiak! Merk dir das!«
»Ihr mit euren dämlichen Spitznamen! Wenn du so ein schlauer Fuchs bist, Lišiak« – Gejca spuckte den Namen regelrecht aus – »warum kommst du dann zu mir?«
Lišiak juckte es in den Fingern, ihm hier und jetzt ein Messer zwischen die Rippen zu stoßen und ihm Respekt beizubringen. Doch er war nicht von Wien heim nach Bratislava gekommen, um sich seine Chance zu verderben. Seine einzige Chance.
»Was willst du?«
Es kostete ihn Überwindung, das Wort auszusprechen. »Hilfe.«
»Von mir?« Gejca rieb sich die narbige Wange; seine blassen Augen funkelten im flackernden Licht einer Laterne.
Lišiak ballte die Hände zu Fäusten. Er hatte keine Lust, sich auf Gejcas Spielchen einzulassen, aber ihm blieb keine andere Wahl.
Gejca nickte nachdenklich. »Draks Leute waren schon bei mir. Sie haben nach dir gefragt. Es ist nicht gut, sich gegen die Familie zu stellen, nicht gut. Familie ist wichtig.«
Als ob Gejca dazugehören würde! Sie teilten kein Blut; Gejca gehörte nicht einmal zum inneren Zirkel der Organisation, er war nicht einmal ein Mitläufer. Mehr so ein Nebenherläufer. Nur weil er vor Ewigkeiten eine Zelle mit seinem Großonkel geteilt hatte, zählte er noch lange nicht zur Familie, auch wenn einen ein paar Jahre in einem tschechoslowakischen Knast zusammenschweißten.
»Du musst mir helfen!«
»Muss ich das?«
Wenn er seine Antworten hatte, würde er Gejca zertreten wie einen Wurm! Mühsam rang Lišiak seine Wut zu Boden.
»Bitte.«
»Drak ist wütend. Du hast die Familie bestohlen.«
»Ich kann es wiedergutmachen!« Aber er brauchte jemanden, der vermittelte, ein gutes Wort für ihn einlegte; ihm half, den Schaden zu beheben und sich zu entschuldigen, bevor Drak die Pistole auf ihn richtete und abdrückte.
»Geld wird nicht reichen. Nur Blut kann eine solche Schuld abwaschen«, gab sich Gejca poetisch. »Aber du hast Glück: Du bist Draks Neffe. Blut ist dick. Liefere Drak einen Kopf, und du kannst deinen aus der Schlinge ziehen.«
Lišiak hieb mit den Fäusten gegen die Hausmauer. Musste Gejca wie Yoda aus »Star Wars« klingen?
»Verfickte Scheiße!«
»Drak weiß, dass du nicht allein gehandelt hast. Du hättest dieses Geschäft allein nie durchziehen können. Die Frage ist: Wer trägt die Verantwortung? Denk gut nach, welche Antwort du Drak darauf geben kannst, du schlauer Fuchs.« Gejca grinste, wobei er zwei prominente Zahnlücken enthüllte. Dann machte er auf dem Absatz kehrt und ging davon.
Lišiak sah ihm hilflos nach. »Verdammt, verdammt, verdammt!«
Er wusste genau, was er tun musste, und er hatte keine Skrupel, seinen Partner – Ex-Partner – ins Messer laufen zu lassen. Nur musste er ihn dazu erst einmal finden. Er war abgetaucht. Weg. Fort aus Wien. Niemand wusste, wohin er verschwunden war.
Scheiße! Drak wollte einen Kopf.
Unwillkürlich fuhr sich Lišiak an den Hals. Er schluckte schwer.
Wo hatte er einen Unterschlupf gefunden? Hatte sein Partner nicht einmal etwas von einem Ferienhaus erzählt? In Kärnten. Wie hieß der verfluchte Ort?
Lišiak dachte so angestrengt nach, wie nur jemand nachdenken konnte, dessen Leben davon abhing. Als er verzweifeln wollte, fiel es ihm ein. Er öffnete auf dem Smartphone Google Maps und tippte den Ortsnamen ein: Obervellach.
1
»Belten! Schau, dass zwegnkommst, du terischer Depp, du!«
Sepp Flattacher hielt den Daumen auf den Klingelknopf gepresst, über dem ein gestochen scharfer Schriftzug den Namen des Hausbesitzers verkündete: »Heinrich BELTEN«. Wozu der Nachname in Großbuchstaben gedruckt war, blieb Sepp ein Rätsel. Mit der zur Faust geballten anderen Hand hämmerte er gegen die Haustür. Es war ihm ernst. Wenn der Piefke nicht bald die Tür öffnete, konnte er was erleben! Ungeduldig drückte er sein Gesicht gegen das gelbe Butzenglas. Wenn der Glaseinsatz der massiven Holztür etwas größer wäre, käme er glatt in Versuchung …
Da! War da nicht eine Bewegung? »Mach endlich die Tür auf! Hörst mich?«
»Flattacher? Bist du das?«
Sepp rollte mit den Augen. »Nein, der Krampus mit dem Nikolo wird’s sein!«
Sein Nachbar ließ sich ewig Zeit, den Schlüssel im Schloss umzudrehen und die Tür zu öffnen. Belten war nie ein schöner Anblick. Aber unrasiert und unfrisiert in einem gestreiften Pyjama, dessen grelle Farben einem die Netzhaut verglühten, war er eine Zumutung. Belten gähnte ausgiebig und kam viel zu spät auf die Idee, sich die Hand vor den Mund zu halten. Immerhin wusste Sepp jetzt, dass er zumindest das Gebiss nicht auf dem Nachtkästchen vergessen hatte.
»Du kannst den Finger jetzt von der Klingel nehmen!«
Sepp blinzelte. Dann zog er seine Hand zurück.
»Weißt du, wie zeitig am Morgen es ist? Dein doofes Gebimmel hat mich aus dem Bett geworfen!«
So ein Morgenmuffel! Sepp warf einen flüchtigen Blick auf seine Uhr. »Was regst dich auf! Ich bin schon seit zwei Stunden munter.«
»Hast die senile Bettflucht, was?«
Eine passende Antwort brannte Sepp auf der Zunge, aber dann erinnerte er sich daran, warum er hier war. Mit Belten herumzustreiten stand heute ausnahmsweise nicht auf seiner Agenda. Nein, er war auf Kooperation angewiesen. Immerhin hatten sie ein Problem, das sie nur gemeinsam lösen konnten.
»Ich muss mit dir reden.«
»Und das kann nicht warten bis zu einer vernünftigen Tageszeit?« Belten kratzte sich das stoppelige Kinn.
»Nein, es ist wichtig!«
Als ob er sonst hier wäre! Freiwillig setzte Sepp doch keinen Schritt auf Beltens Grundstück. Ausgenommen blieben vereinzelte nächtliche Einsätze mit Hammer oder Säge, von denen der Nachbar nie etwas mitbekam – bis es zu spät war und er lauthals über massakrierte Sträucher klagte.
»Es geht um deinen Schwiegersohn.«
»Um wen?«
»Nowak!«
»Häh?«
»Das kannst dir nicht gefallen lassen, Belten, hörst? Du musst –«
»Wovon redest du?«
»Ja, Kruzitürken! Wer von uns beiden ist jetzt senil? Du hast mir doch erzählt, dass der Nowak dich ins Altersheim abschieben will, damit er mit Carola und seinen Fråzn hier einziehen kann.«
Belten lehnte sich gegen den Türrahmen und schaute blöd aus der Wäsch. Also, noch dümmer als sonst, falls das überhaupt möglich war. So etwas Begriffsstutziges gibt’s doch gar nicht! Es war doch erst ein paar Tage her, seit Belten weinend durch seinen Garten geschlichen war und gejammert hatte, dass ihn der gemeine Schwiegersohn in eine Seniorenresidenz nach Villach verbannen wollte. Sogar den bunten Hochglanzprospekt hatte er Sepp in die Hand gedrückt. Und jetzt wusste er nichts mehr davon?
Ach herrje! Sepp runzelte die Stirn. War Belten vielleicht dement geworden? War das der Grund, warum seine Familie ihn in ein Heim stecken wollte?
»Anton Nowak, dein Schwiegersohn?« Sepp sprach jedes Wort langsam und betont aus. »Er ist mit deiner Tochter verheiratet, sie heißt Car–«
»Mensch, ich bin doch nicht blöd! Ich weiß, wie meine Tochter heißt! Aber was geht dich meine Familie an?«
Sehr viel, wenn Sepp daran dachte, dass die Wiener Bagage das ganze Jahr über hier wohnen könnte. Beltens Tochter Carola war noch am ehesten auszuhalten, auch wenn sich ihre Stimme schrill überschlug, wenn sie ihre Kinderschar rief. Aber Anton Nowak war ein fleischgewordener Alptraum, ein Paradebeispiel für einen Wiener Wasserkopf, der sich selbst viel zu wichtig nahm und glaubte, alle – inklusive Nachbarn – nach seiner Pfeife tanzen lassen zu können. Der hatte ihm die wenigen Wochen, in denen er bisher in Kärnten Urlaub gemacht hatte, häufiger die Polizei auf den Hals gehetzt als Heinrich Belten in all den Jahren. Sepp graute es schon vor der Ferienzeit, wenn die ganze Sippschaft erneut anrückte. Aber da hatte er zumindest die Gewissheit, dass sie auch wieder abreisen würden.
Heinrich Belten war Sepp zwar auch zuwider, aber irgendwie hatte Sepp sich in den letzten Jahrzehnten an den lästigen Streithansl gewöhnt und konnte sich sicher sein, dass er ihm immer eine Nasenlänge voraus war. Bei Nowak stünden ihm die alles entscheidenden Machtkämpfe wohl noch bevor, bis auch der Toker einsah, dass mit Sepp nicht gut Kirschen essen war und er ihm lieber seine Ruhe lassen sollte.
Außerdem veranstaltete Belten allein nicht wie die drei Kinder den ganzen Tag über eine Metn, dass man durchdrehen könnte und sich selbst Akko unter die Eckbank verkroch. Nein, Belten war eindeutig die bessere Wahl. Das kleinere Übel, wie man oft viel zu leichtfertig aussprach, um dann in der Wahlzelle schier zu verzweifeln.
»Du willst doch nicht ins Heim, oder?«
»Nein, aber –«
»Noch bist ja nicht entmündigt« – Sepp stutzte kurz – »oder doch?«
»Selbstverständlich nicht!«
»Dann wehr dich! Lass nicht zu, dass sie dich ins Altersheim stecken und dein Haus einkassieren. Wir können –«
»Wir?« Belten richtete sich auf und zog sein Pyjamaoberteil straff.
Erst jetzt fiel Sepp auf, dass er es falsch zugeknöpft hatte. So viel zum Thema Pflegeheim.
»Was meinst du mit wir? Es gibt kein Wir!«
Ja, da schaut er groß, der Belten. Sepp grinste breit. Die letzten Tage hatten ihm ganz schönes Kopfzerbrechen bereitet. Der Wiener als Nachbar, was für ein Alptraum! Stundenlang war er abends wach gelegen und hatte gegrübelt. Als er vorhin auf dem Hochsitz saß und die beschauliche Stille des Waldes genoss – diese herrliche Stille, in die nach und nach das frühmorgendliche Vogelkonzert einbrach; eine Stille, von der er sich daheim endgültig verabschieden konnte, wenn die Wiener fix einziehen sollten –, da war ihm der Knopf aufgegangen. Die Lösung lag so nah! Nowak konnte Belten schließlich nicht zwingen, ins Altersheim zu gehen. Belten konnte sich wehren. Also, nicht er allein. Dafür war er zu tepat, der Depp. Aber mit seiner Hilfe! Wenn er ihm sagte, wo’s langging, würde es schon klappen.
Der Gedanke hatte ihn nicht mehr losgelassen. Unzählige Ideen schossen ihm durch den Kopf, so viele Möglichkeiten, um dem Nowak zu zeigen, dass er in Wien sehr viel besser aufgehoben war und in der schönen Mölltaler Bergwelt nichts verloren hatte. So vertieft war Sepp in seine Überlegungen, dass er den Schmalspießer auf der Lichtung erst bemerkte, als dieser äsend bis auf wenige Meter an den Hochsitz herangekommen war. Brettlbreit stand der junge Hirsch vor ihm, als ob er von allein in die Tiefkühltruhe springen wollte. Aber das Aufbrechen des Stückes und das Versorgen des Wildbrets hätte Sepp mindestens eine Stunde gekostet, eher zwei. Zeit, die er nicht verschwenden wollte. Er musste mit Belten reden, sofort.
»Beim nächsten Mal«, rief er dem Hirsch zu, der verschreckt absprang, als Sepp abbaumte. Also, wenn der Schmalspießer nicht vorsichtiger wurde, dachte er beim Hinunterklettern, erlebte er den Beginn der Schonzeit am Jahresende nicht mehr und würde auch nie ein kapitaler Platzhirsch werden, der Rivalen in der Brunftzeit mit tiefem Röhren aus seinem Revier vertrieb.
Ja, und deshalb stand Sepp so früh am Morgen in seiner abgewetzten Lederhose und dem Wetterfleck aus tanngrünem Loden vor Belten, um ihn in seinen großartigen Plan einzuweihen.
»Zusammen fällt uns schon was ein, um dem Nowak einen Strich durch die Rechnung zu machen. Dem werden wir’s zeigen! Der wird –«
»Flattacher.«
»Pass auf! Wenn der Nowak –«
»Flattacher!«
»Kannst mich verdammt noch mal ausreden lassen?«, schimpfte Sepp. So würde das nie etwas werden!
Belten trat einen Schritt zurück. »Verpiss dich!«
Mit einem lauten Krachen fiel die Tür ins Schloss.
Das war doch wohl die Höhe! Heinrich schüttelte den Kopf und schlurfte in seine Küche. Kurz überlegte er, sich nochmals ins Bett zu legen, aber wenn er es recht bedachte, war er nach dem Ärger wach. Was wünschte er sich jetzt eine richtig schöne Tasse Kaffee! Doch Carola hatte ihn beim letzten Besuch darauf hingewiesen, dass er viel zu viel Kaffee trank, und ihm zu Tee geraten. Sie hatte es sich auch nicht nehmen lassen, gleich ein paar Päckchen mit diversen Mischungen einzukaufen und in seinen Küchenschrank zu stapeln. Ganz bewusst vor die verbeulte Kaffeedose mit dem Mohrenkopf.
Manchmal erinnerte ihn seine Tochter so stark an Mutti, dass ihm die Tränen kamen. Wenn nur Mutti noch am Leben wäre. Wenn … Er wusste nicht, was dann wäre, aber er war sich sicher: Wäre seine viel zu früh verstorbene Frau noch am Leben, wäre vieles anders. Besser. Schöner.
Er seufzte und griff nach einer Teepackung. Erdbeertraum. Einerlei. Tee wäre viel gesünder für ihn, für sein Herz und seinen Magen, hatte Carola ihm erklärt. Hmpf. Wenn er ein Magengeschwür bekam, dann sicher nicht vom Kaffee, sondern von Sepp Flattacher.
Mit gerunzelter Stirn setzte er Wasser auf und blieb, die Hände auf die Arbeitsfläche gestützt, beim Herd stehen. Er konnte sich keinen Reim darauf machen, was Flattacher zu seinem unerwarteten – und allein schon von der Uhrzeit her unverschämten! – Besuch bewogen hatte. Der Zaun zwischen ihren Grundstücken hatte schon seinen Sinn. Obwohl seit Jahrzehnten Nachbarn, war es nicht so, dass einer beim anderen anklopfte, um sich Zucker oder Milch zu borgen. Flattacher war gemein und schreckte vor keiner Boshaftigkeit zurück. Wer einen solchen Nachbarn hatte, der brauchte keinen Feind mehr.
Nein, zwischen ihnen gab es keine freundschaftlichen Gefühle. Deshalb wunderte sich Heinrich sehr über Flattachers Aufforderung, er solle sich gegen seine Abschiebung ins Altersheim wehren. Seit wann kümmerte es den, was aus ihm wurde? Ob er in einem Heim versauern sollte oder nicht? Sein Schicksal ging dem doch garantiert am Allerwertesten vorbei. Im Gegenteil, würde er am Boden liegen, würde Flattacher nicht die Rettung rufen, sondern er wäre der Erste, der nochmals kräftig auf ihn treten und ihn verhöhnen würde.
Das Wasser blubberte. Heinrich holte seine bauchige Lieblingstasse mit der Aufschrift »Für den besten Opa der Welt«, hängte den Teebeutel hinein und goss auf. Er stellte die Eieruhr ein, überprüfte nochmals die Anleitung, korrigierte die Minutenzahl – es waren acht Minuten, nicht sieben – und ließ sich dann am Küchentisch nieder.
Was auch immer Flattacher angetrieben hatte, es konnte sich nur um egoistische Motive handeln.
Die Eieruhr klingelte. Er stand auf und ging zur Küchenzeile. Behutsam zog er den Teebeutel heraus, klopfte ihn am Tassenrand leicht ab und warf ihn in den Biomülleimer. Drei Tropfen rosafarbenen Tees, die auf der Arbeitsfläche prangten, wischte er mit dem Wettex auf. Dann setzte er sich mit der Tasse in der Hand wieder hin, bevor er einen vorsichtigen Schluck nahm.
Sosehr Heinrich davon überzeugt war, dass Flattacher nichts Gutes im Schilde führte und ihn aus purem Eigennutz dazu drängen wollte, um sein Haus zu kämpfen, hatte er doch einen wunden Punkt getroffen: Heinrich wollte nicht in dieses vermaledeite Altersheim nach Villach, das ihm sein Schwiegersohn schmackhaft machen wollte. Carola hatte als Alternative die neue Seniorenresidenz in Möllbrücke ins Gespräch gebracht, die sehr viel näher lag als Villach. Da könnte man ihn doch oft besuchen, viel öfter als bisher, da die Anreise von Wien viel zu lang war für einen spontanen Kurzbesuch.
Als ob! Aus den Augen, aus dem Sinn. Das war das Los zu vieler Altersheimbewohner.
Dabei war Heinrich alles andere als alt. Noch nicht einmal siebzig, fit wie ein Turnschuh und geistig rege genug, jedes Sudoku knacken zu können. Vielleicht nicht die höchste Stufe, aber die mittleren Schwierigkeitsgrade schaffte er mühelos. Es gab keinen einleuchtenden Grund, warum er jetzt schon in ein Altersheim sollte.
Außer dem einen: Anton und Carola wollten mit den drei Kindern in sein Haus am Obervellacher Pfaffenberg einziehen. Das Landleben würde den Kleinen guttun, hatte Carola gemeint, auch wenn sie selbst, wie sie auf sein Nachbohren hin zugab, Wien sehr vermissen würde. Anton hatte sie jedoch davon überzeugt, dass es für die Kinder besser wäre, hier im Mölltal, fernab der Großstadt mit ihren Verlockungen und ihrer höheren Kriminalitätsrate, aufzuwachsen, zumal ihnen die Pubertät erst noch bevorstand.
»Papa, du willst doch auch das Beste für Pia-Nadine, Noemi-Sophie und Anton junior, oder etwa nicht?«
Hätte er da Nein sagen sollen? Seine Familie war ihm das Wichtigste. Er liebte Carola und die Kinder über alles. Das konnte ein Miesepeter wie Flattacher natürlich nicht verstehen. Soviel Heinrich wusste, waren dessen Eltern recht früh verstorben. Geschwister oder andere Familienangehörige hatte er wohl keine, und wenn doch, so ließen sie sich nie blicken. Heinrich konnte es ihnen nicht verdenken. Bis auf einen jungen Mann namens Reini, der ab und zu vorbeikam und den er auch schon beim Rasenmähen beobachtet hatte, erhielt Flattacher nie Besuch. Sogar die Zeugen Jehovas dürften inzwischen zur erleuchtenden Erkenntnis gelangt sein, dass es für diese spezielle schwarze Seele keine Aussicht auf Erlösung mehr gab, denn sie machten einen großen Bogen um ihn und sein Anwesen.
Vielleicht war es das? Wollte Flattacher Heinrich gegen seine eigene Tochter aufhetzen? Missgönnte er ihm die Familie, die Enkelkinder? Flattacher war ein Einzelgänger. Ein einsamer Wolf, der gerade mal seinen Hund in seiner Nähe duldete. Ein Misanthrop, wie er im Buche stand. Wollte er einen Keil zwischen Heinrich und seine Familie treiben und ihn damit in dieselbe verbitterte Vereinsamung jagen, die auch ihn plagen musste? Nicht mit ihm!
Die Familie ging vor. Er wollte nicht wie Flattacher dastehen und seine Liebsten mit egoistischer Bärbeißigkeit vergraulen. Niemals! Was spielte es da für eine Rolle, dass er etliche Jahre eher als geplant ins Altersheim übersiedeln sollte. Früher oder später musste es ohnehin so weit kommen. Warum sich sträuben?
Heinrich kniff die Augen zusammen. Sonst wäre ihm eine weitere Träne über das Gesicht gelaufen.
2
»Na ja, es ist nichts Besonderes. Zugegeben. Aber es hat … ähm …« Bürgermeister Max Müller verstummte, als Anton Nowak demonstrativ langsam mit zwei Fingern über die Theke strich, nur um sie dann angewidert an seiner Anzughose abzuwischen. Zwei gräuliche Streifen blieben auf dem dunklen Stoff zurück.
»Es hat was?«, hakte er in spöttischem Tonfall nach.
Das seit längerer Zeit leer stehende Lokal am Obervellacher Hauptplatz war ein grindiges Loch. Die Einrichtung erschien zwar nicht altersschwach, aber sie wirkte billig. Prüfend klopfte Anton mit dem Zeigefingerknöchel gegen die Thekenverkleidung. Furnierte Spanplatten. Wie erwartet war der Kantenumleimer hier und da abgesplittert und gestattete einen ungeschönten Blick auf die darunterliegenden Sågscharten. Vergebens versuchte das dünne Echtholzfurnier – er tippte auf Kiefer oder Fichte, aber eigentlich war es ihm scheißegal –, den Anschein edlen Massivholzes zu erwecken. Dabei könnte man in einer holzreichen Region wie Oberkärnten doch Echtholz erwarten, oder nicht? Zwei Biergläser waren beim Auszug des letzten Pächters wohl vergessen worden; blind geworden hielten sie im verstaubten Regal die Stellung.
»Potenzial!«, tönte es von unerwarteter Seite.
Müller hatte sich nicht die Mühe gemacht, seinen Begleiter vorzustellen, dessen Gesicht – nun, da er mit seinem Einwurf die Aufmerksamkeit der beiden anderen auf sich gelenkt hatte – rot anlief. Sichtlich nervös blätterte er in seiner Mappe.
»Sie sind …?«, fragte Anton scharf.
»Grab… Also, Gemeinderat Grabner. Hans Grabner.«
»Potenzial. Genau! Das Lokal hat Potenzial«, zog Müller die Gesprächsführung wieder an sich. »Ich zeige Ihnen die WC-Anlagen, die wurden vor vier Jahren komplett saniert.«
»Nicht nötig. Das måcht das Kraut aa ned fett!«
Anton wandte sich zum Gehen, aber gegen die Gemeindevertreter war jeder Gebrauchtwagenverkäufer ein Ausbund an Zurückhaltung. Grabner stellte sich ihm geradezu verzweifelt in den Weg, und als Müller Anton die Hand auf die Schulter legte und ihn in die andere Richtung drängte, war er überzeugt: Die Gscherten würden ihn notfalls mit Gewalt zu den Sanitäranlagen schleppen. Er gab mit einem lauten Seufzen nach.
Die WC-Anlagen mit den weißen Fliesen waren nichtssagend und noch dazu so eng, dass er Angst hatte, der gstauchte Grabner – mehr breit als hoch – würde zwischen Waschbecken und Wand stecken bleiben. Jede Minute mehr mit den beiden Witzfiguren war eine Ewigkeit zu viel. Er war froh, zurück in den Gang zu kommen, der die vorderen Gasträume vom hinteren Teil des Hauses trennte, und wollte nur noch raus. In seiner Hast ging er jedoch in die falsche Richtung. Der Gang machte eine Biegung – und er traf auf eine Metalltür, die in das uralte Haus passte wie die Faust aufs Aug.
»Was ist das?«, fragte Anton und klopfte gegen die massive Stahltür. »Das Obervellacher Fort Knox?«
Müller lachte übertrieben auf. »Nein. Da geht’s in eine Abstellkammer und zum Heizraum. Der letzte Besitzer des Hauses war ein bisserl a Spinner. Der hat da drin hauptsächlich seinen Schnaps gelagert und wohl Angst gehabt, dass ihm den jemand wegsäuft.«
»Kann ich mal hineinschauen?«
»Sicher.«
Rasch schloss Grabner die Tür auf und drückte den innenseitig angebrachten Lichtschalter. Anton betrat einen fensterlosen Raum, der locker fünfzehn Quadratmeter groß war. Während er und Grabner problemlos aufrecht gehen konnten, musste der hochgewachsene Müller aufpassen, dass er sich an den beiden an der Decke entlanglaufenden dicken Heizungsrohren nicht den Kopf stieß.
»Schnaps ist leider keiner mehr da.« Müller lachte gekünstelt. »Im hinteren Raum ist die Ölheizung. Sie ist zwar schon in die Jahre gekommen, aber voll funktionsfähig.«
Anton warf nur einen flüchtigen Blick auf Brennkessel und Öltank. Ein offener Durchgang führte in ein weiteres großzügig geschnittenes Zimmer, in das durch ein verdrecktes Oberlichtfenster nur wenig Sonnenschein drang. Anton fand den Lichtschalter, und nach einem kurzen Flackern wurde der Raum von grellen Neonröhren erleuchtet. Ausgemusterte Küchenschränke, ein Eimer mit Wandfarbe, eine Kabelrolle. Interessant.
»Schade, dass das Haus keinen Keller und der Vorbesitzer die Heizung so blöd eingebaut hat. Jetzt kann man die Zimmer leider nur noch als Rumpelkammer gebrauchen.«
»Sie fallen aber nicht in den Pachtvertrag.« Grabner zerrte einen Grundriss des Hauses hervor, in dem lediglich die Gasträume und die WC-Anlagen rot umrandet waren.
»Selbstverständlich nicht! So viel Lagerraum braucht kein Mensch, und wir können ja schlecht Geld verlangen für nutzlosen Raum.«
Endlich kam Müller auf den entscheidenden Punkt: das Geld. Anton gönnte sich ein Lächeln. Nirgendwo lernte man das Verhandeln besser als auf dem Wiener Naschmarkt. Die beiden Dorftrottel würden nicht wissen, wie ihnen geschah.
»Ich weiß nicht. Ich habe mir mehr vorgestellt«, tat Anton seinen Eröffnungszug, während er ihnen in die Gasträume folgte.
»Ich bitte Sie, ein Geschäftsmann wie Sie macht eine Goldgrube daraus. Außerdem liegt das Lokal direkt am Hauptplatz, zentrale Lage. Sozusagen am Puls der Gemeinde.«
Bürgermeister Müller trug gewaltig dick auf, und wie auf Kommando zog der ihm sekundierende Gemeinderat einen Ortsplan aus seiner dicken Mappe, um Anton damit vor der Nase herumzufuchteln. Anton ignorierte den Wisch. Wenn Müller glaubte, einem Weana Bazi ein X für ein U vormachen zu können, hatte er sich getäuscht.
»Da ist die Reanimation aber überfällig, meinen Sie nicht auch?«
»Häh?«
»Jetzt reden wir mal Tacheles! Von einem Puls kann keine Rede sein. Der Ortskern ist so gut wie ausgestorben. Mein Lokal wäre der dringend nötige Herzschrittmacher, und das wissen Sie.«
»Wir haben sehr wohl Leitbetriebe am Platz wie das Modezentrum Reiter und –«, begehrte Grabner auf, aber Müller brachte ihn mit einer unwirschen Handbewegung zum Schweigen.
»Sie werden in ganz Obervellach keine bessere Immobilie finden.«
»Ja. Das ist der Punkt, nicht wahr?« Anton grinste breit. »Sie als Bürgermeister sind an Obervellach gebunden. Ich nicht.«
Wie Grabner war auch er nicht unvorbereitet zum Besichtigungstermin gekommen. Jetzt war es an ihm, aufzutrumpfen. Er zauberte eine Liste mit Immobilieninseraten aus der Innentasche seines Sakkos.
»Es gibt viele leer stehende Gastro-Betriebe im Mölltal. Was meinen Sie, Müller, das hier in Greifenburg sieht doch gut aus, oder?« Der Farbdruck machte sich bezahlt, denn selbst auf den kleinformatigen Fotos machte das Restaurant optisch schon sehr viel mehr her als die Konkurrenz.
»Greifenburg liegt aber im Drautal«, maulte Hans Grabner, der es garantiert nie weiter als bis zum kleinen Gemeinderat bringen würde.
Anton ignorierte ihn und fixierte den Bürgermeister. »Die Pacht vom Greifenburger Restaurant ist zudem viel geringer.«
»Über den Preis können wir ja reden«, beeilte sich Müller, Kompromissbereitschaft zu signalisieren. »Warum gehen wir nicht auf ein Bier? Sie wissen ja, beim Reden kommen die Leut zåm.«
Am Naschmarkt würde Müller keine fünf Minuten überleben, so schnell, wie der einknickte. Man könnte fast Mitleid mit ihm haben, aber des einen Blödheit war des anderen Gewinn. So lief das im Big Business.
»Ich werd’s mir noch überlegen.«
»Natürlich, natürlich.« Müller ließ seinen Blick unstet durch das Lokal wandern.
Nur Grabner hatte noch nicht begriffen, dass Müller und er am kürzeren Ast saßen. Er sägte munter weiter.
»Lassen Sie sich nicht zu lange Zeit!« Seine Stimme überschlug sich vor lauter Aufregung. »Weil … weil … wir haben auch noch einen anderen Interessenten! Einen sehr interessierten Interessenten!«
Grabner sah Müller beifallheischend an. Der wusste offensichtlich nicht, ob er unterstützend eingreifen oder Grabner ausbremsen sollte. Er konnte sich zu nicht mehr als einem vagen Nicken aufraffen.
»Sie müssen schnell zuschlagen! Sonst ist die Chance weg!«, legte Grabner noch eins nach.
Anton musste lachen. Er konnte einfach nicht anders. Im Ernst? Mit der uralten Verkaufsmasche, die wohl nur noch bei Seniorenkaffeefahrten ziehen konnte, wollte er ihm kommen? Die beiden waren wie die Spanplatten. Sie hatten sich zwar weltmännische Geschäftstüchtigkeit aufgeklebt, aber das konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie im Kern Provinzeier waren. Wenn sie dachten, sie könnten ihn übers Ohr hauen und mit der Bruchbude das große Geschäft machen, hatten sie sich getäuscht!
»Na, mir läuft ja nichts davon. Ich schaue mir in Ruhe die anderen Objekte an« – genüsslich fuchtelte er mit seiner Liste vor Grabners Gesicht herum und ließ ihn eiskalt auflaufen – »und Sie melden sich einfach bei mir, sollte sich der andere Interessent diese Okkasion hier entgehen lassen.«
Er klopfte dem Bürgermeister lässig auf die Schulter und schlenderte auf den Ausgang zu. Grabner wagte es kein zweites Mal, sich ihm in den Weg zu stellen. Die Hand an der Klinke, warf Anton einen letzten Blick zurück. Zumindest in einem Punkt lagen die beiden Lokalpolitiker richtig: Die Immobilie hatte Potenzial.
***
Sepp zog seine Haustür etwas kräftiger zu als beabsichtigt, was sie mit einem protestierenden Knarren quittierte. Als er zu seinem Suzuki Jimny marschierte, schaute er kurz zum Nachbarhaus hinüber. Dort war Belten damit beschäftigt, seine gepflasterte Auffahrt zu kehren.
Wohl damit sich der Wiener seine aufpolierten Schuhe nicht versaute! Anton Nowak hatte keine Zeit verloren, nach dem spätsommerlichen Familienurlaub ins Mölltal zurückzukehren. Anscheinend war es ihm ernst damit, sich hier niederzulassen. Wenigstens war er allein gekommen. Quasi als Vorhut. Leider würde es nicht dabei bleiben.
Und schuld daran war Belten, der sich – Waschlappen, der er war – alles gefallen ließ! Nachdem Sepp sein Auto aufgesperrt hatte, sah er nochmals zu ihm hin. Ihre Blicke trafen sich für einen Moment. Belten ließ es sich nicht einfallen zu grüßen, und Sepp hätte sich eher die Zunge abgebissen. Knapp eine Woche war seit diesem unseligen frühmorgendlichen Besuch vergangen. Wenn er nur daran dachte, ging ihm der Feitel im Sack auf! Kein Wort hatten sie seither miteinander gewechselt, was allerdings, wenn Sepp ehrlich war, keine Besonderheit darstellte. Belten und er pflegten nicht, miteinander plaudernd am Gartenzaun zu stehen. Wenn es zu einem Wortwechsel kam, war der häufig … nicht so nett. Egal.
Was sich Belten einbildete! Ihm einfach die Tür vor der Nase zuzuknallen, obwohl Sepp ihm helfen wollte. So etwas Undankbares hatte die Welt noch nicht gesehen! Das würde er ihm nicht verzeihen. Der Nachbar würde schnell merken, dass am Pfaffenberg eine neue Eiszeit angebrochen war. Fast gönnte er es ihm, ins Altersheim abgeschoben zu werden. Er wünschte Belten eine feldwebelmäßige Schwester, die ihm einen Einlauf nach dem anderen verpasste, und breiige Mahlzeiten, die selbst Akko mit einem Knurren verschmähen würde, wenn man ihm die Schüssel vor die Schnauze stellte. Gab es noch Doppelzimmer? Wenn ja, wäre ein schnarchender, schweißfüßiger Zimmergenosse genau das Richtige für den Deppen. Leider wurde Sepps Schadenfreude dadurch getrübt, dass Beltens Umzug ins Altersheim bedeutete, dass Nowak mit seiner Bagage ins Haus einzog.
Nicht, dass er es mit dem Wiener nicht aufnehmen könnte. Herrgott, er hatte vor nichts und niemandem Angst. Nein, es waren die anderen, die vor ihm einen Mordsrespekt hatten. Doch erschien es ihm mühselig, sich auf einen neuen Nachbarn einstellen zu müssen, wo er Belten gewohnt war und genau wusste, wie der deutsche Nachbar tickte. Er kannte jede seiner Macken, jede Schwäche, jede Schraube, die er beim anderen anziehen konnte. Nowak war im Vergleich dazu ein aggressiver Jungspund, dem er erst die Wadln füri richten müsste. Dem müsste er erst klarmachen, dass es am Pfaffenberg nur einen Platzhirsch gab, und der hieß Sepp.
Er riss die Hecktür des Suzuki auf. Normalerweise brauchte Akko keine Extraeinladung. Den wesensstarken Deutschen Wachtelhund konnte nichts erschüttern. Sogar im hitzigsten Kugelfeuer einer Treibjagd blieb er die Ruhe selbst. Nun stand er zwei Meter entfernt mit hängender Rute da. Akko hatte ein sicheres Gespür für die Stimmungslage seines Herrn und wusste, dass es in ihm brodelte. Nicht, dass Sepp seinen Zorn an ihm ausgelassen hätte, niemals! Nur konnte er dem Hund schlecht erklären, dass er nicht auf ihn angfressn war, sondern auf den Sauhund nebenan.
»Na komm, mein Guter. Hopp!«
Dann stieg er ein und startete den Motor. Bevor er losfuhr, atmete er tief durch. Üblicherweise fuhr er seine Einfahrt im Rückwärtsgang hinauf zur Straße. Nun setzte er ein paar Meter zurück und schlug dann das Lenkrad ein, bis der Wagen fast den Maschendrahtzaun durchstieß. Genau auf Höhe Beltens. Sepp drückte die Kupplung durch und stieg aufs Gas. Im Rückspiegel beobachtete er, wie der Nachbar zur Seite sprang, um der Abgaswolke zu entgehen. Von Beltens Gezeter drangen nur Bruchstücke zu ihm durch. Sepp ließ den Motor noch einmal aufheulen, dann legte er den Gang ein und fuhr davon.
Jetzt ging es ihm besser.
3
Anton Nowak lehnte sich im Besucherstuhl zurück und verschränkte die Hände hinter dem Kopf. Zugegeben, auch wenn er der Gast im Bürgermeisterbüro war, fühlte er sich ein bisschen wie der berühmte Fuchs im Hühnerstall. Mit Bürgermeister Max Müller Geschäfte zu machen – das war ein Spaß. Die Provinzler waren so durchschaubar. Lange hatte Müllers Anruf nicht auf sich warten lassen.
Jetzt versuchte er sich, die Unterarme auf dem Tisch übereinandergelegt, staatsmännisch zu geben. Weitschweifig und ohne auf den Punkt zu kommen, erklärte Müller, warum die Gemeinde doch lieber Herrn Nowak als Pächter hätte und man die Zukunft in einer Zusammenarbeit mit ihm sehen würde und …
»Hören S’ doch auf mit dem Schmäh«, unterbrach Anton ihn ungeduldig. »I bin ned auf der Nudelsuppen dahergschwommen. Außer mir interessiert sich kein Schwein für das Lokal! Sonst würde es nicht seit fast zwei Jahren leer stehen.«
Anton ließ seinen Blick kurz zu Grabner abschweifen, der sich halb hinter dem ledernen Chefsessel des Bürgermeisters versteckte. Die beiden gaben schon ein seltsames Paar ab, wie Dick und Doof. Was sich keineswegs auf Äußerlichkeiten beschränkte.
»Ich bin nicht auf Ihre Immobilie angewiesen, ich kann mein Lokal überall aufsperren. Aber Sie, mein lieber Herr Bürgermeister, Sie brauchen mich!«
»Ach, wirklich«, entgegnete Müller mit säuerlicher Miene.
»Ja, wirklich. Was Obervellach braucht, sind good news. Mit Mord und Totschlag zieht man weder Touristen noch Investoren an. Schlecht fürs Image.« Anton schüttelte in gespieltem Bedauern den Kopf. In den letzten Wochen hatte die Gemeinde landes-, nein, bundesweit mit Mordfällen für Schlagzeilen gesorgt.
»Für die Presse ist die Geschichte von den wild gewordenen Jägern, die sich gegenseitig ans Leder wollten, halt ein gefundenes Fressen. Hat nicht sogar die deutsche BILD-Zeitung groß darüber berichtet? ›Mölltaler Jäger im Blutrausch‹ oder so ähnlich?«
Müller presste die Lippen zusammen und nickte knapp.
»Und erst die Kamera-Teams! Von ATV und ServusTV und vom ORF und auch von –«, zählte Grabner auf.
»Ja, das weiß ich!«, fuhr Müller ihm über den Mund. »Sonst interessiert sich kein Scheißsender für uns, jede noch so kleine Werbung müssen wir teuer zahlen, aber wehe, es passiert mal was! Dann kommen sie alle daher, vom Radio und vom Fernsehen und von der Presse, wie die … wie die …«
»Schmeißfliegen?«, schlug Grabner kleinlaut vor.
»Geier!«
Müller stand so ruckartig auf, dass er Grabner den Drehstuhl gegen den Bauch rammte. Der japste wie ein getretener Hund. Bezeichnenderweise kam Müller keine Entschuldigung über die Lippen, und es hätte Anton doch sehr gewundert, wenn Grabner eine eingefordert hätte. Dessen vorwurfsvollen Dackelblick übersah Müller.
»Was soll der Rest Österreichs von uns denken? Die müssen ja glauben, bei uns im Mölltal herrschen Zustände wie im alten Rom!«, klagte Müller.
Nicht unbedingt wie in Rom, aber wie in einem abgelegenen alpinen Graben, in dem sich noch nicht ganz herumgesprochen hatte, dass man im 21. Jahrhundert angekommen war. Den Gedanken behielt Anton wohlweislich für sich. Ihm war es ganz recht, dass die Entscheidungsträger hinter dem Mond lebten. So würde keiner auf die Idee kommen, misstrauisch zu werden und seine Motive zu hinterfragen.
»Na ja. Die Medien finden schnell ein neues Fressen. In ein paar Tagen ist das Thema vom Tisch.«
»Ihr Wort in Gottes Ohr, Herr Nowak.«
»Anders ist die Lage natürlich hier vor Ort.« Zuckerbrot und Peitsche. »Da werden die Morde Gesprächsstoff Nummer eins bleiben. Wo doch Täter und Opfer aus Obervellach kamen.«
»Die Leute reden von nichts anderem! Egal, wo man hinkommt. Da kannst narrisch werden!« Müller seufzte.
»Da kann man nichts machen«, gab sich Grabner fatalistisch.
»Als Bürgermeister habe ich schon andere Stürme durchgestanden. Da müssen wir halt durch.«
»Außer …« Anton schnalzte mit der Zunge und gab sich nachdenklich. Er runzelte die Stirn und ließ seinen Blick durch das Fenster in die Ferne schweifen. Der Köder war ausgeworfen, jetzt musste er nur noch warten. Fünf. Zehn. Fünfzehn Sekunden dauerte es, bis Müller nach diesem schnappte.
»Außer was?«
»Außer man gibt den Leuten etwas anderes, über das sie reden können. So wie bei den Medien. Ein neues Thema, um vom alten abzulenken.«
»Hm.« Müller ließ sich auf den Bürostuhl sinken.
»Sie sind der Bürgermeister. Die Leute schauen zu Ihnen auf, orientieren sich an Ihnen. Es liegt an Ihnen, diese Krise zu meistern und Führungsqualitäten zu zeigen.«
»Richtig, richtig.«
»Sie müssen beweisen, dass Sie die Lage im Griff haben, dynamisch sind und zukunftsorientiert. Keine Worte, sondern Taten. Sie brauchen ein Vorzeigeprojekt, das auch die Medien aufgreifen.«
»Wir könnten im Gemeinderat einen Unterausschuss … um Ideen zu finden –«
»Sie glauben auch noch ans Christkind, oder, Grabner? Monatelang hinter verschlossenen Türen beraten, finden Sie das dynamisch?«, spottete Anton, bevor er sich wieder auf Müller konzentrierte und die Daumenschrauben anzog: »Stehen nicht bald Wahlen an?«
»Leider.« Müller schluckte. »Hätten Sie eine Idee?«
Und ob. Anton legte seine Pläne auf den Tisch, zumindest jene Teile davon, in die er Müller einzuweihen bereit war.
»Das klingt nicht schlecht.«
»Das hat der Bürgermeister von Greifenburg auch gesagt«, bluffte Anton. Ein wenig konnte er die Daumenschrauben noch anziehen.
»Über den Pachtzins können wir noch reden«, antwortete Müller eilig.
»Das ist ein guter Anfang. Ich denke, dass sich die Gemeinde zudem an der Sanierung beteiligen sollte. Immerhin ist das Haus Gemeindeeigentum. Ich wäre ja nur der Pächter. Eine Förderung von, sagen wir, fünfzehntausend Euro sollte für den Anfang genügen.«
Grabner schnappte hörbar nach Luft. »Das … das geht nie durch … der Gemeinderat …«
»Selbstverständlich ist ein Geschäft nur dann ein Geschäft, wenn beide Seiten davon profitieren, finden Sie nicht auch?« Anton fixierte Müller und ließ ein vielsagendes Lächeln um seine Lippen spielen. Unauffällig rieb er Zeige- und Mittelfinger der rechten Hand gegen seinen Daumen.
Einem Pokerspieler wie Anton entging nicht, wie sich Müller unwillkürlich die Lippen leckte. Der Bürgermeister mochte über eine gewisse Bauernschläue verfügen, mit der er in seiner abgelegenen Landgemeinde am Sessel kleben konnte. Kam es hart auf hart, hatte er keine Chance.
»Fünfzehntausend Euro, hm? Hans«, wandte er sich an seinen Schani, »geh und hol uns einen Kaffee vom Oberstbergmeisteramt drüben. Die Brühe aus unserer Maschine kann man ja niemandem zumuten, der echte Wiener Kaffeehauskultur gewohnt ist.«
Grabner schaute einen Augenblick verdutzt drein, tat dann aber, wie ihm geheißen wurde.
»Unter vier Augen redet es sich leichter. Also, was stellen Sie sich vor, Herr Nowak?«
Anton lehnte sich vor, griff sich eine Kopie des Ortsplanes und riss eine Ecke vom Blatt ab. »Ein Drittel vom ursprünglichen Pachtzins und die Förderung für den Umbau. Dafür können Sie sich das Lokal auf die Fahnen heften. Als Jugendtreff. Das kommt immer gut an: Der Bürgermeister denkt an die jungen Obervellacher«, antwortete er, während er eine Zahl niederschrieb. Drei Nullen.
Müller schaute nicht sehr begeistert drein, was Anton erwartet hatte. Mit einem breiter werdenden Grinsen schob Anton den Fetzen Papier über den Tisch.
Müller nahm ihn auf und blinzelte. »Ich verstehe nicht ganz …«
»Das hat nichts mit dem Pachtvertrag zu tun oder mit der Sanierungsförderung durch die Gemeinde. Sehen Sie es als einen Unterstützungsbeitrag für die kommende Bürgermeisterwahl. Bar. Monatlich.«
Müller stieß einen leisen Pfiff aus. »Und was wollen Sie dafür?«
»Nicht viel. Ihre Unterstützung in bürokratischen Angelegenheiten, Sie wissen schon, Betriebsstättengenehmigung und so.«
Müller nickte bereitwillig. »Ich kenn genug Leute bei der Bezirkshauptmannschaft in Spittal. Das ist kein Problem.«
»Ach ja. Und die hinteren Räume, die würde ich gern privat nutzen. Inoffiziell.«
»Wofür? Nicht, dass ich neugierig wäre, aber das sind Abstellkammern, keine Wohnräume.«
Anton deutete auf das Stück Papier, das Müller in der Hand hielt. »Das sollte als Erklärung reichen.«
Müller betrachtete die Zahl und schürzte die Lippen. »Absolut.«
Ein kurzes Klopfen an der Tür, und Müller ließ den Zettel unter einem Aktenstapel verschwinden. Zu gern hätte Anton gefragt, was Grabner von Beruf war. Kellner war er jedenfalls keiner. So, wie er zitterte, würde man ihn eher als Alkoholiker einstufen. Mit einem deutlich hörbaren Seufzen stellte er das Tablett mit den zwei Verlängerten auf dem Tisch ab.
»Den Pachtvertrag kannst schon aufsetzen«, ordnete Müller an. »Zweihundert inklusive Betriebskosten.«
»Der letzte Pächter hat aber viel mehr –«
»Die Sanierungsförderung passt auch.«
»Aber … aber … Unser Budget! Der Gemeinderat wird nicht zustimmen, nicht bei fünfzehntausend Euro!«
»Der Gemeinderat stimmt gefälligst so, wie ich es sag! Der Bürgermeister bin ich!«
***
Das Telefon klingelte. Schon wieder.
Martin Schober sah von der Akte auf, legte den Stift weg und drehte sich mit seinem Stuhl halb herum. Kerstin Moser tat es ihm gleich, sodass sie sich jetzt gegenübersaßen. Wortlos hoben beide die rechte Faust, ließen sie dreimal auf und nieder zucken.
»Schere schneidet Papier.«
»Mist! Schon wieder verloren«, schimpfte Kerstin und griff widerwillig zum Hörer. »Polizeiinspektion Obervellach«, leierte sie hinein.
Gut, Schere-Stein-Papier war vielleicht wirklich etwas kindisch, wie der muffelige Kollege Gerhard Koller abfällig bemerkt hatte. Aber solche Rituale hatten Martins Ansicht nach etwas Verbindendes an sich – und sie halfen beim dringend nötigen Stressabbau.
»Chef! Es ist für dich«, rief Kerstin.
»Wenn’s schon wieder jemand von der Presse ist, bin ich nicht da!«, donnerte Postenkommandant Georg Treichel, der gerade den Journaldienstraum betrat und den Dienstplan an die Pinnwand heften wollte.
»Der Chef sagt, er ist nicht da«, flötete sie zuckersüß ins Telefon und zwirbelte dabei eine Haarsträhne um ihren Zeigefinger. »Ach, das haben Sie eh mitgehört. Ja, er hat eine laute Stimme, gell. Aber wie er gesagt hat, er ist nicht da …«
Treichel rutschten die Reißnägel aus der Hand. »Kerstin!«
Mit einem Zwinkern hielt sie ihm den Hörer hin. »Scherz! Es ist eine Kollegin von der LPD.«
»Noch so eine Aktion, und du gehst drei Tag lang Fußstreife und kontrollierst die Kurzparkzone von oben bis unten!«, drohte er mit deutlich gedämpfterer Stimme, bevor er sich der Kollegin der Landespolizeidirektion widmete.
»Kaffee?«, flüsterte Kerstin Martin zu.
»Oh ja.«
»Schade, dass ich das Handy nicht parat hatte. Den Gesichtsausdruck vom Chef hätte ich gern auf einem Foto gehabt.«
Martin holte die Milch aus dem Kühlschrank. »Wenn das machst, gehst wirklich Fußstreife.«
»Manchmal komme ich mir vor wie eine Telefonistin im Callcenter! Wenn es wenigstens eine 0900er-Nummer wäre.« Sie gab ihrer Stimme einen rauchig-verruchten Klang: »Polizeiinspektion. Waren Sie ein böser Junge? Dann schicke ich den Martin mit der Rute …«
Sie kicherte und wirkte dabei noch jünger als ihre vierundzwanzig Jahre.
»Oh Gott, hör auf! Das Bild krieg ich nicht mehr aus dem Kopf!«
Das Lachen tat gut. Martin streckte seine Beine unter dem Tisch aus und massierte sich den Nacken. Tag für Tag kehrte mehr Normalität ins Berufsleben zurück. Zwar kamen immer noch viele Anrufe neugieriger Medienvertreter und besorgter Bürger, aber es wurde spürbar ruhiger. Gott sei Dank.
»Apropos nicht aus dem Kopf kriegen: Läuft da jetzt was mit dir und der Bettina?«
»Deine Verhörmethoden solltest ein bisschen aufpolieren.«
»Quatsch. Raus mit der Sprache! Seids jetzt zusammen oder nicht?«
Gute Frage. Damals, noch zu Hauptschulzeiten, hätte er eher eine Antwort gewusst. Da war es üblich gewesen, sich spätestens nach dem ersten Kuss die Frage zu stellen: Willst du mit mir gehen? Obwohl, bis zu dieser Frage war Martin als Teenager nie gekommen, an einen Kuss von Bettina auch nicht. Jetzt war alles anders. Aber nun war er auch dreiunddreißig, und er würde sich mehr als dämlich vorkommen, Bettina zu fragen, wo genau sie mit ihrer Beziehung nun standen. Hatten sie überhaupt eine Beziehung? Sie lebten im 21. Jahrhundert, und selbst unverbindliche One-Night-Stands waren für viele nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Wie konnte Martin da hoffen, von einem Kuss – egal, wie lange und innig – auf eine feste Beziehung schließen zu dürfen?
Klar, er erhoffte sich mehr, wollte mehr. Hatte schon immer mehr gewollt. Bettina war die Flamme seiner Jugendjahre gewesen, und als er sie diesen Sommer so unerwartet wiedergesehen hatte, war das alte Feuer sofort wieder aufgelodert. Doch was fühlte sie? War er für sie lediglich ein Flirt?
»Also?«
Martin trank einen großen Schluck Kaffee und hob die Schultern. »Wir haben uns ein paarmal getroffen, aber da ging es mehr um den Fall. Einmal waren wir wandern.«
»Hast noch kein richtiges Date gehabt mit ihr?«
»Was bitte verstehst du unter einem richtigen Date?«
Kerstin verdrehte die Augen. »Ausgehen, teures Essen, Kerzenschein. Das volle Programm. Hallo? Das Ich-will-mit-dir-ins-Bett-und-drei-Kinder-haben-Programm! Oder habt ihr das übersprungen und seids gleich ab in die Kiste?«
Bettina schaffte es, ihm ein Gefühl der Unsicherheit zu vermitteln und ihn zweifeln zu lassen wie einen Siebzehnjährigen, der noch feucht hinter den Ohren war und ebensolche Träume hatte. Bei Kerstin hingegen kam er sich vor wie fünfzig. Oder siebzig. Martin fand sich selbst nicht verklemmt oder prüde, aber Kerstin überraschte ihn immer wieder mit ihrer ungehemmten, freien Art. Diese Offenheit schätzte er an ihr, immer geradeheraus, kein Blatt vor dem Mund. Außer, wenn es um sein Privatleben ging, sein Liebesleben, das zugegebenermaßen noch ausbaufähig war. Er spürte, wie seine Ohren zu brennen begannen. Würde Kerstin mit ihm demnächst Lieblingsstellungen diskutieren?
»Nein, so weit sind wir noch nicht«, antwortete er und löste damit ein weiteres Augenrollen aus.
»Willst es etwa langsam angehen lassen?«, fragte sie ungläubig. »Du wirst nicht jünger. Wenn du in dem Tempo weitermachst, seids beide im Altersheim, bevor … du weißt schon. Und ich habe die Unterwäsche meiner Oma gesehen! Niiicht antörnend, wennst mich verstehst.«
Martin beeilte sich, das Gespräch aus der Horizontalen zu bringen. »Hast einen Vorschlag, wohin ich Bettina ausführen könnte? Für ein echtes Date?«
Kerstin überlegte kurz. »Ins Casino in Velden? Die haben ein tolles Menü, und es besteht nicht die Gefahr, dass sie nach dem Essen gleich heimwill. Sie muss ja ihre Jetons verspielen. Ja, mit dem Casino schindest Eindruck.«
»Sprichst aus Erfahrung?«
»Was glaubst du denn! Ich war mit dem Peter vor Kurzem unten. Im Sommer ist es besonders schön, wenn man auf der Terrasse sitzen kann.«
»Peter? Ich dachte, dein Freund heißt Joe?«
»Joe ist Schnee von gestern, und Peter erwies sich auch als Null.«
»Das tut mir leid.«
»Mir nicht. Jetzt genieße ich mein Singledasein.«
Martin wusste nicht, was er darauf antworten sollte. Er wollte nicht in offenen Wunden herumstochern, auch wenn Kerstin ihr Beziehungsende nach außen hin locker nahm.
»Dann wird’s das Casino werden. Danke für den Tipp.«
»Das wird in jedem Fall ein Gewinn. Du weißt ja, Pech im Spiel, Glück in der Liebe und umgekehrt.«
Er war richtig erleichtert, als Treichel hereinkam.
»Willst auch einen Kaffee?«, fragte er ihn und sprang auf.
Treichel suchte die Kästen der Küchenzeilen nach Nervennahrung ab und fand eine angebrochene Schachtel Lebkuchen. Ob die noch von den letzten Weihnachten übrig geblieben war oder schon der Vorbereitung auf die nächsten diente, konnte Martin ablaufdatummäßig nicht eruieren. Treichel schüttete den Inhalt auf einen Teller und stellte ihn mitten auf den Tisch.
»Und was wollte die Kollegin von der LPD?«, fragte Martin.
»Einen Termin vereinbaren. Sie rücken morgen mit einem Fotografen an.«
Martin servierte Treichel seinen Kaffee. »Trag’s mit Fassung. Jetzt bist es schon gewohnt, aus der Zeitung zu lachen, oder? Kommst wieder aufs Cover?«
»Du findest das wohl lustig, was?«
»Höchstens so viel«, antwortete Martin und hielt Daumen und Zeigefinger fünf Zentimeter auseinander. »Ich bin lei froh, dass du der Chef bist, das Aushängeschild vom Posten. Um nichts in der Welt würde ich mit dir tauschen wollen.«
»Immer noch besser als in ›Kärnten heute‹«, warf Kerstin ein, was Treichel nicht wirklich ermunterte.
Er hielt sich die Hand vor die Augen und ließ ein Stöhnen hören. Er hatte nur zu gern dem Bezirkskommandanten und dem Pressesprecher der Landespolizei den Vortritt gelassen, als es darum ging, Fragen zu den Obervellacher Mordfällen zu beantworten. Der hartnäckigen Reporterin des ORF-Landesstudios war er jedoch nicht ausgekommen. Sie positionierte ihn am Hauptplatz und befragte ihn vor laufender Kamera. Die neugierigen Passanten und das Wissen, ins Fernsehen zu kommen, brachten Treichel gehörig ins Schwitzen. Da die Reporterin nach der Schrift sprach, versuchte auch er, hochdeutsch zu sprechen. Martin hatte das Ergebnis längst nicht so schrecklich empfunden wie Treichel, der gegenüber der Kollegenschaft lauthals (und im tiefsten Dialekt) schwor, sich nie wieder auf ein Fernsehinterview einzulassen.
»Ein Fototermin ist im Vergleich zum Fernsehen eh halb so schlimm«, sprach Martin ihm Mut zu. »Immer schön gerade stehen und den Bauch einziehen, dann wird das schon.«
Kerstin lachte, bevor sie sich den Zeigefinger ablutschte und begann, die Lebkuchenbrösel vom Teller aufzupicken.
Langsam zog Treichel die Hand vom Gesicht und musterte Martin. Dann lächelte er ein Lächeln, das man nur als wölfisch bezeichnen konnte. »Wenn du zum Friseur gehen willst, geb ich dir den Rest des Tages Zeitausgleich.«