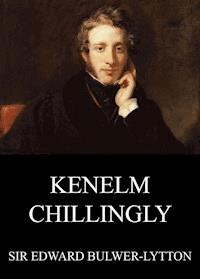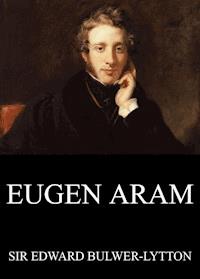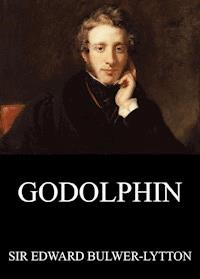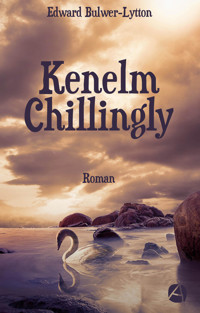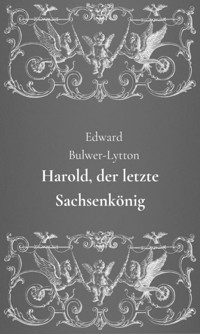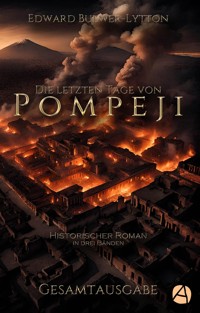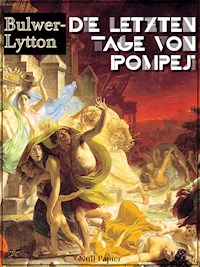
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Klassiker bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
1834 veröffentlicht Edward Bulwer-Lytton sein bekannteste Werk: Das Opus über den Untergang Pompejis Erzählt wird die Geschichte des jungen, reichen Griechen Glaukus und seiner Geliebten Ione, die um 79 n. Chr. in Pompeji leben. Glaukus führt das Leben eines verwöhnten Adligen, bis er Ione begegnet. Vor dem Hintergrund des ausbrechenden Vesuv besiegelt ihr Schicksal. Noch heute kann man die in Vulkanasche versteinerten Menschen sehen, wie sie vom Zorn der Götter überrascht wurden. Null Papier Verlag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 496
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Edward Bulwer-Lytton
Die letzten Tage von Pompeji
Edward Bulwer-Lytton
Die letzten Tage von Pompeji
(The Last Days of Pompeii)Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected]Übersetzung: Wilhelm Cremer 3. Auflage, ISBN 978-3-954184-04-0
null-papier.de/newsletter
Inhaltsverzeichnis
Zum Buch
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Klassiker bei Null Papier
Alice im Wunderland
Anna Karenina
Der Graf von Monte Christo
Die Schatzinsel
Ivanhoe
Oliver Twist oder Der Weg eines Fürsorgezöglings
Robinson Crusoe
Das Gotteslehen
Meisternovellen
Eine Weihnachtsgeschichte
und weitere …
Zum Buch
1834 veröffentlicht Edward Bulwer-Lytton sein bekannteste Werk: Das Opus über den Untergang Pompejis.
Erzählt wird die Geschichte des jungen, reichen Griechen Glaukus und seiner Geliebten Ione, die um 79 n. Chr. in Pompeji leben. Glaukus führt das Leben eines verwöhnten Adligen, bis er Ione begegnet. Vor dem Hintergrund des ausbrechenden Vesuv besiegelt ihr Schicksal.
Noch heute kann man die in Vulkanasche versteinerten Menschen sehen, wie sie vom Zorn der Götter überrascht wurden.
1
Willkommen, Diomedes!« sagte ein junger Pompejaner. »Kommst du auch heute Abend zu Glaukus?« Er war von kleiner Statur und trug seine Tunika in jener nachlässigen Weise, an der man die Mitglieder der vornehmen Lebewelt erkannte.
»Leider, mein lieber Klodius, bin ich nicht eingeladen«, antwortete Diomedes, ein stark gebauter Mann von mittlerem Alter. »Schön ist das nicht von Glaukus, seine Abendessen sollen ja die besten von Pompeji sein.«
»Allerdings – obgleich für mich niemals Wein genug da ist. Er behauptet, nach dem Trinken befinde er sich immer unwohl am nächsten Tage.«
»Er mag wohl noch einen anderen Grund dafür haben«, sagte Diomedes, indem er die Stirn runzelte. »Ich glaube, dass er trotz seines Übermuts und seiner Verschwendung nicht so reich ist, als er scheinen möchte, und er schont vielleicht mehr seinen Wein als seine Gesundheit.«
»Dieses ist ein Grund mehr, bei ihm zu speisen, solange die Gelder vorhalten. Im nächsten Jahr, Diomedes, müssen wir uns einen anderen Glaukus suchen.«
»Er liebt, wie ich höre, auch das Spiel.«
»Er liebt alle Vergnügungen, und solange er uns Feste gibt, lieben wir ihn auch.«
»Da hast du recht, Klodius. Bist du übrigens schon in meinem Weinkeller gewesen?«
»Dass ich nicht wüsste, mein guter Diomedes.«
»Nun, so musst du einmal bei mir zu Abend speisen: ich habe gute Muränen in meinem Wasserbehälter, und werde auch Pansa, den Ädilen, einladen.«
»Oh, mache nur keine Umstände mit mir, ich bin leicht befriedigt. Doch die Sonne wird bald untergehen; ich bin auf dem Wege nach den Bädern – und du?«
»Ich gehe zum Quästor – in Staatsangelegenheiten – und sodann nach dem Tempel der Isis. Vale!«
»Das ist ein übermütiger und ungezogener Bursche«, murmelte Klodius, als er langsam weiterging. »Er glaubt durch seine Feste und Weinkeller seine Abstammung zu verbergen, denn er ist ja nur der Sohn eines Freigelassenen. Aber ich will seine Herkunft vergessen und ihm die Ehre erweisen, ihm sein Geld abzugewinnen.«
Indem er sich so mit sich selbst unterhielt, kam er in die Via Domitiana, die mit Fußgängern und eleganten Wagen angefüllt war. Klodius begrüßte durch freundliches Kopfnicken viele Bekannte, denn es waren nur wenige junge Männer in Pompeji bekannter als er.
»Nun, Klodius, wie hast du nach deinem Glück im Spiel geschlafen?« sagte mit gefälliger und wohltönender Stimme ein junger Mann in einem sehr prachtvollen und eleganten Wagen, der von zwei edlen parthischen1 Pferden gezogen wurde. Der Besitzer war so schön und regelmäßig gebildet, wie die Athener Bildhauer sich ihre Modelle wählten, seinen griechischen Ursprung verrieten die krausen, dichten Locken und das vollkommene Ebenmaß seiner Gesichtsbildung. Seine Tunika glänzte in dem reichsten Schmuck tyrischer Farben, und die Schnallen, durch welche sie festgehalten wurde, waren mit Edelsteinen besetzt. Um den Hals trug er eine goldene Kette, die mitten auf der Brust in der Form eines Schlangenkopfes, aus dessen Munde ein großer Siegelring von vollendeter Arbeit hing, sich schloss. Ein breiter, mit Arabesken gezierter und goldgestickter Gürtel diente zugleich als Behältnis und Tasche für das Schnupftuch und die Börse, für den Schreibgriffel und die Schreibtafeln.
»Mein teurer Glaukus«, sagte Klodius, »es freut mich, zu sehen, dass dein Verlust im Spiel so wenig Eindruck auf dich gemacht hat. Dein Antlitz leuchtet, wie begeistert durch Apollo; wer es nicht wüsste, würde glauben, dass nicht ich gewonnen hätte, sondern du.«
»Und wie vermag der Verlust oder Gewinn jener toten Metallstücke unsere Stimmung zu verändern, mein Klodius? Bei der Venus, solange wir noch jung sind und unser Haupt bekränzen dürfen, solange das süße Lächeln der Lydia oder Chloe unser Blut in Wallung setzt, so lange müssen wir des heiteren Lebens genießen und die dahinsterbende Zeit selbst zu dem Schatzmeister unserer Vergnügungen machen. Du speisest doch heut abend bei mir?«
»Wer vergisst wohl je die Einladung des Glaukus!«
»Doch wohin gehst du jetzt?«
»Ich beabsichtige, die Bäder zu besuchen, doch habe ich noch eine Stunde Zeit.«
»Nun, so will ich meinen Wagen fahren lassen und mit dir gehen.«
Langsam schlenderten die beiden jungen Männer durch die Straßen. Sie befanden sich jetzt in jenem Teil der Stadt, wo die reichsten Kaufläden waren, deren Wände, mit den mannigfaltigsten Freskomalereien geziert, in den lebhaftesten, doch stets harmonischen Farben erglänzten. Die sprudelnden Springbrunnen, welche mit ihrem kühlen Strahl sich in die heiße Sommerluft erhoben, die Menge der meist in tyrischen Purpur gekleideten Spaziergänger, die ab- und zugehenden Sklaven mit bronzenen Gefäßen von geschmackvoller Arbeit, die Landmädchen, die hier und da mit Körben voll reifer Früchte und Blumen standen, die Läden, in denen auf marmornen Tischen Gefäße mit Wein und Öl standen, alles dieses machte einen so sehr zur Lebenslust auffordernden Eindruck, dass die athenische Empfänglichkeit des Glaukus für Frohsinn und Freude dadurch umso mehr aufgeregt werden musste. »Sprich mir nicht mehr von Rom«, sagte er zu Klodius. »Das Vergnügen ist in dieser gewaltigen Stadt zu ernsthaft und schwerfällig. Hier aber können wir unbefangen und behaglich unser Leben genießen.« »Darum hast du wohl auch Pompeji zu deinem Sommeraufenthalt gewählt?« »Allerdings. Ich gebe ihm den Vorzug vor Bajä, dessen Reize ich keineswegs verkenne, doch ich liebe nicht die Pedanten, welche sich dort aufhalten und ihre Vergnügungen nach der Drachme abzuwiegen scheinen.«
»Und doch liebst auch du die Gelehrsamkeit, und was die Dichtkunst betrifft, so sind Äschylus und Homer, die epische Dichtung wie das Drama, in deinem Hause einheimisch.«
»Ja, aber diese Römer, welche meine Athener Vorfahren nachäffen, beginnen alles so schwerfällig. Selbst auf der Jagd lassen sie sich durch ihre Sklaven den Plato nachtragen, und wenn das Wild erlegt ist, suchen sie ihre Bücher und den Papyrus hervor, um ja keine Zeit zu verlieren.«
Indem sie sich so unterhielten, wurden sie durch das auf einem offenen Platze, wo drei Straßen zusammenstießen, versammelte Volk aufgehalten. In dem Schatten eines kleinen, niedlichen Tempels stand ein junges Mädchen, mit einem Blumenkorb am rechten und einem dreisaitigen musikalischen Instrument im linken Arm, zu dessen sanften Tönen sie eine wilde und halb barbarische Melodie sang. Bei jeder Pause bot sie mit anmutigen Bewegungen ihren Blumenkorb dar, indem sie die umstehenden zum Kaufen einlud, und manche Sesterz wurde in das Körbchen geworfen, teils für die Musik, teils aus Mitleid für die Sängerin – denn sie war blind.
»Es ist meine arme Thessalierin«, sagte Glaukus, indem er stehen blieb, »seit meiner Rückkunft nach Pompeji habe ich sie nicht gesehen. Ihre Stimme ist entzückend; wir wollen ihr zuhören.«
Als die Blinde ihr Lied beendet hatte, drängte sich Glaukus durch die Menge und warf ihr eine Handvoll kleiner Münzen in ihren Korb. »Ich muss diesen Veilchenstrauß haben, süße Nydia«, sagte er, »deine Stimme ist reizender als je.«
Das blinde Mädchen trat überrascht vor, als sie die Stimme des Atheners hörte – doch plötzlich blieb sie stehen und errötete.
»Du bist also zurückgekehrt«, sagte sie mit leisem Tone und wiederholte darauf, mit sich selbst redend: »Glaukus ist zurückgekehrt!«
»Ja, mein Kind; ich bin kaum seit zwei Tagen in Pompeji. Mein Garten bedarf, wie früher, deiner Pflege, ich rechne darauf, dass du ihn morgen besuchen wirst. Auch sollen in meinem Hause durch keine anderen Hände Kränze geflochten werden, als durch die der schönen Nydia.«
Ein freudiges Lächeln überzog Nydias Gesicht, aber sie antwortete nicht, und Glaukus verließ die Menge, indem er die Veilchen, die er gewählt hatte, an die Brust steckte.
»Du hast also dieses Kind unter deinen Schutz genommen?« sagte Klodius.
»Ja, singt sie nicht sehr hübsch? Sie interessiert mich, die arme Sklavin! – Überdies ist sie aus Thessalien, der Olymp schaute auf ihre Wiege herab.«
»Also ist sie aus dem Lande der Zauberinnen.«
»Allerdings, aber was mich betrifft, so halte ich jedes weibliche Geschöpf für eine Zauberin, besonders hier in Pompeji, wo selbst die Luft mit einem Liebestrank erfüllt zu sein scheint.«
»Und sieh da! Eine der schönsten in Pompeji, die Tochter des alten Diomedes, die reiche Julia«, sagte Klodius, als ein junges Mädchen, das Antlitz mit einem Schleier bedeckt und durch zwei Sklavinnen auf ihrem Wege zum Bade begleitet, sich ihnen näherte.
»Schöne Julia, wir begrüßen dich«, redete Klodius sie an. Julia hob ihren Schleier etwas und zeigte mit einiger Koketterie ein kühnes, römisches Profil, ein dunkles, feuriges Auge und Wangen, deren von Natur etwas gelben Teint die Kunst mit einer blühenden Rosenglut gefärbt hatte.
»Und auch Glaukus ist zurückgekehrt!« sagte sie, indem sie den Athener mit einem ausdrucksvollen Blick beglückte. »Hat er«, fügte sie halb flüsternd hinzu, »bereits seine Freunde vom vorigen Jahr vergessen?«
»Schöne Julia, wie könnte ein Vergessen möglich sein, wenn der Gegenstand der Erinnerung so lieblich ist?«
Die Römerin lächelte geschmeichelt, dann wandte sie sich zu Klodius. »Wir werden euch beide bald in meines Vaters Villa sehen«, sagte sie.
Dann senkte sie ihren Schleier, aber so langsam, dass ihr letzter Blick mit scheinbarer Schüchternheit zwar, doch in der Tat mit einiger Keckheit auf dem Athener haftete. Dieser Blick war zärtlich und zugleich ein Vorwurf.
Die Freunde setzten ihren Weg fort.
»Julia ist wirklich schön«, sagte Glaukus.
»Und im vorigen Jahre würdest du jenes Bekenntnis in einem wärmeren Tone gemacht haben.«
»Allerdings; ich wurde durch den ersten Blick verblendet, und hielt für einen Edelstein, was später sich nur als künstliche Nachahmung erwies.«
»Jawohl«, erwiderte Klodius, »alle Mädchen sind sich eigentlich ähnlich. Glücklich, wer ein schönes Gesicht und eine reiche Aussteuer heiratet. Was kann er mehr wünschen?«
Glaukus seufzte.
Sie befanden sich jetzt in einer weniger mit Menschen angefüllten Straße, welche ihnen die Aussicht auf jenes ruhige Meer eröffnete, das an diesen herrlichen Küsten so selten ein Bild des Schreckens darbietet, denn sanft sind die Lüfte, welche über seine Oberfläche hauchen, glühend und mannigfaltig das Farbenspiel, das der Widerschein rosiger Wolken bildet, köstlich die Düfte, welche durch die Landwinde ihm zugeführt werden. Wohl konnte man glauben, Anadyomene habe aus einer solchen See sich erhoben, um der Herrschaft über die Erde sich zu bemächtigen.
»Es ist noch zu früh, um in das Bad zu gehen«, sagte der Grieche, der jedem poetischen Eindruck des Augenblicks folgte, »wir wollen die geräuschvolle Stadt verlassen und uns hier an der Küste ergötzen, solange noch die Sonne auf den Wogen verweilt.«
»Sehr gern«, erwiderte Klodius, »auch ist es an der Bai immer am lebhaftesten.«
In der spiegelglatten Fläche der Bai ruhten die Handelsschiffe und die vergoldeten Gondeln für die Lustfahrten reicher Bürger. Schnell glitten die Fischerboote hin und her, und in der Ferne erblickte man die schlanken Maste der Flotte unter dem Befehle des Plinius. Am Ufer saß ein Sizilianer, der mit heftigen Gestikulationen und leicht beweglichen Zügen einer Gruppe von Fischern und Landleuten die Geschichte Schiffbruch erleidender Seeleute und rettender Delphine erzählte.
Der Grieche zog seinen Begleiter von den Zuhörern fort und wanderte mit ihm nach einem einsamen Teile des Gestades, wo die zwei Freunde, auf eine unter den glatten Kieseln sich erhebende kleine Klippe sich setzend, die wollüstig-kühlenden Seelüfte einatmeten, welche, über den Wellen schwebend, mit ihren unsichtbaren Füßen eine Art von Naturrhythmus hielten. Es lag etwas zum Stillschweigen und zur einsamen Betrachtung Einladendes in der ganzen Szene. Klodius berechnete, indem er seine Augen vor der brennenden Sonne schützte, seine Spielverluste der letzten Woche; und der Grieche, sich auf die Hand stützend, und jene Sonne, die schützende Gottheit seiner Nation, nicht scheuend, schwärmte mit seinen Blicken über der weiten Fläche mit jenem leichten Sinne der Lebenslust, Freude und Liebe, welche sein ganzes Wesen erfüllten, und beneidete vielleicht jedes Lüftchen, das seine Schwingen gegen die Ufer Griechenlands erhob.
»Sage mir«, sprach endlich der Grieche, »hast du jemals geliebt?«
»Ja, sehr oft.«
»Wer oft geliebt hat«, entgegnete Glaukus, »liebte nie. Es gibt bloß einen Eros.«
»Liebst du denn wirklich und ernstlich? Empfindest du jenes Gefühl, welches die Dichter beschreiben – ein Gefühl, mit dem wir unsere Mahlzeiten versäumen, das Theater vernachlässigen und Elegien schreiben? Ich hätte es nie gedacht.«
Glaukus lächelte. »Soweit bin ich allerdings noch nicht. Aber ich könnte so lieben, wenn ich nur Gelegenheit hätte, den Gegenstand meiner Verehrung wiederzusehen.«
»Ist es denn nicht des Diomedes Tochter?« fragte Klodius. »Du wirst von ihr geliebt, und sie verbirgt diese Leidenschaft nicht; und beim Herkules, ich muss es wiederholen: Sie ist schön und reich. Sie wird die Türpfosten ihres Gatten mit goldenen Netzen verbinden.«
»Nein, ich beabsichtige keineswegs, mich selbst zu verkaufen. Die Tochter des Diomedes ist schön, das muss ich zugeben, und wäre sie nicht die Enkelin eines Freigelassenen, so hätte ich einst – doch nein – sie trägt ihre Schönheit nur im Antlitz. Ihre Sitten sind nicht jungfräulich, und ihr Gemüt kennt keine anderen Bestrebungen als die des Vergnügens!«
»Du bist undankbar. Doch sage mir, welche die glücklichste Jungfrau ist?«
»So höre denn, mein Klodius. Vor einigen Monaten hielt ich mich in Neapel auf, einer Stadt, die mir sehr gefällt, denn sie behauptet die Sitten und das Wesen ihres griechischen Ursprungs. Eines Tages trat ich in den Tempel der Minerva, um meine Gebete, mehr für die Stadt, über welcher Pallas nicht mehr freundlich lächelt, als für mich selbst darzubringen. Der Tempel war leer und einsam. Die Erinnerungen an Athen drängten sich in mir. Ich glaubte, in dem Tempel allein zu sein, und war ganz in meine Andacht vertieft, als ich plötzlich einen tiefen Seufzer vernahm und beim Umschauen ein junges Mädchen sah. Auch sie betete und hatte ihren Schleier erhoben, und als unsere Augen sich begegneten, schien ein himmlischer Strahl aus jenen dunklen und leuchtenden Blicken in meine Seele zu dringen. Nie, mein Klodius, sah ich ein sterbliches Antlitz schöner gebildet: eine gewisse Melancholie milderte und erhöhte zugleich dessen Ausdruck; jenes unaussprechbare Etwas, welches aus dem Herzen in das Herz dringt, und das unsere Bildhauer in die Züge der Psyche übertrugen, verbreitete über ihre Schönheit etwas Göttliches und Edles; aus ihren Augen flossen Tränen. Ich vermutete sogleich, dass auch sie athenischen Ursprungs sei. ›Bist du nicht auch aus Athen, schöne Jungfrau?‹ fragte ich. Bei dem Tone meiner Stimme errötete sie und bedeckte mit dem Schleier teilweise ihr Antlitz. – ›Die Asche meiner Vorfahren‹, sagte sie, ›ruht an den Ufern des Ilissus; ich bin gebürtig aus Neapel; doch mein Herz ist athenisch wie mein Ursprung.‹ – ›So wollen wir denn, sagte ich, unsere Opfer gemeinschaftlich darbringen‹ und als der Priester erschien, stand ich ihr zur Seite, während wir dessen Zeremonien folgten. Zugleich berührten wir die Knie der Göttin, zugleich legten wir unsere Olivenkränze auf den Altar. Ich fühlte in dieser Gemeinschaft ein eigentümliches Gefühl fast heiliger Zärtlichkeit. Es schien, als sei ich schon seit Jahren mit ihr bekannt, und jener einfache Gottesdienst wirkte wie ein Wunder, indem er die Banden der Sympathie umso fester knüpfte, je schneller er die Schranken der Zeit vernichtete. Schweigend verließen wir den Tempel, und ich stand im Begriff, sie zu fragen, wo sie wohne, und ob es mir gestattet sei, sie zu besuchen, als ein Jüngling, in dessen Zügen eine verwandtschaftliche Ähnlichkeit mit den ihrigen sich aufdrang, und der an dem Eingange des Tempels stand, ihre Hand ergriff. Sie wendete sich zu mir und sagte mir Lebewohl. Sie verschwand im Gedränge; ich sah sie nicht wieder. Zu Hause angelangt, fand ich Briefe, welche mich zwangen, nach Athen abzureisen, denn meine Verwandten drohten mit Prozessen wegen meines Erbteils. Als diese Angelegenheiten glücklich beseitigt waren, kehrte ich nach Neapel zurück. Trotz aller Nachforschungen in der ganzen Stadt konnte ich jedoch die Spuren meiner verlorenen Landsmännin nicht wiederfinden, und indem ich hoffte, die Erinnerung an jene schöne Erscheinung im frohen Lebensgenusse zu übertäuben, beeilte ich mich, den Vergnügungen, welche Pompeji darbietet, mich in die Arme zu stürzen. Dieses ist die ganze Geschichte meiner Leidenschaft.«
Als Klodius erwidern wollte, näherte sich ihnen langsamen und stattlichen Schrittes ein Mann, und als sie das Geräusch seines Ganges in den Kieseln hörten, wendeten sich beide um, und jeder erkannte den Ankommenden.
Es war ein Mann, der kaum das vierzigste Jahr erreicht hatte, von schlanker, doch kräftiger Gestalt. Seine dunkle, bronzefarbene Haut verriet den morgenländischen Ursprung, und seine Züge hatten etwas Griechisches in ihren Linien. Seine großen Augen, dunkel wie die finstere Nacht, blickten fest und mit ruhigem, wechsellosem Ausdruck. Eine tiefe, nachdenkende und melancholische Einsamkeit schien dort ihren majestätischen und gebietenden Sitz gewählt zu haben. Sein Gang und seine Bewegungen waren leicht und gemessen, und etwas Ausländisches in der Einfachheit und dem Schnitte seines Gewandes erhöhte den ehrwürdigen Ausdruck seiner stillen Würde und stattlichen Gestalt. Ein jeder der beiden jungen Männer machte, als sie den Ankommenden begrüßten, mechanisch, aber verstohlen und wie in der Absicht, es vor ihm zu verbergen, eine kleine bezeichnende Bewegung mit den Fingern; denn man glaubte von Arbaces, dem Ägypter, dass er die unheilbringende Gabe des bösen Blickes besitze.
»Diese Landschaft muss wirklich schön sein«, sagte Arbaces mit einem kalten und abstoßenden Lächeln, »da sie den munteren Klodius und den bewunderten Glaukus veranlasst, die lebensfrohe Stadt zu verlassen.«
»Ist denn Natur an sich nicht anziehend?« fragte der Grieche.
»Für die Genusssüchtigen – allerdings nicht.«
»Das ist eine harte Erwiderung, doch schwerlich eine weise. Das Vergnügen erfreut sich der Gegensätze, durch zerstreuende Genüsse lernen wir die Einsamkeit und durch diese jene schätzen.«
»So denken die jungen Philosophen aus dem Garten«, erwiderte der Ägypter, »sie halten Erschöpfung für einsame Betrachtung und bilden sich ein, die Einsamkeit zu kennen, wenn sie durch geräuschvolle Vergnügungen übersättigt wurden. Doch in so leeren Gemütern vermag die Natur jene Begeisterung nicht zu entzünden, welche aus ihrer eigenen keuschen Zurückgezogenheit unbeschreibliche Glückseligkeit schöpft. Sie verlangt von euch nicht die Ermattung der Leidenschaft, sondern jene ganze Glut, von der ihr bloß, indem ihr sie sucht, ausruhen wollt. Bei alledem habt ihr recht, die Zeit zu genießen, solange sie freundlich lächelt; schnell verwelkt die Rose, bald verhaucht ist ihr Duft, und was bleibt uns, o Glaukus, den Fremdlingen im Lande, entfernt von der Asche ihrer Väter, als der Genuss des Vergnügens und das Andenken an die Vergangenheit? Für dich das erstere, für mich vielleicht das letztere.«
Er sah die beiden noch einmal mit seinem kalten, durchbohrenden Blick an. Dann schlug er den Zipfel seines Gewandes über die Schulter und schritt langsam von dannen.
»Ich atme wieder freier«, sagte Klodius. »Die Ägypter nachahmend, stellen wir bei unseren Gastmahlen bisweilen ein Skelett auf. Der Anblick eines solchen Ägypters, wie jener schleichende Schatten, ist gespenstisch genug, um den köstlichsten Falerner zu versäuern.«
»Ein seltsamer Mann«, sagte Glaukus nachdenkend, »wenn er aber auch ertötet scheint für das Vergnügen und kalt für die Reize dieser Welt, so lügt die Verleumdung über ihn, und die Geschichte seines Herkommens und seines Herzens ist sicher eine andere.«
»Ach, man spricht von ganz anderen Orgien als denen der Osiris, die in seinem einsamen Hause gefeiert werden sollen. Auch ist er reich, wie man sagt. Können wir ihn nicht zu dem Unsrigen machen und ihn die Reize des Spiels lehren? O dieser herrlichste von allen Genüssen! Wie schön ist das Spiel, dieses heiße Fieber der Hoffnung und Furcht, diese unvergleichliche, unübertroffene Leidenschaft!«
»O diese glühende Begeisterung!« rief lächelnd Glaukus. »Ein Orakel der Poesie im Munde des Klodius. Was werden wir da noch für Wunder erleben.«
Parthien ist eine antike Landschaft im Norden des heutigen Iran. <<<
2
Der Himmel hatte dem Glaukus jedes Glück gewährt, eines ausgenommen; er war schön, kräftig, wohlhabend, geistreich, von berühmter Herkunft, feurigen Temperaments, poetischen Gemütes; aber es fehlte ihm die Erbschaft der Freiheit.
Er war als römischer Untertan in Athen geboren. Schon frühzeitig zu einer bedeutenden Erbschaft gelangt, hatte er der Neigung für das Reisen, die in der Jugend so natürlich ist, sich hingegeben, und sich in den glänzenden Vergnügungen des kaiserlichen Hofes berauscht.
Er war ein Alcibiades ohne Ehrgeiz. Er war, was ein junger, reicher, talentvoller Mann bald wird, wenn die Begeisterung des Ruhms ihm fremd bleibt. Sein Haus in Rom war Gegenstand der Unterhaltungen aller Genusssüchtigen, aber auch aller Kunstfreunde, seine Wohnung in Pompeji entzückte mit ihren Gemälden und Mosaikarbeiten jeden Kenner. Glaukus war ein leidenschaftlicher Verehrer der Poesie und besonders der dramatischen, welche den Geist und Heldenmut seines Geschlechts vergegenwärtigt, und sein schönes Haus war mit Darstellungen aus dem Äschylus und Homer geziert. Es gehörte übrigens nicht zu den größten, wohl aber zu den vollendetsten und prachtvollsten Privatwohnungen in Pompeji, und sein Besitzer wurde um seinetwillen viel beneidet.
Man trat durch einen langen, engen Gang in die Halle, auf deren Fußboden ein Hund in Mosaik abgebildet war, mit dem wohlbekannten »Cave canem« oder: »Nimm dich vor dem Hunde in acht«. Zu jeder Seite befand sich eine ziemlich geräumige Kammer, denn da der innere Teil des Hauses nicht groß genug war, um die beiden Abteilungen der Zimmer zum Privat- und zum öffentlichen Gebrauch zu enthalten, so wurden diese beiden Kammern besonders für den Empfang derjenigen Besuchenden bestimmt, die durch ihren Rang oder durch genauere Bekanntschaft nicht geeignet waren, in das Innere eingelassen zu werden.
Von der Halle kam man in das mit wundervollen Gemälden geschmückte Atrium. Die Bilder stellten den Abschied des Achilles von der Briseis dar.
An der einen Seite des Atriums führte eine schmale Treppe zu den Kammern für die Sklaven im oberen Stock. Auch befanden sich dort zwei oder drei kleine Schlafzimmer, auf deren Wänden die Entführung der Europa, die Schlacht der Amazonen usw. dargestellt waren.
Darauf trat man in das Tablinium, an dessen beiden Enden reiche Teppiche, mit tyrischem Purpur gefärbt, hingen, die halb zurückgezogen waren. An der Wand war ein Dichter dargestellt, wie er einem Freunde Verse vorlas, und in den Fußboden eine kleine, aber herrliche Mosaik eingefügt, welche Beziehung auf den Unterricht hatte, den ein Schauspieldirektor seinem Personal gab. Durch diesen Saal gelangte man in das Peristil, das den Abschluss des Hauses bildete. Von jeder der sieben Säulen, die diesen Hof zierten, hingen Blumengewinde herab. Das Innere, welches die Stelle eines Gartens vertrat, war mit den seltensten blühenden Blumen in weißmarmornen Vasen besetzt, die auf Piedestalen standen. An der linken Seite dieses kleinen Gärtchens befand sich eine kleine Nische. Sie war den Penaten geheiligt; vor ihr stand ein bronzener Dreifuß. An der linken Seite des Säulenganges waren noch zwei kleine Schlafzimmer; an der rechten das Triklinium, in welchem die Gäste jetzt versammelt waren.
Um den Tisch von Zitronenholz, der glatt poliert und mit Arabesken in Silber ausgelegt war, standen die drei Ruhebetten, die damals in Pompeji noch gebräuchlicher waren als der halbrunde Sitz, der seit kurzem in Rom Mode geworden; und auf diesen Ruhebetten von Bronze, die noch mit Arbeiten von kostbaren Metallen geziert waren, lagen dicke Matratzen mit feiner Stickerei, die elastisch dem Druck nachgaben.
»Ich muss wirklich gestehen«, sagte der Ädil Pansa, »dass dein Haus, wenn es auch klein ist, doch in seiner Art einem kostbaren Edelstein gleicht. Wie schön ist der Abschied des Achilles von der Briseis dargestellt! – Welcher Stil – welche Köpfe – welche, hm!«
»Ein Lob des Pansa über solche Gegenstände ist wirklich schätzbar«, sagte mit ernsthafter Miene Klodius. »Auch sind die Gemälde an seinen Wänden – wahrlich, sie sind der Hand eines Zeuxis nicht unwürdig!«
»Du schmeichelst mir, mein Klodius; du schmeichelst in der Tat«, erwiderte der Ädil, der in ganz Pompeji bekannt dafür war, dass er die schlechtesten Gemälde hatte, denn er war ein Patriot und beschäftigte nur die pompejanischen Künstler. »Du schmeichelst mir; aber die Gemälde sind recht hübsch in den Farben wie in der Zeichnung – und die in der Küche sind ganz von meiner Erfindung.«
»Was stellen sie dar?« fragte Glaukus. »Ich habe deine Küche noch nicht gesehen, wenn ich auch oft Gelegenheit hatte, die Vortrefflichkeit der Speisen zu bewundern.« »Es ist ein Koch, mein Athener, welcher die Beweise seiner Geschicklichkeit auf dem Altar der Vesta darbringt, nämlich eine schöne Muräne (nach dem Leben gemalt), es ist doch wohl genug Erfindung darin!«
In diesem Augenblick traten die Sklaven ein und brachten die ersten Einleitungspfeifen zum Mahl. Zwischen köstlichen Feigen, frischen, mit Schnee bestreuten Kräutern und Eiern wurden kleine Becher eines herrlichen, mit etwas Honig vermischten Weines aufgestellt. Darauf überreichten junge Sklaven jedem der fünf Gäste (denn größer war ihre Anzahl nicht) ein silbernes Becken mit wohlriechendem Wasser und Handtücher mit einer purpurnen Einfassung. Doch der Ädil zog sein eigenes Tuch hervor, welches zwar nicht von so feiner Leinwand, aber dessen Rand sehr breit war, und trocknete seine Hände auf eine Weise, welche die Bewunderung in Anspruch zu nehmen berechnet war.
»Du hast da ein schönes Tuch«, sagte Klodius, »die Borte ist so breit wie ein Gürtel.«
»Oh, es ist nichts Besonderes, mein Klodius! Man sagt mir, dass dieses die neueste Mode zu Rom ist, doch Glaukus versteht mehr von diesen Sachen als ich.«
»Sei uns günstig, o Bacchus!« sagte Glaukus, indem er sich ehrerbietig gegen ein schönes Bild des Gottes neigte, das mitten auf dem Tische stand, an dessen Enden die Laren und die Salzfässer aufgestellt waren. Die Gäste stimmten in diese Anrufung mit ein, und indem sie Wein auf den Tisch sprengten, vollbrachten sie die gewöhnliche Libation.
Nachdem dies geschehen war, nahmen die Gäste ihre Plätze auf den Ruhebetten ein, und das Mahl begann.
»Möge dieser Becher mein letzter sein«, sagte der junge Sallust, als die zu Erregung des Appetits zuerst aufgetragenen Speisen abgenommen waren, die eigentlichen Gerichte folgten und ein Sklave ihm ein bis an den Rand gefülltes Trinkgefäß überreichte, »möge dieser Becher mein letzter sein, wenn dieses nicht der beste Wein ist, den ich je zu Pompeji getrunken habe!«
»Bringe die Amphora her«, sagte Glaukus, »und lies den Jahrgang des Weines.«
Der Sklave beeilte sich, der Gesellschaft mitzuteilen, dass das Alter von vierzig Jahren und der Geburtsort Chios angegeben sei.
»Wie köstlich der Schnee ihn gekühlt hat«, sagte Pansa.
»Er ist wie die Erfahrung eines Mannes«, bemerkte Sallust, »der seine Leidenschaften hinlänglich abgekühlt hat, um ihnen desto mehr Genuss gewähren zu können.«
»Er ist wie das Nein! eines Weibes«, fügte Glaukus hinzu, »es kühlt ab, um nur noch mehr das Feuer anzufachen.«
»Wann findet wieder ein Kampf wilder Tiere statt?« fragte Klodius den Pansa.
»Er wurde für den 9. Idus des August festgesetzt«, erwiderte Pansa. »Wir haben einen herrlichen jungen Löwen für dieses Fest.«
»Wer soll ihm vorgeworfen werden?« fragte Klodius. »Ach, es ist ein großer Mangel an Verbrechern. Du musst auf jeden Fall irgendeinen Unschuldigen oder sonst jemand für den Löwen verurteilen, Pansa!«
»Allerdings habe ich seit kurzem ernstlich darüber nachgedacht«, erwiderte der Ädil gravitätisch. »Es ist ein schändliches Gesetz, welches uns untersagt, unsere eigenen Sklaven den wilden Tieren vorzuwerfen. Ich kann es nicht anders nennen als eine Verletzung des Besitzes selbst, wenn wir über unser Eigentum nicht mehr nach freiem Willen schalten dürfen.«
»In den guten, alten Zeiten der Republik war es anders«, seufzte Sallust.
»Überdem entbehrt durch diese vermeintliche Milde gegen die Sklaven das arme Volk so viel. Wie gern sieht es einen tüchtigen Kampf zwischen einem Menschen und einem Löwen. Und dieses unschuldigen Vergnügens darf es nicht mehr genießen, solange dieses verwünschte Gesetz besteht, wenn die Götter uns nicht einen tüchtigen Verbrecher schicken.«
»Welche Staatskunst kann schlechter sein«, sagte Klodius, »als jene, die die mannhaften Vergnügungen des Volks untersagt?« Hier wurde die Unterhaltung für einen Augenblick durch einen Tusch von musikalischen Instrumenten unterbrochen, und zwei Sklaven traten mit einem einzelnen Gericht ein.
»Ach, welchen Leckerbissen hast du noch für uns aufgehoben?« fragte der junge Sallust mit funkelnden Augen.
Sallust war nur vierundzwanzig Jahre alt, doch kein Lebensgenuss ging ihm über das Essen – vielleicht hatte er alle anderen erschöpft; doch war er nicht ohne Talente und hatte ein vortreffliches Herz, soweit es ihm treu blieb.
»Ich kenne, beim Pollux, dieses Gericht!« rief Pansa. »Es ist Lammfleisch von Ambracia. Ha! Wir müssen für den neuen Ankömmling noch eine Libation darbringen.«
»Ich hatte gehofft«, sagte Glaukus mit einem leisen Bedauern in seiner Stimme, »auch einige Austern aus Britannien vorsetzen zu können, aber die ungünstige Witterung hat die rechtzeitige Ankunft des Schiffes verhindert.«
»Sind sie wirklich so köstlich?« fragte Lepidus, indem er den Gürtel seiner Tunika noch weiter löste.
»Ich vermute, dass bloß die Entfernung ihren großen Wert bestimmt; sie haben nicht den würzigen Geschmack der brundisischen Auster. Zu Rom jedoch hält man ohne sie kein Abendmahl für vollständig.«
»Die armen Briten!« sagte Sallust. »Sie haben doch wenigstens etwas Gutes; sie liefern uns Austern!«
»Ich wollte, sie lieferten uns einen Gladiator«, sagte der Ädil, der immer noch mit den Bedürfnissen des Amphitheaters beschäftigt war.
»Bei der Pallas!« rief Glaukus, als sein Lieblingssklave einen neuen Kranz um sein Haupt wand. »Mir gefallen diese wilden Schauspiele wohl, solange die Bestie mit der Bestie kämpft, aber wenn ein Mensch, ein Mann mit Fleisch und Blut wie wir, gleichgültig in die Arena getrieben und ihm Glied für Glied abgerissen wird, so ist dieser Anblick mir zu schrecklich; mir fängt an zu schwindeln, der Atem stockt mir und es treibt mich, hinabzueilen und ihn zu verteidigen. Das Freudengeschrei des Volkes erscheint mir fürchterlicher als die Stimmen der Orestes verfolgenden Furien. Ich freue mich, dass in dem nächsten Kampfspiel so wenig Aussicht für jene blutige Darstellung vorhanden ist!«
Der Ädil zuckte verständnislos die Schulter, und alle Anwesenden starrten Glaukus verwundert oder befremdet an. Dieser ließ sich aber nicht beirren.
»Ihr Italiener seid allerdings an diese Schauspiele gewöhnt, wir Griechen sind milder. Oh, Schatten des Pindar! – Das Entzückende eines wahrhaft griechischen Spiels – das Aufbieten aller Kräfte des Mannes gegen den Mann – der edelmütige Kampf – der halb traurige Triumph – der Stolz, einem würdigen Feinde zu begegnen, der Missmut, ihn überwunden zu haben! Doch ihr versteht mich nicht!«
»Das Lammfleisch ist vortrefflich«, sagte Sallust.
Der Sklave, der das Vorschneideramt hatte und sich nicht wenig auf seine Geschicklichkeit zugute tat, hatte bei dem Klange der Musik eben dieses Geschäft beendigt, indem sein Messer den Takt hielt, langsam und bedächtig beginnend und im lebhaften Eifer nach den Tönen eines herrlichen Diapasons sein schwieriges Kunstwerk vollendend.
»Dein Koch ist gewiss aus Sizilien?« sagte Pansa.
»Ja, von Syrakus.«
»Ich will auf ihn wetten«, sagte Klodius, »wir wollen einmal einen Wettkampf mit Gerichten veranstalten.«
»Ein solches Spiel wäre allerdings einem Tiergefecht vorzuziehen, aber ich kann die Wette auf meinen Sizilianer nicht eingehen – du hast nicht so Kostbares dagegen zu setzen!«
»Meine Phillida, meine schöne Tänzerin!«
»Ich kaufe niemals Frauen«, sagte der Grieche, indem er sich seinen Kranz zurechtschob.
Die Musikanten, welche draußen in dem Säulengang aufgestellt waren, hatten ihr Konzert mit dem Lammfleisch begonnen. Sie gingen jetzt in eine sanftere, fröhlichere, man konnte fast sagen geistreichere Melodie über und sangen ein Lied von Horaz.
»Ach, der alte, gute Horaz«, sagte Sallust teilnehmend, »er wusste wohl Feste und Mädchen zu besingen, aber nicht so gut als unsere neueren Dichter.«
»Als der unsterbliche Fulvius zum Beispiel«, bemerkte Klodius.
»Und Spuräna, und Cajus Mutius, der in einem Jahre drei epische Gedichte schrieb – konnte das Horaz oder Virgil?« sagte Lepidus. »Diese alten Dichter begingen alle den Fehler, die Bildhauerei nachzuahmen, statt die Malerei. Einfachheit und Ruhe – das machten sie sich zur Aufgabe; doch wir Neuern haben Feuer und Kraft und Leidenschaft – wir schlafen niemals ein, wir ahmen die Farben der Malerei nach, ihr Leben und ihre Handlung. Unsterblicher Fulvius!«
»Habt ihr«, fragte Sallust, »die neue Ode des Spuräna zu Ehren der ägyptischen Isis schon gehört? – Sie ist herrlich – es herrscht in ihr eine wahrhaft religiöse Begeisterung.«
»Isis scheint eine Lieblingsgottheit in Pompeji zu sein«, sagte Glaukus.
»Ja«, erwiderte Pansa, »sie steht besonders jetzt sehr in Gunst; ihre Statue hat die merkwürdigsten Orakel ausgesprochen. Ich bin nicht abergläubisch, doch muss ich bekennen, dass sie schon mehr als einmal in meinem städtischen Amte mir nützlich gewesen ist. Auch sind ihre Priester so fromm! Keine jener lustigen Diener des Jupiter oder der Fortuna; sie gehen barfuß, essen kein Fleisch und sind den größten Teil der Nacht mit Andachtsübungen beschäftigt!«
»Das ist in der Tat ein Beispiel für unsere anderen Priester! Jupiters Tempel ist der Reform sehr bedürftig«, sagte Lepidus, der gern alles reformiert hätte, außer sich selbst.
»Man sagt, Arbaces, der Ägypter, habe den Priestern der Isis einige feierliche Mysterien mitgeteilt«, bemerkte Sallust. »Er rühmt sich der Abstammung von dem Geschlecht des Ramses und behauptet, in seiner Familie seien die Geheimnisse des fernsten Altertums aufbewahrt.«
»Auf jeden Fall besitzt er die Gabe des bösen Auges«, sagte Klodius; »jedes Mal, wenn mir diese Medusenstirn ohne das entzaubernde Zeichen begegnet, kann ich sicher sein, ein Lieblingspferd zu verlieren, oder neunmal hintereinander den niedrigsten Wurf im Würfelspiel zu werfen.«
»Das letztere würde allerdings ein Wunder sein!« sagte Sallust.
»Wie meinst du das?« erwiderte der Spieler mit trotzigem Blick.
»Ich meine nichts, denn das ist das, was du mir übrig ließest, wenn ich oft mit dir spielte.«
Klodius antwortete nur durch ein verächtliches Lächeln.
»Wäre Arbaces nicht so reich«, sagte Pansa, indem er sich ein wichtiges Ansehen gab, »so würde ich ihn meine Würde etwas fühlen lassen und die Wahrheit des Gerüchts untersuchen, welches ihn einen Sterndeuter und Zauberer nennt. Als Agrippa Ädil zu Rom war, verbannte er alle diese gefährlichen Bürger. Aber ein reicher Mann – es ist die Pflicht eines Ädils, die Reichen zu beschützen!«
»Was denkt ihr von jener neuen Sekte, welche, wie man mir erzählt, selbst in Pompeji einige Anhänger zählt, von jenen Jüngern des hebräischen Gottes – Christus?«
»Oh, das sind nur eitle Träumer«, sagte Klodius. »Es ist kein einziger vornehmer Mann unter ihnen. Ihre Proselyten sind arme, unbedeutende, unwissende Menschen!«
»Die jedoch für ihre Gotteslästerungen gekreuzigt zu werden verdienten«, sagte Pansa mit heftigem Ton. »Sie verleugnen die Venus und den Jupiter! Ein Nazarener ist gleichbedeutend mit einem Gottesleugner. Wenn ich sie nur fange!«
Der zweite Gang war vorbei, die Gäste dehnten sich auf ihren Ruhebetten. Es entstand eine Pause, während welcher sie auf die sanften Töne des Südens und der arkadischen Flöte hörten. Glaukus schien am wenigsten geneigt, das Stillschweigen zu brechen, doch Klodius glaubte, dass man die Zeit besser benutzen könne.
»Deine Gesundheit, mein Glaukus«, sagte er, indem er jedem Buchstaben in dem Namen des Griechen einen vollen Becher mit der Gemütlichkeit eines alten Trinkers weihte. »Willst du dein gestriges Unglück nicht wieder gutmachen? Sieh, die Würfel lächeln uns an!«
»Wie du willst«, erwiderte Glaukus.
»Würfeln im August und in Gegenwart des Ädils!« sagte Pansa, indem er sich in die Brust warf, »das ist gegen alle Gesetze.«
»Nicht in deiner Gegenwart, ehrwürdiger Pansa«, erwiderte Klodius, indem er die Würfel in einer langen Büchse schüttelte. »Deine Gegenwart untersagt jede Übertretung des Gesetzes. Doch nicht die Sache selbst verletzt, sondern nur deren Übertreibung.«
»Wie weise!« flüsterte einer der Gäste.
»Nun, so will ich denn nach einer anderen Seite sehen«, sagte der Ädil.
»Jetzt noch nicht, teurer Pansa. Lasst uns bis nach dem Essen warten«, erwiderte Glaukus.
Klodius gab halb unwillig nach, indem er sein Missvergnügen unter einem Gähnen verbarg.
»Er kann es nicht erwarten, bis er das Geld verschlingt«, flüsterte Lepidus dem Sallust, auf eine Stelle in der Aulularia des Plautus anspielend, zu.
»Oh, wie gut kenne ich diese Polypen, die nicht loslassen, was sie einmal berührten«, antwortete Sallust, nochmals eine Stelle aus demselben Lustspiel zitierend.
Der zweite Gang, aus Früchten, Pistaziennüssen, Torten und Konfekt, die zu tausend fantastischen Formen verarbeitet waren, bestehend, wurde nun aufgetragen, und die Aufwärter stellten auch den Wein (der bisher den Gästen einzeln in Bechern gereicht worden war) in großen, gläsernen Gefäßen auf den Tisch, deren jedes auf einem Zettel anzeigte, wie alt und woher der Wein sei.
»Koste einmal diesen Lesbier, mein Pansa«, sagte Sallust, »er ist vortrefflich.«
»Er ist nicht sehr alt«, sagte Glaukus, »aber er wurde, wie wir selbst, durch das Feuer früh gezeitigt – der Wein durch die Flammen des Vulkans – wir durch die seines Weibes – der ich diesen vollen Becher darbringe.«
»Er ist köstlich«, sagte Pansa, »doch ist vielleicht ein klein wenig Rosinenduft in seiner Blüte.«
»Welch schöner Becher!« bemerkte Klodius, indem er ein Trinkgefäß von durchsichtigem Kristall emporhob, dessen Handgriff mit Edelsteinen besetzt und in der Form sich durchschlingender Schlangen, einer Lieblingsdarstellung in Pompeji, gearbeitet war.
»Dieser Ring«, sagte Glaukus, indem er einen kostbaren Juwel vom Finger zog und an den Griff hing, »gibt ihm ein noch reicheres Aussehen und macht ihn, mein Klodius, dem die Götter Gesundheit und das Glück gewähren mögen, ihn oft bis an den Rand zu füllen und zu leeren, eines Geschenks für dich weniger unwürdig.«
»Du bist zu gütig, Glaukus«, sagte der Spieler, indem er den Becher seinem Sklaven übergab, »doch dein Lob macht mir ihn doppelt wert.«
»Diesen Becher den Grazien«, sagte Pansa, und er leerte ihn dreimal. Die Gäste folgten seinem Beispiel.
Die Musik ging jetzt in eine wilde jonische Tonart über, während von jungen, lieblichen Stimmen in griechischer Sprache und in griechischem Rhythmus ein Lied gesungen wurde.
Die Gäste klatschten laut Beifall. »Freunde«, sagte Klodius, »diese jonische Melodie erinnert mich an einen Trinkspruch. Freunde, es lebe die schöne Ione!«
»Ione – der Name ist ein griechischer«, sagte Glaukus mit sanfter Stimme, »ich trinke mit Vergnügen diese Gesundheit. Aber wer ist Ione?«
»Ach, du bist erst vor kurzem wieder in Pompeji angekommen, sonst verdientest du für deine Unwissenheit verbannt zu werden«, sagte Lepidus scherzend. »Ione nicht zu kennen, heißt mit der ersten Schönheit der Stadt unbekannt sein.«
»Es ist eine seltene Schönheit«, bemerkte Pansa, »und welche Stimme sie hat!«
»Sie muss sich von Nachtigallenzungen ernähren«, sagte Sallust.
»Wisse denn, mein Glaukus«, sagte Klodius, »dass Ione eine Fremde ist, die erst seit kurzem nach Pompeji kam. Sie singt wie Sappho, und dichtet ihre Lieder selbst, und ich weiß nicht, ob sie die Musen mehr in der Tibia oder Zither oder der Leier übertrifft. Ihre Schönheit ist blendend. Ihr Haus ist vollkommen eingerichtet; so viel Geschmack – so viel Edelsteine – so herrliche Arbeiten in Bronze! Sie ist reich, und ebenso freigebig als reich.«
»Wahrscheinlich werden ihre Liebhaber«, sagte Glaukus, »dafür sorgen, dass sie nicht verhungert; und leicht gewonnenes Geld wird ebenso leicht wieder ausgegeben.«
»Ihre Liebhaber! – Das ist eben das Rätsel! Ione hat nur einen Fehler – sie ist keusch. Ganz Pompeji liegt zu ihren Füßen, und sie hat keinen Geliebten. Sie will sogar nicht heiraten.«
»Keinen Geliebten!« wiederholte Glaukus.
»Nein, sie hat zwar den Gürtel der Venus, aber auch den jungfräulichen Sinn der Vesta.«
»Das ist ja ein Wunder!« rief Glaukus. »Kann man sie nicht sehen?«
»Ich will dich diesen Abend dort einführen«, erwiderte Klodius. »Bis dahin«, fügte er hinzu, »dürften die Würfel–« »Ich bin dabei!« sagte der gefällige Glaukus. »Pansa, sieh nach einer anderen Seite!«
Lepidus und Sallust spielten gerade und ungerade, während Glaukus und Klodius die Wechselfälle der Würfel versuchten. »Beim Jupiter«, sprach Glaukus; »schon zum zweiten Mal werfe ich den niedrigsten Wurf.«
»Jetzt sei mir Venus günstig«, sagte Klodius, indem er die Büchse lange schüttelte. »Oh, alma Venus – es ist Venus selbst!« – indem ihm der höchste Wurf, nach dem Namen jener Göttin benannt, gelang, »die allerdings meist denen günstig ist, die Geld gewinnen«.
»Venus ist undankbar gegen mich«, sprach Glaukus scherzend, »ich habe immer auf ihrem Altar geopfert.«
»Wer mit dem Klodius spielt«, flüsterte Lepidus, »muss bald, wie der Curculio des Plautus, sein Pallium einsetzen.«
»Der arme Glaukus!« erwiderte Sallust leise. »Er ist so blind als Fortuna selbst.«
»Ich spiele nicht mehr«, sagte Glaukus, »ich habe dreißig Sesterzien verloren.«
»Es tut mir leid«, begann Klodius.
»Kümmere dich nicht«, sprach Glaukus, »der Schmerz meines Verlustes wird durch das Vergnügen überwogen, dich gewinnen zu sehen.«
Die Unterhaltung wurde hierauf allgemeiner und lebhafter. Der Wein floss reichlicher, und Ione wurde nochmals von den Gästen des Glaukus bis in den Himmel erhoben.
»Statt mit den Sternen um die Wette zu wachen«, sagte Lepidus, »wollen wir lieber Ione besuchen, bei deren Anblick die Sterne selbst erbleichen müssen.«
Klodius, der einsah, dass, man seinen Gastgeber an diesem Abend wohl nicht wieder zum Würfelspiel bewegen würde, trat dem Vorschlag bei. Auch Glaukus konnte nicht verbergen, obgleich er seine Gäste höflich nötigte, länger bei ihm zu bleiben, dass seine Neugierde durch das Lob der Ione erregt worden sei. So beschlossen endlich alle außer Pansa, nach dem Hause der schönen Griechin zu wandern. Es wurde noch auf die Gesundheit des Glaukus und des Titus getrunken – sie brachten ihre letzte Libation dar – stiegen die Treppe hinunter, gingen durch das erleuchtete Atrium – und indem sie ungebissen über den wilden Hund schritten, der an der Schwelle auf dem Boden dargestellt war, befanden sie sich in den noch lebhaften Straßen Pompejis, als der Mond eben aufgegangen war.
Sie kamen durch den Teil der Stadt, wo die Juwelierläden sich befanden und in denen die Edelsteine den Glanz der vielen Lichter zurückwarfen, und gelangten endlich zu dem Hause der Ione. Die Halle war glänzend erleuchtet, an jeder Seite des Tabliniums hingen gestickte purpurne Vorhänge, die Wände, sowie der Fußboden von Mosaik, glühten von den lebhaftesten Farben der Künstler; und unter dem Säulengang, der das duftige Viridarium umgab, fanden sie Ione, welche bereits von vielen Anbetern und Verehrern umgeben war.
»Sagtest du nicht, sie sei eine Athenerin?« flüsterte Glaukus, bevor er in das Peristil trat.
»Nein, sie ist aus Neapel.«
»Neapel!« wiederholte Glaukus, und in diesem Augenblick sah er, als jene die Ione umgebende Gruppe auseinandertrat, die schöne Gestalt und die reizenden Züge wieder, welche vor einigen Monaten einen so großen Eindruck auf ihn gemacht hatten.
3
Arbaces, der Ägypter, war, als er Glaukus und seinen Gefährten am Meeresstrand verlassen hatte, nach dem belebteren Teil der Bucht gegangen. Dort blieb er stehen und blickte mit übereinandergeschlagenen Armen und finsterem Blick auf das bewegte Treiben.
»Toren, Kurzsichtige, Narren, die ihr seid!« murmelte er bei sich selbst. »Mögt ihr Geschäfte oder Vergnügen, Handel oder Religion betreiben, immer seid ihr Sklaven der Leidenschaften, die ihr beherrschen solltet! Wie könnte ich euch verachten, wenn ich euch nicht hasste – ja, hasste! Griechen oder Römer, gleichviel – von uns, den geheimen Schätzen der Weisheit Ägyptens, habt ihr das Feuer entwendet, welches euch Seelen verleiht – euer Wissen – eure Dichtkunst – eure Gesetze – eure Künste – eure barbarische Überlegenheit im Kriege – ihr habt sie uns gestohlen, wie ein Sklave die Überbleibsel eines Gastmahls! Und jetzt, ihr Räuber, seid ihr unsere Herren, und die Pyramiden schauen nicht mehr herab auf das Geschlecht des Ramses. Aber mein Geist bezwingt euch doch durch die Macht seiner Weisheit, wenn auch die Fesseln unsichtbar sind. Solange List die Gewalt zu besiegen vermag, solange der Religion eine Höhle bleibt, aus der Orakel die Menschen täuschen können, so lange beherrschen Weise die Welt. Selbst eure Laster benutzt Arbaces für seine Genüsse – Genüsse, die uneingeweihten Augen verborgen bleiben – reiche, unerschöpfliche Genüsse, welche euer entnervter Geist in dumpfer Sinnlichkeit weder begreifen kann noch sich träumen lässt! Meine Macht geht so weit, als die Menschen glauben. Ich beherrsche selbst Männer, die sich in Purpur kleiden. Theben möge gefallen, Ägypten nur ein Name sein; in der ganzen Welt findet Arbaces seine Untertanen!«
Indem er so sprach, schritt der Ägypter langsam weiter, und als er in die Stadt trat, ragte seine schlanke Figur über der auf dem Forum versammelten Menge hervor, und er wandte sich nach dem kleinen, doch anmutigen, der Isis geweihten Tempel.
Dieses Gebäude war erst vor kurzem an Stelle eines anderen, durch ein Erdbeben vor sechzehn Jahren zerstörten Tempels errichtet worden und erfreute sich bei den Pompejanern einer großen Beliebtheit. Die Orakel der Isis wurden in einer geheimnisvollen Sprache erteilt, waren aber das Ergebnis tiefer Menschenkenntnis. Sie entsprachen vollkommen den jedesmaligen persönlichen Verhältnissen und bildeten einen entschiedenen Gegensatz zu der leeren Allgemeinheit, die in den Sprüchen anderer Gottheiten obwaltete.
Als Arbaces an die Schranken gelangte, welche den profanen Teil des Tempels von dem geheiligten trennten, fand er eine Menge Menschen aus allen Klassen, besonders aber vom Kaufmannsstande, vor den Altären in dem offenen Hofe in stiller Andacht und Ehrfurcht versammelt. In den Wänden der Cella, zu welcher sieben Stufen von parischem Marmor führten, standen mehrere Statuen in Nischen, und diese Wände waren mit dem der Isis geheiligten Granatapfel geziert. Auf einem Piedestal1 in dem Innern des Gebäudes standen zwei Statuen, nämlich die der Isis und ihres Gefährten, des schweigsamen und geheimnisvollen Orus. Noch viele andere Statuen bildeten den Hofstaat der ägyptischen Gottheit; der ihr verwandte und vielnamige Bacchus und die zyprische Venus, wie sie aus dem Bade stieg, eine griechische Nachahmung ihrer selbst, und Anubis mit dem Hundekopf, der Stier Apis und mehrere ägyptische Götzenbilder von seltsamer Form und unbekannter Benennung.
Natürlich wurde in den süditalienischen Städten Isis nicht mit den Zeremonien und Formen verehrt wie in Ägypten. Die eingeborenen wie die vermischten Nationen des Südens verwechselten mit ebenso viel Übermut als Unwissenheit den Kultus aller Zeiten und Länder. Auch die düsteren Geheimnisse des Nils wurden durch vielfache leichtsinnige Beimischungen aus den Glaubensbekenntnissen an dem Cephisus und der Tiber verunstaltet und entwürdigt. Den Tempel der Isis zu Pompeji bedienten römische und griechische Priester, die sowohl der Sprache als der Gebräuche ihrer früheren Verehrer unkundig waren, und der Abkömmling jener ehrwürdigen ägyptischen Könige musste, trotz des Scheins tiefer Ehrfurcht, den er beobachtete, oft im geheimen über die kleinlichen Spielereien lachen, welche die feierliche und ernste Götterverehrung jenes glühenden Klimas darstellen sollten.
In zwei Reihen standen auf den Stufen die Opferpriester, gekleidet in weiße Gewänder, und oben zwei untergeordnete Priester, von denen der eine einen Palmzweig, der andere ein kleines, mit Getreide gefülltes Gefäß in der Hand hielt. Auf dem kleinen Raume im Vordergrunde drängten sich die Verehrer der Isis.
»Was führt euch zu den Altären der heiligen Isis?« fragte Arbaces leise einen dieser Verehrer, der offenbar ein Kaufmann war. »Nach den weißen Gewändern der Priester scheint ein Opfer gehalten werden zu sollen, und nach der bedeutenden Versammlung erwartet ihr wohl ein Orakel? Welche Frage wollt ihr beantwortet haben?«
»Wir sind Kaufleute«, erwiderte der Gefragte (der niemand anders als Diomedes war) mit leiser Stimme, »welche das Schicksal ihrer Schiffe, die morgen nach Alexandrien absegeln, wissen möchten. Wir wollen der Göttin ein Opfer darbringen und ihre Antwort erflehen. Ich gehöre nicht zu denen, wie du an meiner Kleidung siehst, die das Opfer veranstaltet haben, doch ist auch mir, beim Jupiter!, an der glücklichen Fahrt der Schiffe viel gelegen. Ich habe einen kleinen Handel, wie könnte ich sonst in diesen schlechten Zeiten bestehen?«
Der Ägypter erwiderte mit Würde: »Zwar ist Isis eigentlich die Beschützerin des Ackerbaues, doch nicht weniger die des Handels.« Indem Arbaces hierauf sein Haupt gegen Osten wendete, schien er sich in eifriges Gebet zu vertiefen.
Jetzt trat ein von Kopf bis zu Fuß weißgekleideter Priester auf die Mitte der Treppe; zwei andere Priester lösten die, welche bisher oben gestanden hatten, ab. Sie waren bis unter die Brust nackt und der übrige Teil des Körpers in weiße, weite Gewänder gehüllt. Zugleich trug ein am Fuße der Treppe sitzender Priester eine feierliche Melodie auf einem langen Blasinstrument vor. Auf der halben Höhe der Treppe stand ein anderer, der in einer Hand einen Votivkranz, in der anderen einen weißen Stab trug, während vor jedem Altar geopfert wurde.
Die Gesichtszüge des Arbaces schienen, während die Aruspices die Eingeweide untersuchten, von ihrer strengen Ruhe und Kälte nachzulassen und ganz frommer Andacht sich hinzugeben – sie nahmen einen freudigeren Ausdruck an, als die Zeichen für günstig erklärt wurden und das Feuer hell und leuchtend den geheiligten Teil des Opfers unter Wohlgerüchen von Myrten und Weihrauch verzehrte. Grabesstille herrschte in der Versammlung, und als die Priester sich um die Cella versammelten, trat ein anderer Priester, ganz nackt bis auf einen Gürtel um den Leib, vor und erflehte, mit wilden Gebärden umherspringend, eine Antwort von der Göttin. Zuletzt hörte er erschöpft auf und man vernahm im Innern der Statue ein leises Geräusch. Dreimal nickte sie mit dem Kopfe, die Lippen öffneten sich, und eine hohle Stimme sprach in geheimnisvollem Ton die Worte:
Wie wilde Rosse schäumen die Wogen, Schon mancher ward in den Abgrund gezogen, Es dräuet das Schicksal mit finsterem Blick, Doch eueren Schiffen wird gnädig Geschick.
Die Stimme schwieg – die versammelte Menge atmete freier – die Kaufleute waren beruhigt. – »Nichts kann deutlicher sein«, flüsterte Diomed; »die See wird stürmisch sein, wie es oft beim Anfange des Herbstes der Fall ist, doch unseren Schiffen wird kein Unglück widerfahren. O gnadenreiche Isis!«
»Gelobt sei ewig die Göttin!« sagten die Kaufleute. »Was kann unverfänglicher sein als diese Prophezeiung?«
Der Oberpriester erhob eine Hand zum Zeichen, dass das Volk schweigen solle, denn der Kultus der Isis gebot eine den lebhaften Pompejanern fast unmögliche Enthaltsamkeit in dem Gebrauche der Sprachorgane, und nach einem kleinen Schlussgebete war die Zeremonie beendet, und die Versammlung wurde entlassen. Der Ägypter blieb jedoch, und als der Tempel schon ziemlich leer war, näherte sich ihm einer der Priester und grüßte ihn mit großer Vertraulichkeit.
Das Äußere dieses Priesters war wenig einnehmend, sein kahler Schädel war über der Stirn so platt und schmal, dass er fast dem eines afrikanischen Wilden glich. Um die Stirn bildete die Haut ein Gewebe tiefer und verwickelter Runzeln, die dunklen und kleinen Augen rollten in gelbschmutzigen Höhlen, die kurze, doch dicke Nase war abgestumpft wie die eines Satyrs, und die aufgeworfenen, blassen Lippen, die hervorstehenden Backenknochen, die gelbliche Farbe der lederartigen Gesichtshaut trugen noch mehr dazu bei, den Anblick dieses Kopfes abschreckend und Misstrauen erweckend zu machen.
»Kalenus«, sagte der Ägypter zu diesem Priester, »du hast, indem du meinen Anweisungen folgtest, die Stimme der Statue sehr verbessert, und deine Verse sind vortrefflich. Prophezeie nur immer günstige Erfolge, außer, wenn deren Erfüllung durchaus unmöglich erscheint.«
»Wenn auch«, sagte Kalenus, »der Sturm eintrifft und die verdammten Schiffe untergehen, haben wir es dann nicht vorhergesagt? Ist es nicht ein gnädiges Geschick, wenn sie zur Ruhe kommen? – Ruhe erfleht der Schiffer in der Ägäischen See, wenigstens sagt Horaz so – kann der Schiffer auf der See mehr in Ruhe sein, als wenn er auf deren Grunde liegt?«
»Richtig, mein Kalenus, ich wünschte nur, dass Apäcides an deiner Weisheit sich ein Beispiel nähme. Doch ich wünsche mit dir über ihn und einige andere Gegenstände mich zu unterhalten. Kannst du mich in eines eurer Sprechzimmer führen?« »Gewiss«, erwiderte der Priester, indem er den Arbaces in eine der kleineren Kammern an dem offenen Tore führte. Hier setzten sie sich an einen mit Früchten, Eiern, kalten Speisen und Gefäßen voll herrlichen Weins besetzten Tisch. Ein Vorhang vor dem nach dem Hofe gehenden Eingang erinnerte sie daran, leise zu sprechen oder sich keine Geheimnisse mitzuteilen; sie wählten das erstere.
»Du weißt«, sagte der Ägypter in einem Tone, der kaum hörbar wurde, »dass es immer mein Grundsatz war, die Jugend an mich zu ziehen. Ihr bewegliches und noch bildsames Gemüt macht es mir möglich, mir in ihr die geeignetsten Gehilfen zu erziehen. Ich forme und leite sie nach meinem Willen. Die Männer mache ich zu meinen Anhängern oder Dienern; die Mädchen –«
»Zu Geliebten«, fiel Kalenus ein, und ein grinsendes Lächeln entstellte noch mehr seine hässlichen Züge.
»Ja, ich leugne es nicht, das weibliche Geschlecht ist der Hauptgegenstand meiner Neigungen und Leidenschaften. Wie ihr das Opfertier erst ernährt, so liebe ich es, den Genuss mir durch eigene Ausbildung vorzubereiten. Ich finde den wahren Reiz der Liebe in dem sanften und unbewussten Fortschritt von der Unschuld zur Sehnsucht nach dem Genusse. Auf diese Weise darf ich auch die Übersättigung nicht fürchten, und ich erhalte mir die Jugendfrische meiner eigenen Gefühle, indem ich sie an anderen beobachte. Doch genug davon. So wisse denn, dass ich vor einiger Zeit in Neapel die Jone und den Apäcides antraf, die Tochter und den Sohn einer Athener Familie, welche sich zu Neapel niedergelassen hatten. Der Tod ihrer Eltern, welche mich kannten und hochschätzten, berief mich zu ihrem Beschützer. Der Jüngling, gelehrig und sanft, fügte sich willig der Richtung, die ich ihm zu geben mich bestrebte. Nach den Weibern liebe ich am meisten die Erinnerungen aus dem Lande meiner Vorfahren, gern befördere und verbreite ich in entfernten Ländern ihren geheimnisvollen Kultus. Indem ich so den Göttern diene, gefällt es mir vielleicht, die Menschen zu täuschen. Den Apäcides habe ich in dem heiligen Gottesdienst der Isis unterrichtet. Ich erklärte ihm einige der erhabenen Geheimnisse, die damit verknüpft sind und entzündete in seinem für religiöse Erhebung besonders empfänglichen Gemüte jene Begeisterung, die der Glaube in der Einbildungskraft aufregt. Ich habe ihn zu euch gesellt; er ist einer der eurigen!«
»Er ist es«, sagte Kalenus, »aber diese Aufklärungen haben nicht günstig auf ihn gewirkt. Unsere Täuschungen der großen Menge, unsere redenden Statuen und geheimen Treppen sind ihm widerwärtig. Er bereut, dass er bei uns eingetreten ist, er schleicht umher, spricht mit sich selbst und weigert sich, ferner teil an unseren Zeremonien zu nehmen. Man weiß, dass er häufig die Versammlung von Männern besucht, die im Verdacht stehen, jener neuen atheistischen Sekte anzugehören, welche alle unsere Götter verleugnet und unsere Orakel für die Eingebungen jenes bösen Geistes hält, dessen die morgenländischen Sagen erwähnen.«
»Dieses musste ich«, sagte Arbaces nachdenkend, »schon nach den Vorwürfen besorgen, die er mir machte, als ich ihn das letzte Mal sah. Schon seit längerer Zeit flieht er mich – ich will ihn aufsuchen. Ich muss meinen Unterricht fortsetzen, ich will ihn in das innere Heiligtum der Weisheit einführen. Ich muss ihn lehren, dass es zwei Stufen der Heiligkeit gibt – die erste: der Glaube – die zweite: die Enttäuschung; erstere für die Menge, letztere für die Auserwählten.«
»Ich habe die erste Stufe überschlagen«, sagte Kalenus, »und ich glaube auch du, mein Arbaces.«
»Du irrst«, erwiderte der Ägypter ernsthaft, »ich glaube noch jetzt – wenn auch nicht das, was ich lehre, doch das, was ich nicht lehre –. Die Natur hat eine Heiligkeit, der ich meine Anerkennung weder verweigern kann noch will. Ich glaube an mein eigenes Wissen, und das hat mir entdeckt – doch genug davon. Kehren wir zu unseren irdischen Angelegenheiten zurück. Wenn ich meinen Plan mit Apäcides ausführte, was waren dann meine Absichten mit Jone? Du weißt bereits, dass ich sie zu meiner Königin – meiner Braut – der Isis meines Herzens bestimmte. Erst als ich sie gesehen, empfand ich ganz die Liebe, deren meine Natur fähig ist.«
»Ich höre von allen Seiten, dass sie eine zweite Helena ist«, sagte Kalenus, und er schmatzte dabei mit den Lippen, doch war es schwer zu unterscheiden, ob dieses Schmatzen auf die Rechnung des Weins oder seiner Bemerkung zu setzen war.
»Ja, ihre Schönheit wurde selbst in Griechenland nie übertroffen«, sagte Arbaces. »Aber das ist noch nicht alles; auch ihr Geist ist des meinigen würdig. Sie hat einen für ein Weib ungewöhnlichen Genius, sie ist kühn und begeisterungsfähig für Kunst und Poesie. Man braucht nur eine Wahrheit auszusprechen, sie erfasst sie sofort mit ihrem ungewöhnlichen Verstand. Jone muss die Meinige werden! Zu ihr zieht mich doppelte Leidenschaft; ich wünsche ihre geistige wie ihre körperliche Schönheit zu genießen.«
»Also ist sie noch nicht die Deinige?« fragte der Priester.
»Nein, sie liebt mich – doch nur wie einen Freund; sie liebt mich bloß mit ihrem Geiste. Sie setzt in mir die geringfügigen Tugenden voraus, welche ich nur zu verachten die höhere Tugend habe. Doch ich muss dir noch mehr über sie mitteilen. Der Bruder und die Schwester waren jung und reich. Jone ist stolz und ehrgeizig – stolz auf ihre geistigen Fähigkeiten – auf ihr poetisches Talent, auf die Reize ihrer Unterhaltung. Als ihr Bruder mich verließ und in euren Tempel trat, ging sie ebenfalls nach Pompeji, um in seiner Nähe zu bleiben. Ihre Talente sind hier bereits bekannt. Sie gibt glänzende Feste; ihre Schönheit, ihre Stimme, ihre Poesie haben eine Schar von Verehrern um sie gesammelt. Es schmeichelt ihrem Ehrgeiz, wenn sie die Nachfolgerin der Erinna genannt wird.«
»Oder der Sappho?«
»Aber eine Sappho ohne Liebe! Ich ermutige sie, in dieser kühnen Laufbahn zu verharren, dem Vergnügen und der Eitelkeit zu huldigen; ich liebte es, sie durch die Zerstreuungen und den Luxus Pompejis fortgerissen zu sehen. Ich wünschte, sie von eitlen, leeren Gecken, von Anbetern umgeben zu sehen, die sie verachten musste, damit sie desto mehr den Mangel wahrer Liebe fühlen möge. Dann, in jenem Zustande der Erschöpfung, welcher der Aufregung folgen musste, konnte ich meine Netze stellen – ihre Teilnahme erregen – ihre Leidenschaften wecken und leiten – um mich ihres Herzens zu bemächtigen.«
»Bist du aber nicht besorgt wegen deiner Nebenbuhler? Die Verehrer des weiblichen Geschlechts in Italien sind gewandt in der Kunst, zu gefallen.«
»Das fürchte ich nicht! – Ihr griechisches Gemüt verachtet die barbarischen Römer, und würde sich selbst verachten, wenn es Liebe für einen Abkömmling dieses Geschlechts fühlte.«
»Aber du bist ein Ägypter und kein Grieche!«
»Ägypten«, erwiderte Arbaces, »ist die Mutter Athens. Die Schutzgöttin dieser Stadt, Minerva, ist unsere Gottheit, und der Begründer Athens, Kekrops, war ein Flüchtling aus unserem ägyptischen Sais. Ich habe ihr das alles schon erzählt, und in meinem Blute verehrt sie die älteste Dynastie der Erde. Doch ich muss gestehen, dass seit kurzem einiges Misstrauen in mir erwacht ist. Sie ist schweigsamer, als sie zu sein pflegte, sie liebt melancholische und traurige Musik, sie seufzt ohne einen äußeren Grund. Dieses kann den Mangel der Liebe – aber auch deren Entstehung andeuten. In beiden Fällen ist es Zeit, meine Pläne auf ihren Geist und ihr Herz auszuführen; in dem einen Fall, um die Quelle der Liebe gegen mich zu leiten, in dem anderen, um sie für mich zu erwecken. Aus diesem Grunde habe ich dich aufgesucht.«
»Und wie kann ich dir behilflich sein?«
»Ich beabsichtige, sie zu einem Fest in meinem Hause einzuladen; ich wünsche, ihre Sinne zu verblenden, aufzuregen und zu entflammen. Unsere Künste – jene Künste, durch welche in Ägypten die Novizen gebildet wurden, müssen angewendet werden; und ich will ihr unter dem Schleier der Mysterien der Religion die Geheimnisse der Liebe mitteilen.«
»Ah, jetzt verstehe ich – eines jener üppigen Feste, an welchen wir – trotz unserer Gelübde der Enthaltsamkeit, wir, die Priester der Isis, in deinem Hause teilgenommen haben.«
»Nein, nein! Glaubst du, dass ihre keuschen Augen für solche Szenen schon geeignet sind? – Nein – zuerst müssen wir den Bruder wieder in unsere Netze ziehen – dieses ist eine leichtere Aufgabe. Ich will dir jetzt meinen Plan mitteilen.«
4
Leuchtend schien die Sonne in das üppige Zimmer im Hause des Glaukus, und durch die Fenster drangen die wohlriechenden Düfte aus dem Garten herein. Die Bilder an den Wänden leuchteten in den lebhaftesten Farben. Außer dem Hauptgemälde, die Leda und den Tyndarus darstellend, wurde das Auge noch durch einige andere Gemälde von ausgezeichneter Schönheit entzückt. In dem einen sah man Kupido, wie er sich an die Venus schmiegte, in einem anderen Ariadne, am Ufer schlafend, noch unbekannt mit der Treulosigkeit des Theseus. Die Sonnenstrahlen spielten lustig auf dem mit Mosaik ausgelegten Fußboden und an den glänzenden Wänden – und zugleich durchdrangen die Strahlen der Freude das Herz des jungen Glaukus.