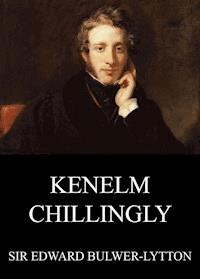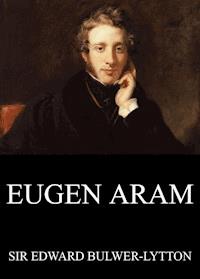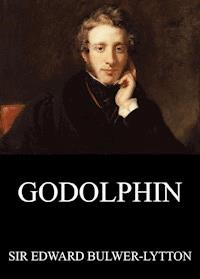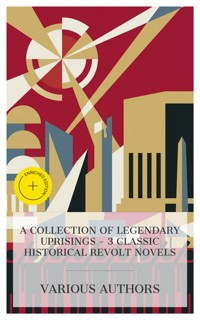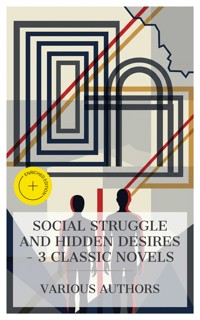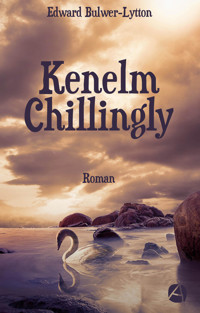1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In "Die letzten Tage von Pompeji" entführt Edward Bulwer-Lytton den Leser in das pulsierende Leben der antiken Stadt Pompeji, kurz vor dem verheerenden Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 n. Chr. Dieser historische Roman vereint eine eindringliche Charakterstudie mit fesselnden sozialen und politischen Spannungen der römischen Gesellschaft. Bulwer-Lyttons meisterhafter Stil verbindet lebendige Beschreibungen mit einer dramatischen Erzählweise, die es dem Leser ermöglicht, die schleichende Gefahr des Vulkanausbruchs zu spüren, während er gleichzeitig in die persönlichen Schicksale der Protagonisten eintaucht, die von Liebe, Ehre und Verrat geprägt sind. Edward Bulwer-Lytton, ein vielseitiger Schriftsteller des 19. Jahrhunderts und ein Pionier des historischen Romans, war stark von seiner Leidenschaft für Geschichte und der Antike beeinflusst. Sein umfangreiches Wissen über die römische Kultur und die Tragik des Schicksals von Pompeji spiegelt sich in jedem Detail seines Werkes wider. Als ein Kritiker der viktorianischen Gesellschaft brachte er mit diesem Roman nicht nur historische Ereignisse ans Licht, sondern auch die moralischen Dilemmata, die das menschliche Handeln durchdringen. Dieses Werk ist eine fesselnde Lektüre für alle, die sich für Geschichte, menschliche Emotionen und die Konfrontation mit unvermeidlichem Schicksal interessieren. Bulwer-Lyttons Erzählung wird sowohl Kulturliebhaber als auch Fans von spannenden historischen Erzählungen in ihren Bann ziehen und sie auf eine packende Reise in die Vergangenheit mitnehmen. In dieser bereicherten Ausgabe haben wir mit großer Sorgfalt zusätzlichen Mehrwert für Ihr Leseerlebnis geschaffen: - Eine prägnante Einführung verortet die zeitlose Anziehungskraft und Themen des Werkes. - Die Synopsis skizziert die Haupthandlung und hebt wichtige Entwicklungen hervor, ohne entscheidende Wendungen zu verraten. - Ein ausführlicher historischer Kontext versetzt Sie in die Ereignisse und Einflüsse der Epoche, die das Schreiben geprägt haben. - Eine gründliche Analyse seziert Symbole, Motive und Charakterentwicklungen, um tiefere Bedeutungen offenzulegen. - Reflexionsfragen laden Sie dazu ein, sich persönlich mit den Botschaften des Werkes auseinanderzusetzen und sie mit dem modernen Leben in Verbindung zu bringen. - Sorgfältig ausgewählte unvergessliche Zitate heben Momente literarischer Brillanz hervor. - Interaktive Fußnoten erklären ungewöhnliche Referenzen, historische Anspielungen und veraltete Ausdrücke für eine mühelose, besser informierte Lektüre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Die letzten Tage von Pompeji (Historischer Roman)
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Glanz und Lebenslust einer Küstenstadt prallen auf die unerbittliche Macht der Natur, die unbemerkt den Countdown schon gestellt hat. Dieser historische Roman entfaltet die letzten, schillernden Tage einer antiken Metropole, deren Alltag, Vergnügungen und Ambitionen in einem Licht erscheinen, das zugleich verführerisch und verhängnisvoll wirkt. Die Straßen sind belebt, die Gärten duften, das Meer glitzert – und über allem thront der Berg, scheinbar ruhig. Aus dieser Spannung zwischen strahlender Oberfläche und subterrainer Bedrohung speist sich der Kernkonflikt. Das Buch lädt dazu ein, Schönheit zu bewundern und Anzeichen zu deuten. Was bleibt, wenn Gewissheiten wanken, ist die leitende Frage.
Die letzten Tage von Pompeji von Edward Bulwer-Lytton ist ein historischer Roman, der in Pompeji kurz vor dem Ausbruch des Vesuv im Jahr 79 n. Chr. spielt. Das Werk wurde erstmals 1834 veröffentlicht und gehört damit zur Literatur des frühen 19. Jahrhunderts. Bulwer-Lytton, ein englischer Autor, verbindet erzählerische Imagination mit dem damaligen Wissen über Antike und Ausgrabungen. Schauplatz ist die prosperierende Stadt am Golf von Neapel, deren kulturelle Pracht und soziale Vielfalt den Hintergrund bilden. Der Publikationskontext spiegelt die Faszination seiner Zeit für Geschichte, Moralfragen und archäologische Funde, die dem Roman Anschaulichkeit und Autorität verleihen.
Die Ausgangssituation zeigt eine Gemeinschaft in Bewegung: Handel, Feste, Spiele und private Rituale strukturieren den Alltag, während persönliche Ambitionen und Verstrickungen das Miteinander prägen. Mehrere Figuren aus unterschiedlichen Schichten erlauben Einblicke in Haus, Straße und Arena, in Kunsthandwerk und Unterhaltung. Die Erzählstimme ist sicher geführt und allwissend, mit einem Sinn für szenische Tableaus und klare Übergänge. Stilistisch arbeitet der Roman mit reicher Beschreibung, rhythmischen Perioden und fein gesetzten Akzenten, die den Lesefluss tragen. Die Stimmung schwankt zwischen heiterer Oberfläche und unterschwelliger Unruhe, ohne die spätere Katastrophe vorwegzunehmen, die der Titel bereits andeutet.
Zentrale Themen sind Vergänglichkeit, gesellschaftlicher Schein und die Frage nach Verantwortlichkeit in Zeiten des Wohlstands. Der Roman erkundet, wie Luxus, Unterhaltung und Machtbeziehungen Wahrnehmungen formen und Wahrheiten überdecken. Er lotet auch Spannungen zwischen verschiedenen Weltbildern aus, ohne sich auf simple Gegensätze festzulegen. Die Nähe zwischen öffentlicher Schau und privater Verletzlichkeit trägt zur dramatischen Dichte bei. Wiederkehrende Motive – Lärm und Stille, Licht und Schatten, Feier und Vorsicht – strukturieren die Lektüre. So entsteht ein Panorama, das nicht nur Historie belebt, sondern menschliche Konstanten freilegt: Sehnsucht nach Dauer, Angst vor Verlust, Hoffnung auf Sinn.
Für heutige Leserinnen und Leser gewinnt das Buch Relevanz, weil es die Zerbrechlichkeit komplexer Lebenswelten vor Augen führt. Es zeigt, wie Normalität trügerisch sein kann, wie Zeichen übersehen werden und wie Gemeinschaften Schönheit kultivieren, während Risiken wachsen. Die Lektüre regt an, über Stadtleben, Öffentlichkeit, Spektakel und die Ethik des Zuschauens nachzudenken. Auch Fragen sozialer Ungleichheit und kultureller Deutungshoheit werden berührt, wenn auch im Rahmen einer historischen Bühne. Emotional wirkt der Roman durch Kontraste: Nähe zu alltäglichen Freuden trifft auf das Bewusstsein eines größeren Zusammenhangs. Intellektuell bietet er Anlass, Quellen, Deutungen und Erzählstrategien zu reflektieren.
Bulwer-Lytton gestaltet sein Material mit Sinn für Detailtreue und dramaturgische Setzungen. Beschreibungen von Architektur, Kostüm und Ritualen schaffen eine plastische Oberfläche, auf der sich leise Vorausdeutungen entfalten. Die Komposition nutzt Wechsel von Ruhe und Bewegung, von Intimität und Öffentlichkeit, um Spannung aufzubauen. Dabei verschränkt der Text zeitgenössische archäologische Kenntnisse mit romantischer Vorstellungs- und Sprachkraft. Der Ton kann pathetisch und festlich sein, er kennt aber auch nüchterne Beobachtung. Diese Mischung erzeugt einen Sog, der weniger auf Überraschung als auf Steigerung des Bewusstseins und der Empfindung zielt.
Als Einleitung zu einer Lektüre lädt dieser Roman dazu ein, langsam zu schauen, Sinneseindrücke aufzunehmen und unter der Oberfläche Bedeutungen zu suchen. Wer sich auf die Bilder, Dialogrhythmen und kulturellen Verweise einlässt, erlebt eine Reise, die Vergangenheit sinnlich und gedanklich gegenwärtig macht. Ohne vorzugreifen, lässt sich sagen: Das Buch belohnt Aufmerksamkeit für Details, weil daraus emotionale Tiefe entsteht. Zugleich ermutigt es, die eigenen Maßstäbe von Erfolg, Sicherheit und Erinnerung zu befragen. So wird eine historische Erzählung zu einer Reflexion über Gegenwart – und über das, was Menschen bewahren wollen, wenn Zeit knapp wird.
Synopsis
Der historische Roman spielt in den letzten Sommertagen des Jahres 79 in Pompeji, einer wohlhabenden Stadt am Golf von Neapel. Handwerker, Händler, Patrizier und Sklaven prägen den Alltag zwischen Forum, Thermen und opulenten Villen. Feste, Spiele und Kunstgenuss spiegeln römische Lebensfreude, während am Horizont der Vesuv als ruhender Hintergrund steht. Leichte Erdstöße und ungewöhnliche Erscheinungen werden registriert, aber als Launen der Natur abgetan. Der Roman verbindet Sittenbild und Spannung, indem er die Stadt als Bühne aufbaut, deren Routine allmählich Risse zeigt. So entsteht ein Panorama, das Nähe und Vorahnung zugleich erzeugt.
Im Zentrum steht der junge Grieche Glaucus, kultiviert, lebenslustig und großzügig, der in Pompeji eine zweite Heimat gefunden hat. Er bewundert Ione, eine gebildete Schönheit griechischer Herkunft, deren Bruder Apaecides nach spiritueller Orientierung sucht. Der ägyptische Priester Arbaces gilt als einflussreicher Gönner, rätselhaft und überzeugend in öffentlichen Auftritten. Die blinde Blumenverkäuferin Nydia bewegt sich nahezu unsichtbar durch Häuser und Gassen und hört mehr, als andere ahnen. Kaufmann Diomedes und seine Tochter Julia repräsentieren bürgerlichen Ehrgeiz und gesellschaftliche Ambitionen. Nebenfiguren, darunter römische Lebemänner und frühe Christen wie Olinthus, fächern das soziale Spektrum der Stadt auf.
Empfänge, Badehausgespräche und Straßenfeste führen die Figuren zusammen, während Glaucus und Ione ihre Zuneigung behutsam vertiefen. Nydia pflegt still ihre heimliche Liebe und zeigt Loyalität, die oft unbemerkt bleibt. Julia, auf Bewunderung bedacht, reagiert empfindlich auf Zurückweisung und sucht nach Mitteln, Einfluss zurückzugewinnen. Die Erzählung zeichnet das Flair der Dekorationen, Fresken und Gärten, ohne den Blick für die Mechanik des Alltags zu verlieren. Im Hintergrund stehen kleine Erschütterungen, irritierte Tiere und zögerliche Deuter. Doch die meisten Bürger halten an Vergnügen, Geschäften und Gewohnheiten fest. Diese Gleichzeitigkeit prägt den Ton der frühen Kapitel.
Religiöse Spannungen treten deutlicher hervor. Im Tempel der Isis entfalten Priester zeremonielle Pracht, die Gläubige beeindruckt und Autorität stiftet. Arbaces nutzt Ansehen und Geheimnis, um Netzwerke zu knüpfen und Entscheidungen zu lenken. Apaecides zweifelt zunehmend am Sinn der Rituale und sucht ernstere Wahrheit. Ein Christ namens Olinthus vertritt eine Lehre, die innere Überzeugung und Nächstenliebe betont, was stille Anhänger gewinnt und Widerspruch provoziert. Zwischen kultischer Schau und persönlichem Gewissen entsteht ein Konflikt, der private Beziehungen berührt. Die Stadt bleibt höflich tolerant, doch Misstrauen wächst. Damit verknüpft der Roman Glaubenskampf und Gesellschaftssatire.
Die Intrigen verdichten sich, als Arbaces Ione für sich beanspruchen will und Wege sucht, Glaucus zu kompromittieren. Gerüchte, Verleumdungen und inszenierte Zufälle verändern öffentliche Wahrnehmungen. Ein fragwürdiges Mittel, als harmloser Trank ausgegeben, stiftet Verwirrung und lässt Handlungen missdeutet erscheinen. Julia mischt Eitelkeit mit Verletzung und wird zur nützlichen Bündnispartnerin wider Willen. Nydia beobachtet Vorgänge, die andere übersehen, und gerät zwischen Loyalität und Gefahr. Ehre, Einfluss und Leidenschaft verstricken sich, während die Kulissen des Wohlstands unverändert glänzen. Die Handlung gewinnt Tempo, ohne den Überblick über die verschiedenen Schauplätze zu verlieren.
Ein nächtisches Treffen, das Aufklärung verspricht, endet in einem Verbrechen, dessen Spur geschickt verdrängt wird. Der Verdacht fällt auf einen Unbeteiligten, und die Stadt erregt sich über Schuld und Sühne. Behörden und Publikum verlangen Entscheidung, die Bühne wechselt vom Hausflur zur Arena und zum Tribunal. Olinthus spricht furchtlos über sein Bekenntnis und verschärft damit den Widerstand der Mehrheit. Die Erzählung zeigt, wie Sensationslust, Frömmigkeit und politischer Druck ineinandergreifen. Figuren stehen vor der Frage, ob sie schweigen, bekennen oder handeln. Das Geschehen steuert auf eine öffentliche Vorführung zu, die viele Fäden zusammenführt.
Am Tag großer Spiele und religiöser Feierlichkeiten strömt Pompeji in das Amphitheater. Gladiatoren, Tiere, Magistrate und Priester füllen ein sorgfältig inszeniertes Programm, während der Beschuldigte auf sein Urteil wartet. Private Fehden und verborgene Allianzen flackern hinter der festlichen Fassade. Zugleich mehren sich Anzeichen ungewöhnlicher Witterung: flimmernde Luft, feiner Staub, dumpfes Grollen. Die Menge bleibt gebannt, denn Unterhaltung überdeckt Unruhe. Der Roman hält die Balance zwischen Spektakel und drohendem Ernst. Der Moment wird zum Schwellenpunkt, an dem städtischer Stolz und persönliche Entscheidungen aufeinanderprallen.
Ein Naturereignis unterbricht das Ritual und verwandelt Ordnung in Verwirrung. Himmel und Straßen verdunkeln sich, Asche und Steine fallen, Orientierung bricht weg. Menschen suchen Angehörige, Wege und Schutz; Verfolger werden zu Helfern oder verlieren einander im Gedränge. In der Dunkelheit zählt weniger Rang als Mut, Erinnerung und Zufall. Eine blinde junge Frau beweist Führungsstärke, weil ihre Sicherheit im Unsichtbaren liegt. Gruppen bilden sich und lösen sich wieder auf, während bekannte Orte unkenntlich werden. Entscheidungen fallen in Sekunden, und jedes Zögern wiegt schwer. Der Roman steigert Spannung, ohne das Ende vorwegzunehmen.
Die Schlusskapitel belassen Schicksale in Bewegung und richten den Blick auf Bedeutung und Maßstab der Ereignisse. Menschenpläne erweisen sich als fragil gegenüber geologischer Realität; Reichtum und Ruhm verlieren ihre Geltung. Der Text betont Verantwortung, Mitgefühl und Wahrhaftigkeit, die in Krisen sichtbarer werden als Statussymbole. Glaubensfragen bleiben offen diskutiert, doch die Kritik an Täuschung und Missbrauch ist deutlich. Pompeji erscheint als Momentaufnahme einer Welt, die im Augenblick ihres Glanzes zum Denkmal geworden ist. Die Gesamtbotschaft vereint Mahnung und Anschaulichkeit: Kultur blüht, solange Moral trägt, und Natur setzt den letzten Rahmen.
Historischer Kontext
Das Geschehen spielt im 1. Jahrhundert n. Chr. in Pompeji, einer blühenden Stadt Kampaniens am Golf von Neapel. Nach dem Bundesgenossenkrieg wurde Pompeji 80–70 v. Chr. römisches Municipium und nahm römische Institutionen, lateinische Sprache und städtische Lebensformen an, blieb jedoch von oskisch-samnitischen und griechischen Traditionen geprägt. Durch den Hafen und die Nähe zu Puteoli (Pozzuoli) war die Stadt in Mittelmeerhandel und Luxuswirtschaft eingebunden. Villenlandschaften, Thermen, Amphitheater und Tempel zeugen von Wohlstand, während der scheinbar ruhige Vesuv als unscheinbarer Hintergrund das latente geologische Risiko verbarg, das die Erzählung historisch rahmt.
Die Eruption des Vesuvs im Jahr 79 n. Chr. ist das zentrale historische Ereignis. Nach Plinius dem Jüngeren begann sie traditionell datiert am 24.–25. August (neuere Funde favorisieren den 24. Oktober), mit einer plinianischen Eruptionssäule, gefolgt von Bimsregen, Aschesturz und pyroklastischen Strömen, die Pompeji, Herculaneum, Stabiae und Oplontis verwüsteten. Plinius der Ältere starb bei einem Rettungsversuch in Stabiae; seine Neffenbriefe (Epist. 6,16; 6,20) bilden die maßgebliche zeitgenössische Quelle. Kaiser Titus organisierte Hilfsmaßnahmen. Der Roman dramatisiert die Phasen – Dunkelheit, Einsturz, panische Flucht – in enger Anlehnung an Plinius’ Bericht, wenn auch mit erzählerischer Verdichtung.
Dem Ausbruch voraus ging das schwere Erdbeben vom 5. Februar 62 n. Chr., das Seneca (Naturales quaestiones 6,1) beschreibt. Es beschädigte in Kampanien Wohnhäuser, Tempel und Infrastrukturen; viele Bauten befanden sich 79 n. Chr. noch in Reparatur. Städtische Eliten und Freigelassene finanzierten Wiederaufbauprojekte, erkennbar an Inschriften und erneuerten Fassaden (etwa im Haus der Vettier). Der Isis-Tempel wurde in dieser Phase erneuert. Diese anhaltende Bautätigkeit prägte den Alltag, erzeugte wirtschaftliche Chancen, aber auch soziale Spannungen. Der Roman verknüpft die fortdauernden Schäden, Gerüste und Risse als visuelle Marker eines verletzlichen urbanen Organismus, der dem finalen Naturereignis entgegengeht.
Die kommunale Politik Pompejis beruhte auf Duoviri, Ädilen und dem Stadtrat (decuriones); Patronage und Wahlkämpfe sind durch Wahlaufrufe (programmata) an den Wänden greifbar. Ein Schlüsselereignis war der Gladiatorenkrawall im Amphitheater 59 n. Chr., den Tacitus (Ann. 14,17) schildert: Ein blutiger Streit mit Besuchern aus Nuceria führte zu einem zehntägigen Spielverbot und Exilen für Organisatoren, darunter Livineius Regulus. Spiele dienten sozialer Konkurrenz und öffentlicher Selbstdarstellung. Der Roman nutzt die Welt der Arenen, der Kämpfer und der städtischen Ehrambitionen, um Machtkämpfe, Massenpsychologie und die politisierte Kultur der Unterhaltung authentisch zu spiegeln.
Religiös war Pompeji plural: Staatskulte, Hausgötter (Lares), Kaiserkult und Mysterienreligionen koexistierten. Der Isis-Kult blühte besonders; sein Tempel, 1764 ausgegraben, war nach 62 n. Chr. durch N. Popidius Celsinus erneuert worden, wie eine Inschrift belegt. Ägyptische Bilderwelten, Prozessionen und Initiationsriten verbanden sich mit städtischer Frömmigkeit. Zugleich konnten fremde Kulte politisch verdächtigt werden. Der Roman bindet diese Konstellation eng ein: Figuren wie der Ägypter Arbaces und die Darstellung des Isis-Heiligtums spiegeln sowohl die Popularität als auch die potenzielle Instrumentalisierung religiöser Autorität im spätneronischen/ flavischen Umfeld.
Das frühe Christentum war im Golf von Neapel plausibel präsent: Der Apostel Paulus erreichte um 60/61 n. Chr. Puteoli (Apg 28,13–14) und verweilte dort eine Woche; von hier aus konnten Netzwerke in kampanische Städte ausgreifen. Nach dem Brand Roms 64 n. Chr. verfolgte Nero Christen in der Hauptstadt, was das Klima der Verdächtigung prägte, ohne ein reichsweites Verbot zu etablieren (vgl. später Plinius/Trajan-Korrespondenz 112 n. Chr.). Der Roman zeigt eine kleine, bedrohte christliche Gemeinde um Olinthus und macht rechtliche Unsicherheiten und soziale Ablehnung sichtbar, die einer religiösen Minderheit in einer von Staatskulten geprägten Stadt entgegenschlugen.
Direkte Inspirationsquelle waren die Ausgrabungen: Herculaneum wurde 1709 entdeckt, systematisch ab 1738; Pompeji ab 1748 freigelegt und 1763 durch Inschriften als solche identifiziert. Bis in die 1820/30er Jahre traten ikonische Funde zutage (Haus des Tragischen Dichters 1824, Haus des Fauns 1830). Sir William Gells Pompeiana (1817–1819; 1832) bot detaillierte Pläne und Ansichten. Bulwer-Lytton bereiste 1833 Neapel und Pompeji, studierte Sammlung und Fresken im Museo Borbonico, und veröffentlichte 1834 den Roman. Architektur, Graffiti wie Cave canem und Alltagsobjekte erlaubten ihm, soziale Räume, Rituale und Katastrophenszenarien historisch anschaulich zu verankern.
Als gesellschaftliche und politische Kritik nutzt das Buch die antike Kulisse, um Missstände seiner eigenen Epoche zu spiegeln: die Kälte einer hierarchischen Ordnung, die Ausbeutung von Sklaven und Freigelassenen, die Korruption lokaler Eliten und die Gewaltökonomie der Massenspektakel. Die instrumentalisierte Religion – ob Staatskult oder exotische Priesterschaft – kontrastiert mit der Gewissensfreiheit einer Minorität und thematisiert Intoleranz. Der plötzliche Untergang einer prosperierenden Stadt verweist auf die Fragilität von Ordnung gegenüber Naturgewalt und menschlicher Hybris. So wird Pompeji zur Projektionsfläche für Debatten über Macht, Moral und soziale Gerechtigkeit im frühen 19. Jahrhundert.
Die letzten Tage von Pompeji (Historischer Roman)
Erster Band.
So ist der Vesuv, und solche Ereignisse finden jedes Jahr daselbst Statt. Aber alle seitherigen Ausbrüche sind, auch wenn man sie in einen einzigen zusammenfaßte, unbedeutend gegen das, was zu dem Zeitpunkte geschah, von dem wir reden. ...
Tag wurde in Nacht, und Nacht in vollständige Finsternis verwandelt – eine unaussprechliche Menge Staub und Asche wurde ausgeworfen, die Land, Meer und Luft erfüllte und zwei ganze Städte,. Herkulanum und Pompeji, begrub, während die Bewohner dem Schauspiele zusahen!
Dio Cassius, lib. XVI.
Zueigungsschreiben
an Sir William Gell etc. etc.
Werther Herr!
Bei Veröffentlichung eines Werkes, zu welchem Pompeji den Stoff liefert, kann ich mir Niemanden denken, dem es so füglich gewidmet werden dürfte, als Ihnen. Ihre herrlichen Schriften über die Alterthümer dieser Stadt haben Ihren Namen in unauflösbarer Weise mit deren früheren Erinnerungen verknüpft, gleich wie Ihr Aufenthalt in der Umgegend Sie mit den neueren Zuständen dieses Ortes identifizierte.
Ich hoffe zuversichtlich, daß Sie bei Empfang dieser Blätter einer besseren Gesundheit sich erfreuen werden, als da wir uns zu Neapel trennten, und daß, wenn Ihre Freunde ein Beispiel an Ihrer Philosophie zu nehmen haben, dies eher bezüglich Ihres unermüdlichen Fleißes in Erwartung wissenschaftlicher Kenntnisse, als hinsichtlich Ihrer unübertrefflichen Geduld in dem Leiden, der Fall sein möge.
Noch ehe diese Blätter in Ihre Hände gelangen, hoffe ich in dem Lesen Ihres gegenwärtig erscheinenden Werkes über die »Topographie von Rom und seinen Umgebungen« ziemlich weit vorgeschritten zu sein. Der flüchtige Blick, den Sie mich zu Neapel auf dessen Inhalt werfen ließen, überzeugte mich zur Genüge von seinem hohen Interesse und Werthe; und als Engländer, sowie als einer, »der unter dem Portico gewandelt,« freue ich mich bei dem Gedanken, daß Sie, während Sie hierdurch ihren eigenen Ruhm beträchtlich vermehren, zugleich auch die Ansprüche unseres Vaterlandes auf den Vorrang in denjenigen Zweigen des Wissens erneuern, in welchen wir freilich seit einigen Jahren unseren alten Ruf nur schwach gewahrt haben. Indem ich so den günstigen Erfolg Ihres Werkes vorherzusagen wage, dürfte es ziemlich überflüssig sein, einen Wunsch für die Erfüllung dieser Prophezeihung auszudrücken; eine allgemeinere Hoffnung jedoch darf ich wohl aussprechen, die nämlich, daß Sie noch lange Muße und Neigung zu den literarischen Arbeiten behalten mögen, in welchen Sie eine so umfassende Gelehrsamkeit besitzen, und daß dieselben, wie bisher, so auch fernerhin, Sie bisweilen von sich selbst, nie aber von Ihren Freunden abziehen möchten.
Ich habe die Ehre zu sein Werther Herr Ihr sehr ergebener E. L. Bulwer. Leamington, 21. September 1834
Vorrede.
Beim Besuche der wieder an's Licht gebrachten Ueberreste einer alten Stadt, die den Reisenden mehr vielleicht in die Nähe von Neapel ziehen, als die köstliche Luft oder die wolkenlose Sonne, die Veilchenthäler oder Orangenhaine des Südens, beim Anblicke der noch immer frischen und lebhaften Häuser, Straßen, Tempel und Theater eines Platzes, aus dem stolzesten Zeitpunkte des römischen Reichs – war es vielleicht ganz natürlich, daß ein Schriftsteller, der früher schon, wenn auch nur mangelhaft, in der Kunst, wieder zu beleben und zu schaffen, sich versucht hat, den innigen Wunsch empfand, diese verlassenen Straßen noch einmal zu bevölkern, diese anmuthigen Ruinen wieder herzustellen, die Gebeine, die ihm zu sehen vergönnt war, wieder zu beleben, die Kluft von achtzehn Jahrhunderten zu überspringen und zu einer zweiten Existenz zu erwecken – die Stadt der Todten!
Der Leser kann sich fernerhin leicht denken, wie gewaltig dieses Verlangen in Einem werden mußte, der fühlte, daß er sein Unternehmen ausführen könne, dem Pompeji selbst nur wenige Meilen entfernt – die See, die einst seine Schiffe trug und seine Flüchtlinge aufnahm, zu Füßen – und der verhängnisvolle Berg Vesuv, noch immer Rauch und Feuer athmend, beständig vor Augen lag!1
Ich verhehlte mir übrigens von Anfang an die großen Schwierigkeiten nicht, mit denen ich zu kämpfen hatte. Die Sitten des Mittelalters darzustellen und seine Lebensweise zu beschreiben, erforderte die Hand eines großen Geistes und doch ist diese Aufgabe vielleicht leicht und bequem im Vergleich zu derjenigen, die sich's zum Ziele setzt, eine viel frühere, uns weniger vertraute Epoche darzustellen.
Für die Menschen und Gebräuche aus der Feudalzeit fühlen wir eine natürliche Sympathie; diese Menschen waren unsere Vorfahren – von diesen Gebräuchen überkamen wir die unsrigen – der religiöse Glaube unserer ritterlichen Ahnen ist noch heute der unsrige – ihre Gräber heiligen noch jetzt unsere Kirchen – die Ruinen ihrer Burgen schauen noch heutzutage zürnend auf unsere Thäler herab. In ihren Kämpfen für Freiheit und Gerechtigkeit finden wir den Keim unserer gegenwärtigen Institutionen und in den Elementen ihres gesellschaftlichen Zustandes erblicken wir den Ursprung unseres eigenen.
An die klassischen Zeiten hingegen knüpfte sich für uns keine häusliche oder vertraute Beziehung. Der Glaube jener entschwundenen Religionen, die Gebräuche jener vergangenen Civilisation bieten wenig dar, was für unsere nordische Einbildungskraft heilig oder anziehend wäre; auch werden sie uns durch die scholastischen Pedanterien, die uns zuerst mit ihrem Wesen bekannt machten, noch mehr entkleidet und stehen mit der Erinnerung an Studien in Verbindung, die eher als Arbeit auferlegt, denn als Sache des Vergnügens betrieben wurden.
Gleichwohl übrigens schien mir die Aufgabe trotz ihrer Schwierigkeiten des Versuches werth; und in dem von mir auserwählten Zeitpunkte und Schauplatze dürfte sicherlich Vieles gefunden werden, was die Neugierde des Lesers erweckt, und sein Interesse an die Schilderungen des Verfassers fesselt. Es war das erste Jahrhundert unserer Religion – die civilisirteste Periode Roms – die Geschichte spielt an Orten, deren Ueherbleibsel wir noch heute sehen – und die Katastrophe ist eine der fürchterlichsten, welche die Tragödien der alten Geschichte unserem Auge darbieten.
Von den mir reichlich vorliegenden Materialien war ich bemüht, diejenigen auszuwählen, die für einen Leser der neueren Zeit am anziehendsten sein dürften; die ihm am wenigsten fremden Gebräuche und religiösen Meinungen – Schatten, die – wieder belebt, – ihm Bilder darstellten, welche, obschon die Repräsentanten der Vergangenheit, dennoch auch den Betrachtungen der Gegenwart am wenigsten uninteressant erschienen. Es erforderte fürwahr eine größere Selbstbeherrschung, als sich der Leser auf den ersten Blick denken mag, um so Vieles von der Hand zu weisen, was an und für sich höchst einladend war, was aber, obschon es einzelnen Theilen des Werkes Anziehungskraftt verliehen hätte, dennoch die Symmetrie des Ganzen beeinträchtigt haben würde. So spielt z.B. meine Geschichte unter der kurzen Regierung des Titus[1], als Rom auf seiner stolzesten und riesenhaftesten Höhe ungezügelten Luxus und unbeschränkter Macht stand. Es war darum eine höchst einladende Versuchung für den Verfasser, die Personen seiner Geschichte im Verlaufe der Ereignisse von Pompeji nach Rom zu führen. Was könnte solchen Stoff zur Schilderung, oder ein solches Feld für die Eitelkeit der Darstellung bieten, als jene prachtvolle Weltstadt, deren Größe der Einbildungskraft eine so herrliche Begeisterung – der Forschung eine so vortheilhafte und feierliche Würde verleihen müßte? Da ich mich jedoch bei der Wahl von Zeit und Schauplatz für den Untergang von Pompeji entschieden hatte, so bedurfte es nur einer geringen Einsicht in die höheren Prinzipien der Kunst, um zu begreifen, daß die Erzählung sich durchaus auf Pompeji selbst beschränken müsse.
In Gegensatz zu dem mächtigen Pompe Roms gebracht, wären der Luxus und Schimmer der lebhaften campanischen Stadt zur Unbedeutendheit herabgesunken. Ihr entsetzliches Geschick würde nur als ein kleiner und vereinzelter Schiffbruch auf den ungeheuern Meeren des Kaiserreiches erschienen sein, und die zu Erhöhung des Interesses meiner Schilderung herbeigerufene Hülfsmacht würde lediglich die Sache, zu deren Unterstützung sie aufgeboten wurde, zernichtet und überwältigt haben. Ich sah mich deshalb genöthigt, auf einen an und für sich so verlockenden Ausflug zu verzichten und unter strenger Beschränkung meiner Geschichte auf Pompeji Andern die Ehre zu überlassen, die hohle, aber majestätische Civilisation Roms zu schildern.
Die Stadt, deren Geschick mir eine so erhabene und fürchterliche Katastrophe darbot, gab mir auch auf den ersten Blick auf ihre Ueberbleibsel unschwer diejenigen Charaktere an die Hand, die dem Stoff und Schauplatz am besten anpaßten. Die halbgriechische Colonie des Herkules, die mit den Gebräuchen Italiens so viele aus Hellas entlehnte Sitten vermischte, wies von selbst auf die Personen des Glaukus und der Ione hin. Der Gottesdienst der Isis, ihr vorhandener Tempel, mit den falschen, entschleierten Orakeln; der Handel Pompeji's mit Alexandria, die Verbindungen des Sarnus mit dem Nil führten auf den Egypter, Arbaces, den niederträchtigen Kalenus, und den feurigen Apäcides. Die frühen Kämpfe des Christenthums mit dem heidnischen Aberglauben ließen den Olinthus erstehen und die verbrannten Felder Campaniens, längst bekannt durch die Künste der dortigen Zauberinnen, riefen die Saga des Vesuvs ganz von selbst hervor. Den Gedanken, das blinde Mädchen auftreten zu lassen, verdanke ich einer zufälligen Unterredung mit einem Herrn, der wegen seiner vielseitigen Kenntnisse und Erfahrungen unter den zu Neapel lebenden Engländern wohl bekannt ist. Als er nämlich von der tiefen Finsternis, welche den ersten von der Geschichte uns aufbewahrten Ausbruch des Vesuvs begleitete, und von dem weiteren Hindernisse sprach, das dieselbe für die Flucht der Einwohner bildete, bemerkte er, daß die Blinden in einem solchen Falle am besten daran sein und sich am leichtesten retten würden. Diese Bemerkung nun bewirkte die Erschaffung der Nydia.
Die Personen sind also die natürlichen Kinder des Schauplatzes und der Zeit, und auch die Ereignisse dürften meines Erachtens mit der damals existirenden Gesellschaft im Einklange stehen; denn nicht bloß, um die gewöhnlichen Gebräuche des Lebens, die Feste und das Forum, die Bäder und das Amphitheater, den allgemein bekannten, damals herrschenden Luxus zu schauen, rufen wir die Vergangenheit zurück; gleich wichtig und noch unendlich interessanter sind die Leidenschaften, die Verbrechen und die Wechselfälle, die die Schatten, die wir hiermit zum Leben rufen, bewegt haben mögen. Wir verstehen eine Weltepoche nur sehr schlecht, wenn wir das Romantische in ihr vernachlässigen; – in der Poesie des Lebens liegt eben so viel Wahrheit, als in seiner Prosa.
Da bei Behandlung einer wenig gekannten und weit hinter uns liegenden Zeit die größte Schwierigkeit darin liegt, die eingeführten Personen vor dem Auge des Lesers »leben und weben« zu lassen, so sollte dies ohne Zweifel das erste Bestreben bei einem derartigen Werke sein; und alle Versuche zu Entfaltung erlernter Kenntnisse dürfen nur als untergeordnete Mittel zu Erreichung dieses Haupterfordernisses der Dichtung betrachtet werden. Die erste Kunst des Dichters (des Schöpfers) ist, seinen Geschöpfen Lebensathmen einzuhauchen – die zweite, ihre Worte und Handlungen der Epoche, in welcher sie sprechen und handeln sollen, anzupassen. Letztere Kunst wird vielleicht dadurch am besten in Anwendung gebracht, daß man die Kunst selbst dem Leser nicht beständig vor Augen führt, nicht jede Seite mit Citaten, nicht den Rand mit Noten füllt. Beständige Verweisungen auf gelehrte Autoritäten haben den Werken der Dichtung etwas Ermüdendes und Anmaßendes an sich. Sie erscheinen wie Lobreden, die der Verfasser seiner eigenen Genauigkeit und seinem Wissen hält; sie dienen nicht dazu, seine Gedanken in ein klares Licht zu setzen, sondern lassen nur seine Gelehrsamkeit strahlen. Der Anschauungsgeist jedoch, der antiken Bildern antike Farben zu verleihen weiß, ist wohl die wahre Gelehrsamkeit, welche ein derartiges Werk erfordert, – ohne jenen Geist ist die Pedanterie störend und ärgerlich, mit demselben aber unnöthig. Niemand, der genau weiß, was die prosaische Dichtung nunmehr geworden ist, der ihre Würde, ihren Einfluß, die Art, wie sie allmählig alle ähnlichen Zweige der Literatur absorbirt hat, ihr Vermögen, zu belehren sowohl, als zu unterhalten, völlig erkennt, kann ihre Beziehung zur Geschichte, zur Philosophie, zur Politik, – ihre gänzliche Uebereinstimmung mit der Poesie und ihre Unterwürfigkeit unter die Wahrheit so weit verkennen, um sie zu scholastischer Frivolität herabwürdigen zu wollen; sie erhebt ja die Schulwissenschaft zur schaffenden Kraft, und ist weit entfernt, die letztere unter das Joch der ersteren zu beugen.
Was die Redeweise der eingeführten Personen anbelangt, so war ich sorgfältig bemüht, das zu vermeiden, was mir von jeher als ein unglücklicher Irrthum derer erschienen ist, die in unseren Tagen Menschen aus der klassischen Zeit vorzuführen versuchten.2 Die Autoren haben denselben meistens die hochtrabenden Sentenzen, die kalte und didaktische Feierlichkeit der Sprache in den Mund gelegt, die sie in den vorsätzlich bewunderten klassischen Schriftstellern finden; Römer im gewöhnlichen Leben in den Perioden Cicero's sprechen zu lassen, ist aber eben so widersinnig, als wenn ein Novellendichter seinen englischen Charakteren die langen Phrasen Johnson's oder Burke's zuschreiben wollte. Der Fehler ist sogar um so größer, weil er unter der Maske von Gelehrsamkeit und Wahrheit nur den gänzlichen Mangel einer richtigen Beurtheilungskraft verräth; weil er ermüdet, langweilt, ärgert, und weil wir beim Gähnen nicht einmal die Befriedigung haben, zu denken, daß wir gelehrt gähnen. Um den Gesprächen klassischer Personen einige Treue zu verleihen, müssen wir uns namentlich hüten, die Gelegenheit zu klassischen Redensarten an den Haaren herbeizuziehen. Nichts kann einem Schriftsteller ein steiferes und unbehaglicheres Ansehen geben, als das hastige und plötzliche Umwerfen der Toga. Wir müssen zu unserer Aufgabe die vertraute Bekanntschaft vieler Jahre mitbringen; die Anspielungen, die Wendungen und Ausdrücke, so wie die Sprache überhaupt, müssen aus einem längst angefüllten Strome fließen; die Blumen müssen aus natürlichem Boden versetzt und nicht etwa aus zweiter Hand auf dem nächsten Marktplatze gekauft werden. Dieser Vorzug nun, der allerdings lediglich in der genauen Bekanntschaft mit dem Stoffe liegt, ist fast mehr Sache des Zufalls als des eigenen Verdienstes; denn er hängt von dem Umfange ab, in welchem die Klassiker in unsere Jugenderziehung und in das Studium unserer reiferen Jahren hineingezogen wurden. Wäre übrigens ein Schriftsteller sogar im Besitze der höchsten Vorzüge, die Erziehung und Studium hiebei an die Hand gehen können, so dürfte er doch kaum im Stande sein, sich in ein von dem seinigen so gänzlich verschiedenes Zeitalter zu versetzen, ohne daß einige Ungenauigkeiten, einige durch Unachtsamkeit oder Vergeßlichkeit entstandene Fehler in seine Zeichnungen sich einschlichen. Wenn fernerhin sogar in Werken über die Gebräuche der Alten, die von der ernstesten und ausgearbeitesten Art und von den gelehrtesten Männern verfaßt sind, einzelne derartige Unvollkommenheiten oft durch einen verhältnismäßig nur oberflächlich unterrichteten Kritiker entdeckt werden, so müßte es denn doch von mir allzu anmaßend erscheinen, wenn ich hoffen wollte, daß ich glücklicher gewesen sei, als unendlich gelehrtere Männer, und zwar in einem Werke, bei welchem die Gelehrsamkeit unendlich weniger erforderlich ist. Genug, wenn dieses Buch trotz aller seiner Unvollkommenheiten als ein in der Farbengebung vielleicht ungeübtes, in der Zeichnung mangelhaftes, aber gleichwohl nicht völlig unähnliches Gemälde der Zeit erfunden wird, die ich zu schildern unternommen – so möchte es fernerhin (was weit wichtiger ist) eine richtige Darstellung der menschlichen Leidenschaften und des menschlichen Herzens bieten, deren Grundstoffe zu allen Zeiten dieselben sind! Möge mir endlich gestattet sein, den Leser zu erinnern, daß, wenn es mir gelungen ist, einer Beschreibung klassischer Gebräuche und einer Geschichte aus der klassischen Zeit einiges Interesse und Leben zu verleihen, mir etwas gelang, was bis daher Allen mißlang;3 aus diesem Vordersatze aber entwickelt sich nothwendigerweise als ebenso tröstliches, obwohl minder glorreiches Correlat, daß, wenn mein Unternehmen fehl schlug, ich da unterlag, wo Alle scheiterten! Nach solchem Ausspruche weiß ich nichts Besseres zu thun, als sogleich zu schließen. Kann ich etwas Sprechenderes sagen, um zu beweisen, daß ein Schriftsteller nie halb so viel Scharfsinn entwickelt, als wenn er bemüht ist, seine eigene Schöpfung ins bestmöglichsten Licht zu stellen?
Fußnoten
1 Dieses Werk wurde beinahe vollständig im vorigen Winter zu Neapel niedergeschrieben. Bei meiner Rückkehr nach England war ich zu sehr mit politischen Gegenständen beschäftigt, um viele Zeit zu rein literarischen Arbeiten zu haben, außer allenfalls in den nicht unwillkommenen Zwischenräumen, wo das Parlament schlafen geht, und die anderen Gegenstände des menschlichen Lebens erwachen läßt, indem es nämlich seine ermüdeten Gesetzgeber entsendet, theils zu den verschiedenen Arten der Jagd nachzugehen, theils um Ochsen zu mästen, und endlich auch, um das Feld der Literatur zu bearbeiten.
2 Was das klare und scharfe Urtheil Sir Walter Scotts in seiner Vorrede zu Ivanhoe (erste Ausgabe) so trefflich ausgedrückt hat, scheint mir wenigstens eben so gut seine Anwendung auf einen Schriftsteller zu finden, der seinen Stoff aus dem klassischen Alterthum, als auf einen, der ihn aus den Feudalzeiten schöpft. Möge mir gestattet sein, mich hier der betreffenden Worte zu bedienen, und mir dieselben für den Augenblick achtungsvoll und ehrwürdig anzueignen:
3 Man muß mir verzeihen, wenn ich selbst Barthelemy nicht ausnehme. Sein Anarchasis ist ein Werk voll wunderbarer Gewandtheit, Sorgfalt, Eleganz und Forschung; aber es ist kein Leben darin! Es macht allerdings keinen Anspruch darauf, ein wirklicher Roman zu sein; aber selbst als fingierte Reiseschilderung ist es schwerfällig und ermüdend. Aeußere Gelehrsamkeit findet sich in Menge, aber der innere Geist fehlt. Barthelemy wurde nicht vom Wein des Alterthums entzückt, aber er hat eine gewaltige Menge von Weinlisten zusammengetragen. »Anacharsis,« sagte Schlegel treffend und witzig, »sieht Alles auf seinen Reisen nicht wie ein junger Scythe an, sondern wie ein alter Pariser!« Ja, und wie ein Pariser, der nie in dem Leser den Gedanken erweckt daß er überhaupt gereist sei – außer allenfalls in seinem Armstuhl.
Erstes Buch.
Quid sit futurum eras, fuge quaerere; Quem sors dierum cunque dabit, luero Appone: nec dulces amores Sperne puer, neque tu choreas.
Hor. lib. I. od. 9.
Erstes Kapitel.
Die zwei edlen Pompejaner.
»Ha, Diomed, gut, daß ich Dich treffe. Speisest Du diesen Abend bei Glaukus?« sagte ein junger Mann von kleinem Wuchse, der seine Tunika in jenen lockern und weibischen Falten trug, die in ihm einen vornehmen und eleganten Herrn erkennen ließen.
»Ach nein, mein lieber Klodius, er hat mich nicht eingeladen,« antwortete Diomed, ein Mann von mittleren Jahren und stattlichem Aussehen. »Beim Pollux! er hat mir da einen schlechten Streich gespielt; man sagt, seine Abendessen seien die besten in Pompeji.«
»Sie sind nicht schlecht, aber es gibt für mich nie Wein genug dabei. Das wahre Blut der alten Griechen rollt in Glaukus' Adern nicht; denn er behauptet, wenn er des Abends Wein getrunken habe, besitze der den andern Tag keinen Verstand mehr.«
»Seine Sparsamkeit hat nach meiner Meinung nach einen andern Beweggrund,« sagte Diomed, seine Augenbrauen runzelnd; »trotz seiner Eitelkeit und Verschwendung halte ich ihn nicht für so reich, als er zu sein vorgibt, und er schont vielleicht lieber seine Amphoren, als seinen Verstand.«
»Das ist ein Grund mehr, seine Gastereien zu besuchen, so lange seine Sestertien dauern. Im nächsten Jahre, Diomed, werden wir uns einen andern Glaukus suchen müssen.«
»Er soll auch ein Freund vom Würfelspiele sein.«
»Er liebt alle Vergnügungen; und so lange er es liebt, Abendessen zu geben, werden wir Alle auch ihn lieben.«
»Schön, mein Klodius, das ist gut gesagt! aber, gelegentlich gesprochen, hast Du meinen Keller nie gesehen?«
»Ich erinnere mich dessen nicht, mein guter Diomed.«
»Nun, so mußt Du an einem der nächsten Abende mit mir zu Nacht speisen; ich habe Muränen[2] in meinem Behälter und werde den Aedil Pansa auch einladen.«
»Oh! mache keine Umstände mit mir! – Persicos odi apparatus. Ich bin leicht zufrieden zu stellen. Aber der Tag neigt sich; ich habe im Sinne, in's Bad zu gehen – und Du?«
»Ich gehe zum Quästor – Staatsangelegenheiten; – hierauf in den Isistempel. Lebe wohl!«
»Was ist das für ein prahlsüchtiger, anscheinend bis über den Kopf beschäftigter und schlecht erzogener Bursche!« sagte Klodius leise zu sich, während er sich langsam entfernte; »er denkt uns mit seinen Festen und seinem Keller vergessen zu machen, daß er der Sohn eines Freigelassenen ist; und was wollen wir auch, so oft wir ihm die Ehre erweisen, ihm sein Geld abzugewinnen; diese reichen Plebejer sind für uns verschwenderische Patrizier eine wahre Ernte.«
Unter diesem Selbstgespräche gelangte Klaudius in die Via Domitiana, die, voll von Fußgängern und Equipagen, ganz dieselbe übermäßige Lebendigkeit, Rührigkeit und Fröhlichkeit zeigte, wie man sie noch heutzutage in den Straßen von Neapel findet.
Die Schellen der schnell an einander vorbeifahrenden Wägen drangen lustig zum Ohre, und Klodius grüßte die Eigenthümer der Equipagen, die sich durch ihre Eleganz oder Eigenthümlichkeit am meisten bemerklich machten, mit einem Lächeln oder Kopfnicken; – denn es gab in der That keinen jungen Mann in ganz Pompeji, der eine so ausgebreitete Bekanntschaft gehabt hätte.
»Ah! Du bist es, Klodius! und wie hast Du auf Dein Glück geschlafen?« rief mit angenehmem und sanftem Tone ein junger Mann, der in einem herrlich und anmuthig gebauten Wagen saß. Auf der bronzenen Außenseite waren von griechischer Künstlerhand Basreliefs angebracht, welche die olympischen Spiele vorstellten. Die an seinem Wagen befindlichen Pferde waren von der seltesten parthischen Race; ihre schlanken Glieder schienen die Erde zu verachten und in der Luft zu schweben, und doch standen sie bei der leisesten Bewegung des Kutschers, der sich hinter dem Herrn der Equipage befand, unbeweglich still, wie wenn sie plötzlich in Stein verwandelt worden wären, scheinbar leblos, aber lebensähnlich, wie eines der Wunderwerke des Praxiteles. Auch der Herr selbst war von jener schlanken und schönen Symmetrie, welche die athenischen Bildhauer zu ihren Modellen wählten; an seinen leichten, in Büscheln herabfallenden Locken und an der vollkommenen Harmonie, die in seinen Zügen herrschte, verrieth sich seine griechische Abkunft. Er trug keine Toga – ein Kleidungsstück, das zu den Zeiten der Kaiser kein unterscheidendes Merkmal der römischen Bürger mehr war, und über das sich alle Tonangeber in der Mode lustig machten; aber seine Tunika glühte im reichsten Schimmer des tyrischen Purpurs und die Fibulä oder Schnallen, die sie zusammenhielten, waren mit Smaragden geschmückt. Um den Hals trug er eine goldene Kette, die sich in der Mitte der Brust in die Gestalt eines Schlangenkopfs verflocht, aus dessen Munde ein Siegelring von ausgesuchter Arbeit hing. Die Ärmel seiner Tunika waren weit und am Handgelenke mit goldenen Fransen geziert, und ein mit Arabesken gestickter, von demselben Stoffe wie die Fransen, gefertigter und um den Leib geschlungener Gürtel diente ihm statt der Taschen, um Sacktuch, Beutel, Griffel und Schreibtafel darin aufzubewahren.
»Mein lieber Glaukus,« sagte Klodius, »ich freue mich, daß Dein Verlust auf Dein Aussehen so wenig Einfluß geübt hat. Du siehst ja aus, als ob Du von Apollo begeistert worden wärest, und Dein Gesicht strahlt wie eine Glorie von dem Glanze des Glücks. Jedermann würde Dich für den glücklichen Spieler und mich für den Verlierenden halten.«
»Ach! mein Klodius, was liegt denn in dem Gewinn oder Verluste dieses elenden Metalls, das unsere Heiterkeit stören sollte? Beim Jupiter, so lange wir noch jung sind und die vollen Locken mit Kränzen bedecken können, so lange die Töne der Zithara noch zu ungesättigten Ohren dringen und das Lächeln Lydia's oder Chloe's über unsere Adern hinfliegt, in welchen das Blut so schnell fließt, müssen wir auch beim Anblick des Sonnenlichts uns freuen, und sogar die Zeit zwingen, nur die Schatzmeisterin unserer Vergnügungen zu sein. Du weißt wohl, daß Du diesen Abend bei mir speisest?«
»Wer vergäße je eine Einladung von Glaukus!«
»Wohin gehst Du jetzt?«
»Ich dachte ins Bad zu gehen; aber es ist noch eine ganze Stunde bis zur gewöhnlichen Zeit.«
»Gut, da will ich meinen Wagen zurücksenden und Dich begleiten. So, so, mein Philias,« fuhr er fort, indem er das Pferd liebkoste, das ihm zunächst stund und durch ein leichtes Wiehern und durch ein Zurücklegen seiner Ohren die Zärtlichkeit spielend heimgab; »du hast heute Feiertag. Ist dies nicht ein schönes Thier, Klodius?«
»Des Phöbus würdig,« antwortete der edle Parasit, »oder des Glaukus.«
Zweites Kapitel.
Das blinde Blumenmädchen und die Modeschönheit. – Geständnis des Atheners – Der Leser macht die Bekanntschaft des Arbaces von Egypten.
Während sich die beiden jungen Männer über tausenderlei verschiedene Gegenstände flüchtig besprachen, durchwandelten sie die Straßen der Stadt mit leichtem Schritte. Sie waren in das Quartier der reichsten Kaufläden gelangt, deren offenstehendes Innere von der flimmernden, aber harmonischen Pracht der Fresken strahlte, die in Geschmack und Zeichnung von unsäglicher Mannigfaltigkeit waren. Die sprudelnden Springbrunnen, die, wo sich ein freier Anblick darbot, ihren kühlenden Schaum in die Sommerluft schleuderten; die Menge der Vorübergehenden oder vielmehr der Umherschlenderer, von denen der größere Theil in Gewänder von tyrischem Purpur gekleidet war, die um die reizendsten Läden versammelten Haufen, die hin und her wandelnden Sklaven mit bronzenen Gefäßen von den anmuthigsten Formen auf dem Kopf; die da und dort stehenden jungen Landmädchen mit Röcken voll hochrother Früchte oder Blumen, welche für die alten Bewohner Italiens reizender waren, als für ihre Nachkommen, denen in der That latet anguis in herba[3] – in jedem Veilchen oder jeder Rose eine Krankheit zu lauern scheint.4 Die verschiedenen Versammlungsörter, die bei diesem geschäftslosen Volke unsere Kaffeehäuser und Clubs ersetzen; die Schuppen, in welchen auf Marmortafeln Gefäße mit Wein und Öl aufgestellt waren, und vor deren Schwellen Bänke, die man durch ausgespannte Purpurdecken gegen die Sonne geschützt hatte, die Müden zum Ausruhen, die Müßiggänger zum Verweilen einluden – Alles dieses bildete eine so bunte, belebte und belebende Scene, daß der athenische Geist des Glaukus wegen seiner Empfänglichkeit für die Freude dadurch wohl entschuldigt wurde.
»Sprich mir nicht mehr von Rom,« sagte er zu Klodius. »In seinen mächtigen Mauern sind die Vergnügungen zu prunkvoll und schwerfällig. Sogar in dem Kreise des Hofes, in dem vergoldeten Hause des Nero, inmitten der beginnenden Pracht des für Titus bestimmten Palastes liegt eine gewisse Schwerfälligkeit. Das Auge leidet darunter und der Geist wird dadurch ermüdet. Überdies macht es uns angenehm, mein lieber Klodius, den unermeßlichen Luxus und Reichthum Anderer mit der Mittelmäßigkeit unserer eigenen Zustände vergleichen zu müssen. Hier hingegen überlassen wir uns ganz behaglich den Vergnügungen und genießen den vollen Glanz des Luxus ohne das Ermüdende seines Pompes.«
»Aus diesem Grunde also hast Du Pompeji zu Deinem Sommeraufenthalt gewählt?«
»Ja wohl; ich ziehe Pompeji Bajä vor. Zwar lasse ich den Reizen von Bajä Gerechtigkeit widerfahren; aber ich hoffe die Pedanten, die es bewohnen und jedes ihrer Vergnügungen nach Drachmen abzuwägen scheinen.«
»Und doch bist Du ein Freund der Gelehrten, und was Poesie betrifft, so sind ja Äschylus und Homer, das Epos, wie das Drama, bei Dir zu Hause.«
»Ja, aber diese Römer, die meine athenischen Vorfahren nachahmen, benehmen sich bei Allem so schwerfällig! Selbst wenn sie auf die Jagd gehen, lassen sie sich die Werke Plato's von ihren Sklaven nachtragen; und wenn sie die Fährte des wilden Schweines verlieren, greifen sie nach ihren Büchern und ihrem Papyrus, um nicht auch die Zeit zu verlieren. Während die Tänzerinnen in dem ganzen Zauber persischer Tänze vor ihren Augen hingleiten, liest ihnen ein Freigelassener mit einem Marmorgesichte ein Kapitel aus Cicero de officiis[4] vor. Ungeschickte Parmazisten! Vergnügen und Studium, sind keine vereinbare Elemente; man muß sie getrennt genießen; die Römer aber verlieren beide Genüsse durch diese vorwitzige Affektation von Versteinerung, und beweisen dadurch, daß sie weder für den einen noch für den andern Sinn haben. Oh! mein lieber Klodius, wie wenig verstehen Deine Landsleute von der wahren Geschmeidigkeit des Perikles, von den wahren Zauberkünsten einer Aspasia! Gestern besuchte ich Plinius. Er saß in seinem Sommerhause und schrieb, während ein unglücklicher Sklave Flöte blies. Sein Neffe, (ach! Ohrfeigen möchte ich solchen philosophischen Zierbengeln geben!) sein Neffe las die Beschreibung der Pest von Thucybides, begleitete bisweilen die Musik mit einem Nicken seines dünkelhaften Köpfchens, während seine Lippen all die Ekel erregenden Details dieser schrecklichen Schilderungen vortrugen. Dieser junge Windbeutel fand es ganz in der Ordnung, zu gleicher Zeit ein Liebeslied und die Beschreibung der Pest zu lernen.«
»Nun, sie sind auch ziemlich dasselbe!« meinte Klodius.
»Dies sagte ich auch wirklich zu ihm, um seine Abgeschmacktheit zu entschuldigen; aber mein junger Philosoph sah mich vorwurfsvoll an, und antwortete mir, ohne den Spott zu verstehen, die Musik ergötze nur den Sinn des Gehörs, während das Buch (wohl zu bedenken, die Beschreibung der Pest!) das Herz erhebe. ›Ach!‹ sagte der dicke Oheim, ›mein Neffe ist ein ganzer Athenienser, der das utile mit dem dulci zu vereinigen weiß.‹ Bei der Minerva, wie lachte ich in die Faust hinein. Ich war noch da, als man dem philosophischen Schulknaben meldete, daß sein liebster Freigelassener eben am Fieber sterbe. ›Unerbittlicher Tod!‹ rief er, ›bringet mir meinen Horaz. Wie schön weiß dieser liebenswürdige Poet auch in solcherlei Unglücksfällen zu trösten!‹ Oh, können solche Leute lieben, mein Klodius? Kaum mit den Sinnen! Wie selten hat ein Römer ein Herz! Er ist nur eine geistige Maschine, der Fleisch und Blut fehlt.«
Obschon Klodius sich im Geheimen etwas verletzt fühlte, als er seine Landsleute so herabwürdigen hörte, so stellte er sich doch, als ob er derselben Meinung sei, wie sein Freund; theils weil er von der Natur ein Parasit, theils weil es damals unter den leichtsinnigen jungen Römern Sitte war, gegen dieselbe Abkunft, die sie in Wirklichkeit so anmaßend machte, einige Verachtung zu affektiren. Es gehörte zur Mode, die Griechen nachzuahmen und sich zugleich über diese ungeschickte Nachäfferei lustig zu machen.
Während dieses Gesprächs wurden ihre Schritte von der Menge aufgehalten, die sich an einem offenen Platze, wo drei Straßen zusammenliefen, versammelt hatte. Hier, im Schatten der Säulenhalle eines Tempels von graziöser und leichter Architektur, stand ein junges Mädchen, am rechten Arm ein Blumenkörbchen, in der linken Hand ein kleines, dreisaitiges Instrument, zu dessen schwachen und angenehmen Tönen sie ein halb barbarisches Lied sang. Bei jeder Ruhepause in der Musik bot sie mit Anmuth den Zuschauern ihr Körbchen dar, und lud sie zum Kaufe der Blumen ein; und mehr als ein Sesterz fiel in den Korb, entweder zur Belohnung des Gesanges, oder als ein Beweis der Theilnahme an der Sängerin – denn sie war blind.
»Es ist meine arme Thessalierin,« sprach Glaukus stille stehend. »Ich habe sie seit meiner Rückkehr nach Pompeji nicht wieder gesehen. Sie hat eine angenehme Stimme; wir wollen ihr zuhören.«
Das Lied des blinden Blumenmädchens
1.
Kauft meine Blumen, hört meine Klagen, Ich komm' aus der Ferne, ich bin blind; Wenn die Erde so schön ist, wie sie sagen, Die Blume hier ist der Erde Kind! Ihr seht noch die Schönheit, die sie ihr lieh? Sie kommt so eben von ihrem Schooß; Vor einer Stunde erst riß ich sie Aus dem Schlafe in ihren Armen los, Mit der Kunst, die ihr zarter Odem ist, Die ihr zarter, lieblicher Odem ist, Und tosend sich über sie ergoß!
Seht, wie auf den Lippen ihr Kuß noch schwebt, Wie auf den Wangen die Thräne noch bebt, Denn sie weinet, die zärtliche Mutter weinet, (Wenn sie, Sorge und Sehnsucht im Herzen geeinet, Morgens und Abends die Wache bezieht) – Sie weinet, weil der Liebling so schön erblüht, Sie weinet, sie weinet aus Liebe, Und der Thau ist die Thräne der Liebe, Die aus dem Brunnen des Herzens quillt.
2.
Ihr lebet in eitler Welt voll Licht, Wo Liebe sich in dem Geliebten spiegelt, Das Ohr allein ist der Blinden Gesicht, Und ihr ist der Tag für immer verriegelt.
Wie drunten ein abgeschied'ner Geist Steh' ich am Strome der Qual verwaist; Ich höre die Schatten vorüberziehen Und fühle nur ihres Odems Wehen.
Und ich möchte so gern die Geliebten schauen Und ich recke die Arme nach ihnen all, Doch ich fasse nur hohler Stimmen Schall, Das Leben ist mir ein Gespenst voll Grauen.
Kauft meine Blumen, o seht sie weinen, O hört sie seufzen die lieblichen Kleinen (Sie haben auch eine Stimme wie wir); »Die Blinde,« klagen die Blätterlosen, »Versengt mit ihrem Odem die Rosen; »Wir sind vom Lichte ans Licht gebracht, »Wir schauern zurück vor dem Kinde der Nacht. »O lasset uns uns're Erlösung erflehen; »Wir schmachten nach Augen, die uns sehen. »Wir sind zu heiter für diese Nacht, »O gönnt uns den Tag, der aus Euch lacht, »O kaufet, o kaufet die Blumen!«
»Ich muß diesen Veilchenstrauß haben, liebenswürdige Nydia,« sagte Glaukus, sich durch die Menge hindurchdrängend und eine Handvoll kleiner Münzen in das Körbchen werfend; »Deine Stimme ist reizender als je.«
Die junge Blinde fuhr rasch vor, als sie die Stimme des Atheners hörte, aber plötzlich stand sie still, und Hals, Wangen und Stirne überzog schnell eine hohe Röthe.
»Du bist also wieder zurückgekehrt?« sagte sie mit leisem Tone; hierauf wiederholte sie, gleichsam wie im Selbstgespräche: »Glaukus ist zurückgekehrt!«
»Ja, mein Kind, ich bin erst seit wenigen Tagen wieder in Pompeji. Mein Garten bedarf Deiner Pflege wie früher; ich rechne darauf, daß Du ihn morgen besuchest. Ich versichere Dich, daß in meinem Hause keine andere Hand Kränze flechten soll, als die der hübschen Nydia.«
Nydia lächelte, antwortete aber nicht; Glaukus stecke die ausgesuchten Veilchen an seine Brust und begab sich vergnügt und gleichgültig aus der Menge fort.
»Dieses Kind ist also eine Art Klientin von Dir?« sagte Klodius.
»Ja; – nicht wahr, sie sing recht brav? Diese arme Sklavin interessirt mich. Ueberdies ist sei aus dem Lande des Götterberges; der Olympus hat auf ihre Wege geschaut – sie ist aus Thessalien.«
»Dem Lande der Zauberinnen.«
»Allerdings; aber ich meines Theils finde, daß alle Frauenzimmer Zauberinnen sind, und bei der Venus! in Pompeji scheint die Luft sogar einen Zaubertrank eingesogen zu haben, so viele Reize findet hier mein Auge auf jedem bartlosen Gesichte.«
»Ach! da geht gerade eine der schönsten Gestalten von Pompeji vorüber, die Tochter des alten Diomed, die reiche Julia,« rief Klodius, während eine junge Dame, das Gesicht mit einem Schleier verhüllt und von zwei Sklavinnen begleitet, auf dem Wege ins Bad sich ihnen näherte.
»Schöne Julia! wir grüßen Dich,« sagte Klodius.
Julia lüftete ihren Schleier weit genug, um mit einiger Koketterie ein schönes römisches Profil, ein dunkles, feuriges Auge und eine Wange zu zeigen, über deren natürliche Olivenfarbe die Kunst ein schöneres und sanfteres Rosenroth ausgegossen hatte.
»Und Glaukus ist auch wieder zurückgekehrt?« begann sie, dem Athener einen ausdrucksvollen Blick zuwerfend. »Hat er,« setzte sie beinahe halblaut hinzu, »seine Freunde vom letzten Jahre vergessen?«
»Reizende Julia, Lethe selbst, wenn er an einem Theile der Erde verschwindet, taucht wieder an einem andern auf. Jupiter erlaubt uns nie länger als einen Augenblick zu vergessen, die strengere Venus aber gestattet selbst die Vergessenheit eines Augenblicks nicht.«
»Glaukus ist nie um schöne Worte verlegen.«
»Wer könnte es sein, wenn der Gegenstand derselben so schön ist?«
»Werden wir Euch Beide bald in meines Vaters Villa sehen?« fragte Julia, sich zu Klodius wendend.
»Wir werden den Tag, an dem wir Dich besuchen, mit einem weißen Steine bezeichnen,« antwortete der Spieler.
Julia ließ ihren Schleier wieder zurückfallen, aber langsam, so daß ihr letzter Blick mit erheuchelter Schüchternheit und wahrhaftiger Kühnheit auf dem Athener heftete. Dieser Blick drückte Zärtlichkeit und Liebe zumal aus.
Die Freunde setzten ihren Weg fort.
»Julia ist in der That sehr schön,« sagte Glaukus.
»Im verflossenen Jahre hättest Du dieses Geständnis mit mehr Wärme abgelegt.«
»Das ist wahr; beim ersten Anblicke war ich verblendet und hielt für einen kostbaren Stein, was nur Nachahmung war.«
»Ach,« meinte Klodius, »im Grunde gleichen sich alle Weiberherzen. Glücklich der Mann, der bei seiner Gemahlin Schönheit mit reicher Mitgift gepaart findet! Was kann er mehr wünschen?«
Glaukus seufzte.
Sie traten eben in eine weniger besuchte Straße, an deren Ende sie das breite und liebliche Meer unterschieden, das an diesen herrlichen Küsten auf sein Privilegium, Schrecken einzuflößen, verzichtet zu haben scheint; so sanft sind die über seine Oberfläche hinhauchenden Lüftchen, so glänzend und mannigfaltig die Farben, die es von den rosigen Wolken annimmt, so duftend die Wohlgerüche, die der Landwind über seine Tiefen hinstreut. Einem solchen Meere ohne Zweifel entstieg Anadyomene, um das Scepter der Welt zu ergreifen.
»Es ist noch zu früh ins Bad,« sagte der Grieche, der einem poetischen Antriebe nie zu widerstehen wußte; »wir wollen uns vom Geräusche der Stadt entfernen und die See betrachten, während die Mittagssonne sich auf ihren Wellen spiegelt.«
»Mit allem Vergnügen,« antwortete Klodius; »überdies ist die Bucht der lebhafteste Theil der Stadt.«
Pompeji bot ein Miniaturgemälde der Civilisation jener Zeit. In dem engen Kreise seiner Mauern fand sich so zu sagen ein Muster jeder Gabe vor, die der Luxus dem Reichthume lieferte. In seinen kleinen, aber strahlenden Verkaufsgewölben, seinen niedlichen Palästen, seinen Bädern, seinem Forum, Theater und Circus, in der Energie wie in der Verdorbenheit, in der Verfeinerung wie in der Lasterhaftigkeit seiner Einwohner sah man ein Muster des ganzen Reiches. Dies war gleichsam ein Spielzeug, ein Schaukästchen, worin die Götter zu ihrem Vergnügen ein Ebenbild der großen Monarchie der Erde aufzustellen schienen, und das sie später der Zeit entzogen, um der Bewunderung der Nachwelt die Wahrheit des Grundsatzes ans Herz zu legen: daß es nichts Neues unter der Sonne gebe.
Die spiegelglatte Bucht war mit Handelsschiffen und vergoldeten Galeeren, die den reichen Bürgern zum Vergnügen dienten, angefüllt. Die Fischernachen glitten rasch nach allen Seiten hin und in der Ferne zeigten sich die hohen Masten der von Plinius befehligten Flotte. Am Ufer saß ein Sicilianer, der unter heftigem Geberdenspiele und unter äußerster Beweglichkeit seiner Gesichtszüge eine Gruppe von Fischern und Landleuten eine sonderbare Geschichte von Schiffbruch leidenden Matrosen und liebreichen Delphinen erzählte, gerade so wie man sie heutzutage noch in der modernen Nachbarschaft auf dem Molo von Neapel hören kann.
Der Grieche zog seinen Gefährten aus der Menge fort und lenkte seine Schritte gegen einen einsamen Theil des Ufers, wo sich die beiden Freunde auf einem kleinen Felsstücke, das sich aus den glatten Kieselsteinen erhob, niedersetzten, und die wollüstige und kühle Luft einsogen, die, über die Wasser hintanzend, eine liebliche Musik bildete. Es lag vielleicht etwas in dieser Scene, das sie zum Stillschweigen und zu Träumereien einlud. Klodius hielt die Hand vor die Augen, um diese gegen den brennenden Himmel zu schützen, und überrechnete seinen Gewinn von der vorigen Woche; der Grieche aber stützte sich auf seinen Ellenbogen, ohne Scheu vor der Sonne, der Schutzgöttin seines Vaterlandes, deren strömendes Licht sein Herz mit Poesie, Liebe und Glück erfüllte, seine Blicke hafteten fest auf der ungeheuer großen Meeresfläche und beneideten vielleicht jedes Lüftchen des Mittags, das seine Schwingen nach den Küsten Griechenlands hintrug.
»Sage mir, Klodius, bist Du nie verliebt gewesen?«
»Jawohl, sehr oft.«
»Wer oft geliebt hat,« antwortete Glaukus, »hat nie geliebt. Es gibt nur einen Eros, obwohl viele Nachbildungen von ihm.«
»Diese Bilder sind, im Ganzen genommen, keine bösen Götterchen,« sagte Klodius.
»Ich gebe es zu,« versetzte der Grieche; »ich bete sogar den Schatten der Liebe an, sie selbst aber noch viel mehr.«
»Bist Du also ernstlich und nüchtern verliebt? empfindest Du dieses von den Dichtern geschilderte Gefühl, das uns dahin bringt, unsere Abendessen zu vernachlässigen, das Theater zu verschmähen und Elegien zu schreiben? Ich hätte es nie geglaubt; Du kannst Dich recht verstellen.«
»So weit bin ich noch nicht,« sagte Glaukus lächelnd; »ich spreche vielmehr mit Tibull:
Wen sanfte Liebe lenket, der ist, Wo er auch geht, geschützt und heilig.
In der That, ich bin nicht verliebt; aber ich könnte es werden; wenn ich nur Gelegenheit hätte, den Gegenstand meiner Liebe zu sehen. Eros möchte gerne seine Fackel anzünden; aber die Priester haben ihm kein Öl gegeben.«
»Soll ich den Gegenstand Deiner Wahl erraten? Ist es nicht Diomeds Tochter? Sie betet Dich an, und gibt sich nicht einmal die Mühe, es zu verbergen, und, beim Herkules, ich wiederhole es, sie ist so schön und reich zugleich. Sie wird die Thürpfosten ihres Gatten mit goldenen Bändern umwinden.«
»Nein, verkaufen will ich mich nicht. Die Tochter Diomeds ist schön, das gebe ich zu, und es gab eine Zeit, wo ich, wenn sie nicht die Enkelin eines Freigelassenen wäre, vielleicht – Aber nein, sie trägt all ihre Schönheit auf dem Gesichte; ihr Benehmen ist nicht wie das eines Mädchens, und ihr Verstand kennt keine andere Sorge, als die für das Vergnügen.«
»Du bist undankbar. Sage mir doch, wer die glückliche Jungfrau ist.«
»Vernimm denn, mein theurer Klodius. Vor einigen Monaten befand ich mich in Neapel, einer Stadt, ganz nach meinem Herzen; denn sie bewahrt noch das Wesen und den Stempel ihres griechischen Ursprungs, und verdient durch ihr himmlisches Klima und ihre herrlichen Gestade noch immer den Namen der Parthenope. Eines Tages trat ich in den Minervatempel ein, um die Göttin nicht sowohl für mich selbst, als für die Stadt, auf welche Pallas nicht mehr lächelt, anzuflehen. Der Tempel war einsam und verlassen; die Erinnerungen an Athen drängten sich schnell und erweichend auf mich ein; da ich mich allein glaubte und in meine ernsten und frommen Betrachtungen versunken war, drang ein Gebet aus meinem Herzen hervor, schwebte über meine Lippen und betend vergoß ich Thränen. Plötzlich wurde ich hierbei durch einen tiefen Seufzer unterbrochen; ich wandte mich um und sah dicht hinter mir ein Frauenzimmer. Sie hatte ihren Schleier aufgehoben und betete gleichfalls; als sich unsere Augen begegneten, schien mir aus diesen dunkeln und leuchtenden Sternen ein himmlischer Strahl in die innerste Seele zu dringen. Nie, mein lieber Klodius, sah ich ein schöner geformtes Menschenangesicht; eine gewisse Melancholie milderte und erhob zugleich seinen Ausdruck; jenes unaussprechliche Etwas, das der Seele entspringt und das unsere Bildhauer in das Gesicht der Psyche übertrugen, verlieh ihrer Schönheit einen erhabenen und himmlischen Charakter. Thränen entströmten ihren Augen. Ich ahnete augenblicklich, daß sie athenischer Abkunft war, und daß bei meinem Gebete für Athen ihr Herz dem meinigen geantwortet hatte. Ich fragte sie mit bewegter Stimme: ›Bist Du nicht auch eine Athenerin, schöne Jungfrau?‹ Beim Klange meiner Stimme erröthete sie, bedeckte ihr Gesicht zur Hälfte mit dem Schleier und antwortete: ›Die Asche meiner Väter ruht an den Ufern des Ilissus; ich wurde zu Neapel geboren, allein mein Herz ist athenisch, wie meine Abkunft.‹ – ›Wir wollen also unsere Opfer miteinander darbringen,‹ sagte ich zu ihr. In diesem Augenblick war der Priester hereingekommen, und wir sprachen nun, nebeneinanderstehend, ihm das Gebet nach; miteinander berührten wir die Kniee der Göttin, miteinander legten wir unsere Olivenkränze auf den Altar nieder. Bei dieser gemeinschaftlichen Handlung empfand ich ein eigenthümliches Gefühl einer fast geheiligten Zärtlichkeit. Fremd, aus einem entfernten und gefallenen Lande hergekommen, standen wir hier bei einander und allein in diesem der Gottheit unseres Vaterlandes geheiligten Tempel. War es da nicht natürlich, daß mein Herz sich zu ihr hingezogen fühlte, die ich doch gewiß mit Recht meine Landsmännin nennen konnte? Mir war, als ob ich sie seit langer Zeit kenne, und dieser einfache Gottesdienst schien mir wie durch ein Wunder die Sympathie der Herzen bewirkt und die Bande der Zeit ersetzt zu haben. Wir verließen den Tempel in tiefem Stillschweigen, und als ich sie eben fragen wollte, wo sie wohne und ob ich mir nicht einen Besuch bei ihr erlauben dürfe, kam ein Jüngling, dessen Gesichtszüge einige Ähnlichkeit mit den ihrigen hatten, und der auf den Stufen des Tempels stand, herbei und erfaßte ihre Hand. Sie wandte sich noch einmal um und gab mir den Abschiedsgruß. In diesem Augenblicke trennte uns die Menge und ich sah sie nicht wieder. Bei meiner Nachhausekunft fand ich Briefe vor, die mich zur Reise nach Athen nöthigten, wo mir Verwandte meine Erbschaft streitig zu machen drohten. Nach Gewinnung meines Prozesses kehrte ich nach Neapel zurück; ich ließ in der ganzen Stadt Nachforschungen anstellen, ohne jedoch irgend eine Spur von meiner Landsmännin auffinden zu können, und in der Hoffnung, im Schooße der Vergnügungen jede Erinnerung an diese liebliche Erscheinung zu vergessen, eilte ich mich in die Herrlichkeiten Pompeji's zu versenken. Dies ist meine ganze Geschichte. Ich liebe nicht, aber ich erinnere und sehne mich.«
Klodius wollte eben antworten, als ein langsamer und gemessener Schritt sich auf den Kieselsteinen vernehmen ließ; bei diesem Geräusch wandten sie sich Beide um und erkannten augenblicklich den neuen Ankömmling.
Es war ein Mann, der kaum vierzig Jahre zählte, von hohem Wuchse und magerem aber kräftigen und sehnigen Körperbau. Seine dunkle und bronzirte Haut verrieth seinen orientalischen Ursprung und seine Züge hatten etwas Griechisches in ihren Umrissen, besonders an Kinn, Lippen, Stirne und Hals; nur war seine Nase etwas groß und gebogen, während seine harten und hervorstechenden Knochen jene fleischlichen Conturen nicht gestatteten, die einer griechischen Physiognomie selbst im Mannesalter die runden und schönen Linien der Jugend erhielten. Seine Augen waren groß und schwarz, wie die tiefste Nacht, und strahlten von einem beständigen festen Glanze. Eine tiefe, nachdenkende und beinahe melancholische Ruhe schien in ihrem majestätischen und imposanten Blicke ihren steten Wohnsitz aufgeschlagen zu haben. Sein Gang und seine Miene waren auffallend gesetzt und stolz, und der sonderbare Schnitt und die einfachen Farben seines langen Gewandes erhöhten den gewaltigen Eindruck der ruhigen Physiognomie und der stattlichen Gestalt. Die beiden jungen Männer machten, da sie ihn grüßten, maschinenmäßig ein leichtes Zeichen mit den Fingern, das sie jedoch sorgfältig vor dem Fremden verhehlten; denn Arbaces, der Egypter, galt dafür, daß er die Gabe eines unheilvollen Blickes besitze.
»Die Scene muß wirklich herrlich sein,« sagte Arbaces mit kaltem, aber höflichem Lächeln, »die den lebenslustigen Klodius und den allbewunderten Glaukus aus den volkreichen Straßen der Stadt wegzulocken vermag.«
»Ist denn die Natur im Allgemeinen so religiös?« fragte der Grieche.
»Für die Zerstreuten – ja.«
»Diese Antwort ist streng, aber ich halte sie nicht für richtig. Das Vergnügen liebt die Gegensätze; die Zerstreuung lehrt uns die Reize der Einsamkeit, die Einsamkeit die der Zerstreuung schätzen.«
»So denken die jungen Philosophen,« antwortete der Egypter; »sie halten Erschöpfung für Nachdenken, und glauben, weil sie der Welt satt sind, den Reiz der Einsamkeit zu kennen. Aber nicht in so abgematteten Herzen kann die Natur jenen Enthusiasmus erregen, der allein ihrer keuschen Zurückhaltung ihrer unaussprechlichen Schönheit zu entlocken vermag; sie fordert keineswegs Ausrottung der Leidenschaft von Euch, sondern jene ganze Glut, der Ihr Euch, indem Ihr sie anbetet, zu entschlagen suchet. Wisse, junger Athener, als sich Luna dem Edymion im geheimnisvollen Licht enthüllte, geschah dies nicht etwa nach einem in den unruhigen Wohnungen der Menschen verlebten Tag, sondern auf dem stillen Gipfel der Berge und in den einsamen Thälern des Jägers.«
»Das Gleichnis ist schön!« rief Glaukus, »aber die Anwendung falsch. Erschöpfung, sagst Du! Oh! die Jugend erschöpft sich niemals, und was mich wenigstens betrifft, so habe ich nie einen Augenblick der Sattheit kennen gelernt.«
Wiederum lächelte der Egypter; aber diesmal war sein Lächeln frostig und schneidend, und sogar Klodius, dessen Einbildungskraft nicht sehr lebhaft war, empfand ein kleines Frieren dabei. Arbaces gab übrigens auf den leidenschaftlichen Ausruf des Glaukus keine Antwort, sondern sprach nach einer Pause mit sanftem und melancholischem Tone: »Im Ganzen genommen thust Du wohl daran, das Leben zu genießen, so lang es Dir lächelt. Die Rose welkt schnell, das Parfüm verdunstet[1q] – und was uns betrifft, o Glaukus, die wir in diesem Lande fremd und hier ferne von unserer Väter Asche sind, – welche andere Wahl bleibt uns, als sinnliches Vergnügen oder Sehnsucht? Jenes für Dich, für mich vielleicht die letztere.«
Die glänzenden Augen des Griechen füllten sich plötzlich mit Thränen.