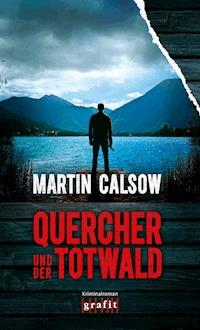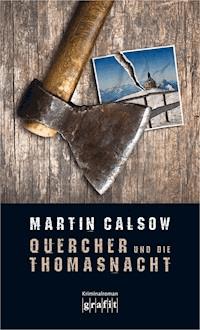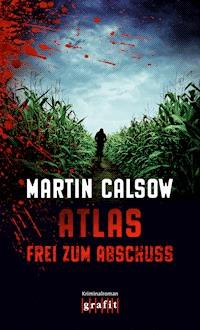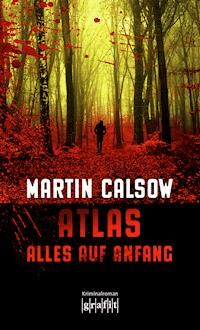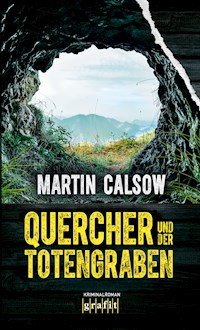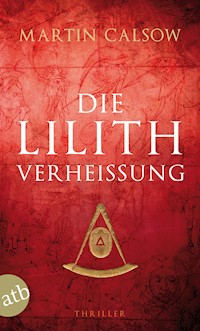
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Lilith - Dämonin und Göttin
- Sprache: Deutsch
Mystik, Macht und Mord.
Regina Bachmaier, Privatermittlerin aus Österreich, reist zu einem Auftraggeber an den Tegernsee. Sie soll für den Großindustriellen Arwed Köhn die spurlos verschwundene Archäologin Almut Moser suchen. Nur sie kann Köhn zu einem Bild von Hieronymus Bosch führen, das seine Gemäldesammlung komplettieren soll.
Während Reginas Aufenthalt auf dem tief verschneiten Anwesen der Familie Köhn brechen in Deutschland die Pocken aus. Das Land ist Opfer eines Terroraktes geworden. Zusammen mit ihrem Freund, dem deutschen Arzt Jan Kistermann, wird Regina Zeugin eines Mordes an einem Einsiedler, der mehr über das gesuchte Bosch-Gemälde und den Pockenanschlag zu wissen scheint. Kannte er das Geheimnis des Bildes, dessen Maler an die magischen Kräfte der Göttin Lilith glaubte? Jetzt werden Regina und Jan zu Gejagten: Eine Odyssee durch Österreich, Italien, die Niederlande und die apokalyptisch anmutenden Landschaften Deutschlands beginnt ...
Die fieberhafte Suche nach einem rettenden Heilmittel – packend und wie ein Film erzählt!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 711
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Martin Calsow
Die Lilith Verheißung
Thriller
- Leseprobe -
Impressum
Für meine Frau Insa
Hic Rhodus, hic salta
in herzlichem Andenken an
Harald Calsow und Margot Döscher
ISBN 978-3-8412-0492-9
Aufbau Digital,
veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, November 2012
© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin
Die Originalausgabe erschien 2012 bei Aufbau Taschenbuch, einer Marke der Aufbau Verlag GmbH & Co. KG
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.
Umschlaggestaltung capa, Anke Feselunter Verwendung zweier Motive von Bridgeman Art Library
E-Book Konvertierung: le-tex publishing services GmbH,www.le-tex.de
www.aufbau-verlag.de
Es ist alles eitel
Du siehst, wohin du siehst, nur Eitelkeit auf Erden.Was dieser heute baut, reißt jener morgen ein;Wo itzund Städte stehn, wird eine Wiese sein,Auf der ein Schäferskind wird spielen mit den Herden.
Was itzund prächtig blüht, soll bald zertreten werden;Was itzt so pocht und trotzt, ist morgen Asch und Bein;Nichts ist, das ewig sei, kein Erz, kein Marmorstein.Itzt lacht das Glück uns an, bald donnern die Beschwerden.
Der hohen Taten Ruhm muß wie ein Traum vergehn.Soll denn das Spiel der Zeit, der leichte Mensch bestehn?Ach, was ist alles dies, was wir für köstlich achten,
Als schlechte Nichtigkeit, als Schatten, Staub und Wind,Als eine Wiesenblum, die man nicht wieder findt!Noch will, was ewig ist, kein einig Mensch betrachten.
Andreas Gryphius
Das erste Buch
EinstMittenwald, Tirol, 05. 11. 1499
Mit einem weiten Schnitt öffnete der Mann den Hals des Pferdes. Das Blut sickerte in den frischgefallenen Schnee. Dampf stieg von der dunkelroten Lache auf. Sofort legte er seine Hände hinein. Sie durften auf keinen Fall Frostbeulen bekommen. Die Hände waren sein Werkzeug. Vier Männer aus Mailand sollten ihn über die Alpen begleiten. Zwei hatten sich bereits südlich von Trient aus dem Staub gemacht. Der Winter hatte Einkehr gehalten. Reisende, die den Pass lebend hinter sich gelassen hatten, berichteten von Lawinen und Überfällen. Und so waren sie zu dritt hinauf zum Brenner geritten. Das Fuhrwerk war von vier Pferden gezogen worden. Kräftige Haflinger, die hier aus dem südlichen Tirol stammten. Bis zur Grenze der Republik hatte er sich in einer Kiste mit päpstlichem Siegel versteckt. Erst Meilen dahinter war Aken herausgekrochen und auf ein Pferd gewechselt. Bozen hatten sie passiert. Die Häscher, die der Hohe Rat auf sie gehetzt hatte, schienen sie weiter westlich im Herzogtum Mailand zu vermuten. Natürlich war ihnen klar, dass er in seine Heimat zurückwollte. Aber niemals dürfte er mit seinem Werk dort ankommen. Aken war vogelfrei, solange er Brabant im Norden nicht erreicht hatte. Bis zu 40 Tage konnte die Reise dauern.
Vor einer Woche hatte er noch die letzten warmen Tage in der Lagunenstadt genossen. Auch wenn die Feuchtigkeit am Abend in seine Knochen fuhr, sog er das Licht des Tages auf. Nie zuvor hatte er solch eine Leichtigkeit, Wärme und Schönheit erlebt wie in Venedig. Seine Zeit mit Meister da Vinci hatte dem wortkargen, oft melancholischen Künstler die Tore zu einer neuen, weit besseren Welt geöffnet. Sofort hatte er zugestimmt, als der Künstlerfreund ihn bat, das Werk auf diese Art zu vollenden. Wenn er es vollständig zu seinen Freunden bringen würde, könnte sich alles neu und gut fügen. Aber wehe, die Häscher des Dogen würden ihrer habhaft werden. Seine Nackenhaare stellten sich auf, und ein Stich brach sich Bahn am Ende seines Rückens, wenn er nur daran dachte, was er hatte mitansehen müssen. Der Doge hatte ihn in das Gefängnis bringen lassen, nur um ihm zu zeigen, was sie dort mit Verrätern machten. Wie sie ihnen die Augen ausdrückten, die Finger zermalmten und die Füße zertrümmerten. Er tat ahnungslos, und so ließen sie ihn noch einmal ziehen. Seine Flucht war in letzter Sekunde geglückt. Aber nun schien die Reise zu Ende zu sein. Der Fuhrwerker hatte noch die Zügel mit aller Gewalt angezogen, war rechtzeitig vom Bock gesprungen, aber der Steinschlag prasselte dennoch auf die Pferde. Kein Treffer war tödlich, doch die scharfkantigen Felsbrocken hatten bei dem einen den Leib und bei dem anderen die Flanken aufgerissen. Schreiend und hilflos wiehernd lagen die Pferde auf der verschneiten Passstraße. Noch waren sie allein, aber zum einen brach bald die Nacht herein, und zum anderen wollten die Männer unerkannt bleiben. So kramten sie ihre Habseligkeiten aus dem umgekippten Planwagen, stürzten ihn den Abhang hinab in den Fluss, packten die wenigen Überbleibsel auf ihre Pferde und zogen zu Fuß weiter hinauf zum Pass nach Mittenwald. Dies war die einfachste Möglichkeit, die Alpenkette zu überqueren. Aber auch wenn in der Poebene noch kräftig die Sonne strahlte, konnte dort oben schon längst der Winter regieren.
Um Mitternacht erreichten sie den Pass im dichten Schneetreiben. Die drei Gasthäuser auf über 1000 Meter Höhe waren voll mit Reisenden, die sowohl von Norden wie auch vom Süden kamen. So stapften sie erschöpft und resigniert von einer Tür zur anderen und wurden immer abgewiesen. Der Wirt eines heruntergekommenen Hauses, direkt am Fluss liegend, hatte schließlich mit ihnen Erbarmen. Reisende, die aus Innsbruck kamen, hatten von Lawinen berichtet, die den Weg gen Norden versperrten. Eine schlechte Nachricht, denn so saßen die drei in der Falle. Was, wenn die Söldner des Dogen auch diesen Pass kontrollieren würden?
Der alte Wirt wies ihnen im Stall einen Platz bei den Kühen zu, die vor wenigen Wochen noch auf den Almwiesen oberhalb der Klause gegrast hatten und jetzt den Winter über hier unten ihr Dasein fristeten. Es gab zwei kleine Verschläge, getrennt durch dicke, alte Fichtenbohlen, an jeweils drei Seiten. Es stank, war aber dank der Tiere wenigstens warm, fand Aken. Die Mailänder rümpften die Nase, doch alles war besser, als in der Kälte zu verrecken. Aken hatte sich eine Box direkt neben den Rindern ausgesucht, die beiden anderen wollten so weit weg wie möglich von den Fliegen und dem Gestank. Er richtete sich so ein, dass er auf der Kiste mit dem Werk lag. So konnte es keiner heimlich stehlen, während er schlief. Er träumte. Ein Insekt kroch aus seinem Bauchnabel, ein anderes aus seinem Geschlecht. Mit seinen langen Fühlern tasteten sie sich über seinen Körper und krabbelten langsam den Bauch herauf. Dann erklommen sie den Kopf und versuchten sich durch die Nase wieder in den Körper hineinzuzwängen. Aber dort verstopften kleine, gelbe Maden den Weg, die sich wütend hervorwanden, den warmen Platz nicht aufgeben wollten. Schweißnass wachte er auf und fuhr sich hysterisch schnaufend durch das Gesicht, fand aber nichts und fiel zurück in das muffig riechende Stroh. Mit einem Mal hörte er ein Stöhnen hinter sich, das sich mit dem Schnaufen und Scharren der Kühe vermischte. Ruckartig drehte Aken sich um, wand sich aus der stinkenden Wolldecke und griff nach seinem Dolch, den er immer an der Seite mit sich führte. Langsam und vorsichtig zog er sich an den Holzbohlen der Wand hoch. Erneut stöhnte jemand gedämpft. Schnaufen war zu hören. Nur ein fahler Mond und die langsam anbrechende Morgendämmerung spendeten durch die Ritzen des Gemäuers etwas Licht. Jemand kniete hinter den Holzbohlen. Es war einer seiner Begleiter. Sein Gesicht war sehr nah an den Bohlen, so dass Aken seinen fauligen Atem riechen konnte. Sein Körper wurde von einem dauerhaften Zittern durchzogen. Konnte das sein? Aken wandte seinen Kopf, so weit er konnte, zur Seite und sah das Unglaubliche. Er erkannte den anderen Mailänder. Der hatte seinen Kopf zwischen den Pobacken des Mannes versenkt und leckte und küsste den von Grinden und Pickeln überzogenen Arsch seines Begleiters. Osculum infame, schoss es Aken durch den Kopf. Der Kuss des Satans. So hatte es ihr Lehrer, ein Dominikaner, in Brabant einst gelehrt. So wird der Teufel durch seine Jünger begrüßt. War er mit Dämonen gereist? Hatte ihm Antonio Grimani bewusst diese Abgesandten der Hölle zur Seite gestellt? In seinem Kopf hämmerte es, und er glaubte fast, das Bewusstsein zu verlieren. Er stieß nach vorn gegen die Wand. Prompt verharrten die beiden Männer wie erstarrt und horchten. Da hatte sich Aken aber schon aus der Box gestohlen, das Werk unter seinem Arm, und sich hinter einer auf dem Boden liegenden dicken Kuh versteckt. Im nächsten Moment wurde die Tür zum Stall aufgerissen. Mit Schrecken erkannte Aken das Tuch eines venezianischen Söldners. Sie hatten sie gefunden. Der Erste war mit einem Schritt in der Box seiner Begleiter. Ohne ein Wort zu verlieren, hieb er mit einem Schwert auf den nackten Rücken des oben liegenden Mailänders. Das Schwert war so scharf und schwer, dass es den Leib teilte. Der darunterliegende, nun vom Blut seines Freundes völlig besudelte Mailänder versuchte noch sich zu erheben, hatte aber das Metall des Häschers schon in seinen Eingeweiden, ehe er nach seinem Dolch greifen konnte. Aken robbte sich schnell und dennoch vorsichtig an den Kühen vorbei bis zur hinteren Stalltür. Wie ein Kreuz bei einer Pilgerreise hielt er seinen Dolch in beiden Händen. Mit seinem Leib schob er das in einem Kasten versteckte Werk unter sich her. Kurze Zeit später war er unbemerkt aus dem Stall entkommen. Draußen sattelte gerade eine Reisegruppe aus Deutschland, gut erkennbar an dem groben Stoff ihrer Kleider, ihre Pferde. Aken warf den Umhang über seinen Kopf, drückte zwei der Goldtaler aus dem Saum, die ihm der Admiral gegeben hatte, und sprach den Führer der Gruppe leise an. Die Deutschen, wortkarge Tuchhändler aus der Hansestadt Osnabrück, wollten sich bis zu den Lawinen vorkämpfen und dann selbst, so gut es ging, räumen, um vor dem nächsten Schnee nach Innsbruck hinunterzugelangen. Jede Hand war da willkommen. Dennoch kostete es Jeroen van Aken aus ’s-Hertogenbosch, den man Jahrhunderte später nur unter dem Namen seiner Heimatstadt kannte, zwei weitere Goldmünzen, um von Mittenwald, dem Ort, der später als Brennerpass berühmt wurde, hinein in die deutschen Lande und weiter ins Herzogtum Brabant zu kommen. Die Leichen der beiden Mailänder fanden Wölfe wenige Tage später am Ufer der Eisack und zerfleischten sie bis auf die Knochen.
HeuteMo’ynoq, Usbekistan, 01. 11., 07.30 Uhr
Die Sonne hing erst seit wenigen Minuten fahl über dem Horizont und übergoss die schneebedeckte Steppe mit einem müden Licht. Draußen bei den rostigen Schiffswracks hatten sie sich verabredet. Die Stadt starb einen langsamen Tod. Einst am südlichen Ende des Aralsees gelegen, war sie nunmehr 80 Kilometer von der Uferlinie entfernt. Die Fischerei, früher der größte Wirtschaftszweig der Stadt, verlor sich im Sand der Steppe. Gerade einmal 10000 Menschen lebten hier, meist Karakalpaken, ein muslimisches Turkvolk. Seit Jahrzehnten verlandete der See, seit Stalin die Flüsse, die ihn jedes Jahr mit Wasser speisten, für die Baumwollfelder im Norden stauen ließ. Der Wasserspiegel sank unaufhörlich. Die Winter wurden kälter, die Sommer heißer, das Land trocknete aus. Allah hatte es vergessen.
»Meine Auftraggeber sind etwas erstaunt, dass Ihr Teil der Vereinbarung nicht eingehalten wurde. Was könnte der Grund sein?« Der Mann war Anfang 50, seine Gestalt wirkte hager. Dieser Eindruck wurde durch einen schmalen Kopf mit schütterem blondem Haar verstärkt. Er trug als Einziger keine Handschuhe. Während sein Gegenüber frierend von einem Bein auf das andere stapfte, blieben er und seine Begleiter unbewegt im kalten Wind stehen und starrten auf die Bande Freischärler, die aus den Bergen im Osten hier hinuntergekommen waren. Sie bezeichneten sich als Rebellen, kämpften gegen die Machthaber in Usbekistan, lebten aber hauptsächlich von Schmuggel und Drogenhandel.
Georg Arnold hielt sich seit 24 Stunden auf den Beinen. Sie waren am frühen Abend zuvor in Termiz aufgebrochen und mussten noch heute die 900 Kilometer zurück in den Süden fahren, wenn sie die Bundeswehrmaschine erreichen wollten. Diese Freischärler hier waren die, die seinen Kameraden in Afghanistan mit Sprengfallen zusetzten. Aber das war ihm egal, solange sie die Geschäfte machten, die ihm das Geld für eine Zukunft nach der Bundeswehr brachten. Der Abzug aus diesem verdammten Land aus Staub und Tod hatte sich verzögert. Arnold hatte die Gelegenheit genutzt, um seine kleinen Geschäfte aufzubauen. Jeder Logistiker wusste, dass in der heißen Phase eines Rückzugs niemand wirklich auf alle Zahlen und Transporte schaute. Zu groß war bei allen der Wunsch, unversehrt und schnell zurückzukehren.
Der Anführer ließ sich nicht durch den drohenden Unterton verunsichern. »Wir haben alles dabei, Sie können es sofort übernehmen. Aber Ihre letzte Überweisung ist nicht vollständig. Richten Sie Ihrem Auftraggeber aus, dass wir so nicht arbeiten. Hier setzt man auf Vertrauen.«
Er lächelte, und seine gelben Zahnstümpfe wurden sichtbar. Er kaute Tabak, spuckte ihn zur Seite aus. Arnold widerte dieses kriegerische Bergvolk an. Zu gern hätte er sie mit einem Luftschlag vernichtet. Aber diese Ladung, die er hier übernehmen und über seine »Linie« nach Deutschland bringen sollte, war zu lukrativ. Seit über fünf Jahren arbeiteten er und sein »Team« nun auf dem Bundeswehrstützpunkt in Termiz, im Süden Usbekistans. Der Flughafen war das Drehkreuz der deutschen Armee in Afghanistan, hier wurde Personal und Material in und aus dem Kriegsgebiet verladen.
Vor seiner militärischen Karriere hatte Arnold als Disponent in einem Warenlager eines hessischen Spielwarenkonzerns gearbeitet. Seine Kenntnisse konnte er jetzt in einem ganz neuen Maßstab anwenden. Sein System war so einfach wie genial. Ihm unterstand die Definition der Verladung. Er wusste, was in den Transall-Maschinen mitflog, wo und wann entladen wurde und wer nötigenfalls geschmiert werden musste. »Seine« Container wurden meist als militärisches Sicherheitsgut deklariert, die zuständige Empfangsstelle in Deutschland war mit seinen Leuten besetzt, und so kamen jedes Jahr 50 Tonnen Rohopium nach Europa. Sein alter Chef aus dem Warenlager hatte ihn vor drei Tagen angerufen. Er solle im Nordwesten Usbekistans zusätzliche Ware aufnehmen, ein kleiner Gefallen unter Freunden. Es war überdies gut bezahlt, also nahm der Oberleutnant den Auftrag an. Diese Unstimmigkeit in diesem Nest mit den Banditen war Alltag für ihn. Mittlerweile sprach er zwei einheimische Dialekte, und so konnte er auch die leisen Befehle, die der Anführer seinen Männern gab, gut verstehen. Sie wollten schnellstmöglich weg, es war nicht sicher. Er spürte ihre Unruhe. Arnold dagegen blieb entspannt. Er wählte mit seinem Satellitentelefon eine Nummer in Deutschland, schilderte in kurzen Worten die Problematik und lächelte, als er den Hörer weitergab. »Es ist alles geklärt.« Er reichte dem Anführer eine Zigarre, zündete sie an und blickte erwartungsvoll auf den Usbeken. Dieser zog zwei Mal kräftig, hörte derweil der Stimme aus dem Telefon zu und winkte gleichzeitig seinen Leuten. Die begannen sofort, die Container vollzuladen.
Zwei Stunden später fuhr Oberleutnant Arnold in einem der drei MAN-10-Tonner zurück nach Termiz. Morgen Abend würde die Ladung auf dem Luftwaffenstützpunkt Landsberg am Lech in Bayern landen. Hätte Arnold geahnt, was zwischen den Tonnen gepressten Haschischs und Opiums mit ihm fuhr, so wäre er sofort aus dem LKW gesprungen und schreiend weggerannt.
Kufstein, Österreich, 14. 12., 14.45 Uhr
Der Pajero rutschte gefährlich auf die Mittelleitplanke zu. Schnee spritzte auf. Der Fahrer riss das Lenkrad hektisch nach rechts. Ein dahinterfahrender Tanklastzug hupte lang anhaltend und blendete auf.
»Du kannst nicht Auto fahren. Es ist wirklich das erste Mal, dass ich einen Mann erlebe, der nicht fahren kann.« Regina Bachmaier war nicht glücklich darüber, dass ihr Freund Jan das Auto steuerte. Der Mann war Arzt, Notfallarzt, sicher einer der besten, wie sie von seinen Freunden gehört hatte. Aber eine solche Feindschaft zwischen Fahrer und Auto hatte die ehemalige Elitepolizistin aus Wien bisher selten erlebt. »Du bremst, gibst dann wieder Gas und beides ohne Grund. Brauchst du den Rhythmus?« Sie konnte das Sticheln nicht lassen.
Jan Kistermann blieb äußerlich ruhig. Er konzentrierte sich. Natürlich sah er sich wie jeder Mann als sicheren und erfahrenen Fahrer, aber neben einem Exmitglied eines Spezialkommandos fühlte er sich wie in einem Examen. »Ein alter Mann hat mir einmal gesagt: Wenn die Frau deinen Fahrstil kritisiert, dann solltest du nicht nur schnell aus dem Auto aussteigen …«
Regina lachte. »Du bist eine Mimose, Ihr Ärzte seid nicht kritikerprobt.«
Jan lächelte säuerlich. »Ich bin noch Rekonvaleszent, also für dich: in der Erholungsphase.«
»Ich weiß, was das heißt, du deutscher Klugscheißer.« Sie zwickte ihn in den Arm. Er schrie theatralisch auf, bis sein Handy brummte. Eine SMS war eingegangen. Er verstummte, griff in die Ablage und sah nach. Regina runzelte mit der Stirn, ließ sich den in ihr aufkommenden Ärger aber nicht anmerken.
Ein halbes Jahr war seit den Ereignissen in Syrien und Israel vergangen. Jan war als Tourist in den Nahen Osten gereist. Kurz darauf fand er sich inmitten der Verschwörung einer Sekte wieder. Dessen Anführer hatten Thesen publiziert, die die islamische Welt in ihren Grundfesten bedrohte. Chaos brach aus. Dann traf er auf die Privatermittlerin Regina, die im Nahen Osten nach einer österreichischen Archäologin suchte. Er hatte sich Hals über Kopf in sie verliebt. Gemeinsam mit einem syrischen und einem israelischen Spion waren sie quer durch den Nahen Osten und Europa gehetzt, um am Ende in einem UN-Posten in eine wilde Schießerei zu geraten. Jan Kistermann war von mehreren Schüssen schwer verletzt worden. Jetzt, sechs Monate später, waren die Wunden verheilt. Dennoch hatte er noch nicht die Kraft gefunden, seinen alten Job im Klinikum rechts der Isar in München wiederaufzunehmen. Die meiste Zeit lebte er bei seiner neuen Liebe in Wien. Für Regina war das sehr ungewohnt. In ihrer Zeit bei der Kripo Wien hatte sie immer allein gelebt. Die unregelmäßigen Arbeitszeiten, die langen Observationen und nicht zuletzt die dunklen Seiten des Jobs hatten sie immer wieder von einer »normalen« Beziehung abgehalten. Ein katastrophaler Einsatz im Wiener Rotlichtmilieu, der zu ihrer Suspendierung führte, hatte ihr Leben verändert. Gedanken an Liebe und Zweisamkeit waren verschwunden. Bis Jan in ihr Leben trat. Seine Ruhe, sein sicheres Gespür für Gut und Böse, hatten sie angezogen. Aber natürlich war es auch sein Aussehen. Er war nicht zu groß und auch nicht zu dick. Er liebte Sport, genau wie sie. Sie hatten in den vergangenen Wochen versucht, ihr sehr unterschiedliches Leben zusammenzufügen. Das war nicht leicht. Sie fühlte sich so ungebildet angesichts seines akademischen Wissens, so ungeschickt, wenn es um Stil und Etikette ging. Er konnte fast jede Situation traumwandlerisch bestehen. Sie empfand sich zuweilen wie ein Bauerntrampel. Aber er hatte sie beruhigt. Ihre Welt der Waffen, des Kampfsports, der verdeckten Ermittlungen und der nötigenfalls auch tödlichen Konsequenzen war auch für ihn neu und beängstigend. Mit ihren fast 40 Jahren waren beide aber erwachsen genug, um dem anderen die nötige Neugierde entgegenzubringen.
Jan hatte am Tag zuvor zum ersten Mal Reginas Familie kennenlernen dürfen oder das, was noch davon übrig war. Ihre Mutter war gestorben, als Regina noch ein Kind war. Sie war mit ihren drei Brüdern auf einem Almgasthof oberhalb Innsbrucks aufgewachsen. Ihr Vater erzog sie mit Disziplin, Härte und Zähigkeit. Liebe und Zärtlichkeit kannte er nicht. Sein Hass auf die Ärzte, die seine Frau verrecken ließen, hatte jedes positive Gefühl in ihm absterben lassen. Einmal im Monat soff er sich in einen Rausch, schlug auf das Mobiliar, verschreckte die wenigen Gäste, die hier oben für ein paar Stunden Rast machten, und konnte meist erst von der Belegschaft einer etwas unterhalb liegenden Polizeistation beruhigt werden. An ihrem letzten Tag auf der Alm, bevor sie zur Gendarmerieschule nach Linz ging, hatte er Regina eine Axt hinterhergeschleudert. Die Axt, die ihm Minuten später den Kopf spaltete. Reginas Bruder hatte die Gewalt des Vaters nicht mehr ertragen können. Das war jetzt fast 20 Jahre her.
So war Reginas Weg zur Polizei einerseits zwangsläufig, andererseits hatte sie damit nie die Welt der Männer verlassen. Jan hatte gespürt, wie ihre Gedanken düsterer wurden, je näher sie ihrer Heimat kamen. Sie hatte ihm Tage zuvor von ihrem Vater und seinem Hass auf alle Ärzte erzählt. Aber eben auch von ihrem ältesten Bruder, der für sie ins Gefängnis gegangen war, und seinen zwei Kindern. Sie hatten es alle vom Berg herunter geschafft. Aber das Gefühl der Verlorenheit, der Niederlage und vor allem der Schuld holte sie hier immer wieder ein.
Sie waren am Mittag mit Jans Auto in Innsbruck losgefahren. Ihr Ziel war ein Ort am Tegernsee in Deutschland. Regina wollte dort einen neuen Auftraggeber treffen. Gern hätte sie die Abkürzung über den Achensee genommen, aber der Pass war natürlich bei diesen Witterungsverhältnissen längst geschlossen. Die Wettervorhersagen warnten bereits generell vor Reisen. Wer es nicht unbedingt musste, sollte zu Hause bleiben. Seit Anfang November kletterte die Temperatur in den meisten Teilen Europas nicht mehr über den Gefrierpunkt. Und im Dezember kam jeden Tag neuer Schnee hinzu. Die Räumfahrzeuge waren pausenlos im Einsatz, um wenigstens die Hauptverkehrsadern schneefrei zu halten. So hart und großflächig war der Winter schon lange nicht mehr über den Kontinent eingebrochen.
Jans Geländewagen kam zwar gut mit den Verhältnissen zurecht, aber immer noch waren einige Zeitgenossen mit Sommerreifen unterwegs, was zu Staus und Unfällen führte. Zudem hatten in vielen Bundesländern wie auch in Holland und Dänemark die Schulferien begonnen. So verstopften wie jedes Jahr um diese Zeit Kombis mit hässlichen Skikästen auf dem Dach die Strecken in die Winterskigebiete. Jan und Regina hatten bereits zwei Stunden Fahrt hinter sich, als sie auf der A12 Richtung Deutschland fuhren. Im Abstand von 15 Minuten erhielt Jan regelmäßig Kurznachrichten von seiner Exfrau. Regina hatte sich schon in Wien zusammengerissen und diese Flut an Nachrichten nicht kommentiert. Jan hatte etwas von Kaufabwicklung des ehemaligen gemeinsamen Hauses erzählt. Aber schon bei einer Nachfrage antwortete er genervt. Sie wollte sich zurückhalten, er würde ihr vielleicht noch mehr erzählen. Aber jetzt, nach unzähligen SMS, war ihre Geduld am Ende. Zudem litt sie an einer zähen Erkältung. Der Fußraum zwischen Reginas Beinen war voll mit benutzten Taschentüchern. In Wien hatte sie nach einem ausgiebigen Apothekenbesuch noch gescherzt, dass der Virenexpress nach Tirol nun starten könne. Jan hatte ihr, ganz Arzt, erklärt, dass es sich um eine bakterielle Infektion handeln müsse, aber mitnichten um ein Virus. Sie hatte ihn nur angeniest.
Mit tränenden Augen sah Regina hinaus in die Schneewelt. Wenn der neue Auftrag lukrativ wurde, hatte sie in den wenigen Monaten nach ihrer Suspendierung bereits mehr verdient als in ihrer gesamten Laufbahn als Polizistin. Die Mutter ihrer letzten Klientin hatte ihr gestern die letzte Tranche überwiesen. Ein seltenes Gefühl von Erfolg stieg in ihr hoch, das jedoch sofort wieder verschwand, als sie an ihre Schulden dachte. Regina Bachmaier spielte leidenschaftlich gern Backgammon. Es hatte begonnen, als sie noch Polizeianwärterin gewesen war. Jeden ihrer Kollegen forderte sie heraus. Und fast immer gewann sie. Bis keiner mehr spielen wollte. So suchte sie neue Gegner. Und hatte in Wien in den einschlägigen Lokalen der Türken und Araber rasch zweifelhafte Berühmtheit erlangt. Sie spielte schnell, setzte hohe Beträge und gewann auch immer wieder. Aber wie alle Spieler verlor sie mehr, als sie einnahm. Jan wusste nichts von ihrer Leidenschaft. Nur ab und zu hatten sie in den vergangenen Wochen zusammen gespielt. Und Jans langsames Spiel war Regina schon bald auf die Nerven gegangen. Sie war das schnelle Ziehen der meist zwingenden Züge gewohnt. Sie konnte nie begreifen, wie man bei einer Drei und einer Eins lange nachdenken konnte. Jan hatte ihre Ungeduld gespürt und ihr dann Schach vorgeschlagen, was ihr vorkam wie ein Wechsel von Sex zu Petting.
»Du hast wieder eine SMS bekommen«, sagte sie etwas zu deutlich in die Stille hinein.
Er tat gelangweilt, griff aber nach einer kleinen Pause dennoch zum Telefon und las.
»Schickt sie dir den Kaufvertrag per SMS?«, fragte Regina eine Spur zu spitz.
Sie hatten fast das Inntaldreieck erreicht. Der Verkehr auf der anderen Seite der A93 war ins Stocken geraten.
Jan blickte verächtlich aus dem Fenster. »Jedes Jahr das Gleiche, die Menschen benehmen sich wie Herdentiere. Alle wissen um die Staus, aber sie müssen jeden Tag Urlaub ausnutzen. Diese Gier widert mich an. Hauptsache Spaß, alles mitnehmen und konsumieren. Und der Stau geht in den Alpendörfern weiter.« Obwohl er Münchener war, verachtete Jan den Hype um das Skifahren. Er sah die Zerstörung, die der hemmungslose Ausbau der Skiregionen in den Alpen verursachte. Früher zog er es vor, den Stress in der Notfallstation des Krankenhauses auf stillen Wanderungen abzubauen. Dank seines Schichtdienstes konnte er unter der Woche, frei von Touristenschwärmen, allein in die Berge gehen.
»Du lenkst ab«, insistierte Regina.
Jan antwortete nicht. Mit einem Ruck riss er das Lenkrad nach rechts und zog auf die Ausfahrt Richtung Rosenheim.
»Was machst du?«, rief Regina.
Jan schwieg. Er bog auf das Gelände einer Tankstelle und stoppte den Wagen. Dann sah er sie mit wütendem Gesicht an. »Ich habe ein Kind verloren. Es war auch das Kind dieser Frau. Ich liebe sie nicht mehr. Aber ich stehe in ihrer Schuld. Sie bittet mich, nach München zu kommen. Der Verkauf des Hauses wächst ihr über den Kopf. Das ganze Haus ist voll mit gemeinsamen Erinnerungen. Kannst du das verstehen?« Den letzten Satz hatte er fast geschrien.
Regina schwieg. Langsam beschlugen die Scheiben. Es war, als säßen sie in einer Nebelwolke. »Sie ruft, und du kommst. Was soll ich davon halten? Ich will nicht die böse Geliebte sein, die …«
»Das bist du nicht. Ich liebe dich. Aber sie braucht meine Hilfe. Und ich soll jetzt mit dir zu einem zweifelhaften Treffen an den Tegernsee fahren. Das ist sehr schwierig für mich.«
Sie sah ihn nicht an. Statt zu weinen, eine Regung, die sie sich schon früh hatte abgewöhnen müssen, schlug sie mit der Hand auf die Ablage des Autos. »Dann fahr halt zu ihr.«
Jan hasste solche Ausbrüche. Schweigend stieg er aus, stapfte durch den dichten Schnee, öffnete die Heckklappe und nahm seine Reisetasche und einen kleinen Koffer heraus.
Regina war ebenfalls ausgestiegen und hatte sich eine Zigarette angezündet. »Wo willst du denn jetzt hin? Sei vernünftig, Jan.«
Er sah über den Wagen hinweg zu ihr. »Ich fahre mit dem Zug nach München, und du fährst an den Tegernsee. Wir beide lassen unsere Köpfe ein wenig abkühlen und sehen uns dann in München wieder. Was meinst du?«
Sie trat gegen die Felge des Wagens und schüttelte nur den Kopf. Dann schritt sie schweigend um Jan herum, setzte sich auf die Fahrerseite und fuhr dicht und mit quietschenden Reifen an gerade tankenden Autofahrern vorbei.
Es wurde bereits dunkel, als sie im Tegernseer Tal eintraf. Von der A8 führte nur eine Straße in das Tal hinein. Am Wochenende und zu Ferienzeiten stauten sich dort die Autos der Kurzurlauber aus dem nur 50 Kilometer entfernten München. Der See lag eingebettet zwischen malerisch schneebedeckten Bergen. Vier große Seen bestimmen das Voralpenland. Der Tegernsee ist der schönste von allen, fand Jan. Früher war er oft hier, hatte mit seiner Familie wunderbare Sommertage am See verbracht. Er mochte die Menschen – kein einfacher Schlag, aber nicht so hinterfotzig wie die Münchener.
Die tiefen Temperaturen der letzten Wochen hatten das Gewässer komplett zufrieren lassen. Das war ungewöhnlich, da der See mit seinen 72 Metern Tiefe nicht als eissicher gilt. In Gmund musste sie sich entscheiden, ob sie den See westlich oder östlich umrundete. Ihr Ziel lag südlich von Rottach-Egern, dem Touristenort schlechthin. Dort wohnten lange Jahre die wirklich reichen Menschen. Industriebosse, Filmschaffende und Privatiers mit einem Vermögen von manchmal zweifelhafter Herkunft. Der See war als Erholungsort der Nazis bekannt geworden. Himmler besaß dort ein Haus, der fingierte Röhm-Putsch wurde dort inszeniert. Dies war ein Teil der lokalen Geschichte, der von den Einheimischen gern vergessen wurde. Und heute schmückte man sich erneut mit illustrer Gesellschaft.
Anders allerdings als am Starnberger See, wo man damit protzt, dass dort die reichsten Deutschen leben, wohnen hier Millionäre mit Wunsch nach Diskretion und Stille. Erst in den letzten Jahren kamen, zum Missfallen des alten Geldadels, die Neureichen in die Idylle am Bergsee.
Regina hielt an einer Bushaltestelle und nahm noch einmal den Brief, der ihr wenige Tage zuvor zugestellt worden war, in die Hand. »Melden Sie sich, wenn Sie am Beginn der Mautstation Suttensee sind. Dort werden Sie abgeholt.« Das Navigationssystem des Autos zeigte noch zehn Minuten bis zum Ziel an. Es war Punkt fünf Uhr. Das Nachrichtensignal ertönte aus dem Radio. Die Straße, die sich am Ufer des Sees vorbeischlängelte, lag unter einer festen Schneedecke. Ein großer LKW schlich vor ihr vorsichtig durch den Ort. Dann konnte sie endlich abbiegen und sah noch im dichten Schneetreiben den Wallberg, der über 1700 Meter in die Höhe ragte. Das Wetter wurde immer schlechter. Sie durchfuhr ein breites Tal, bis die Straße in einen Wald mündete. Der Geländewagen pflügte durch den Schnee, denn die Straße, die in die Valepp führte, wurde hier nicht mehr geräumt. Der Scheibenwischer quietschte auf Hochtouren über die immer weißer werdende Windschutzscheibe.
»Scheiße, was macht der da?« Regina bremste hart ab, der Wagen ruckelte, aber angesichts der geringen Geschwindigkeit fing er sich wieder. Vor ihrem Auto stand eine völlig in weißes Leinen gekleidete Gestalt. Sie schien direkt von den Passionsspielen aus dem benachbarten Oberammergau zu kommen. Aber statt Sandalen trug sie wenigstens dicke Winterstiefel, allerdings mit losen Schnürsenkeln. Die Gestalt schritt langsam auf sie zu. Regina griff ins Handschuhfach, wo ihre Pistole der Marke »Glock« lag. Dann ließ sie die Fensterscheibe herunter; nun konnte sie deutlich einen Mann erkennen.
»Fahren Sie nach oben?«, fragte er.
Schlechter Atem schlug Regina entgegen. »Ich hätte Sie beinahe umgefahren …« Angesichts des mitleiderregenden Aussehens des Mannes vergaß sie ihre Wut. »Soll ich Sie mitnehmen?«
Regina legte die Waffe für den Unbekannten nicht sichtbar zwischen ihre Beine. Statt eine Antwort zu geben, stieg er ein.
Kaum saß er, rief er: »Ich bin Ezechiel. Das Ende ist nah.«
Regina verdrehte die Augen. »Ein Spinner«, dachte sie, »jede gute Tat wird sofort bestraft.«
»Wo wollen Sie hin?«, fragte der Mann.
Regina antwortete: »Hoch zur Schlagalm. Kommen Sie von hier?«
Er ging nicht auf ihre Frage ein. »Sie wollen zum Köhn, nicht wahr? Seien Sie gewarnt.«
Regina schaute ihn an. »Warum?«
Ezechiel schien ein Prophet ohne Zahnarzt zu sein. Er besaß nur noch drei Vorderzähne, der Rest war abgebrochen oder nur als Stumpf vorhanden. Fettiges Haar lag auf seiner von kleinen Pickeln übersäten Stirn. Die Äderchen in seinen Augen waren gerötet. Ständig kratzte er sich an den Händen.
»Er hat in seinen Abgrund sehen dürfen. Er steht am Steuer, dreht und dreht. Aber wer sich ihm anschließt, wird in die Verdammnis einkehren. Er wird Erkenntnis spüren, wo keine ist, Wahrheit sehen, wo Lüge weilt. Und dafür wird er zahlen«, flüsterte er von der Seite. Immer stärker füllte sich das Wageninnere mit dem widerlich süßlichen Atem des Mannes. »Er hat die Büchse geöffnet, aber er wird nicht mehr sehen, wie sie geschlossen wird. Sei gewarnt.« Regina hatte einen Parkplatz erreicht und den Wagen abgebremst. Ruckartig öffnete Ezechiel die Tür und sprang heraus. Regina blickte nach hinten. Sie konnte nur noch sehen, wie der Irre im dichten Schneetreiben im Wald verschwand. »Ein Irrer. Ich sag’s ja, Die Deutschen neigen zum Wahnsinn. Wir haben Freud und die Nietzsche. Das sagt doch alles.«
Vor ihr erkannte sie durch die dichten Flocken eine rot-weiße Schranke. Die Straße schien nicht passierbar zu sein. Missmutig rief Regina die im Brief angegebene Nummer an.
Eine harte Frauenstimme erklang: »Sie sind mit einem Geländewagen unterwegs. Die Schranke öffnet sich gleich automatisch. Fahren Sie bis zum Skilift. Dort warten Sie. Danke.«
Ehe Regina etwas erwidern konnte, beendete die Frau das Gespräch. Regina konnte nur noch ein ironisches »Jawoll« in die Stille ihres Autos murmeln.
Immer wieder drehten die Reifen durch, die Kurven wurden immer enger. Ihr Navigationssystem sagte ihr, dass sie sich nun 900 Meter über dem Meeresspiegel befand und gleich eine Außentemperatur von minus 16 Grad ertragen musste. Sie stoppte den Wagen. Es war still, auf der benachbarten Piste fuhr kein Skifahrer mehr, die Dunkelheit hatte alle nach unten in die warmen Quartiere gescheucht. Auch im gegenüberliegenden Gasthof löschte ein korpulenter Mann das Licht, kam aus der Tür, setzte sich eine Fellmütze auf und stapfte durch die Millionen von Schneeflocken, die vom Abendhimmel fielen, in seinen mit Schneeketten ausgestatteten Wagen. Sie schienen hier oben allein zu sein. Regina nahm ihr Smartphone, sah aber, dass es hier oben keinen Empfang gab. »Verdammt, das hätte diese Frau eigentlich wissen müssen.« Sie drehte das Telefon in alle Richtungen, bis wenigstens ein Balken aufblinkte. Dazu musste sie das Gerät in den Fußraum halten. »Jetzt …«, rief Regina. Sie beugte sich gerade über das Display, als jemand gegen die Scheibe klopfte. Sie zuckte zusammen.
Regina sah aus dem Seitenfenster in das völlig ausdruckslose Gesicht einer älteren Frau. Sie drückte den Fensterknopf, und die Scheibe surrte nach unten.
»Ich bin Margot Köhn. Sie wollen zu meinem Neffen. Ich fahre Sie hin.«
Kein Lächeln oder Zeichen von Verbindlichkeit hatte diese kurze Vorstellung untermalt. Das Gesicht der Frau hatte unzählige Falten. Ihr Oberkiefer war nach vorn gewölbt, dahinter verbargen sich große, sehr weiße Zähne. Selbst in der Dunkelheit waren ihre ausgesprochen blauen Augen zu erkennen. Aus ihrem Kinn wuchsen stachelige weiße Haare. Ihr Gesicht wirkte wie das einer alten, weisen, aber dennoch gefährlichen Ziege, dachte Regina erschrocken und gleichzeitig belustigt. Die Alte trug keine Mütze auf dem Kopf, und so hatte sich reichlich Schnee auf ihren weißen, kräftigen Haaren gesammelt. Sie war mit einer Steppjacke, einer ebensolchen Hose und schweren Wanderstiefeln bekleidet.
»Sie sind doch Regina?«
»Ja, wollen Sie einsteigen?«
Die Frau schüttelte den Kopf und wies nach links. »Nehmen Sie bitte Ihr Gepäck, der Wagen kann hier stehen bleiben, wir fahren mit dem Unimog. Nur so können wir das Anwesen erreichen.«
Durch den dichten Schneefall sah Regina ein grünes Ungetüm, das sie schon als Kind geliebt hatte. Dieses Fahrzeug konnte im Winter wirklich jede Steigung nehmen. Es war ein Meisterwerk deutsch-österreichischer Ingenieurskunst.
Fast eine Stunde quälte sich das Allradfahrzeug durch einen tiefverschneiten Forstweg. Immer wieder musste die Frau den Unimog stoppen, die Gänge neu justieren und vorsichtig anfahren. Plötzlich zog die Alte das Lenkrad abrupt nach rechts, sie verließen den ohnehin schon schmalen Weg und rutschten einen nur mit einer tiefen Treckerspur versehenen Pfad hinab. Der Unimog rumpelte jetzt fast senkrecht, so dass Regina sich mit ihren Händen am Armaturenbrett mühsam abstützen musste, um nicht an der Windschutzscheibe zu kleben. Dann beleuchteten die Scheinwerfer ein Eisentor. Margot Köhn drückte, ohne zu bremsen, auf eine Fernbedienung, und das Tor öffnete sich, während sie schlingernd kurz vor einer meterlangen Garage zum Stehen kamen. Das Haus war inmitten des dichten Tannenwaldes kaum zu erkennen gewesen. Es schien in den Hang hineingebaut worden zu sein. Links neben der Garage verbarg sich der Eingangsbereich eines typischen Tegernseer Landhauses, mit einem großen Holzbalkon über einer schweren Eichentür, die mit einer großen Schnitzerei in Form eines Sterns versehen war.
Das Schneetreiben war jetzt noch stärker geworden, Böen fegten über den Vorplatz. Regina sprang geduckt aus dem Führerhaus, nahm ihre Tasche und wankte mit fast geschlossenen Augen der Frau hinterher. Kaum war sie eingetreten, bemerkte sie, dass die Inneneinrichtung komplett anders angelegt war, als das Außenbild vermuten ließ. Ein Flur mit nackten Betonwänden, links und rechts hingen großflächige Bilder mit seltsamen Dämonen und Teufeln. Keine Lampe war zu sehen, und dennoch war es fast taghell. Es war ein Licht wie an einem Strandtag im Sommer, dachte Regina. Vögel waren zu hören, irgendwo plätscherte Wasser. Am Ende des Flurs begrenzte eine Balustrade aus Stahl den Blick nach unten. Gedämpft waren Männerstimmen zu hören. Es mussten mehrere Menschen hier sein, obwohl sie keine Autos auf dem Parkplatz unten im Tal, geschweige denn hier oben, gesehen hatte. Doch bevor sie nach unten blicken konnte, zog Margot Köhn sie nach links, und sie stiegen eine Treppe aus schwarzem Marmor empor. Vor dem Gästezimmer wischte Margot Köhn mit einer schnellen Bewegung über ein Display am Türstock, und ohne jedes Geräusch schob sich die Milchglastür zur Seite. Dahinter lag ein Raum wie aus dem Katalog eines Fünf-Sterne-Hotels. Ein überdimensioniertes Bett mit einer schwarzen Felldecke darauf stand vor einem bis zum Boden gehenden Panoramafenster. Draußen wirbelten die Schneeflocken, aber hier war es behaglich. Dafür sorgte auch ein knisterndes Kaminfeuer. Hier war alles edel, dachte Regina. Aber nichts wirkte aufgesetzt oder gar neureich. Der Hausherr schien einen guten Geschmack zu haben. Ihr berufsmäßig antrainiertes Misstrauen wich, und sie zeigte sich ehrlich beeindruckt.
»Wenn Sie sich frisch gemacht haben, erwartet mein Neffe Sie im großen Saal«, informierte sie Margot Köhn und verschwand.
Regina runzelte die Stirn. Jetzt redete die Alte schon zum zweiten Mal von ihrem Neffen. Dabei musste Köhn uralt sein. Sie hatte sich schon in Wien ausgiebig über ihn informiert, war dank alter Kontakte bei der Polizei in die üblichen Sicherheitssysteme von Europol und FBI gekommen. Es hatte ihr ein sehr unklares Bild vermittelt. Köhn – das war in Deutschland ein Synonym für unermesslichen Reichtum. Köhn war der König des Spielzeugs. Er hatte mit unzähligen Ideen für Kinder Milliarden erwirtschaftet. Dazu kamen Beteiligungen an Reedereien, Sektkellereien, Biobauernhöfen und kleineren Lebensmittelunternehmen. Der alte Köhn musste ein echter Geizhals sein, geradezu skurrile Anekdoten hatte Regina über ihn gefunden. Er wollte sich nicht fotografieren lassen, Partys mied er, öffentliche Ehrungen waren ihm ein Graus. Aber zuweilen spendete er. Anders sein Sohn. Der war bis zu seiner Inthronisation als Firmenchef ein Partynomade, lebte das Leben des Jetsets, ließ sich auf wilden Expeditionen durch Wüsten wie auch an der Seite zweifelhafter Models und Schauspielerinnen ablichten. Trotz exzellenter Schulbildung an den Top-Universitäten in Oxford und Harvard schien der Sohn nicht im Mindesten den unternehmerischen Geist des Alten zu besitzen, der überall Geschäfte witterte. Experten sahen schon den Untergang des weitverzweigten Köhn-Konzerns voraus, aber Köhn junior überraschte alle. Er investierte in Biolebensmittel, kaufte gigantische Flächen im Osten Deutschlands auf, setzte auf erneuerbare Energien, alternative Medizin und Pharmaforschung. Und siehe da: Binnen weniger Jahre wurde aus dem gigantischen, aber eben nur national agierenden »Spielzeugladen« des alten Köhn ein moderner, global agierender Konzern. Insider berichteten immer wieder von Zerwürfnissen zwischen dem Alten und seinem Sohn über die Ausrichtung des Unternehmens. Aber der Junge hatte nun alle Fäden in der Hand. Und positionierte sich in der Öffentlichkeit als Menschenfreund und Visionär. Zudem galt er immer noch als der begehrteste Junggeselle der Nation.
»Warum muss ich ausgerechnet den Vater treffen?«, dachte Regina. Sie zog sich hastig um, öffnete die Tür und lief die Empore entlang zur Treppe, die in einen großen Raum führte. Von weitem sah sie, wie mehrere Männer sich lachend in einen hinter einer Milchglasscheibe versteckten Raum, ein Zigarrenzimmer, wie Regina erkannte, zurückzogen. Kaum war die Tür geschlossen, war kein Geräusch mehr zu hören.
Der Mann vor ihr konnte nicht ihr Gastgeber sein. Der Mann, der ihr mit einem ausgesprochen sympathischen Lächeln gegenüberstand, war braungebrannt und besaß den durchtrainierten Körper eines Leistungssportlers. Die wettergegerbte Haut und die kräftigen Unterarme ließen Regina auf Klettern tippen. Die kräftigen blonden Haare schienen von der Sonne so ausgeblichen zu sein, als ob er gerade eben noch das Surfbrett abgestellt hätte. Zudem besaß er die gewinnende, aber auch etwas ölig wirkende Aura eines charismatischen Berufspolitikers. Köhn war alles andere als der Greis, als der er sich in dem Schreiben ausgegeben hatte. Ein Greis, der beide Weltkriege erlebt haben wollte. Auch das hatte Regina stutzig, aber vor allem neugierig gemacht.
Er konnte ihre Enttäuschung erkennen, ergriff ihre Hand und mit der anderen ihren Arm, so als seien sie alte Bekannte. »Verzeihen Sie, dass Sie warten mussten. Aber ich hatte noch ein paar Freunde hier, und diese Gesellschaft von jungen Alphatieren wollen Sie bestimmt nicht wirklich ertragen … Ach, stimmt ja …« Er sah sie belustigt an. »Mein Schreiben … Sie glaubten, einen alten Mann zu treffen. Ich muss Sie enttäuschen. Es war für mich die beste Möglichkeit, die gesamte Aufgabenstellung in einen Satz zu packen. Setzen Sie sich doch. Seien Sie mein Gast.« Er wies auf ein großes braunes Sofa, in dem Regina sofort bis zur Hüfte versank. Der Hausherr setzte sich in eine Art Yogasitz auf die andere Seite, beugte sich dann nach hinten, goss sich aus einer Teekanne dampfendes Wasser in ein rosa schimmerndes Glas und hielt es trotz der vermutlich starken Hitze in beiden Händen.
Regina ging in die Offensive. Sie konnte Menschen bewusstlos schlagen, schwere Waffen bedienen und Sprengsätze entschärfen, aber so etwas wie Konversation oder Small Talk war ihr fremd, wenn nicht gar zuwider. Sie zog es immer vor, geradlinig ihr Ziel zu verfolgen. Zudem war sie müde und krank und wollte eigentlich nichts lieber als in das Bett, das sie eben noch so ehrfurchtsvoll betrachtet hatte. »Herr Köhn. Es ist sehr hübsch hier. Aber ich wüsste gern, um welche Aufgabe es sich genau handelt. Ich bin Privatermittlerin, und somit ist Zeit meist ein knappes Gut. Ich will also nicht unhöflich erscheinen, aber was kann ich für Sie tun?«
Irgendwo schien ein Wasserfall zu plätschern. Die Geräuschkulisse wollte so gar nicht zu den großformatigen, düsteren Bildern an den Wänden passen. Köhn ließ sich mit der Antwort Zeit.
Regina wurde ungeduldig. »Wie sind Sie denn überhaupt auf mich gekommen? Gibt es in Deutschland keine Privatermittler mehr?« Ihr Ton war eine Spur zu rau, aber Köhn schien das zu übergehen.
»Wir haben eine gemeinsame Freundin, wenn Sie so wollen. Almut Moser, die Archäologin, der sie im letzten Sommer das Leben gerettet haben. Ich bin vor vielen Jahren mit ihr zur Schule gegangen.«
Er ließ die Worte im Raum verklingen und trank in kleinen, vorsichtigen Schlucken aus der Tasse. Regina durchzuckte es. Die Ereignisse im Nahen Osten waren noch nicht so weit weg, als dass sie sie hätte sachlich verarbeiten können. Sie hatte mehrfach am Abgrund gestanden, war gequält, gefoltert worden, sollte in einem Meer aus Asche ersticken – gemeinsam mit eben jener Almut, die sie monatelang dort unten gesucht hatte. Wie ein Bluthund, der niemals die Fährte aufgibt, hatte sie sich in den Fall verbissen und war in ein Chaos ungeahnten Ausmaßes geraten. Sie hatte dort ihre Liebe Jan kennengelernt, aber auch Formen des Bösen, denen sie niemals zuvor begegnet war. Und das wollte etwas heißen, als ehemalige Kommissarin der Wiener Kriminalpolizei. Für den Bruchteil einer Sekunde ließ sie ihre Augen länger geschlossen, als es notwendig gewesen wäre.
Aber Köhn bemerkte es. »Ich kann mir vorstellen, dass es die Hölle war«, kam es leise von der anderen Seite des Sofas.
Sie schluckte, griff nach einer Flasche Wasser und goss sich etwas davon in ein Glas.
»Frau Bachmaier. Almut hat mir nach ihrer Rückkehr von den Dingen da unten erzählt. Wir sind in einem Internat nahe Linz zur Schule gegangen, unsere Väter haben sich gut gekannt, und wir zwei waren befreundet. Nach ihrer Rückkehr trafen wir uns im Herbst in Wien. Sie war schwanger. Was mich sehr für sie gefreut hat. Denn einerseits sind wir alle in einem Alter, in dem das Kinderkriegen nicht mehr so leicht ist, und andererseits schien sie sich von der Manie der Graberei befreit und verliebt zu haben. Sie hatte nicht besonders viele Mittel. Ihr Vater, ein Bauunternehmer aus der Nähe von Linz, war mächtig sauer auf sie und hat sie wohl enterbt. Sie wollte mit ihrem Freund eine neue Existenz in Wien aufbauen und bot mir ein Geschäft an …«
Regina versuchte, sich auf das Gesagte zu konzentrieren, merkte aber, wie ihr langsam die Kräfte schwanden. Sie musste wirklich bald schlafen, wenn sie sich nicht vor ihrem neuen Auftraggeber auf dem Sofa zusammenrollen und laut schnarchen wollte.
»… mein Vater sammelt sogenannte Alte Meister. Bilder flämischer Maler aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Das hat mich früher nie sonderlich interessiert. Ich bin Sportler und Unternehmer, aber vor einigen Jahren geriet ich beim Heli-Skiing in den kanadischen Alpen in eine Lawine. Ich überlebte. Aber während ich dort lag, träumte ich von wilden Dämonen, die mich packen wollten. Ich kämpfte gegen sie, und dieser Gedanke ließ mich von diesem Moment an nicht mehr los. Ich erkannte in den Bildern eines Künstlers so etwas wie eine Erklärung meiner damaligen Träume.«
Regina hatte von dem Unfall gelesen. Er war durch alle bunten Blätter der Welt gegangen. Denn was Köhn nicht erwähnte, war die Tatsache, dass er bereits drei Mal von Lawinen verschüttet worden war. Und jedes Mal waren andere Menschen, meist enge Freunde von ihm, dabei umgekommen. Beim zweiten Mal war es eine Hollywood-Schauspielerin gewesen. Köhn drehte sich um und deutete auf eines der großen Bilder an der Wand.
»Das sind nur Reproduktionen oder eigene, ziemlich dilettantische Fortsetzungen von Boschs Bilderwelten …«
»Entschuldigen Sie, aber was hat das mit Almut zu tun?«, fragte sie.
Er nickte zustimmend.
»Almut wusste, woher auch immer, von einem Bild, das in der Kunstwelt als verschollen gilt. Es ist ein Werk des flämischen Malers Hieronymus Bosch aus dem 16. Jahrhundert. Es ist Teil eines Polyptychons, also eines mehrflügeligen Bilderaltars. Man weiß aus Aufzeichnungen und Rechnungen, die im Umfeld Boschs erstellt wurden, dass es von einem reichen Venezianer in Auftrag gegeben wurde.«
Regina war erstaunt. »Sie interessieren sich für Kunst? Ich dachte, Sie seien eher an Sport interessiert.«
Er bemerkte die kleine Spitze in ihren Worten, ging aber nicht darauf ein.
»Ich habe mittlerweile die Leidenschaft für das Sammeln solcher Werke von meinem Vater übernommen. Wenn man einmal damit anfängt, dann kann man nicht mehr aufhören. Und zudem ist der Wert dieses Bildes eher ideell. Sicher würden manche Menschen viel Geld dafür bezahlen, aber … Nun, Almut hatte nach ihrem Aufenthalt im Nahen Osten mit mir Kontakt aufgenommen und konnte sehr stichhaltig erklären, das Bild gesehen zu haben. Mehr wollte sie nicht verraten. So bot ich Almut sehr viel Geld, wenn sie mir die entscheidenden Hinweise über den Aufenthaltsort des Bildes und seines Besitzers geben würde. Sie müssen wissen, dass viele Bilder in Privatbesitz sind und die Besitzer aus verständlichen Gründen, die Sie als Kriminalerin ja kennen dürften, an einer Publizität nicht interessiert sind.«
Regina nickte. Sie war keine Kunstmarktexpertin, wusste aber von befreundeten Kollegen, die in dieser Grauzone ermitteln mussten, um die enormen Summen, die im Spiel waren. »Und hat sie Ihnen etwas liefern können?«
Er schüttelte den Kopf. »Sie versprach, sich baldmöglichst darum zu kümmern, und wollte sich mit mir in einem Wiener Museum treffen, aber plötzlich verschwand sie. Ich ließ sie von meinem Sicherheitsteam suchen, doch sie war wie vom Erdboden verschluckt. In ihrer Wiener Wohnung fanden meine Leute noch Blutspuren, Hinweise auf eine Sekte, die hier in Bayern aktiv ist, und einen Zugreiseplan, der nach Venedig führte. Aber die Recherchen sowohl im Umfeld der Sekte als auch in Venedig waren erfolglos. Nun bitte ich Sie um zweierlei. Erstens: Sie haben Almut in Syrien kennengelernt. Sie haben sie schon einmal gesucht und gefunden. Ich mache mir Sorgen, und meine Leute sind für den Personenschutz unserer Familie ausgebildet worden, nicht für die Suche nach Menschen. Also: Finden Sie Almut. Zweitens: Suchen Sie mit mir nach dem Bild. Es ist für mich von großem Wert. Es würde mir meine Sammlung komplettieren und Almut einen erheblichen finanziellen Gewinn erbringen, den sie sicher in ihrer jetzigen Situation dringend benötigt …«
»Wie selbstlos«, dachte Regina unwillkürlich, sprach den Gedanken aber nicht aus.
»… mein Büro hat Ihnen ein Dossier erstellen lassen. Sie finden dort alle möglichen Hinweise. Nehmen Sie sich die Zeit, sie zu studieren. Seien Sie mein Gast, und erholen Sie sich hier. Jetzt sollten Sie erst einmal schlafen. Meine Tante wird Ihnen erstklassige Medizin zur Verfügung stellen. Sollten Sie Hunger haben, serviert sie Ihnen zudem eine heiße und sehr gesunde Hühnersuppe.«
Sie nickte und erhob sich. »Eine Frage noch, Herr Köhn.«
Er hielt ihre Hand, aber Regina ließ sich davon nicht beirren.
»Hat Ihnen Almut von ihrem Peiniger erzählt, dem Mann, der sie in Syrien so gequält hat?«
Es war nur ein kurzer Moment. Aber Regina hatte das Gefühl, dass Köhn zögerte. Ein kurzer Eindruck, der sich durch die Müdigkeit und die Erkältung nicht in ihrem Hirn festbeißen konnte. Und so antwortete der junge Köhn nur mit einem Kopfschütteln.
Wer lange in Großstädten lebt, verliert zuweilen das Gefühl für den dort herrschenden permanenten Lärmpegel. Dieses Grundrauschen verinnerlichen Großstädter. Auch wenn Regina auf dem Land aufgewachsen war, hatten die Jahre in Wien ihr Gehör auf stadttypische Geräusche trainiert. Sie war in ihrer Kleidung eingeschlafen und nach zwei Stunden wieder aufgewacht. Hier war alles still. Sie hatte sich ausgezogen, ausgiebig heiß geduscht und sich dann in einen übergroßen Pyjama von Jan geworfen. Er roch noch nach ihm. Erst war es ein Gefühl des Vertrautseins, dann aber rückten die ärgerlichen Momente des Streits in ihr Bewusstsein. Und so zog sie ihn wieder aus und tapste zu ihrer Tasche, um nach einem T-Shirt zu suchen. Dabei übersah sie eine kleine Stufe, die sich vor dem Bett befand, stolperte und fiel der Länge nach auf den Boden. Sie war zu müde, um sich abzurollen, und stürzte so mit großer Wucht mit dem Kopf auf den Eichenholzboden. Schmerz durchzuckte ihren erschöpften Körper. Mit einem Mal war sie hellwach. Sie fluchte mit gepressten Lippen, wollte keinen aufwecken und tapste leise vor sich hin zeternd zum Bad. Regina drehte den Wasserhahn auf kalt, wartete und hielt dann ein kleines Handtuch unter den Strahl. Sie vernahm eine Stimme und drehte den Kopf in alle Richtungen, weil sie nicht orten konnte, aus welcher Richtung die Stimme kam. Stille. Dann wieder die Stimme. Sie war weiblich und besaß definitiv einen strengen Unterton. War es Margot? Die Stimme kam von oben. Regina sah zur Decke. Der Raum hatte kein Fenster, nur eine leise vor sich hin blasende Lüftung, die kaum mehr als einen Quadratmeter maß, sog die Luft aus dem Raum. Regina stellte sich auf den Klodeckel und hielt ihren malträtierten Kopf nah an die Lamellen der Lüftung.
»Dreh dich, du Dreckstück.«
Regina hob die Augenbrauen. Was war das denn?
»Streck ihn mir entgegen.«
Der Schmerz an ihrem Kopf war wie weggeblasen, und das lag nicht an der Lüftung. Regina streckte ihr Bein zur Tür und löschte so das Licht im Badezimmer, um durch die Lüftung vielleicht etwas sehen zu können. Es gab für sie nicht einen Moment der Scham oder das Gefühl, Diskretion walten lassen zu müssen. Wer weiß, was man da sehen konnte. Sie war eben eine Ermittlerin, es diente der Sache. Und tatsächlich konnte sie durch das andere Badezimmer direkt auf das Bett im angrenzenden Schlafzimmer sehen. Sie erkannte eine Person auf einem Stuhl direkt vor ihr. Anhand der breiten Statur und des Hinterkopfs konnte Regina sie als Mann identifizieren. Zwei Meter vor ihm, direkt an der Bettkante, stand eine Frau mit hohen glänzenden Stiefeln, einer äußerst engen Korsage und einer Reitpeitsche. Mit dieser dirigierte sie eine junge Frau, die sich mit verbundenen Augen auf dem Bett positionierte. »Was die Reichen nachts so anstellen, um in den Schlaf zu finden«, dachte Regina amüsiert.
»Spreiz deinen Po. Ich will dich sehen …«
Regina hatte genug. Köhn junior schien tatsächlich ein visueller Mensch zu sein. Sie hüpfte vom Klodeckel und schlich müde und mit schmerzendem Kopf ins Bett. Sofort schlief sie ein. Sie träumte von Jan, von dem Ascheturm in Syrien. Sie schrie, schwitzte und wälzte sich. Erst als schon Licht durch die Jalousien ihres Raumes drang, schlief sie ruhiger.
War sie wach? Etwas schien nicht zu stimmen. Sie öffnete die Augen und sah auf die Lichtstreifen, die sich durch die Jalousien des Fensters über das Parkett schoben. Regina gähnte, reckte sich, strampelte die Decke nach unten, schloss dabei die Augen, drückte ihren Rücken durch und ließ sich dann mit einem Grunzen wieder auf die Matratze fallen. Im letzten Augenblick hatte sie etwas an ihrer Seite bemerkt. Sie sah nach rechts und schrie auf.
Seine Wangen waren eingefallen, die Ohren dagegen wirkten riesig. Er saß in einem modernen Rollstuhl. An seinem Arm war eine Infusion gelegt worden, neben ihm hing an einer Aluminiumstange ein Beutel mit Flüssigkeit, auf seinem Schoß lag ein Ordner mit Papieren.
»Es ist eine dieser üblichen Legenden, dass Magenkrebs heilbar sein kann, nicht wahr?« Regina erkannte ihn sofort. Das war Köhn senior. Hastig zog sie die Decke über sich. Aber der Alte schien keinen Blick an ihren durchtrainierten Körper verlieren zu wollen.
»Sie sind gestern Abend gekommen, ich hörte Sie noch mit meinem Sohn sprechen.«
Regina fand ihre Sprache wieder. »Finden Sie nicht, dass Sie bis zum Frühstück hätten warten können? Ich meine, was wollen Sie hier bei mir?«
Der Mann war an Krebs erkrankt, eine Chemotherapie schien noch nicht lange her zu sein. Sie hatte allerdings noch nicht viele Patienten in diesem Stadium gesehen. Für einen kurzen Moment wünschte sie sich Jan herbei, der ihr mit seiner Professionalität als Arzt sicher hätte helfen können.
»Willkommen im Haus Ritterbusch. Bleiben Sie liegen. Nicht nur mein Krankheitsverlauf verbietet uns, verschwenderisch mit der Zeit umzugehen. Geht man den Weg, den der Krebs einem vorgezeichnet hat, so verliert man nicht nur das Gedächtnis, sondern auch Teile des Körpers. Sie haben mir den Magen entnommen, ein Stück des Darms hochgezogen, und jetzt bin ich genötigt, bis zu sieben kleine Mahlzeiten am Tag zu mir zu nehmen. Nicht schön, aber notwendig. Es hat auch positive Seiten: Dick werde ich in diesem Leben nicht mehr.« Sein Lachen glich eher einem Meckern. »Ich freue mich sehr, dass Sie der Bitte meines Sohnes nachgekommen sind. Ich hoffe, Sie haben alles zu Ihrer Zufriedenheit vorgefunden. Meine Schwester ist etwas ruppig, aber sie ist im Grunde ein herzlicher Mensch.«
Regina war nicht nach Konversation zumute. »Bei allem Respekt: Was wollen Sie hier? Hat unser Gespräch nicht noch etwas Zeit? Dann würde ich mich nämlich gern anziehen und Sie nicht mit meinem schlechten Atem belästigen.«
»Nun, Frau Bachmaier, Sie haben vollkommen recht. Ich schätze offene Worte. Als Unternehmer war ich zu oft von Speichelleckern und Günstlingen umgeben, als dass ich Ihre Art als unangenehm empfinden würde. Aber all das, was ich nun erzählen werde, unterliegt einer strengen Geheimhaltung. Und Zeit ist kostbarer für mich als Etikette. Ich möchte Sie bitten, die vor Ihnen liegenden Erklärungen zu unterzeichnen. Es ist eine reine Sicherheitsmaßnahme. Zu viele wollen über mich berichten und schmutzige Geheimnisse hervorkramen.«
»Gibt es denn welche?«, fragte Regina, während sie sich erhob und am Rollstuhl des Alten vorbeidrängte, wohl wissend, dass er ihr trotz Krankheit und Alter auf den Arsch starren würde, während sie zum Badezimmer ging. Der Alte war irre. Aber vielleicht konnte er etwas Interessantes zu diesem Fall beitragen. Sie spielte das Spiel lieber mit.
Köhn legte den Kopf ein wenig in die Schräge und lächelte. »Noch ganz Polizistin, nicht wahr? Eine Schande, wie man Sie behandelt hat.«
»Was meinen Sie genau, Herr Köhn?«, rief sie aus dem Badezimmer.
»Nun, Sie töteten doch einst diesen Tschuschen, wie man in Ihrer Heimat sagt, diesen Balkanverbrecher. Das war doch der Grund für Ihre Suspendierung.«
Regina wurde stutzig. Der Alte schien etwas über sie zu wissen. War der Auftrag nicht allein von seinem Sohn ausgegangen? »Es war ein mutmaßlicher Krimineller, richtig. Und darüber konnte man noch Wochen später ausführlich in der Zeitung lesen. Ich bin nicht überrascht. Sie oder Ihr Sohn und dessen Mitarbeiter scheinen einen guten Zugang zum Online-Archiv Wiener Medien zu haben.« Regina hatte sich einen Bademantel übergezogen und war in das Schlafzimmer zurückgekommen.
Wieder lächelte Köhn. »Ich schätze Diskretion, und ich weiß gern, mit wem mein Sohn zusammenarbeitet. Wenn Sie wie ich und mein Vater im Krieg waren, wollen Sie dem Mann oder der Frau im Graben neben sich vertrauen können. Das hat er mir immer eingebläut. Ich nehme an, bei Polizistinnen ist das ähnlich.«
Jetzt lächelte auch Regina. »Ich bin keine Polizistin mehr.«
Der Alte ignorierte ihren Einwand. »Mein Name ist Heinrich Köhn. Ich bin der Vater des Mannes, der Sie gestern Abend so charmant begrüßt hat, und der Sohn des Heinrich Köhn senior, des Gründers des Ihnen wohlbekannten Konzerns. Der Geburtsort meines Großvaters war Anklam im heutigen Mecklenburg-Vorpommern. Dort kam er am 12. Juni 1900 zur Welt, überlebte den Ersten Weltkrieg an der Westfront. Ich wurde 1921 geboren und diente im zweiten großen Krieg unserer Nation. Ich will Sie nicht mit meiner Familiengeschichte langweilen, sie ist aber vielleicht wichtig für Ihren Auftrag.«
Regina nickte, obwohl sie sich insgeheim fragte, ob der Sohn vom Sonderweg des Vaters wusste.
»Nun, nach dem Zweiten Weltkrieg konnte ich im Spielzeughandel einige Gewinne erzielen, die mir meinen jetzigen unabhängigen Lebensstil ermöglichen. Damit hätten wir das ›Wer‹ beantwortet.«
Schweigen erfüllte den Raum. Regina sah aus dem Panoramafenster. Aus einer Dachrinne hing ein meterlanger Eiszapfen. Es war kalt, aber eine strahlende Sonne stand am Himmel. Ideales Skiwetter, dachte sie. Gleichzeitig bemerkte sie das sehr dicke Panzerglas. Hier schien jemand Angst zu haben.
»Sagen Sie, eine kurze Frage …« Sie wollte den Alten ein wenig aus dem Konzept bringen. »Ich habe weiter unten einen Mitfahrer gehabt. Er warnte mich vor Ihnen. Kennen Sie zufällig einen Ezechiel?«
Köhn hob erstaunt die Augenbrauen.
»Ezechiel, weißes Leinengewand, keine Zähne«, ergänzte sie.
Er schüttelte den Kopf. »Nie gehört. Wir haben mit den Menschen hier nicht viel Kontakt. Wir sind gern allein«, sagte er streng.
Er griff in ein Seitenfach des Rollstuhls und zog einen weiteren Ordner hervor. »Ihr Husarenstück im Sommer ging ja durch alle Medien. Ihr Kampf gegen das Böse hat sicher viele beeindruckt.« Er blätterte und zeigte ihr Fotokopien mit Bildern von Jan und Regina in Syrien, Berlin und Israel. Es waren teils offizielle Bilder aus Zeitungen oder Fernsehsendungen, aber es gab auch Fotos, die unmöglich von Journalisten gemacht worden sein konnten.
Regina wurde unruhig. »Woher stammen diese Bilder?«
Köhn hob beschwichtigend die Hand. »Sie wurden seit Ihrer Einreise nach Deutschland von einer Gruppe observiert. Diese Gruppe hat mir das Material, sagen wir, überlassen. Ich konnte also Ihrem Abenteuer im Nachhinein folgen. Sie haben mit Ihrem Kampf gegen die Lilith-Sekte ein Tor aufgestoßen, dessen Ausmaße Sie nicht abschätzen können. Fischer und seine Bande waren nur ein kleiner Teil, der Kopf der Medusa sozusagen. Aber all das Böse, was es bedeutete, wächst nach. Sie haben in die Geschehnisse eingegriffen. Aber hier habe ich etwas für Sie …« Er warf ihr eine kleine Sammlung von Papieren, eingeschweißt in eine Plastikfolie, auf den Schoß. »Das müssen Sie studieren. Das kann irgendwann einmal Ihre Chancen erhöhen, Ihr Leben nicht zu verlieren.«
»Aha, und warum tun Sie das?«, fragte Regina und warf gleichzeitig einen Blick auf die Dokumente. Sofort erkannte sie den Reichsadler der Nazis auf dem Briefkopf. Waren das Fälschungen? So einfach gab man doch so etwas nicht aus der Hand.
»Ich nehme an, dass Sie mit theologischen Fragen nicht allzu vertraut sind, da Ihre Arbeit eine Beschäftigung mit solchen Dingen sicher nicht zuließ. Lassen Sie es mich erklären: Das Böse, so wie wir es bezeichnen, spielte in vergangenen Zeiten immer eine andere Rolle. Sind Sie christlichen Glaubens? Glauben Sie, dass wir durch eine Erbsünde das Böse in uns tragen, sozusagen in Form des freien Willens? Ich glaube es. Es gibt das Böse, das von uns selbst ausgeht, als Gegenstück zum sittlich und moralisch Guten. Und es existiert das nominelle Böse, der Satan, der Dschini, die Dämonen. Jede Religion besitzt Begriffe für diese Form. Nur das Christentum und das Judentum beharren darauf, dass das Böse eine Gott untergeordnete Kraft sein müsse, somit also immer auf der Verliererseite stehen müsse. Denn wenn Gott einzigartig ist und die Welt allein erschaffen hat, kann keine böse Kraft daneben eigenständig gedacht werden. Ihre Freunde des Lilith-Kultes sahen das naturgemäß anders. Sie wollten das Böse, weil es die Kraft des Fortschritts ist, der Veränderung und die treibende Kraft auf dieser Welt. Sie suchten den Kampf mit den Mächten des Guten. Das alles setzt voraus, dass man an etwas Größeres glaubt. Was glauben Sie?«
»Vater, hier bist du ja!«
Köhns Sohn hatte, ohne zu klopfen, ihr Zimmer betreten. Regina sah erleichtert zur Tür, ließ aber die Dokumente unter ihrer Bettdecke verschwinden. »Das scheint eine Macke der Köhns zu sein, unaufgefordert bei Frauen aufzutauchen«, dachte sie.
Der alte Mann sah seinen Sohn mit einer Mischung aus Wut und Ekel an, was diesen aber nicht daran hinderte, weiterhin seinen Charme zu versprühen. »Behandeln wir so unsere Gäste? Verzeihen Sie, Frau Bachmaier. Mein Vater neigt dazu, Dinge, die ihm wichtig erscheinen, selbst in die Hand zu nehmen.«
Arwed Köhn lächelte Regina beschwichtigend an. Er trug einen knappen Sportdress, der seine sehnigen Muskeln betonte. Im nächsten Augenblick schob er sanft, aber bestimmt den Rollstuhl mitsamt seinem Vater aus dem Raum. Er sah sich noch einmal um, verdrehte die Augen, um ihr zu signalisieren, dass der Vater nicht zurechnungsfähig sei, und rief draußen nach seiner Tante. Regina hörte eilige Schritte, leise Vorwürfe, und dann erschien der Sohn wieder im Zimmer.
»Wie geht es Ihnen heute?«
»Na ja, ich bin schon netter geweckt worden«, antwortete sie trocken.
»Mein Vater ist mittlerweile nicht mehr so häufig in unserer Welt. Er vermischt die Dinge, vergisst Fakten, und daraus wird eine eigene Sphäre. Er weiß von unserem Auftrag, bringt ihn aber in Verbindung mit eigenen Erlebnissen aus der Vergangenheit. Es tut mir leid. Meine Tante hätte besser auf ihn aufpassen sollen. Er entwickelt zuweilen eine eigene Dynamik. Was macht die Erkältung?«