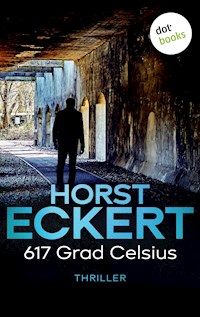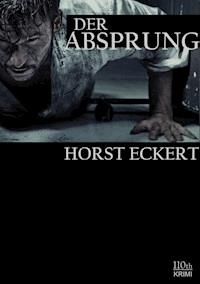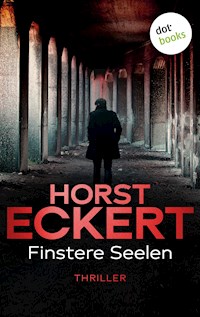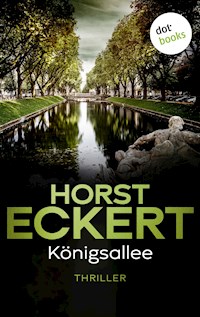9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Fall für Melia und Vincent-Reihe
- Sprache: Deutsch
Melia Adan hat es im Polizeiapparat schon in jungen Jahren weit gebracht. Doch mit einem Auftrag wie diesem hätte sie im Leben nicht gerechnet: Die Bundeskanzlerin persönlich bittet um ihre Hilfe. Offenbar wird die Regierungschefin von jemandem aus ihrem direkten Umfeld erpresst. Zugleich bringt sich, angeführt von einem bekannten Meinungsmacher, eine neue rechtskonservative Bewegung für die nächsten Wahlen in Position. Angesichts der aufgeheizten Stimmung im Land scheint plötzlich alles möglich. Es entbrennt ein ungeheurer Kampf um politische Glaubwürdigkeit, Einfluss und Macht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 390
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Das Buch
Auf Deutschlands Straßen wird demonstriert. Die sozialen Spannungen nehmen zu. TV-Moderator Christoph Urban schwingt sich zum Aushängeschild einer neuen rechtskonservativen Sammlungsbewegung auf, die rasch an Zulauf gewinnt und die etablierten Parteien vor sich hertreibt. Unterstützung erhält Urban dabei vom milliardenschweren Immobilien-Magnaten Hartmut Osterkamp, der seinen politischen Einfluss mit aller Macht zu mehren versucht.
Als auf einer Osterkamp-Baustelle mehrere Leichenteile gefunden werden, übernimmt Hauptkommissar Vincent Veih die Ermittlungen. Es könnte sein letzter Einsatz als Kommissariatsleiter werden. Sollte seine Freundin Melia Adan tatsächlich zur nächsten Kripochefin von Düsseldorf ernannt werden, wird er seinen Posten wohl oder übel räumen müssen. Der Fall konfrontiert Vincent mit einem dunklen Fleck in seiner eigenen Familiengeschichte.
Melia hat unterdessen unter strengster Geheimhaltung einen heiklen Auftrag angenommen: Ein hoher Beamter hat belastendes Material gegen die Bundeskanzlerin in der Hand. Melia soll ihn der Erpressung überführen. Falls sie scheitert, könnte das ihre Karriere ausbremsen – und die politischen Verhältnisse in Deutschland endgültig umwerfen.
Der Autor
Horst Eckert, 1959 in Weiden/Oberpfalz geboren, lebt seit vielen Jahren in Düsseldorf. Er arbeitete fünfzehn Jahre als Fernsehjournalist, u. a. für die »Tagesschau«. 1995 erschien sein Debüt »Annas Erbe«. Seine Romane gelten als »im besten Sinne komplexe Polizeithriller, die man nicht nur als spannenden Kriminalstoff lesen kann, sondern auch als einen Kommentar zur Zeit« (Deutschlandfunk). Sie wurden unter anderem mit dem Marlowe-Preis und dem Friedrich-Glauser-Preis ausgezeichnet und ins Französische, Niederländische und Tschechische übersetzt.
Lieferbare Titel
Im Namen der Lüge
Die Stunde der Wut
Das Jahr der Gier
THRILLER
WILHELMHEYNEVERLAG
MÜNCHEN
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Originalausgabe 04/2023
Copyright © 2023 by Horst Eckert
Copyright © 2023 dieser Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Lars Zwickies
Covergestaltung: Designomicon, Anke Koopmann, nach einer Idee von Katie Wewer,
unter Verwendung von Motiven von © shutterstock (Blue Titan/engel.ac)
Satz: KCFG – Medienagentur, Neuss
ISBN 978-3-641-29874-6V002
www.heyne.de
Der Tag bricht an, und Mars regiert die Stunde.
(Friedrich Schiller, Wallensteins Tod)
EIN TAG IM MÄRZ
PROLOG
MOSKAU
DIESPETSOPERATSIYAZURABSETZUNG der Faschisten in Kiew war noch keine drei Wochen alt, als Rotenberg dem Boss im Kreml einen Plan vorlegte, um auch in Deutschland einen Regime Change zu erwirken.
Ohne jeden Militäreinsatz.
Ausschließlich mit dem Intellekt.
Was im Russischen auch das Wort für Geheimdienst war.
Sie berieten zu dritt, denn der Boss wollte Setschin dabeihaben. Alle drei waren Ex-KGB-Kollegen, Judopartner, engste Freunde aus alten Sankt Petersburger Tagen. Doch ausgerechnet Setschin, der wegen seiner Skrupellosigkeit auch Darth Vader genannt wurde und stolz darauf war, trug Bedenken vor.
Er wirkte griesgrämig und sah Rotenberg nicht an.
»Ich kann vor solchen Abenteuern nur warnen.«
»Warum nur, Igor Iwanowitsch? Der Feind muss überall bekämpft und geschwächt werden.«
»Denk an die Unsummen, die wir an Venezuela vergeudet haben, Arkadi Romanowitsch.«
Das Totschlagargument. Rotenberg hatte es kommen sehen. Venezuela galt im Kreml als Fehlschlag. Auch wenn Rotenberg das anders sah.
Lieber ein kaputter Staat, der sein Öl kaum noch aus der Erde bekam, als eine Regierung, die es billig verkaufte, um Amerika zu gefallen.
»Und Velikobritaniya?«, fuhr Setschin fort. »Dort haben wir massiv die Tories unterstützt und gefühlt jeden zweiten Lord des Königreichs auf die Lohnliste gesetzt. Was hat es gebracht? Die Inselaffen unterstützen die Kiewer Faschisten mit Drohnen und Haubitzen. Sie bilden sie in ihrem eigenen Land aus!«
Er hatte die Stimme gehoben, als wolle er sicherstellen, dass der dritte Mann, der am anderen Ende des überlangen Tisches saß, ihn auch hörte.
Doch der Boss war nur mit seinem Smartfon beschäftigt.
»Wir haben immerhin den Brexit durchgesetzt«, erwiderte Rotenberg. »Das wiegt das andere auf.«
Setschin wackelte mit dem Kopf, seine Wangen vibrierten. »Marine Le Pen wird wieder verlieren.«
»Das tut sie immer knapper. In nicht allzu ferner Zukunft …«
»Und Savini ist nur Dritter.«
»Aber er bestimmt in Italien den Diskurs.«
»Die FPÖ …«
»Seit wann ist Darth Vader ein Pessimist? Die liberale Welt ist überall auf dem Rückzug. Das ist Fakt. Unser Auslandskapital arbeitet hervorragend. Von Venezuela mal abgesehen.«
Beide blickten zu Wladimir Wladimirowitsch hinüber, der das Machtwort sprechen sollte. Er saß sechs Meter entfernt – aus Angst vor Viren, Bazillen und Anschlägen.
Und nach wie vor vom Display seines Smartfons gefesselt.
Rotenberg fiel auf, wie glatt das Gesicht des kleinen Mannes war. Eine neue Botox-Behandlung, vermutete er. Auch die Lider hatte sich der Boss straffen lassen.
Was man nicht alles tat, um einer ehemaligen Olympionikin zu gefallen, die kaum älter war als die eigenen Töchter.
Rotenberg wandte sich wieder dem Griesgram Setschin zu. »Die FPÖ holt auf, Igor Iwanowitsch. Wir haben Victor Orban im Sack. In Griechenland sogar die Linken und die Rechten. Wir besiegen den Westen, indem wir die Herzen und Köpfe erobern. Mit allen Mitteln, die wir beim KGB erlernt haben.«
Plötzlich ertönte vom anderen Ende des Tisches ein glucksendes Lachen, das kaum enden wollte.
»Was gibt’s?«, fragten Rotenberg und Setschin zugleich.
Wladimir Wladimirowitsch schüttelte belustigt den Kopf.
Seine Knopfaugen leuchteten.
»Schaut euch das mal an!«
Er ließ sein Smartfon über den spiegelblanken Tisch gleiten.
Setschin ergriff es zuerst.
»Wer ist das?«, fragte er.
»Die Koreanerin. Schaut, wie sie für uns betet!«
Rotenberg erhaschte einen Blick auf das Display und erkannte Soyeon Schröder-Kim, die soeben ein Selfie auf Instagram gepostet hatte. Die Hände gefaltet. Vor einem Fenster. Im Hintergrund der abendlich erleuchtete Rote Platz. Die Basilius-Kathedrale und das Warenhaus GUM strahlten im Licht.
Es war der Blick aus dem Hotel Baltschug Kempinski.
Am anderen Ufer der Moskwa.
»Dann ist auch Gerhard da, oder?«, wollte Rotenberg wissen. Er war versucht, ans Fenster zu treten und hinüberzuwinken.
Der Boss hob seufzend die Augenbrauen. »Sie machen ihm das Leben schwer. Rauben ihm Büro, Sekretärin und Fahrer. Und sie verlangen, dass er bei Rosneft aufhört.«
»In Berlin regieren Faschisten in grünem Gewand.«
»Was ist euer Plan?«
Endlich interessierte sich Wladimir Wladimirowitsch für den Grund ihres Treffens.
Rotenberg antwortete: »Die Berliner Faschisten zu stürzen.«
»Und wie?«
»Wir kontrollieren einen Fernsehsender. Und den Aufbau einer Protestbewegung. Bald können wir eine ganze Partei steuern.«
Der Boss verzog die Mundwinkel. »AfD.«
»Nein, viel besser. Eine Neugründung. Jünger, frischer. Attraktiv für alle, die unbehelligt vom Staat ihren Geschäften nachgehen wollen. Und um Geschäfte geht es in Deutschland zuerst.«
»Was sagt unser Kontakt im Kanzleramt dazu?«
»Er steht bereit, die deutsche Kanzlerin zu stürzen, damit es Neuwahlen gibt. Er sucht nach einem geeigneten Vorsitzenden für die neue Partei und wartet praktisch nur auf unser Go.«
Setschin mischte sich ein: »Sag dem Boss, was das kostet, Arkadi Romanowitsch.«
Rotenberg zögerte.
»Und?«
Er musste sich räuspern. Es wäre mehr, als jemals eine Partei in Deutschland für einen Wahlkampf verpulvert hatte. Aber Rotenberg glaubte fest daran, dass Klotzen effektiver war als Kleckern.
»Vierzig Millionen Euro.«
Gemessen an ihren Privatausgaben war das gar nicht so viel. Rotenbergs neue Datscha hatte ein Vielfaches gekostet. Und selbst die war ein Klacks im Vergleich mit dem Palast am Schwarzen Meer, den er für den Boss gebaut hatte.
Der Mann am anderen Ende des polierten Tisches kniff seine Augen zusammen.
»Bedenken, Igor Iwanowitsch?«, fragte er.
Setschin atmete tief ein.
Er ließ seinen Blick von einem zum anderen wandern.
Dann schüttelte er den Kopf. Seine Wangen schlackerten dabei.
Rotenbergs Plan stand nichts mehr im Weg.
Wladimir Wladimirowitsch lachte und rief: »Vielleicht wird Gerhard sogar noch Präsident. Falls Gott die Gebete der Koreanerin erhört!«
TEILEINS
DIEERSTEERPRESSUNG
Hier, wo das Trümmergewirr, wo Stein vom Steine gerissen, wo Staubwolken du siehst.
(Vergil, Aeneis, 2. Buch)
ANFANG JUNI
01
HAGEN
»AUFWIEDERSEHENZUSAGEN erspare ich uns lieber, nicht wahr?«
Zum abgestandenen Scherz des Justizbeamten gab es einen Händedruck und den Entlassungsschein. Dennis Schubert faltete das Papier und steckte es in die Außentasche seiner Jeansjacke. Ihn irritierte, dass sie nicht allein waren. Ein Reporter stand da und grinste. Sein Kameramann nahm alles auf.
»Was soll das?«, empörte sich Dennis und wandte sich an den Beamten. »Sag den Clowns, sie sollen sich verpissen. Ich will das nicht!«
»Ich dachte, es ist alles geklärt«, sagte der Reporter.
»Nicht mit mir!«
Der Kameramann nahm ächzend seine Mühle von der Schulter. Sein Ellbogen war bandagiert. Der Wärter zeigte darauf.
»Was ist passiert?«
»Montagsdemo. Die haben mich umgestoßen.«
»Ich dachte, Deutschland-TV lassen die in Ruhe.«
»Wir waren an dem Tag für den WDR unterwegs.«
»Verstehe.«
»Die Polizei stand keine fünf Meter entfernt und hat nichts zu unserem Schutz unternommen.«
Dennis klopfte gegen die Tür und wurde lauter.
»Was soll das Gequatsche? Kann ich jetzt gehen?«
Der Reporter versuchte es noch einmal. »Wir drehen einen Beitrag zum Thema private Gefängnisse.«
Dennis lachte auf. »Wie, jedem Häftling sein eigener Knast?«
»Nein, Sie wissen schon, ein privates Unternehmen baut und betreibt die Anstalten.«
»Ist schon klar. Aber ich muss nicht ins Fernsehen. Ich brauch das nicht. Sucht euch einen anderen Idioten.«
»Wir können Ihr Gesicht verpixeln, wenn Sie …«
»Ich traue euch Clowns nicht. Und wenn ihr auch nur eine Sekunde von dem sendet, was ihr gerade aufgenommen habt, verklage ich euch, bis euch die Lichter ausgehen!«
Der Uniformierte schloss auf.
Endlich konnte Dennis ins Freie auf den Vorplatz treten.
Es war bewölkt und windig, ein durchwachsener Frühlingstag. Dennis sog die Luft in seine Lungen. Eigentlich unterschied sie sich nicht von der, die er all die Jahre auf dem Gefängnishof geatmet hatte.
Und doch war alles anders.
Hinter ihm krachte die schwere Tür ins Schloss.
Dennis ließ seinen Blick schweifen.
Am Straßenrand hatte seine Schwester geparkt. Sie winkte und eilte auf ihn zu. Steffi war den ganzen Weg von Benrath am Rhein gekommen, um ihn abzuholen.
Ein Engel, dachte Schubert.
»Dennis«, sagte sie und strahlte.
Soweit er es überblicken konnte, war niemand außer ihr da. Keiner von denen, die ihm die Scheiße eingebrockt hatten.
Und auch keine Bullen.
Beruhig dich, Mann.
Er schloss seine Schwester in die Arme. Sie war verschwitzt von der Fahrt. Für ihn die erste Umarmung seit zehn Jahren. Im Besuchsraum war Körperkontakt verboten gewesen. Seine Ex hatte sich ohnehin nicht blicken lassen.
Dennis warf der Fassade der JVA Hagen einen Abschiedsblick zu. Hier sperrte man die ein, die man zu besonders langen Haftstrafen verurteilt hatte. Errichtet in der Weimarer Zeit. Siebeneinhalb Quadratmeter pro Zelle, finster und muffig.
Und er hatte seine volle Strafe absitzen müssen. Egal, ob gute Führung oder nicht. Weil er den Mund gehalten hatte. Gegenüber den Bullen, im Prozess und auch seitdem. Er war keiner, der quatschte.
Ein Dennis Schubert hielt seine Abmachungen ein.
Und von jetzt an hatte die Welt für ihn keine Grenzen mehr.
Adieu JVA. Auf Nimmerwiedersehen.
Privat betriebene Knäste. Dennis schüttelte den Kopf. Auf Ideen kamen manche Leute, wenn es darum ging, sich die Taschen zu füllen. Sicher alles ganz legal.
Steffi öffnete den Kofferraum. Dennis warf seine Tasche hinein und blickte sich noch einmal um. Nach wie vor keine Bullen da.
Beim Losfahren schob Steffi eine CD in den Schlitz der Audioanlage.
»Immer noch Rammstein-Fan?«
Dennis behielt eine Weile lang den Verkehr im Blick.
Dann drehte er die Musik lauter, lehnte den Kopf gegen die Nackenstütze und schloss die Augen. Der Refrain traf ins Schwarze.
»Gott weiß, ich will kein Engel sein.«
Ein ganzes Jahrzehnt lang hatte das Leben ohne ihn stattgefunden.
Höchste Zeit, das zu ändern.
ENDE JUNI
FREITAGNACHMITTAG
02
DÜSSELDORF-STADTMITTE
HEUTEFANDBRIGITTEVEIH den Durchschlupf verschlossen vor. Die Elemente des Bauzauns standen ohne Lücke und fest verzurrt da. Nur Lärm und Staub drangen herüber.
Ihr blieb die Zufahrt.
Große Kipplaster rollten vom Gelände, randvoll mit Schutt beladen. Motorlärm, Abgaswolken. Brigitte wartete ab, bis sich eine Gelegenheit ergab, dann ging sie auf die umzäunte Kaufhausruine zu.
Der Wind trieb ihr das Wasser entgegen, mit dem die Arbeiter die Mauern benässten, damit es nicht noch mehr staubte. Schützend hielt Brigitte ihre Hand über die Kamera.
Sie staunte über den Fortschritt der Arbeiten.
In den letzten Wochen war sie immer mal wieder hergekommen, um die Arbeit von Baggern, Abbruchzangen und Stahlbirnen zu dokumentieren. Das Verschwinden eines Konsumtempels aus vergangener Zeit.
Sie war in einem Dorf auf der anderen Rheinseite aufgewachsen. Wann immer sie mit ihren Eltern hierhergekommen war, erschien ihr der Ort als das Sinnbild der großen glänzenden Stadt.
Der Kaufhof am Wehrhahn.
Einst hatten hier mehr als tausend Angestellte in Verkauf und Verwaltung gearbeitet. Doch Onlineshopping hatte sie überflüssig gemacht. Die viel gepriesene Digitalisierung. Eine Ära war vorbei.
Bereits vor ein paar Jahren hatte der Immobilientycoon Hartmut Osterkamp den heruntergewirtschafteten Kaufhauskonzern erworben. Dessen Grundstücke in den besten Lagen des Landes waren eine Goldgrube, wenn man über den nötigen Einfluss verfügte, um sie neu bebauen zu können.
Und wer hätte Einfluss, wenn nicht einer wie Osterkamp?
Immobilienentwickler – so nannten ihn Politik und Medien.
Und statt Abriss sagte man Rückbau.
Den schönfärberischen Worten setzte Brigitte ihre Bilder entgegen.
In einem früheren Leben hätte sie den Milliardär kurzerhand zum Anschlagsziel erklärt. Aber seit ihrer Freilassung Ende der Neunzigerjahre schoss sie nur noch mit ihrer Kamera. Inzwischen war sie als Künstlerin anerkannt. Gewann Auszeichnungen, erzielte gute Preise für handgefertigte Abzüge.
Sie stiefelte durch Dreck und Trümmer. Nahm Blickwinkel ein, die das Motiv zum Sprechen brachten. Machte Licht, Steine und Staubschwaden zu Protagonisten. Drückte den Auslöser. Ein ums andere Mal.
»Hey, Oma!«
Ein Kerl in blauer Uniform und mit gelbem Plastikhelm auf dem Kopf lief auf sie zu. Das Logo auf seiner Brust bestand aus drei Buchstaben: OFS. Sie kannte das Kürzel.
Osterkamp Firm & Secure. Europas größtes Sicherheitsunternehmen, das ebenfalls zum weitläufigen Imperium des feinen Konzernherren gehörte.
Brigitte hatte recherchiert.
»Ich mache nur ein paar Fotos, junger Mann.«
»Nichts da, verschwinde!«
»Neulich hat Ihr Kollege ein Auge zugedrückt.«
»Das kann nicht sein. Unbefugte haben hier nichts zu suchen. Dat is’ hier ’ne Baustelle. Viel zu gefährlich!«
»Dann geben Sie mir auch so einen Helm.«
»Bist du taub, Oma?«
»Rühren Sie mich nicht an. Mein Sohn ist bei der Polizei. Ich kenne meine Rechte.«
Der Kerl blieb unbeeindruckt. Er schubste sie in Richtung Zufahrt.
»Hey, was hier geschieht, liegt im öffentlichen Interesse«, protestierte Brigitte. »Ich darf hier Fotos machen!«
»Lass dir mal vom Sohnemann erklären, was Hausfriedensbruch ist. Dat is’ verdammtes Privatgelände!«
Leute gafften herüber. Bauarbeiter, weitere Security. Und ein paar Leute in Anzügen. Architekten, Manager, Bauverwaltung.
Brigitte trat den Rückzug an. Dabei schoss sie aus der Hüfte ein Foto von dem Wachschutzbullen, um die grimmige Erscheinung festzuhalten. Hulk im zerstörten Walhalla.
Es würde ihr vorerst letzter Besuch hier sein. Denn am Sonntag ging es nach Kassel. Zur diesjährigen Documenta, wo man einige ihrer jüngsten Arbeiten zeigte.
Auch in Kassel war Krawall programmiert. Irgendwelchen Deppen war es ein Dorn im Auge, dass ein ehemaliges RAF-Mitglied in den heiligen Hallen ausstellen durfte.
Wie ruhig war es noch vor fünf, sechs Jahren gewesen, als kaum jemand sie gekannt hatte.
Oder lag es am Wandel der Zeit?
Das Klima, die Seuche, der Krieg.
Die Leute wurden dünnhäutig, drehten durch.
Irgendetwas kippte gerade gewaltig.
03
DÜSSELDORF-UNTERBILK
ENDLICHWARDIESITZUNGder Kommissariatsleiter zu Ende. Sie hatte heute am Nachmittag stattgefunden, was den Feierabend für Vincent Veih hinauszögerte. Er steckte rasch seinen Stift ein, schob die Blätter vor sich zu einem Stapel zusammen und stand auf.
Lautes Stühlerücken, der große Raum leerte sich. Kripochef Engel hatte offiziell verkündet, was jeder längst wusste: In zwei Monaten würde er in Pension gehen. Einige Kollegen blieben auf dem Flur stehen, tauschten Spekulationen aus, wer ihm nachfolgen würde. Ob das Ministerium die Stelle intern besetzte oder durch einen Bewerber von außen.
Vincent beteiligte sich nicht daran. Er hatte es eilig, denn vor ihm lag ein verlängertes Wochenende in Berlin. Ein dreitägiger Trip mit seiner Liebsten.
Und wer für den Posten des Kripochefs am besten geeignet war, stand für ihn sowieso bereits fest.
»Herr Veih?«
Kriminaldirektor Engel holte ihn vor der Glastür zum Treppenhaus ein.
»Kommen Sie noch kurz in mein Büro?«
Vincent nahm die Hand von der Klinke und machte widerwillig kehrt. Sein Koffer stand ein Stockwerk höher bereit. Womöglich wartete auch schon das Taxi vor dem Präsidium.
Er folgte Engel ins Vorzimmer von dessen Büro und grüßte die Sekretärin, der er heute noch nicht begegnet war.
»Kaffee, Herr Veih?«
Vincent nickte aus reiner Höflichkeit. Er hoffte, das Gespräch hinter sich zu haben, bevor Frau Lechtenbrink die dünne Filterplörre servierte, für die sie berüchtigt war.
Der Kripochef deutete auf die Stühle vor seinem Schreibtisch.
»Kann ich Sie was Privates fragen? Ihre Freundin ist doch Kinderpsychologin, Herr Veih, nicht wahr?«
»Nein, mit Nina bin ich schon länger nicht mehr zusammen.«
»Verstehe.«
»Wieso fragen Sie?«
Engel räusperte sich. »Mir ist da ein Gerücht zu Ohren gekommen.«
»Bezüglich meiner Ex? Hat Nina etwas ausgefressen?«
»Nein, es geht um Sie und Frau Adan.«
Vincent verschränkte die Arme. Die Unterhaltung gefiel ihm nicht. Sicher wartete Melia bereits im Taxi auf ihn.
»Dass Beziehungen am Arbeitsplatz entstehen, ist nichts Ungewöhnliches«, fuhr Engel fort. »Es fördert nicht immer das Klima in der Dienststelle, aber damit können wir umgehen. Solange der Partner nicht der Vorgesetzte ist. Oder die Vorgesetzte.«
Vincents Blick fiel auf die Jalousie vor dem Fenster, die nicht ganz nach oben gezogen war und etwas schief hing.
»Ein dienstliches Abhängigkeitsverhältnis stellt eine potenzielle MeToo-Situation dar«, sagte der Kriminaldirektor. »So etwas kann jederzeit aus dem Ruder laufen.«
»Muss es aber nicht.«
»Herr Veih. Früher oder später gibt es Unruhe. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche.«
Vincent überlegte, wer ihn und Melia beim Kripochef verpfiffen hatte.
»Was wollen Sie?«, fragte er.
Engel nestelte an seiner Krawatte herum, als sei ihm nicht wohl in seiner Haut. »Die Behörde hat definitiv ein Problem. Wie will eine Inspektionschefin ihren Kommissariatsleiter unvoreingenommen beurteilen oder ihm die angemessenen Anweisungen erteilen, wenn sie mit ihm das Bett teilt?«
Vincent hatte keine Lösung parat, obwohl er stets befürchtet hatte, dass sich diese Frage eines Tages stellen würde. Er wusste nur, dass er seine Dienststelle nicht wechseln wollte.
Die Leitung des KK11, des Kommissariats für Todesermittlungen, das zu Melias Inspektion gehörte, war für ihn die Erfüllung seiner beruflichen Wünsche. Er machte das jetzt seit fast neun Jahren. Und bis zu seiner Pensionierung sollte das auch so bleiben.
Scheiß auf die Compliance-Regeln.
Sein Handy vibrierte. Verborgen unter der Tischplatte zog er es hervor. Eine Nachricht von Melia. Das Taxi stand bereit. Der Zug nach Berlin ging in zwanzig Minuten.
»Herr Veih? Haben Sie mir zugehört?«
Vincent stand auf. »Es geht niemanden etwas an, mit wem ich morgens frühstücke.«
Engel räusperte sich erneut. »Hören Sie, meine Tage in diesem Haus sind gezählt. Ich werde mich auf der Zielgeraden in niemandes Privatleben mehr einmischen. Aber sehen Sie zu, dass die Gerüchte nicht weiter die Runde machen. Haben wir uns verstanden, Herr Veih?«
Vincent holte den Rollkoffer aus seinem Büro und ging zum Paternoster. Das Taxi wartete vor dem Eingang des Präsidiums. Der Fahrer nahm ihm den Trolley ab und verstaute ihn. Vincent stieg zu Melia ein.
Sie drückte seinen Schenkel und küsste ihn auf die Wange.
Er spähte beunruhigt nach draußen.
»Was ist?«, fragte Melia.
»Jemand hat dem Kripochef von uns erzählt. Ich wette, es war Anna.«
Es hatte eine Zeit gegeben, als seine Stellvertreterin gegen ihn intrigiert hatte. Sein Verhältnis zu Melias Vorgänger war zerrüttet gewesen, und Anna hatte versucht, das auszunutzen. Sich beim Inspektionsleiter beliebt zu machen, um Vincents Posten zu übernehmen. Doch das war Jahre her.
»Anna Winkler?«, fragte Melia.
»Erinnerst du dich, wie sie neulich ins Zimmer kam?«
»Wir saßen meterweit voneinander entfernt.«
»Sie spürt, was los ist.«
»Dagegen können wir nichts tun, Vincent. Irgendwann müssen wir uns outen.«
Und dann? Vincent sprach die Frage nicht aus, denn es gab keine befriedigende Antwort darauf. Er wusste nur, dass Melia sich nicht sorgen musste, einen Karriereknick zu erleiden. Er hätte wetten können, dass man sie bereits als Engels Nachfolgerin auserkoren hatte.
Als erste Frau an der Spitze der Düsseldorfer Kripo.
Als Person of Color.
Mit nicht mal vierzig Jahren.
Er drückte ihr die Daumen. Aber für ihn wäre es das Aus in der Kripo. Das hatte ihm die Unterredung mit Engel noch einmal klargemacht. Eine private Beziehung zwischen Beamten, die in dienstlicher Abhängigkeit zueinanderstanden, war tabu.
Vincent hatte keine Lust, auf einer Wache den Streifendienst zu organisieren. Abgesehen davon, dass die entsprechende Stelle erst freigeräumt werden müsste.
Der Fahrer bog am Fürstenwall Richtung Osten ab und gab Gas.
Den Zug würden sie noch kriegen.
»Warum hat Engel nicht mit mir darüber gesprochen?«, fragte Melia.
»Keine Ahnung.«
»Egal. Versprich mir eines, Vincent: in den nächsten drei Tagen kein Wort über die Arbeit. Keine dunklen Gedanken. Nur Liebe, Spaß und Zweisamkeit.«
»Jawohl, Chefin.«
Melia schlang die Arme um ihn. Sie küssten sich. Hier durften sie es.
Er spürte, wie er sich allmählich entspannte.
SAMSTAGABEND
04
DÜSSELDORF-STADTMITTE
BRIGITTEWARDOCHNOCHeinmal zurückgekehrt. Vielleicht wurde die Baustelle am Wochenende um diese Uhrzeit nicht so scharf bewacht. Oder von einem netten Typen wie neulich, der sie mit ihrer Kamera gewähren ließ.
Es war kurz nach halb elf an einem der längsten Tage des Jahres, und vor ihrer Fahrt nach Kassel wollte Brigitte nachsehen, wie der Ort bei Dunkelheit wirkte. Sie konnte nicht bis zu ihrer Rückkehr warten. Womöglich würde dann von den Außenmauern des großen Kaufhauses kaum noch etwas übrig sein.
Zu ihrer Enttäuschung war die Zufahrt mit einem Gitterzaun verschlossen.
Sie wusste nicht, wie sie die Verbindungsschellen lösen konnte. Selbst mit einem Bolzenschneider hätte sie hier keine Chance. Brigitte beschloss, nicht gleich die Flinte ins Korn zu werfen, denn nicht immer ging es an solchen Orten ordentlich zu.
Sie begann die Baustelle zu umrunden. Abgesehen von den Gittern an der Zufahrt war der Zaun blickdicht. Profilierte Bleche in Weiß. Schätzungsweise zwei Meter hoch.
Plötzlich stand sie vor einer Lücke. Zwei Elemente klafften auseinander. Weit genug, um hindurch zu schlüpfen.
Brigitte sah sich um. Niemand schien sie zu beachten.
Und wenn schon, dachte sie.
Ich habe nichts Kriminelles vor.
Sie betrat das Areal und stand zunächst vor einem Schuttberg. Je näher sie der Mitte des Geländes kam, desto interessanter wurden die Blickwinkel.
Die Baumaschinen wirkten wie Gerätschaften einer außerirdischen Invasionsarmee. Das Skelett der riesigen Ruine ragte vor dem rötlichen Himmel auf. Darüber hing ein Halbmond.
Das Zusammenspiel von Mauerresten, Schatten, verblassenden Farben und irreal anmutendem Licht erzeugte ein Bild maroder Schönheit.
Die Faszination des Zerfalls, fast schon kitschig.
Brigitte schoss Foto um Foto, während sie sich der höchsten noch stehenden Außenwand näherte. Der Staub hatte sich gelegt. Der Boden war trocken. Brigitte stakste über das Trümmerfeld und musste aufpassen, um nicht über Betonbrocken zu stolpern.
Plötzlich wurde ihr bewusst, woran sie der Blick durch den Sucher erinnerte.
An den Krieg.
An Fernsehbilder aus Irpin, Charkiw, Mariupol.
Leise Schritte auf Schotter ließen sie erstarren. Jemand kam durch dieselbe Lücke wie sie. Sie duckte sich hinter die Schaufel eines Radladers und wagte kaum zu atmen.
Es war ein Mann. Er schleppte einige dunkle Beutel und legte sie am Fuß des Schuttbergs ab. Unmittelbar darauf trat er den Rückweg zur Straße an.
Brigitte blieb still und bewegte sich nicht vom Fleck.
Kurz darauf kam der Typ wieder. Diesmal trug er in jeder Hand nur einen Sack, größer und schwerer als die Beutel zuvor.
Beim dritten Mal waren es wieder mehrere Tüten. Er warf sie an den Fuß des Hügels.
Schließlich zog er ein großes Brett aus dem Schuttberg, dessen Flanke daraufhin wegbrach. Unter lautem Prasseln rutschten die Geröllmassen auf die Beutel. Staub stieg auf, und die verwehenden Schwaden fingen das Licht der Laternen jenseits der Umzäunung ein.
Der Mann verschwand, ohne wiederzukehren.
Brigitte spürte, wie ihr Herz klopfte.
Irritiert nahm sie die Kamera herunter und fühlte sich, als hätte ihr ein Riss in der Welt einen Blick auf eine zweite, noch absurdere Wirklichkeit ermöglicht. Das Ganze hatte nur wenige Minuten gedauert.
Sie sagte sich, dass sie genug Material gesammelt hatte, und machte sich vom Acker.
SONNTAG
05
NEANDERTAL
CHRISTOPHURBANÜBERFLOGDEN Newsfeed von dpa und die jüngsten Beiträge auf Twitter. Er hatte wie jeden Sonntagnachmittag gut zwei Stunden lang mit der Chefredaktion von Deutschland-TV konferiert, die in München saß. Offenbar war in dieser Zeit nichts Weltbewegendes geschehen.
Wenn man mal vom Krieg absah.
Die russische Armee eroberte den letzten Winkel einer zerstörten Stadt im Osten der Ukraine. Deren Präsident Selenskyj rühmte die toten Helden, die den Ort bis zum letzten Blutstropfen verteidigt hatten. In Deutschland wiederum mutierten Pazifisten zu Schreibtischkriegern. Und wer das nicht tat, wurde als Lump und fünfte Kolonne Moskaus beschimpft.
Zu Recht, dachte Christoph.
Er hob den Blick vom Monitor und sah aus dem Fenster.
Da war er wieder.
Der Silberreiher.
Der große weiße Vogel stand regungslos am grasigen Ufer der Düssel. Letzte Woche hatte Christoph ihn zum ersten Mal entdeckt und zunächst für einen Storch gehalten. Doch Störche hatten schwarze Flügelenden und wirkten nicht so elegant.
Plötzlich schlug der Reiher mit den Flügeln, hob ab und schwebte mit größter Gelassenheit aus Christophs Blickfeld.
Es klopfte an der Tür. Patti, die eigentlich Patrycja hieß, trat ein, außerdem der neue Praktikant. Christoph zwinkerte Patti zu.
War ein schöner Tag gestern, dachte er. Sollten wir bald wiederholen.
»Der Studiogast wird jeden Moment eintreffen«, sagte sie.
»Kümmerst du dich um ihn?«, fragte er.
»Klar.« Sie verließ das Zimmer wieder.
Christoph wandte sich an den Praktikanten. Leif Naumann. Student der Geschichte und Politikwissenschaften in Köln. Vierundzwanzig Jahre, doch er wirkte älter.
Was am Vollbart lag. Sorgfältig getrimmt und über den Mundwinkeln gezwirbelt. Vermutlich ging der Junge regelmäßig zum Barbier.
Wie weit er die politischen Ansichten seines Vaters teilte, hatte Christoph noch nicht herausgefunden. Aber er wusste, dass die beiden sich sehr nahestanden.
Christoph fragte: »Leif ist ein Wikingername, stimmt’s?«
»Heißt so viel wie ›Erbe‹.«
»Dein Fazit nach einer Woche Praktikum?«
»Hab schon unglaublich viel gelernt!«
»Sechs Tage die Woche, nur samstags frei – das wird dir nicht zu viel?«
»Ach was. Ich kann’s immer noch nicht fassen, hier mitarbeiten zu können.«
»Du musst bei mir nicht schleimen.«
»Nein, ehrlich. Und ich kann’s auch noch immer nicht fassen, dass Deutschlands beste Politsendung in einer Scheune auf dem Land produziert wird.«
Christoph lachte. »Ich bin eben ein häuslicher Typ. Warum sollte ich umziehen? Oder ständig nach München pendeln? Hier bin ich mein eigener Herr. Wir sind ein eingespieltes Team, und ich habe alles an Equipment, was ich brauche.«
Der Programmchef des Senders sah das anders. Aber Christoph genügten drei fest installierte Kameras und ein Techniker, der die Bildregie übernahm. Zum Teufel mit Kamerafahrten, Studioband und protzigem Bühnenbild.
Die Quote war mehr als zufriedenstellend.
»Was willst du mal machen, wenn du mit dem Studium fertig bist?«
»Ein Volontariat. Am liebsten bei Deutschland-TV. Ich hab auch schon Verlagserfahrung. Mein letztes Praktikum war bei Talos.«
»Ach, in dem Laden habe ich deinen Vater kennengelernt.«
»Ich weiß. Ihr Buch verkauft sich noch immer ganz gut.«
»Hey, ich dachte, wir duzen uns.«
»Sorry.«
Ole Naumann könnte locker auch Leifs Opa sein, dachte Christoph. Der Alte war jetzt mindestens achtzig Jahre alt und hatte einst bei Talos sein Buch lektoriert.
Damals hatte Christoph wegen unbequemer Äußerungen seinen Job beim WDR verloren und wollte seine Sicht der Dinge darstellen. Verpackt mit allerlei Anekdoten aus der Welt der Fußballclubs und ihrer Stars.
Mittendrin geradeaus, so der Titel.
Ole hatte ihm dabei sehr geholfen.
Das Buch wurde ein Bestseller, weil Christoph als Moderator der Sportschau schon damals prominent gewesen war. Aber es hatte ihm die Rückkehr zu den Mainstreammedien endgültig versperrt. Jahrelang war ihm nur sein YouTube-Kanal geblieben.
»Ich hoffe, dein Vater übertreibt es nicht wieder«, sagte Christoph. »Die Holocaustleugnung ist ihm ja nicht so gut bekommen.«
Weil Ole es liebte zu provozieren und damit partout keine Ruhe gab, war er immer härter bestraft worden. Ein Jahr hatte er im Knast verbracht. Die äußerst rechte Szene verehrte ihn deshalb als Helden und Märtyrer.
Dabei hatte Ole einst am linken Rand des politischen Spektrums angefangen. Als Rechtsanwalt hatte er 1970 Andreas Baader verteidigt und mit ihm die RAF gegründet. Ein verrückter Lebenslauf.
Aus alter Verbundenheit mit Ole hatte Christoph sofort eingewilligt, den jungen Studenten einzustellen.
»Papa ist ruhiger geworden«, antwortete Leif. »Ein regelrechter Israelfreund.«
»Sieh an.«
»Und für sein Alter ist er superfit. Du solltest ihn mal in deine Sendung einladen. Er kann über Ausdauersport und vegane Ernährung genauso reden wie über die islamische Bedrohung. Oder über Russland.«
»Ach ja?«
»Was Putin in der Ukraine macht, ist im Grunde eine innerrussische Angelegenheit. Der Westen sollte seinen Wirtschaftskrieg beenden, damit Deutschland im kommenden Winter nicht hungern und frieren muss. Auf Deutschland-TV hört man das ständig.«
Was nicht heißt, dass es stimmt, dachte Christoph. »Nur du hast dich da noch nicht positioniert. Kommt noch, oder?«
Christoph überlegte, ob er darauf eingehen sollte. Er beschloss, dass es nicht nötig war.
Leif war nur der Praktikant.
Der sich manchmal etwas aufspielte.
Es klopfte wieder. Patti lugte ins Büro.
»Dombacher wartet im Wintergarten.«
Christoph machte sich auf den Weg.
06
DÜSSELDORF-STADTMITTE
ALEXANDRUPOPESCUSCHWITZTEIN der Fahrerkabine seines Radladers. Wegen des Staubs konnte er kein Fenster öffnen. Und ausgerechnet jetzt war die Klimaanlage im großen Cat ausgefallen. Die Sonne brannte durch die Rundumverglasung. Der kleine batteriebetriebene Plastikpropeller, den Alexandru am Morgen auf die Bedienkonsole geklebt hatte, linderte die Saunatemperaturen nicht. Seine Beschwerden stießen auf taube Ohren.
Gestern hatte er noch öfter Pausen einlegen können. Am Nachmittag hatte nur ein Securitymann Dienst geschoben. Er drückte beide Augen zu und gesellte sich zum Rauchen zu den Arbeitern. Alexandru hatte gehofft, das wäre auch am Sonntag so. Doch heute waren die Uniformierten wieder zu zweit angetreten, und der Wortführer spielte sich auf wie ein Sklaventreiber.
Im Minutentakt, so schien es Alexandru, rollten die Muldenkipper herein und wollten befüllt werden. Vom Kaufhaus waren nur noch ein paar Reste der Außenmauer übrig. Ein letzter Bagger machte sich an ihnen zu schaffen. Der Kollege, der den Kran mit der Birne bedient hatte, arbeitete nun auch auf einem Cat.
Etwas Großes würde auf dem Gelände entstehen, hatte Alexandru gehört. Ein neues Wahrzeichen dieser Stadt. Alexandrus Chef hatte ihm angeboten zu bleiben, weil die Firma einen Folgeauftrag erhalten hatte.
Mal sehen, dachte Alexandru. So heiß und staubig würde es dann vielleicht nicht mehr zugehen. Und wenn schon, er war hart im Nehmen. Den Lohn konnte er auf jeden Fall gebrauchen.
Zu Hause in Rumänien war das Leben teuer geworden. Die Mutter brauchte Medizin. Die älteste Tochter ging auf eine teure Schule. Aus Florentina sollte mal etwas werden. Nicht bloß Näherin oder Putzfrau in Italien, wie es das häufige Schicksal der Frauen seiner Generation war, zumindest im Heimatdorf.
Alexandru nahm das Handtuch von der Armlehne und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Er trank einen Schluck aus der Wasserflasche. Pisswarme Plörre, von Kohlensäure keine Spur mehr. Dann ging es weiter.
Ein paar schwarze Müllbeutel, die in dieser Ecke der Baustelle zwischen den Mauerbrocken lagen, waren ihm schon am Morgen aufgefallen. Jemand hatte seinen Abfall hier entsorgt.
Die Nachtschicht der Security hatte nicht aufgepasst. Nicht mein Problem, dachte Alexandru. Das Zeug landete so oder so auf der Deponie.
Und jetzt lag hier wieder so eine Tüte.
Statt mit dem Schutt auf der Kippmulde zu landen, blieb sie an einem Zahn der Schaufel hängen. Alexandru versuchte, sie mit einer Schleuderbewegung loszuwerden.
Die Plastikhaut riss.
Der Inhalt plumpste vor dem Laster in den Staub.
Alexandru traute seinen Augen nicht.
Er schaltete den Motor aus und hielt einen Moment lang den Atem an. Dann öffnete er die Tür und kletterte mit weichen Knien aus der Kabine.
Prompt wurde der Sklaventreiber auf ihn aufmerksam und eilte herbei.
»Hey, was ist los?«
»Schau selber!«
Alexandru kämpfte gegen den Reflex an, seine Brotzeit hochzuwürgen.
»Verdammte Scheiße«, entfuhr es dem Securitymann. Dann schlug er mit der flachen Hand gegen das Außenblech des Cat. »Weitermachen!«
»Im Ernst?«
Der Zeigefinger des Uniformierten beschrieb einen weiten Kreis. »Das alles muss heute noch auf die Deponie. Zahlst du die Kosten, wenn sich das verzögert? Los, dalli, hörst du?«
Im gleichen Moment fuhr bereits der nächste Muldenkipper auf die Baustelle.
»Geht das in deinen bulgarischen Dickschädel, oder muss ich den Leuten von deiner Firma sagen, dass sie einen anderen schicken sollen?«
»Rumänischer Dickschädel«, korrigierte Alexandru.
»Was meinst du, wie mein Chef tobt, wenn es nicht sofort weitergeht?«
Alexandru registrierte, dass der Fahrer des ersten Lastwagens ebenfalls ausgestiegen war und mit bleichem Gesicht in sein Handy sprach. Er gab den Ort der Baustelle durch.
Alexandru verstand und war erleichtert.
Die Polizei würde in wenigen Minuten eintreffen.
07
NEANDERTAL
CHRISTOPHREICHTEPEERDOMBACHER die Hand. Der Mann, den viele seiner Anhänger nach wie vor den General nannten, trug einen nachtblauen Businessanzug, weißes Hemd, gestreifte Krawatte. Es wirkte wie eine Verkleidung.
»Herr Urban«, sagte Dombacher.
»Mon général«, antwortete Christoph.
Der Händedruck seines Gastes war längst nicht so übertrieben fest, wie er befürchtet hatte. Der ehemalige Chef der Westkreuz-Miliz war im Mai sechzig Jahre alt geworden. Weißes Haar, streng gescheitelt. Die buschigen Augenbrauen waren dunkel, was einen auffälligen Kontrast ergab.
»Hübsch haben Sie’s hier«, lobte Dombacher. »Hätte nie gedacht, dass Deutschlands polarisierendste Fernsehsendung in dieser Idylle produziert wird.«
»Das sagt jeder.«
Sie setzten sich zum Vorgespräch an den kleinen runden Tisch auf der Terrasse. Kaffee und Kuchen standen bereit. Der Blick ging auch hier auf die Düssel. Die Schatten waren länger geworden, der Silberreiher nicht mehr zu sehen.
»Schönen Gruß übrigens von unserem gemeinsamen Freund Ole«, sagte sein Gast.
»Ach, Sie kennen sich?«
»Er ist mehr als ein Kamerad. Er ist ein Bruder. Bei Westkreuz hat er die weltanschauliche Schulung verantwortet. Ich helfe ihm ab und zu, wenn es darum geht, Freunden den Rücken freizuhalten.«
Dombachers Blick verunsicherte Christoph für einen Moment.
»Ich bin ein großer Fan Ihrer Show, Herr Urban. Natürlich komme ich nicht immer dazu, mir sie anzusehen. Aber wie Sie neulich die Vorsitzende der Grünen auseinandergenommen haben, das war großes Kino. Kein Wunder, dass sich die Vertreter der Systemparteien nur selten in Ihr Studio trauen.«
Christoph lächelte. »Glauben Sie aber nicht, dass ich Sie mit Samthandschuhen anfassen werde.«
»Na, na, na!« Der General lachte. »Muss ich mich jetzt fürchten?«
»Mein Job besteht darin, auch unbequeme Fragen zu stellen. Dann liegt es vor allem an meinem Gast, wie er rüberkommt.«
»Also bin ich unbesorgt. Ich bin ein Mann des Volkes. Genau wie Sie.«
»Aber für den Bundesinnenminister galten Sie vor einiger Zeit noch als Staatsfeind Nummer eins.«
»Mir ging es stets nur um den Schutz der Verfassung.«
»Der war gut.«
»Nein, ich meine es ernst. Und das wissen Sie. Westkreuz wurde geschaffen, um die Freiheit der Rede und der Versammlung zu schützen. Der Staat ist dazu bekanntlich immer weniger bereit.«
»Manche behaupten, Sie hätten Neonazis für den Bürgerkrieg trainiert. Für die sogenannte nationale Revolution.«
»Ich habe die Jungs von der Straße geholt. Hab sie auf die richtige Spur gesetzt. Ordentliches Benehmen, keine Drogen. Wir haben Veranstaltungen von Demokraten gegen die Schläger der Antifa geschützt. Die Linken sind die Verfassungsfeinde, nicht wir. Wenn Sie mögen, erzähle ich Ihnen ein paar Geschichten darüber, wozu diese Chaoten fähig sind.«
Christoph schenkte Kaffee nach. Er war mit Dombachers Karriere vertraut. Sie hatte im Bundesamt für Verfassungsschutz begonnen. Dort musste er seinen Hut nehmen, nachdem bekannt wurde, dass er die NSU-Akten vernichtet hatte. Später gründete er Westkreuz, doch die Miliz lockte zu viele Idioten an, und die Sache lief aus dem Ruder.
Nach dem Verbot floh Dombacher ins Ausland, um seiner Verhaftung zu entgehen. Doch ernsthaft hatte man nie nach ihm gefahndet. Inzwischen war alles, was man ihm vorwarf, verjährt und der General wieder da.
»Ich vermisse Ihre Uniform«, sagte Christoph. Bei der Vorbereitung auf die Sendung hatte er den Weißhaarigen auf allen Bildern nur in Flecktarn und mit Barett gesehen.
»Wie Sie wissen, gehöre ich inzwischen dem Vorstand vonOsterkamp Firm & Secure an, Europas größtem Wachschutzunternehmen.«
»Ja, wir haben sozusagen den gleichen Boss.«
Hartmut Osterkamp hatte seine Milliarden mit Immobiliengeschäften gescheffelt und sein Portfolio stetig erweitert. Vor einem Jahr hatte er Deutschland-TV übernommen, die Redaktion umgekrempelt und Urban direkt einen Sendeplatz zur besten Uhrzeit verschafft.
Christoph hatte Osterkamp also einen gewaltigen Sprung nach vorn zu verdanken. Vom YouTuber zum Star von dessen Sender. Mehr Reichweite, Prominenz, Einkommen. Sofort nach Vertragsabschluss hatte sich Christoph einen lang gehegten Traum erfüllt, den ehemaligen Stall restauriert und Pool sowie Sauna einbauen lassen.
Dombacher einzuladen war die Idee des Programmdirektors gewesen. Vielleicht steckte auch Osterkamp selbst dahinter, überlegte Christoph jetzt.
Sein Gast hob den Finger. »Ich soll Ihnen übrigens ausrichten, dass Sie mich unbedingt fragen müssen, was ich von Public-private-Partnership im Sicherheitssektor halte.«
»Public was?«
»Sie wissen schon. Privatwirtschaftlich gebaute und betriebene Justizvollzugsanstalten. Wir nehmen dem Staat die Last teurer Investitionen ab, und obendrein betreiben wir die Dinger auch viel kostengünstiger, sobald man uns den Auftrag dazu erteilt.«
»Sie meinen Osterkamp Firm & Secure?«
»Wir stehen in den Startlöchern und scharren mit den Hufen. Das Gefängniswesen ist ein potenzieller Geschäftsbereich mit unglaublichen Renditechancen. Ich sage nur: win-win.«
Christoph konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. »Und das Wachpersonal stellen die Neonazis Ihrer einstigen Miliz?«
»Schon wieder dieses hässliche Wort. Wie gesagt, ich setze die Jungs auf die richtige Spur. Solide Jobs, Herr Urban. Security ist eine wichtige Branche in Zeiten wie diesen. In einer Welt, die zunehmend ihre Werte verliert. Die Antifa habe ich schon erwähnt. Oder Millionen von Muslim-Migranten. Das heißt Klankriminalität, religiöser Wahn und sexuelle Gewalt. Unsere Frauen trauen sich schon nicht mehr auf die Straße.«
Dombacher kam in Fahrt, und Christoph freute sich bereits auf die Sendung.
»Schuld sind natürlich die liberalen Globalisierer, deren Politik das Volk in den Abgrund treibt. Ohne Sicherheit kein freies, starkes Deutschland. Ohne Gegenwehr stürzen wir ins Bodenlose.«
Es klang wie auswendig gelernt.
Der Mann hat sich coachen lassen, dachte Christoph.
»Predigt das nicht auch die AfD?«, fragte er.
»Vergessen Sie die AfD! Wie haben wir die jemals ernst nehmen können? Eitle Spalter und Selbstdarsteller, die ihren eigenen Laden zerstören. Was davon noch übrig ist, fasst niemand mit der Kneifzange an, außer vielleicht im Osten. Im Bund stehen sie uns inzwischen nur im Weg. Aber zum Glück reicht die neue Sammlungsbewegung bis weit ins bürgerliche Lager.«
»Die Partei, die noch keinen Namen hat?«
»Es wächst schneller, als die Etablierten ahnen. Deshalb bevorzuge ich den Begriff ›Bewegung‹. Da stecken kluge Leute dahinter. Die Ergebnisse der jüngsten Meinungsumfragen kennen Sie sicher.«
»Ich vertraue nur Statistiken, die ich selber fälsche.«
Der General verzog keine Miene. »Osterkamp hat sie in Auftrag gegeben. Ich maile Ihnen die Zahlen morgen früh. Die Entwicklung macht Mut. Sie sollten sich mit der neuen Bewegung mal näher befassen.«
»Wie stehen Sie zum Ukrainekrieg?«
Dombacher lachte. »Von mir aus kann Putin bis Berlin vorstoßen und endlich dort aufräumen. Dann wäre Schluss mit dem Genderwahn und der ständigen Rücksichtnahme auf jede sexuelle Entartung. Insgeheim sehen Sie das doch genauso, oder?«
Schon der Zweite an diesem Tag, der meine Haltung zu Russland abklopfen will.
»Das wird aber nicht unser Thema sein«, wich Christoph aus.
»Bin auch eher wegen der Privatisierung der Gefängnisse gekommen.«
Christoph blickte auf die Uhr und stand auf. »Ich glaube, wir werden uns gut verstehen, mon général. Jetzt ist Zeit für die Maske.«
Sie gingen hinüber zur Scheune, in der sich das Studio befand. Noch eine halbe Stunde bis zum Beginn der Liveübertragung, die seine Zuschauer begeistern und die Kritiker mal wieder auf die Palme bringen würde. Dessen war sich Christoph sicher.
Er liebte schillernde Figuren.
Er liebte den Krawall.
Und er liebte es, den ach so korrekten Mainstream zu provozieren.
08
BERLIN-CHARLOTTENBURG
HERRLICH, EINWOCHENENDEINBERLIN.
Bummeln und Shoppen abseits der Konzernfilialen. Off-Theater, Jazzkonzert, ein Straßenfest in Kreuzberg. Und nicht über die Arbeit reden – ihre Abmachung hatten sie eingehalten.
Eine viel zu kurze Auszeit, aber sie tat Vincent gut. Eine Erinnerung daran, dass Fluchten möglich waren.
Morgen würden Melia und er nach Düsseldorf zurückfahren.
Aber der letzte Abend wird gefeiert.
Während Vincent sich im Bad frisch machte, hörte er, wie nebenan Melias Handy klingelte und sie sich meldete.
Für seine Freundin war es nicht bloß ein touristischer Trip. Gestern hatten sie sich mit ihrem Vater Andreas Götz getroffen, bis vor drei Jahren Fraktionsvorsitzender der Unionsparteien im Deutschen Bundestag.
Vincent hatte ihn bislang nur aus dem Fernsehen gekannt. Er war angenehm überrascht gewesen, wie unkompliziert und sympathisch der Mann aus der Nähe wirkte. Ein regelrechter Menschenfänger, obendrein sehr unterhaltsam. Sie redeten nicht über politische Themen und verstanden sich gut.
Es irritierte Vincent nur, dass Götz seine Tochter stets Amelie nannte. Als klinge ihm Melia zu exotisch. Nicht im Einklang mit dem, was seine Parteifreunde unter Leitkultur verstanden.
Aber vielleicht interpretiere ich das falsch, dachte Vincent, und weil es Melia nicht zu stören schien, sprach er ihren Vater nicht darauf an.
Götz hatte Lina mitgebracht, seine jüngste Tochter. Eine lebhafte junge Frau, die gerade erst volljährig geworden war. Sie und Melia unterhielten sich interessiert, was Vincent erfreut registrierte – die erste Begegnung der beiden Halbschwestern hätte auch kühler ausfallen können.
Vincent wusste, dass Melia den Kontakt zu ihrem Vater erst in den letzten Jahren wieder aufgenommen hatte. Er hatte seine somalische Freundin Zeinab Adan und die gemeinsame Tochter verlassen, als Melia noch ein Kind gewesen war. Jahrelang wurden Zeinab und Melia in keinem Lebenslauf des aufstrebenden CDU-Politikers erwähnt.
Melia war weitgehend ohne Vater aufgewachsen.
Vincent konnte nachfühlen, wie das war. Er kannte seinen Vater nicht mal. Bis heute blockte seine Mutter ab, wenn er sie darauf ansprach.
Er spülte den Rasierschaum ab und trocknete sein Gesicht mit dem Hotelhandtuch.
Sein Handy gab einen Ton von sich.
Eine Nachricht von Anna Winkler. Die Kollegin hatte diese Woche Mordbereitschaft. Mist, dachte Vincent, als er ihre Zeilen las.
Sie versetzten ihn unwillkürlich in den Dienstmodus.
Der Job ließ ihn auch hier nicht los.
Leichenteil auf Baustelle der neuen Oper. Melde mich, sobald ich mehr weiß.
Die Badezimmertür ging auf, und Melia stand vor ihm. Sie hielt ebenfalls ihr Handy in der Hand.
»Ein Anruf«, bemerkte er. »Dein Papa?«
»Scheiße, ja.«
»Wieso? Was ist los?«
Mit der freien Hand fuhr sie sich durchs Haar. Sie hatte sich bereits zum Ausgehen zurechtgemacht.
Eine gerade geschnittene schwarze Hose, dazu eine farbenfrohe Seidenbluse, die ihr hervorragend stand.
Sie sagte: »Ich fürchte, wir müssen unseren Restaurantbesuch verschieben.«
»Wie bitte? Es ist unser letzter Abend!«
»Es ärgert mich ja selbst, aber …«
»Wir gehen so selten miteinander aus!«
In Düsseldorf trafen sie sich meist bei ihm oder ihr zu Hause. Sie wollten nicht beim Händchenhalten von Kollegen überrascht werden.
»Die Kanzlerin hat Andreas um ein Treffen gebeten und …«
»Ich dachte, er ist nicht mehr im politischen Geschäft.«
»… und ich soll mitkommen.«
»Wieso das denn?«
»Keine Ahnung. Vielleicht irgendetwas strafrechtlich Relevantes, und er meint, ich könnte ihn beraten. Frings-Fassbinder vertraut ihm. Andreas ist für viele Leute immer noch so etwas wie die graue Eminenz seiner Partei.«
Vincent sah ein, dass er Melia nicht zurückhalten konnte.
»Respekt«, sagte er. »Meine Freundin trifft die Bundeskanzlerin.«
»Ruf im Restaurant an, mein Schatz, und sag Bescheid, dass wir ’ne Stunde später kommen. Viel länger wird es nicht dauern.«
Vincent bezweifelte das. Jedenfalls hatte er sich den letzten Abend in Berlin anders vorgestellt.
Sie drückte ihm einen Kuss auf die Lippen, griff nach ihrer Jacke und verließ das Zimmer. Vincent atmete tief durch.
Er las noch einmal die Nachricht seiner Stellvertreterin. Auf dem Gelände hatte bis vor Kurzem noch der Kaufhof gestanden. Dass die Stadtverwaltung hier die neue Oper errichten lassen würde, war noch nicht endgültig entschieden. Aber führende Lokalpolitiker schwärmten bereits von den Plänen eines angesehenen Investors.
Mit dem Fund eines Leichenteils stand das Projekt schon mal unter einem schlechten Stern.
Inzwischen hatte Anna ihm auch Fotos geschickt.
Es handelte sich um einen Fuß.
Genauer gesagt, um die untere Hälfte eines nackten Beins. Die Wade stark behaart. Auf Höhe des Knies vom Rest des Körpers abgetrennt. Knochen, Sehnen, rohes Fleisch.
Ein Chirurg war hier nicht am Werk gewesen.
Der Mann, dem der Fuß gehört hatte, war mit Sicherheit tot.
Und nicht freiwillig aus dem Leben geschieden.
Zu Vincents Verdruss lag der Tatort rund fünfhundert Kilometer von Berlin entfernt.
Er befand sich in der falschen Stadt.
09
BERLIN-CHARLOTTENBURG/MITTE
MELIAMUSSTENICHTLANGE vor dem Hotel warten. Ein Taxi fuhr vor, mit ihrem Vater auf dem Rücksitz. Sie stieg zu ihm ein.
»Kanzleramt«, sagte er zum Fahrer.
Der Wagen setzte sich leise in Bewegung. Hinter dem Steuer saß ein älterer Südländer mit grauem Schnurrbart. Am Rückspiegel baumelte eine Gebetskette aus Holzperlen. Er verzog keine Miene, als sei es sein tägliches Geschäft, das politische Herz der Republik anzusteuern.
»Ich bin froh, dass du mitkommst, Amelie«, sagte Andreas Götz. »Hoffentlich ist Vincent nicht allzu sauer.«
»Es wird nicht lange dauern, oder?«
»Bei Ute weiß man das nie.«
Melia rekapitulierte, was sie über die Kanzlerin wusste. Ute Frings-Fassbinder kam wie sie aus Düsseldorf. War bis vor zwei Jahren in der Landespolitik aktiv gewesen und hatte sich, nachdem ihre Vorgängerin zurückgetreten war, bei der Abstimmung um den Posten der Parteichefin gegen zwei männliche Bewerber durchgesetzt.
Das hatte sie unter anderem auch deswegen geschafft, weil Andreas ihr großer Fürsprecher gewesen war.
Kurz darauf trat sie als Spitzenkandidatin der Union zur Bundestagswahl an und gewann, wenn auch denkbar knapp.
Wenn die Kanzlerin sich an einen Politpensionär statt an ihren Beraterstab wendet, muss sie vor einem ungewöhnlichen Problem stehen, dachte Melia.
»Hast du wirklich keine Ahnung, worum es geht?«, fragte sie ihren Vater.
»Das wollte mir Ute am Telefon nicht verraten.«
»Und was soll meine Rolle sein?«
»Das erzählt sie dir sicher gleich selbst.«
»Wow«, sagte Melia.
Ein junger Mitarbeiter des Kanzleramts führte sie zum Aufzug. In Sekundenschnelle ging es in den siebten Stock. Dort gelangten sie auf eine Galerie, die das Foyer überragte. Melia fiel die Stille im Haus auf, die dem Sonntag und der späten Stunde geschuldet war.
Neben einer Glastür gab es ein Kästchen mit Tastenfeld. Der Anzugträger deckte es ab, während er den Code eingab.
Über der Tür am Ende des Flurs hing eine Überwachungskamera. Es war bereits die dritte, die Melia auf dem Weg durch das Haus bemerkt hatte.
Der junge Mann klopfte.
»Herein!«
Andreas nickte Melia zu.
Sie betraten ein riesiges Büro. Zuerst fielen Melia zwei große Fahnen ins Auge – Deutschland und EU – sowie ein übergroßer Schreibtisch, leergeräumt bis auf einen Globus und zwei Telefone. Von der Wand blickte ihr Konrad Adenauer entgegen, mit groben Strichen in hellen Farben gemalt.
Die Bundeskanzlerin schritt ihnen mit ausgestreckter Hand entgegen. Sie war kleiner, als Melia erwartet hatte, doch ihre Ausstrahlung schlug sie sofort in ihren Bann. Diese Frau war ein Energiebündel, ein Alphatier.
»Schön, dich zu sehen, Andreas. Und ich freue mich, dass Sie es ebenfalls einrichten konnten, Frau Adan.«
Sie hat sich meinen Namen gemerkt. Wow.
»Frau Bundeskanzlerin.«
Händeschütteln. Melia registrierte die Aussicht auf das Reichstagsgebäude und den Tiergarten. Hinter rötlich glühenden Wolken stand die Sonne tief.