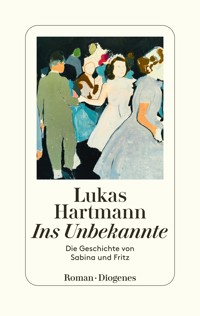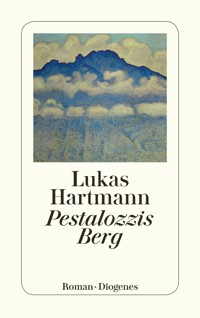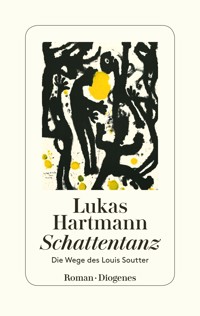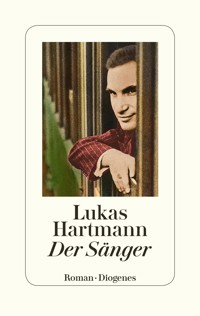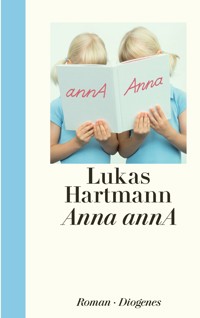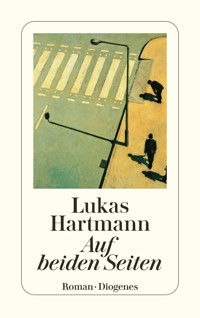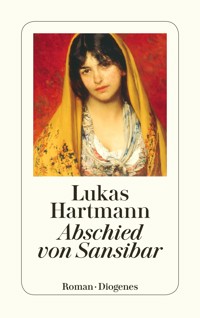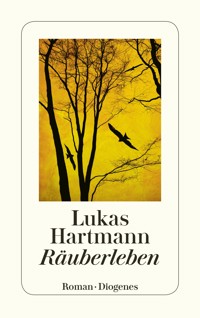13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Wer wünschte sich nicht, endlich gut in der Schule zu sein? Zu wissen, wie die Hauptstadt von Madagaskar heißt, wie viel Kilo ein Flusspferd auf die Waage bringt und wie viel Gramm ein Regenwurm. Ein bisschen merkwürdig ist es allerdings schon, dass der schüchterne Tobi plötzlich alle Antworten kennt, seit er eine Zahnspange trägt. Die Mitschüler, erst baff vor Bewunderung, werden misstrauisch, und auch Tobi ist das Ganze allmählich unheimlich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Lukas Hartmann
Die magische Zahnspange
Mit Illustrationen von Julia Dürr
Diogenes
{5}Für meinen Enkel Robin,
der schon bald keine Zahnspange mehr braucht
{11}in welchem Tobi für seine Zahnkorrektur eine Sonderanfertigung bekommt
Ich heiße Tobi, bin vor einem Monat zwölf geworden. Jetzt habe ich das Ding wieder im Mund, die zweite Nacht schon. Es drückt, obwohl meine Schwester Aga sagt, nach drei Tagen Angewöhnung spürt man die Spange kaum noch. Aga ist vierzehn und hat ihre Zähne bereits korrigiert. Ich glaube ihr nur halb, meine Zunge wird das fremde Ding im Mund noch lange ertasten. Abgesehen davon will ich nicht wie Aga mit einem Dauergrinsen herumlaufen, bloß weil die oberen Zähne jetzt schön in der Reihe stehen. Die Spange ist eine Sonderanfertigung, das hat mir Doktor Letrou gesagt. Aber was da jetzt in meinem Mund geschieht, ist doch ziemlich unheimlich.
{12}Und so fing alles an: Unser Familienzahnarzt, Doktor Wagner, war sehr unzufrieden, als er vor drei Monaten mein Gebiss begutachtete. Ich war viel zu lange nicht mehr bei ihm gewesen. Seit dem letzten Termin waren ein paar Milchzähne ausgefallen und die neuen nachgewachsen. Die neuen Zähne standen zum Teil schief, mein Oberkiefer, sagte Doktor Wagner, stehe vor, das sei ein sogenannter Überbiss, kurz und gut, er schicke mich jetzt zum Kieferorthopäden und der müsse mir eine Spange anpassen. KIE-FER-ORTHO-PÄ-DE. Das war ein schwieriges Wort, es klang unangenehm, und alles Unangenehme vergesse ich entweder sofort, oder es beißt sich in mir fest. Was das bedeutete, wusste ich ja eigentlich von Aga, die hatte bis vor einem halben Jahr einen Gartenhag im Mund, so nennen wir das, farbige Plättchen, von einem Draht zusammengehalten, das sah ziemlich idiotisch aus, aber sie war stolz darauf.
Kleinere Kinder würden den Zahnspangenspezialisten Kifi nennen, sagte Doktor Wagner, aber ich sei ja nicht mehr so klein. Er hielt mir einen Spiegel vor die Nase, und ich fand es überhaupt nicht schlimm, wie meine Zähne aussahen. Wenigstens hatte mich noch nie jemand Ratte oder Biber genannt. Bei einer in meiner Klasse sah das viel doofer aus, sie hat nun auch eine Spange.
{13}»Ist das wirklich nötig?«, fragte ich.
»Unbedingt«, erwiderte Doktor Wagner, »sonst wirst du später unter der Fehlstellung leiden. Irgendwann«, dazu zwinkerte er, »willst du doch bestimmt auch den Mädchen gefallen.«
Das geht den überhaupt nichts an, dachte ich, schwieg aber, weil er jetzt begann, mit einem spitzen Instrument in meinem Mund herumzustochern und nach Löchern zu suchen. Er werde mir jetzt, sagte er am Schluss, einen Termin beim Kieferorthopäden Doktor Letrou besorgen, der sei erst seit kurzem in unserer Stadt, aber ein Könner auf seinem Gebiet.
Aga hatte es mit einer Frau zu tun gehabt, also einer Kieferorthopädin. Letrou, dachte ich, das ist gerade der richtige Name für einen Zahnarzt, denn er bedeutet auf Französisch »das Loch«. Auch ein Kieferorthopäde war ja eigentlich ein Zahnarzt. Bohrer, fand ich, wäre als Name noch besser, ich lachte ein wenig in mich hinein und täuschte einen Hustenanfall vor, als Doktor Wagner mich fragte, was mich so amüsiere.
Er fragte aber nicht weiter, sondern erzählte einen Witz: »Kommt ein Skelett zum Zahnarzt. Und der sagt: Ihre Zähne sind gut, mein Herr, aber Ihr Zahnfleisch macht mir Sorgen.« Nun lachte ich laut. Natürlich kannte ich den Witz, er hatte ihn {14}schon Aga erzählt, als sie bei ihm war, und sie erzählte ihn dann zu Hause bei uns.
Eine Woche später hatte ich den ersten Termin bei Doktor Letrou. Meine Mutter nahm sich dafür frei, ich wäre auch allein hingegangen. Die vorstehenden Zähne habe ich von ihr geerbt. Als sie in meinem Alter war, sagte sie, habe man noch nicht sozusagen jedem Kind eine Zahnspange verpasst. Sie trinkt viel Kaffee und Schwarztee, deshalb sind ihre Schneidezähne ziemlich gelb. Das sieht nicht sehr hübsch aus, aber meinen Vater scheint das nicht gestört zu haben. Und für Zungenküsse, hat mir Michael, unser Klassenbester, gesagt, sei diese Zahnstellung eigentlich sehr geeignet, aber er konnte nicht erklären, weshalb genau.
Mama heißt Cornelia, sie ist Erziehungsberaterin, ausgerechnet, und gibt Kurse für Mütter mit schwierigen Kindern. Wir drei, also meine zwei Schwestern und ich, sagt sie, seien mittelschwierig, und sie könne sich ja notfalls selber einen Kurs geben. Außerdem kocht sie nicht besonders gut: Ihre Hamburger haben zu wenig Kruste, und sie ist sehr fürs Gesunde, was auch meinen Vater, Balthasar, abgekürzt Balz, ab und zu stört. Er isst sogar Krautstiel und Rote-Beete-Salat, wenn es sein muss, was ich selbst nie tue. Und sie predigt natürlich, wenn ich mehr Gemüse essen und weniger {15}Cola trinken würde, wären meine Zähne auch besser geraten.
Vater hingegen hat drei oder vier künstliche Zähne, man sieht sie gar nicht, und sonst ist er schwer in Ordnung, er ist Programmierer und hat seine eigene Software-Firma, die irgendwas mit Sicherheitssystemen für Banken zu tun hat. Was er genau macht, ist kompliziert, er hat es mir schon ein paarmal erklärt, aber ich verstehe es nur halb. Er hat seine Arbeitsräume in einem abgetrennten Bereich unseres Hauses, im Untergeschoss, dort dürfen wir nur hin, wenn er es ausdrücklich erlaubt. Meist ist der Eingang sowieso abgeschlossen, aus Sicherheitsgründen, wie er sagt. Man kann nur zu ihm hinunter, wenn man beim Eingang den richtigen Code eintippt, und der wechselt alle paar Tage. Oder wir melden uns über die Haussprechanlage bei ihm an, und er öffnet dann die Verbindungstür von innen.
Tagsüber, manchmal auch nachts, sitzt er an einem seiner vielen PCs oder Tablets oder Laptops, er stellt Berechnungen an, die keiner außer ihm versteht. Es kommt vor, dass ich Lust habe, etwas mit ihm zu besprechen, zum Beispiel etwas Technisches oder wie ich am besten auf die dummen Sprüche von Mitschülern reagieren kann. Sie spotten darüber, dass ich mit Viola aus der Klasse mehr rede als {16}mit anderen. Oder sie finden, meine Haare seien zu lang. Ich melde mich dann bei Pa an, wir sitzen einander an seinem großen Computertisch gegenüber, und er hört mir aufmerksam zu. Ganz anders als beim gemeinsamen Essen am Familientisch, wo er oft bloß schweigt und durch uns hindurchschaut, weil er, wie Aga sagt, total in Gedanken ist. Ich solle mich, hat Pa mir geraten, so verhalten, wie es für mich richtig sei, und über den Spott hinwegsehen, das habe er als Junge auch lernen müssen. So was tut mir gut. Oft kommt er gar nicht zum Essen, weil er zu viel zu tun hat, und vielleicht bin ich der Einzige, der ihn dann vermisst. Und wenn er nach Zigaretten riecht, stört mich das nicht, im Gegensatz zu Mama. Darum geht er nach dem Essen auf die Terrasse, um zu rauchen.
Wir nennen Mama übrigens seit langem Mum, weil ja fast alle zu ihrer Mutter Mama sagen und wir etwas wollen, was nur wir drei verwenden. Also besteht sie von jetzt an in dieser Geschichte auch aus drei Buchstaben. Der Nachname ist Schreyer, den mögen wir nicht besonders. Irgendwas Geheimnisvolles würde mir besser gefallen, zum Beispiel Fiorentini oder Samuelsson.
Aber jetzt muss ich wohl noch meine Schwestern vorstellen. Die ältere heißt, wie gesagt, Aga, eigentlich Agathe, sie ist vierzehn und will immer {17}das letzte Wort haben, die jüngere heißt Vre, das kommt von Veronika, und sie hat den Namen selbst abgekürzt. Sie ist neun und schnell beleidigt. Ich bin genau mittendrin, was manchmal nicht leicht ist.
Doktor Gaston Letrou hat seine Praxis in einem ziemlich alten Haus. Mum behauptet, das sei mal eine vornehme Villa gewesen.
Letrous Assistentin öffnet uns, eine von zwei. Sie heißt, kein Witz, Mathilda Böhnlein, sie hat einen blonden Pferdeschwanz, sie riecht nach Pfefferminz und kommt, das hört man gleich, aus Deutschland. Mum, die überall Rauch riecht, behauptete nachher, hinter dem Pfefferminzgeruch verstecke sich bei der Böhnlein auf Haut und Kleidern ein halbes Tabakfeld.
Die zweite Assistentin heißt Freja Pedersen, so steht es wenigstens auf ihrem Namensschildchen, sie ist viel kleiner als die Böhnlein, ein wenig mollig, und sie lispelt, was wohl an der Zahnstellung liegt.
Eigenartig für jemand in einer Zahnarztpraxis, meinte Mama.
Und dann erst der Doktor, der Kieferorthopäde, der Kifi, wie ihn kleinere Kinder nennen. Er ist groß, er hat einen grauweißen Vollbart und einen Haarkranz um den Kopf, der ihm über die Ohren {18}fällt, und wenn er lacht, wackelt der Zahnarztstuhl gleich mit.
Frau Pedersen führte mich fast feierlich zu ihm, während Mama am Empfangspult irgendwelche Formulare ausfüllte. Ich war gleich an der Reihe, der Doktor begrüßte mich mit starkem Händedruck und zog danach Plastikhandschuhe an, die ihm die Assistentin überreichte. Ich setzte mich auf den Behandlungsstuhl, aus dem ich beinahe hinausfiel, weil der Doktor ihn ganz schnell weit nach hinten kippte und dabei zum ersten Mal laut lachte. Sein Blick war aber stechend, und ich musste den Mund weit aufsperren, so weit, bis es richtig weh tat. Er schüttelte den Kopf: »Ein richtiges Durcheinander, junger Mann! Der Oberkiefer, der Oberkiefer!« Und wieder lachte er.
Er machte zuerst einen Abdruck. Die Assistentin rührte irgendein Pulver an, ließ es in einer komischen Apparatur zu einer rosaroten Masse werden, fast wie Plastilin, und dieses Zeug, das seltsam schmeckte, schob der Doktor in meine Mundhöhle und drückte es an die Zähne, und das tat dann doch ein wenig weh, aber nicht wie beim Bohren. Ich musste warten, bis es fest geworden war. In der Zeit ging er rasch hinaus, und Frau Pedersen versprach, es daure nicht lange, denn so mit offenem Mund dazusitzen, fand ich nicht lustig.
{19}Und vielleicht, sagte sie und schaute mich bedeutsam an, bekäme ich ja eine Sonderanfertigung. Ich versuchte zu fragen, was das sei, aber wer kann schon mit offenem Mund reden, und da kam Doktor Letrou zurück. Er roch nach etwas Seltsamem, das ich nicht kannte, er nahm den Abdruck heraus und zeigte ihn mir. Und an ihm sah ich meine komische Zahnstellung besser.
Zum Abschied drückte mir Doktor Letrou lange die Hand. Das war seltsam, ich hatte das Gefühl, dass von ihm her irgendwie Wärme in mich floss. Er schloss dazu die Augen, und die beiden Assistentinnen standen neben ihm wie Schutzwachen. Als er die Augen wieder öffnete, schaute er mich an, und das war nicht mehr stechend, sondern schon fast bohrend, und mir schien, es flögen Funken aus ihnen zu mir, aber das konnte ja nicht sein. Er versetzte mir, als ich tschüss gesagt hatte, einen kleinen Schubs, der aber doch so stark war, dass ich aus der Praxis ins Wartezimmer taumelte, wo meine Mutter auf einem Stuhl saß.
»Was ist denn mit dir?«, fragte sie besorgt.
Doktor Letrou, der hinter mir herkam, wollte noch einen Augenblick mit ihr allein sprechen. Er schloss die Tür, ich ging in den Vorraum zur Theke, hinter der die Assistentinnen standen. Sie lächelten beide, und Frau Pedersen schenkte mir einen {20}Kaugummi, der mich an den Geschmack der Abdruckmasse erinnerte.
Meine Mutter sah mich seltsam an, als sie zurückkam. Der Doktor zeigte sich nicht mehr. »Er hat versprochen«, sagte sie, »für dich beim Zahntechniker wirklich eine Sonderanfertigung in Auftrag zu geben.«
»Was heißt denn das?«, fragte ich besorgt.
»Das Allerneueste sei das, sagt er. Mit Chips wie in einem Computer oder Sensoren, die genau überwachen, dass immer genügend Druck auf die Zähne ausgeübt wird. Und sie geben Töne von sich, wenn du die Spange zu wenig lang im Mund behältst. Davon habe ich noch nie gehört. Aber es wird schon nützlich sein.« Sie lächelte. »Du seist ein besonderes Kind, hat er gesagt, ein schlaues und ideenreiches, und darum würdest du eben auch eine Sonderanfertigung verdienen.«
Wie wollte denn Doktor Letrou das gemerkt haben? Vielleicht bin ich ja wirklich schlau und ideenreich, aber ich hatte doch kaum etwas gesagt.
Die beiden Assistentinnen flöteten zweistimmig: »Ja, das bist du!« Und dazu lächelten sie so strahlend, dass ich rot wurde (was leider ab und zu passiert).
{21}in welchem die neue Zahnspange summt und blinkt und sehr viel weiß
Die Spange bekam ich schon nach zwei Wochen.
Ich saß wieder in Doktor Letrous Stuhl, er holte das Ding aus einer rosafarbenen Box, sie sah ganz normal aus wie die anderen, die ich schon gesehen hatte. Er zeigte mir, wie man sie einsetzt. Das war nicht schwierig, sie passte ja genau. Ich müsse sie, sagte er, mindestens zwölf Stunden pro Tag tragen. Es sei ja eigentlich eine Nachtspange. Die Nacht allein reiche aber nicht aus für eine richtige Korrektur, ich sollte sie auch beim Hausaufgabenmachen in den Mund schieben, beim Fernsehen und beim Spielen am Computer.
»Und noch etwas«, fügte er mit gesenkter {22}Stimme hinzu, so dass meine Mutter, die dieses Mal auch im Raum war, nichts verstand: »Pass gut auf, was in deinem Mund geschieht.«
Das brachte mich komplett durcheinander. Was sollte da in meinem Mund schon geschehen? War das eine Warnung? Doktor Letrou, dem seine Assistentinnen dauernd mit Nicken und Lächeln beipflichteten, kam mir immer geheimnisvoller vor. Zu Hause hatte ich ihn gegoogelt, auf seiner Homepage stand aber nichts Besonderes, bloß dass er sehr freundlich und rücksichtsvoll sei, und ein Alban (16) hatte geschrieben, Doktor Letrou sei ein Könner auf seinem Gebiet. In seinem Lebenslauf, den man anklicken konnte, stand, er habe in verschiedenen Großstädten praktiziert, in Berlin, in Kalkutta, in Rio de Janeiro.
Eine seltsame Mischung, fand mein Vater, als ich ihn danach fragte. Und nun habe es ihn in die friedliche Schweiz gezogen, denn er liebe die Berge. Er hatte sogar, das stand auch da, einen Wissenschaftspreis für Fortschritte in der Zahnmedizin bekommen.
Zu uns gelockt, sagte Pa, haben ihn bestimmt die höheren Honorare, die er in einem reichen Land bekommt. Dabei hatte er die erste Rechnung noch gar nicht gesehen.
Bei Frau Pedersen lernte ich, die Nachtspange {23}richtig einzusetzen, und sie brachte mir auch bei, wie man sie am gründlichsten mit einem Bürstchen putzt. »Das ist sehr wichtig, weil sich sonst Bakterienherde bilden«, sagte sie in einem Ton, dass es mich kalt überlief. Ich nahm mir vor, die Anweisungen genau zu befolgen.
Da hatte Doktor Letrou sich schon verabschiedet, er drückte mir wieder sehr lang die Hand: »Wende dich einfach an unsere Praxis, wenn dich irgendetwas unsicher macht oder stört.«
Ich nickte, und Mum sagte nachher, das sei doch ein äußerst netter Mann.
Zuerst machte mich nichts unsicher, außer dass mich der Druck auf Zähne und Zahnfleisch in der Nacht störte und ich schlecht einschlafen konnte.
Pa sprach mir gut zu, als ich darüber klagte. »In den reichen Ländern«, sagte er, »haben über die Hälfte der Kids Zahnspangen, dann hältst du das sicher auch aus.« Pa mag Zahlen und beweist vieles mit ihnen, das wissen wir schon lange. Aber dann hatte er doch Mitleid mit mir und wollte mir eine Schmerztablette geben, aber Vre stand gerade dabei, und darum sagte ich: »Nicht nötig, es geht schon.«
Wenn ich, mit der Spange im Mund, nur für mich selbst probehalber zu sprechen versuchte, klang es verwaschen und undeutlich, und bei den S lispelte {24}ich ganz schrecklich. Ich stellte mir vor, wie die Klasse mich auslachen würde, und schwor mir, dass ich die Spange in der Schule nie tragen würde. Du kannst auch üben, hatte Frau Pedersen gesagt, dann geht es mit der Zeit besser.
Aber manchmal summte es in meinem Mund, wie wenn da ein kleines Lebewesen drin sitzen würde, eine Hummel zum Beispiel. Oder ein Zwergmäuschen, denn aus dem Summen wurde manchmal ein Piepsen, das war doch komisch, fast ein wenig unheimlich.
Von der dritten Nacht an waren die Druckschmerzen zum Glück verschwunden. Und ich konnte mich auf all diese winzigen Geräusche besser konzentrieren. Da glaubte ich plötzlich eine Stimme zu vernehmen. Noch verstand ich gar nichts, aber mir schien doch, es sei die Stimme von Doktor Letrou. Und das war nun wirklich unheimlich. Die Stimme wurde ein wenig lauter, wenn ich den Mund schloss, und noch lauter, wenn ich die Lippen zusammenpresste.
»Hör zu« war das Erste, was ich eindeutig verstand. Und wieder: »Hör zu!« Und dann, als ich noch angestrengter horchte: »Ich kann dir bei vielem helfen.«
Das bilde ich mir alles ein, sagte ich mir und schlug mir links und rechts auf die Wange, nicht {25}sehr fest, aber doch wie bei einer Ohrfeige. Da verstummte die Stimme, setzte aber wenig später von neuem ein. Und eine feine Musik, wie von einer Spieldose, erklang dazu.
Was ist denn das?, dachte ich, oder vielleicht hatte ich halblaut gesprochen, denn ich glaubte eine Antwort zu hören, wieder mit Doktor Letrous Stimme: »Das wirst du bald herausfinden, Tobi.«
Meine Verblüffung konnte kaum größer sein. War dieser Letrou ein Zahnzauberer? War es überhaupt möglich, dass es so einen gab? Und wenn ja, was wollte er denn ausgerechnet von mir? Das Wort Sonderanfertigung bekam plötzlich eine neue und geheimnisvolle Bedeutung für mich.
Schlafen mit der Spange im Mund konnte ich dann doch. Aber am nächsten Morgen musste ich zur Schule. Ich nahm die Spange heraus, legte sie nach dem Reinigen in ihre Box zurück. Ich sah sie mir vorher genau an und tastete sie rundum ab. Nichts Besonderes, oder doch winzige Erhebungen hier und dort? Kleine Punkte, ganz leicht verfärbt? Aber meiner Erinnerung an die Nacht traute ich nicht. Hatte ich mir diese feine Stimme bloß eingebildet? Ich hätte ja den Doktor anrufen und fragen können. Aber ich wollte von ihm oder den beiden Assistentinnen nicht ausgelacht werden.
{26}»Das wirst du bald herausfinden, Tobi«, hatte ich in meinem Mund oder eher im Schädel gehört. Wirklich?
So schob ich die Spange in den Mund, als ich mich für die Hausaufgaben hinsetzte, das hatte mir ja die Böhnlein eingeschärft. Meine Mum will, dass wir unsere Pflichten nicht aufschieben. Ich muss ja auch immer alles Unangenehme erledigen, bevor ich zum Fußballspielen raus darf. So saß ich also an meinem Schreibtisch und sah mir das Aufgabenblatt an, das uns Frau Bodenheimer mitgegeben hatte. Manchmal schaute sie mich so merkwürdig an, dass mir ganz heiß wurde, und ich wusste gar nicht, warum. Es ging um Gewichte in Kilogramm und Gramm, wir mussten das Gewicht von Tieren schätzen, die auf dem Blatt abgebildet waren. Wer am besten abschneiden würde, hatte Frau Bodenheimer gesagt, werde einen Preis bekommen. Das macht sie oft so. Um uns anzuspornen, sagte sie. Meistens war der Preis etwas Gesundes, eine Frucht zum Beispiel. Aber so leicht war die Aufgabe gar nicht. Das erste Tier war ein Braunbär. Wie schwer konnte so einer sein? Ich presste die Lippen aufeinander und dachte nach. Hundertzehn Kilogramm wollte ich unter das Bild schreiben. Etwa so schwer wie mein dicker Onkel, der stolz auf seinen Bauch ist. Aber da war plötzlich wieder diese Stimme da, {27}irgendwo in meinem Kopf und jetzt sehr verständlich: »380 Kilogramm!«
Ich zögerte. Der Bär war wirklich groß und struppig. Der konnte mich, wenn ich an die echten Bären im Zoo dachte, mit einem einzigen Tatzenhieb umwerfen. Ich schrieb die Zahl hin, überlegte gar nicht mehr lange.
Das Nächste war ein Regenwurm. Sehr schwierig. Es gibt ja lange und kürzere. Und als ich kleiner war, hatte ich mir manchmal einen um den Finger gewickelt, und später hatte es mich gegraust. Zehn Gramm vielleicht?
»Schreib zwei Gramm«, befahl die Stimme.
Ich gehorchte, obwohl mir das viel zu leicht schien.
Königstiger 250 Kilo, sagte die Stimme, Nilpferd 1600 Kilo (das hatte ich krass unterschätzt), Storch bloß drei Kilo. Im Ganzen gingen wir, die Spange und ich, auf diese Weise fünfundzwanzig Tiere durch. Das ausgefüllte Blatt steckte ich in die Klarsichtmappe und die in die Schultasche.
Fürs Abendessen nahm ich die Spange natürlich heraus und kam mir gleich fast ein wenig einsam vor. Fürs Schlafen setzte ich sie wieder ein, und als Mum und später auch Pa fragten, wie es mir damit gehe, lispelte ich: »Es geht so.«
Am nächsten Morgen gab ich das Blatt ab. Bis {28}am Mittag hatte Frau Bodenheimer die Blätter durchgesehen. Und nach der Elf-Uhr-Pause trat sie vor die Klasse und zeigte uns das Blatt, das gewonnen hatte. Es war meines.
»Nicht zu fassen«, sagte Frau Bodenheimer. »Tobi hat alles richtig beantwortet, auf Kilogramm und Gramm genau.«
Ein Raunen ging durch die Bänke, die Köpfe drehten sich nach mir um.
Frau Bodenheimer schaute mich seltsam an. »Schummeln war ja nicht möglich, oder?«
Ich schüttelte heftig den Kopf.
»Oder hast du die halbe Nacht im Internet nachgeforscht?«
»Das darf ich doch gar nicht«, antwortete ich.
»Wieso hast du denn alles so genau gewusst?«
Ich zuckte die Achseln. »Ich lese halt eine Menge und behalte das meiste im Kopf.«
»Streber«, zischte jemand von hinten. Es war natürlich Helmut, der dauernd prahlt, er sei der Stärkste von uns.
»Der kann sich einfach ganz viel merken!«, sagte Viola, auch von hinten.
Ich drehte mich nach ihr um. »Danke!«
Sie lächelte mich an.
»Jetzt schweigt alle schön«, befahl Frau Bodenheimer, »und gönnt Tobi seinen Erfolg.«
{29}In der Pause umringten mich ein paar Jungen, auch Helmut war darunter. Frau Bodenheimer hatte mir zur Belohnung eine reife Birne geschenkt, die schmeckte wunderbar süß.
»Jetzt gib es doch zu«, schimpfte er und zeigte mir die Faust. »Du hast geschummelt. Du betrügst uns.«
»Nein!« Ich schüttelte den Kopf, hatte aber ziemlich Angst. »Ich hab’s einfach gewusst.«
»Man findet alles im Internet«, sagte Michael, der sonst immer der Klügste war. »Man muss es nur schlau genug anstellen.«
»Ich schwöre euch«, sagte ich und hob meine Schwurfinger. »Ich hatte alle Angaben im Kopf.« Und das war ja nicht einmal gelogen.
Danach ließen sie mich zum Glück in Ruhe.
{30}in welchem die Zahnspange zwar Fehler macht, aber beim Fußball Tobis Beine lenkt
Von jetzt an hatte ich den Ruf, ein Vielwisser zu sein. Aber der war ich nur, wenn ich zu Hause die Zahnspange gefragt hatte.
Ich war zum Beispiel der Einzige, der ein schwieriges Kreuzworträtsel zum Thema Geographie ohne Fehler löste. Es war eine freiwillige Aufgabe, und Frau Bodenheimer sagte, sie sei eigentlich für viel ältere Schüler bestimmt, aber das fordere einige von uns – dabei sah sie mich an und zwinkerte mir zu – bestimmt heraus. Dass die Hauptstadt von Madagaskar Antananarivo heißt, hätte ich nie im Leben herausgefunden, auch niemand aus der Familie hätte es gewusst. Und wieder dachten alle – bestimmt auch Frau Bodenheimer –, jemand habe mir {31}geholfen. Die Spange half mir auch bei den Durchschnittstemperaturen in verschiedenen Ländern und bei der größten Eisdicke von Gletschern in Grönland.
Wenn mir aber Frau Bodenheimer im Unterricht unerwartet eine Frage stellte, tappte ich im Dunkeln. Wir übten Kopfrechnen, und sie fragte, indem sie mich scharf anschaute: »Wie viel ist vierundzwanzig mal vierundzwanzig, Tobi?« Die Zahlen flatterten in meinem Kopf herum, ich kam zu keinem Resultat, begann zu stottern, einige lachten leise. Hinter mir flüsterte Viola etwas, das ich nicht verstand. Frau Bodenheimer winkte ab, und Viola gab die richtige Antwort: 576.
»Toll«, lobte Frau Bodenheimer. »Das ist ja gar nicht so leicht. In Geographie und Naturkunde bist du eindeutig besser als in Mathematik. Oder dann hilft dir jemand, der sehr viel weiß, bei den Hausaufgaben.« Wieder zwinkerte sie mir zu, und das fand ich doch ziemlich komisch.
Ich schüttelte den Kopf, aber jemand flüsterte »Lügner«. Und darum nahm ich mir vor, die Zahnspange auch in der Schule zu tragen, sie sollte mir nicht nur zu Hause helfen. Aber dafür musste ich zuerst deutlicher sprechen, wenn ich sie trug. So schob ich sie nun in der nächsten Zeit, kaum war ich zu Hause, in den Mund und las mir in meinem Zimmer selber aus unserem Schullesebuch vor. {32}Obwohl das stinklangweilig ist. Manche Texte las ich mindestens zehnmal. Ich lernte, die Zunge anders zu gebrauchen, damit das alles nicht so verwaschen klang. Es ging allmählich besser, nur das Lispeln konnte ich nicht ganz vermeiden.
Einmal klopfte Vre an die Tür, öffnete sie halb, obwohl wir das einander verboten hatten, und fragte: »Was redest du eigentlich die ganze Zeit für Zeug?«
»Lass mich doch«, schrie ich sie an und spuckte dabei fast die Zahnspange aus.