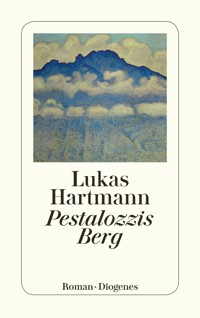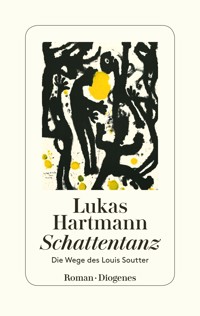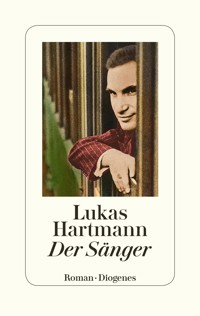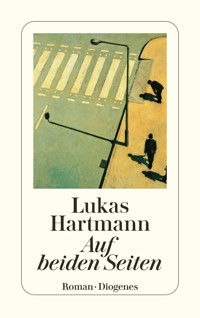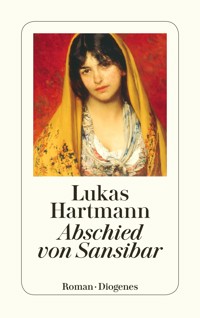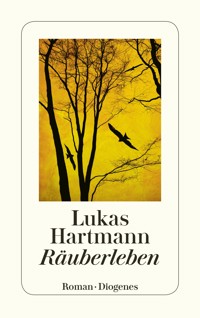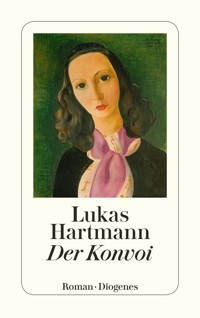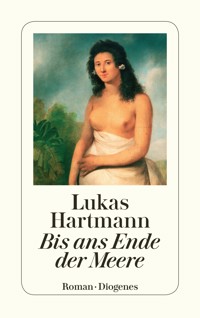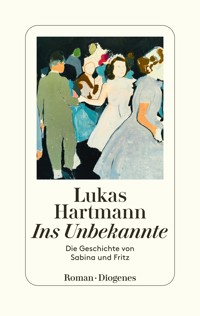
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sabina kommt aus Russland nach Zürich, um sich in der psychiatrischen Klinik von Dr. C.G. Jung behandeln zu lassen. Und wird seine Geliebte. Fritz, der Sohn eines Schreiners, träumt von einer besseren Gesellschaft, bringt die Schweiz an den Rand einer Revolution und rettet Lenin in Russland das Leben. Beide sind sie mutig, widersprüchlich, zerrissen, betreten unaufhörlich Neuland. Ihre Schicksale kreuzen, spiegeln sich – und verlieren sich im Dunkel der europäischen Geschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 334
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Lukas Hartmann
Ins Unbekannte
Die Geschichte von Sabina und Fritz
Roman
Diogenes
1Die Ankunft, Zürich, Psychiatrische Klinik Burghölzli, 1905
Wo war sie denn? Sie wusste es nicht genau. Die Eltern hatten Sabina zu dieser langen Reise genötigt, vor allem die überbesorgte Mutter, der Vater schwieg und wich Sabinas Blicken aus. Er hatte ein schlechtes Gewissen, und das geschah ihm recht. Sie war ja kein Kind mehr, sie war eine junge Frau. Man durfte sie nicht so brutal behandeln, nie hätte er sie, als sie jünger war, im Beisein der Brüder mit Rutenhieben auf den nackten Hintern bestrafen dürfen. Sie musste sich danach vor ihnen verbergen, sich irgendwo in ihr drin verkriechen, und wenn man sie herauslocken wollte, wehrte sie sich mit aller Kraft, sie schrie, schlug um sich, egal, ob eine Berührung sanft war oder grob. Man brachte sie schon in Rostow zu Ärzten, schob sie in weiß gestrichene Räume hinein, sie hörte die Mutter weinen, den Vater schwer atmen. Man legte sie auf eine Couch, es waren mehrere Hände an ihr, sie stieß sie weg, man band sie fest, Gesichter über ihr, die sie nicht kannte und verscheuchen wollte, sie lachte alle aus, mit Absicht schrill und theatralisch, und das galt als Krankheitssymptom, ausgerechnet bei ihr, die Ärztin werden wollte, sie hatte doch schon, zum Entsetzen der Mutter, kranke Puppen aufgeschnitten und wieder zusammengenäht. Dann wurde der Familie von Verwandten geraten wegzufahren, weit weg, dorthin, wo das medizinische Niveau höher war als in Russland, in eine Schweizer Klinik, in der man sich auch um das Seelische kümmere, sagte die Mutter, die ja selbst Zahnärztin war. Sabina sprach fließend Deutsch, aber der Ort, zu dem sie nun in der Mietkutsche fuhren, hieß Burghölzli, das Wort verstand sie nicht, und weil ihr der Klang so drollig erschien, fügte sie sich und ließ sich in das abweisend wirkende Gebäude hineinbegleiten.
»Ich werde nichts schlucken, nichts trinken«, sagte sie sehr laut, »und ich will keine Spritze.«
»Ach Gott«, seufzte die Mutter und fasste Sabina an der Hand, »man wird dich doch nicht quälen, mein Kind.«
Sabina schüttelte aber die Hand ab, rutschte ganz an den Rand des gepolsterten Sitzes, schloss die Augen und tat, als sei sie sogleich eingeschlafen. Da spürte sie wieder eine Hand auf ihrer Schulter, viel zu lastend, es war, sie wusste es, die des Vaters. Sie fuhr auf und schrie: »Lass mich!« Das Gewicht verschwand, es fiel von ihr ab wie etwas Totes, Schlaffes, sie lachte laut, hysterisch nannten sie es, das wusste sie. Sollte sie miauen wie eine zornige Katze? Sie tat es und hörte das langgezogene »Ach« der Mutter. Vom Vater hörte sie nichts.
Eine Tür wurde geöffnet, Sabina fühlte sich hinausgedrängt, eine stämmige Pflegerin in weißer Tracht mit weißer Haube gehörte nun auch zum Trupp, sie war kräftiger als Sabina und stieß sie vorwärts in einen Raum. Alles weiß, erbarmungslos weiß. Man nötigte die Patientin auf einen Stuhl mit harter Rückenlehne. Da war Leder hinter ihr, das mochte sie nicht, Leder stammte von Tieren.
»Ich will anderswo sitzen«, quengelte sie. »Versteht ihr, anderswo!«
Sie begann laut zu schluchzen; nun habe ich mein Repertoire durchgespielt, dachte sie. Oder doch nicht? Sie glitt vom Stuhl, warf sich auf den Boden. Der war härter als die Stuhllehne, aber sie achtete nicht darauf, lachte laut. Inzwischen waren zwei andere Pflegerinnen dazugekommen, gemeinsam versuchten sie, die Patientin zu bändigen. Sabina wehrte sich, sie hatte eine Kraft, die sie von sich gar nicht gekannt hatte. Man hob sie gemeinsam wieder auf den Stuhl, jemand versuchte, sie mit einem Riemen festzubinden, nun half sogar der Vater mit, und das war abscheulich. Sie wand sich, sie schrie.
»Wir tun Ihnen doch nichts«, verstand sie in mehreren Variationen.
Sie spielte ja Klavier, sie mochte Variationen und lachte wieder. Aber nun waren ihre Arme am Körper festgebunden.
»Doch, ihr tut mir weh«, jammerte sie und übertrieb den Schmerz.
»Hört auf«, sagte der Vater im Hintergrund, genau das hatte sie gewollt. Aber man hörte, wie gewöhnlich, nicht auf ihn. Er war nur in ihrer Kindheit ein Herrscher gewesen.
»Was macht ihr da?«, hörte sie plötzlich die sanfte Stimme eines Mannes.
Da war jemand lautlos eingetreten.
»Bindet sie los«, sagte der Mann.
Verlegene Stille, aber man gehorchte. Sabina atmete mit Vorsatz laut und keuchend; außerdem war sie nun wirklich erschöpft. Sie blinzelte ins Helle, der Mann, der vor ihr stand, schien ihr übergroß, auch er trug einen weißen Kittel. Ein Arzt offenbar, jung noch, mit solchen wie ihm hatte sie in letzter Zeit genug zu tun gehabt. Aber er hatte ein gütiges Gesicht, die Augen waren von unbestimmbarer Farbe. Hellblau? Eher gräulich. Die Verwandtschaft mit »greulich« brachte sie zum Lachen, so gut beherrschte sie die deutsche Sprache, in der Gymnasialklasse war sie deswegen bewundert worden. Er stutzte, lächelte, das sah sie wohl, ein hübscher Mann, ungewöhnlich würdig für sein Alter.
»Wie ist die Farbe Ihrer Augen?«, fragte sie, was seine Erheiterung zu steigern schien.
»Warum interessiert Sie das?«, fragte er zurück und kniff nun seine Augen zusammen.
»Einfach so«, sagte sie.
»Sie werden es bestimmt herausfinden«, gab er zurück, eher scherzhaft als ernst. »Ich bin übrigens Ihr Arzt, Ihnen zugeteilt. Mein Name ist Jung, Doktor Jung.«
Das reizte sie zu einem weiteren Lachanfall. »Eben habe ich gedacht, Sie seien noch sehr jung. Und jetzt heißen Sie auch so.« Sein Lachen war weniger melodiös als ihres, leicht angespannt, fand sie. Ringsum blieb alles still, kaum ein Geräusch war zu hören außer der Unterhaltung zwischen den beiden.
»Ich bin wohl älter, als Sie meinen«, sagte er, nun ernsthaft, sogar leicht beleidigt, wie ihr schien.
»Sind Sie verheiratet?«, fragte sie und freute sich über seine sichtliche Irritation, seine Mundwinkel zitterten leicht. Sie sah nun, dass er eine randlose Brille trug, die ihn älter machte, und einen dünnen Schnurrbart, der ihm nicht stand.
»Ja, das bin ich, Fräulein Spielrein. Aber die Fragen stelle ich, wenn Sie das bitte akzeptieren wollen.«
Sie tat, als ob sie ihn nicht verstanden hätte. Sie richtete sich halb auf. »Und ist Ihre Frau denn in froher Erwartung?«
Er schwieg, musterte sie abwartend; die Schwestern wagten kaum zu atmen; nur von einer, der jüngsten, kam ein Geräusch, das klang wie ein unterdrücktes Lachen.
Sabina sank zurück aufs Bett, sie murmelte etwas, die Wörter, die sie zustande brachte, wurden lauter, blieben aber unverständlich, dann hob und senkte sich ihr Körper in immer schnellerem Rhythmus. Doktor Jung gab einer Schwester einen Wink, sie legte eine Hand auf Sabinas Bauch, das beruhigte sie sogleich. Erst seit Kurzem wusste sie, wie Kinder entstanden, das hatte ihr die Mutter viel zu lang verheimlicht, und Sabina hatte eigene Theorien dazu fabriziert, die sie allesamt wieder verwarf. Eine Zeit lang war sie davon überzeugt gewesen, dass das Kind im Oberschenkel der Mutter, der ja bei vielen Frauen sehr ausladend war, entstand und dann herausgeschnitten wurde. In einem medizinischen Buch, das im elterlichen Bücherregal – nicht bei der Biologie, sondern listigerweise bei der Geographie – hinter anderen verborgen war, hatte sie die Antwort gefunden. Sie hatte sie geahnt, auch durch die Andeutungen der Schulkameradinnen, aber es hatte ihr gegraut vor der Vorstellung dessen, was da bei der sogenannten Kopulation zwischen Mann und Frau geschah, es war ihr gleichzeitig klar, dass die Brüder längst Bescheid wussten. Sie hatte die Mutter damit konfrontiert, und diese hatte den Kopf gesenkt und sich herausgeredet, dass man eine junge Frau doch so lange wie möglich vor diesen Dingen verschonen müsse. Sabina, die schon ihre Menstruation hatte, sah das nicht ein und redete zwei Wochen lang kein Wort mehr mit der Mutter; der Vater blieb ohnehin bei solchen Dingen außen vor, obwohl er sie, wenn sie vorlaut gewesen war, auf den nackten Hintern geschlagen hatte, was mit der Zeugung in keiner Weise verbunden war.
Sie stellte sich den Doktor Jung vor, wie er auf seiner Frau lag und in sie eindrang, weil das beim Zeugungsakt offenkundig nötig war, und stöhnte dabei abwehrend auf.
Besorgt fühlte ihr die junge Schwester den Puls, und Doktor Jung fragte, ob ihr nicht gut sei. Doch Sabina beruhigte sich.
»Es ist nichts«, sagte sie mit klarer Stimme. »Gar nichts.«
»Wir sehen uns schon morgen wieder«, eröffnete ihr der Doktor, bevor er ging. »Wir sehen uns von nun an jeden Tag um elf. Ich wünsche mir, dass Sie um diese Zeit bereit sind, zur Konsultation in mein Besprechungszimmer geführt zu werden.« Dann stand er auf und verließ ohne Händedruck oder ein weiteres Zeichen den Raum, und Sabina kam sich plötzlich, zu ihrer eigenen Verwunderung, verlassen vor, obwohl sie ja flankiert war von ihren Eltern.
Sie war enttäuscht, sie hätte den Doktor gerne weiter herausgefordert. Das sollte man als junge gefügige Frau nicht tun; gerade deshalb tat sie es, sie konnte dem Zwang nicht entrinnen.
»Herr Doktor Jung«, sagte sie, völlig beherrscht in die Runde, »hätte mir gewiss geraten, was man bei hartnäckiger Verstopfung tun kann.« Sie liebte die beiden deutschen vokalreichen Wörter, die sie hier aneinandersetzte, »hartnäckig« und »Verstopfung«, sie klangen fremdartig und anziehend, ganz anders als »Regen« oder »Besen«. Den Anwesenden im Konsultationszimmer schien für einen Augenblick der Atem zu stocken.
»Ich mag es nicht«, fuhr Sabina fort und achtete nicht darauf, dass die Mutter sich mahnend räusperte, »wenn der Stuhlgang« – auch eines dieser seltsamen Wörter – »ausbleibt.« Sie schaute provozierend in die Runde. »Oder ist Ihnen lieber, wenn ich von Scheiße rede?« Das Wort hatte sie von einer deutschsprachigen Klassenkameradin aus Rostow, die sich gerne derb ausdrückte; im Familienvokabular kam es nicht vor, aber alle wussten, was es bedeutete.
Es gehörte zu den Gepflogenheiten bei den Spielreins, dass jeden Tag bei Tisch, auf Geheiß der Mutter, eine andere Sprache geübt wurde. Am Dienstag war Deutsch an der Reihe. Sabina lachte auf und zog die Beine an, ließ wieder ihre Strümpfe bis über die Knie sehen, und die Mutter zog ihr den Rock so weit hinunter, wie es ging. »Lass mich«, fauchte Sabina, warf sich auf dem Stuhl herum und lachte gleich wieder. Ob Doktor Jung gegen sie Gewalt anwenden würde, wusste sie noch nicht, aber sie stellte sich gerne ihren heftigen Widerstand vor; seine Hände waren ungewöhnlich groß, beinahe derb.
»Es ist genug«, meldete sich die Älteste der drei Pflegerinnen zu Wort und wandte sich an die Mutter, deren gerötetes Gesicht von ihrer Verlegenheit zeugte. »Wir bringen Fräulein Spielrein nun in ein Einzelzimmer, dort kann sie sich beruhigen. Sie bleibt ja für die Dauer der Konsultationen hier im Hauptgebäude, ich werde das noch mit dem Herrn Doktor absprechen.«
»Wir haben einen Koffer mit Kleidern dabei«, beeilte sich die Mutter zuzustimmen, und der Vater nickte gravitätisch.
»Sie bekommt Anstaltskleidung«, sagte die jüngste Pflegerin leicht schadenfreudig.
Sabina fuhr auf, ihr Körper versteifte sich, sie gab einen Laut von sich, der wie ein Entsetzensschrei klang. »Das habt ihr mir nicht gesagt! Ihr seid Heuchler! Ihr wollt mich einfach loswerden!«
Die Mutter schüttelte schuldbewusst den Kopf. »Du bist ja oft gar nicht mehr zugänglich, Sabina.«
»Wenn Sie sich angemessen verhalten, Fräulein Spielrein«, mischte sich die Wortführerin ein, »werden auch wir Sie mit Anstand behandeln. Bitte fügen Sie sich unseren Anordnungen.«
»Rufen Sie den Doktor«, empörte sich Sabina, »er soll es mir persönlich sagen.«
Aber niemand achtete mehr auf ihren hervorgekeuchten Protest, der Vater hatte sich zur Wand gedreht, damit er nicht Zeuge der weiteren Demütigung seiner Tochter wurde. Denn nun umringten die vier den Stuhl, hoben Sabina, die den Widerstand aufgab, fachkundig mit längst eingeübten Griffen aus dem Stuhl, und führten, nein, trugen sie hinaus. Ein einziges Mal noch schrie Sabina auf dem Weg in ihr Zimmer auf, wild und triumphierend. Woher der Triumph kam, wusste sie nicht, aber er war da, heiß und überwältigend.
2Zürich, Sabina in der Klinik Burghölzli
Sie schlief in dieser Nacht lange, fuhr aber einmal mit einem Schrei auf, weil sie sich von einer schattenhaften Gestalt bedrängt fühlte und fürchtete, ihre Eingeweide hätten sich rot verfärbt. Sie schickte die Nachtschwester, die herbeieilte – es war wieder die junge – zurück in die Wachstube, wie das hier hieß. Am Morgen wurde ihr ein Frühstück gebracht. Schwarzbrot esse sie nicht, sagte sie mit scharfer Betonung. Wortlos trug die Schwester das Tablett weg, kam aber wieder und legte mit leicht schadenfrohem Lächeln ein Kleid über das Bett, es war die weißgraue Anstaltskleidung, die man hier zu tragen habe, belehrte sie die Patientin.
»Ich nicht«, fuhr Sabina sie an. »Dieser grobe Stoff würde mich kratzen, das weiß ich im Voraus, und dann würde meine Haut feuerrot.« Sie lachte laut, blies die Backen auf und hielt den Atem an, sodass ihr Gesicht sich schon jetzt rötete.
Die Schwester – oder doch eher die Pflegerin? – unterdrückte ein Lachen und sagte: »Sie können ja Ihre Unterkleider anbehalten.«
»Das will ich aber nicht«, widersprach Sabina. »Ich spüre gerne weichen Stoff auf meiner geplagten Haut.«
»Geplagt?« Die Schwester schien verwirrt. »Warum geplagt?«
»Weil die Welt mich plagt, mein braves Kind«, erwiderte Sabina. »Dich denn nicht?« Mit einem Ruck zog sie ihr Nachtgewand, das die Mutter mitgebracht hatte, über den Kopf und stand nackt vor der Schwester da, sie wusste ja, dass sie schöne Brüste hatte. »Wie heißt du denn, mein Kind?«
Die Schwester senkte beschämt den Kopf und stammelte: »Das dürfen Sie nicht.« Sie war den Tränen nahe. Dennoch fügte sie mit kaum verständlicher Stimme hinzu: »Also gut, ich heiße Johanna.«
Sabina empfand plötzlich ihr gegenüber ein starkes Mitleid. »Ist ja gut, Johanna«, tröstete sie die Pflegerin, die bestimmt schlecht ausgebildet war. »Ich tue, was du willst.« Damit nahm sie die Anstaltskleidung vom Bett und streifte sie sich über den Kopf, fuhr mit den Armen in die Ärmel, schüttelte sie, bis der Stoff ordentlich über die nackte Haut fiel, fast bis auf den Boden. Sie wirbelte einmal um sich selbst, sodass sich der Rocksaum leicht hob. »Nun, wie sehe ich aus, liebe Johanna?«
Das Mädchen – es war doch noch ein Mädchen – war augenscheinlich in größter Verlegenheit und sagte nichts.
»So werde ich vor den Herrn Doktor Jung treten und ihn fragen, wie kleidsam er diese Tracht findet.«
»Das weiß ich nicht, Fräulein Spielrein. Aber er wird Sie auffordern, ein Unterkleid zu tragen.« Sie lächelte nun sogar, auf verschmitzte Weise, wie Sabina schien.
»Meinst du denn«, fragte sie, »er würde bemerken, dass ich keines trage? Das Kleid ist ja so hochgeschlossen, wie es nur geht, es würgt mich beinahe.« Das stimmte natürlich nicht, aber damit hatte sie Johanna nun doch ein kleines, leicht gackerndes Lachen entlockt, und Sabina setzte sich würdevoll auf den Holzstuhl, einen der zwei, die zur Zimmerausstattung gehörten.
»Ich bringe Ihnen einen Tee«, sagte Johanna. »Etwas müssen Sie doch trinken.«
Sabina schüttelte den Kopf. »Eigentlich trinke ich nur Champagner.«
Johanna schien es die Sprache zu verschlagen.
Sabina lachte laut. »Jetzt habe ich dich hereingelegt, wie? Bring mir einen Krug Wasser und ein Glas, das reicht.«
Johanna nickte unsicher; ihre nun wieder verschlossene Miene verriet, dass sie aus dieser Patientin nicht klug wurde. Sie hatte die Tür schon geöffnet, da hielt Sabina sie mit einer Frage auf: »Welche Uhrzeit haben wir, liebe Johanna? Meine goldene Uhr, die mir der Teufel geschenkt hat, liegt unter der Matratze.«
Das Mädchen räusperte sich und sagte in Sabinas neuerliches Gelächter hinein: »Bald neun, glaube ich.«
Sabina mimte ein Erschrecken. »Oh, ich werde ja schon bald zu Herrn Doktor Jung gebracht. Für die erste Konsultation. Das ist wohl sehr feierlich. Ich muss mich jetzt vorbereiten. Geh nur.«
Johanna schloss leise die Tür hinter sich. Und Sabina hatte in der Tat das Gefühl, sie müsse sich so gut wie möglich auf die Konfrontation mit dem Doktor vorbereiten, allerlei Flucht- und Angriffswege überdenken, um ihn, den schönen Mann, zugleich zu verführen und zurückzuweisen. Er sollte ja nicht glauben, er sei ihr als junger Frau von Natur aus – und durch seine Ausbildung natürlich – haushoch überlegen. Sie nahm sich vor, ihn in Verlegenheit zu bringen, aus seiner gütigen Ruhe herauszuscheuchen. Er sollte sie bloß nicht fragen, was ihre Zukunftswünsche seien, das behielt sie für sich. Sie hieß Sabina Spielrein, sie war Jüdin, und ihr war bewusst, dass der Familienname Anlass zu Spott und schmierigen Andeutungen gab. Damit musste sie leben. Genügte das denn nicht? Sie hätte jetzt, wie schon so oft, gerne über Zauberkräfte verfügt und sich in eine Katze verwandelt, und wäre in dieser Gestalt zum Herrn Doktor gegangen, stolz, mit erhobenem Schwanz.
Sie zog sich wieder um, schlüpfte in ihr rotes Sonntagskleid, das ihr die Mutter zum Glück ebenfalls in die große Ledertasche gepackt hatte, auch ein paar unverdächtige Bücher hatte sie eingepackt, damit es der verwirrten Tochter nicht langweilig würde, Pride and Prejudice von Jane Austen war dabei, wohl eine Aufforderung an die Tochter, ihr unverständliches Verhalten zu bereuen. Da hielt sie sich lieber an Madame Bovary, von der ihr die Mutter streng abgeraten hatte. Deshalb hatte Sabina es sich heimlich von einer Mitschülerin ausgeliehen und zuunterst ins Gepäck geschmuggelt, unter den Knäuel der wollenen Strumpfhose, die sie hasste. Sie hatte aber gar keine Lust zu lesen, schaute sich dafür sehr lange im kleinen und trüben Spiegel an, der immerhin an der Wand hing, von einem darüber hängenden Schal halb zugedeckt. Den Schal legte sie sich um den Hals und hielt eine Weile ihr eigenes Spiegelbild aus. Sie war überhaupt nicht schön, wie bestimmte Männer behaupteten, die Nase zu schief, das Kinn zu eckig, sie schnitt eine Grimasse, das hatte sie schon als kleines Kind gelernt, sie wusste, dass man damit Leute erschrecken oder in die Enge treiben konnte, aber bestimmt nicht Herrn Doktor Jung. Wobei sie es ja versuchen konnte. Jetzt erprobte sie ein schnippisches Lächeln und zog die Augenbrauen hoch, um interessant und klug zu wirken. Sie wusste, dass dies junge Männer verwirrte. Mittelalterliche auch?
Sie konsultierte ihre Taschenuhr, die sie auch mitgeschmuggelt hatte. Es dauerte noch lange bis elf. Sie las ein paar Seiten in Flauberts Roman, sie merkte rasch, dass die Anfangsszene sie langweilte. Also schob sie den Lesestuhl ans Fenster, schaute hinaus in die ebenso langweilige Parklandschaft, über der ein bedeckter Himmel hing, sie sah Frauen in der Anstaltstracht auf gekiesten Wegen hin und her wandern, allein oder zu zweit, einige schleppten die Rocksäume über den Boden, das fand Sabina entwürdigend. Sie hatte Lust, mit beiden Fäusten an die Scheiben zu trommeln oder das Fenster aufzureißen und ihre Missbilligung hinauszuschreien. Sie tat es aber nicht. Sie solle, hatte ihr ein Arzt in Rostow geraten, nicht jedem Impuls nachgeben, damit schade sie ihrer geistigen Gesundheit. Außerdem, das hatte sie schon herausgefunden, war das Fenster mit einem Schlüssel zugesperrt. Rütteln nützte nichts, die Scheibe zerschmettern könnte sie später einmal, falls nötig. Sie schaute auf den Sekundenzeiger ihrer Uhr – Viertel vor elf nun – und überlegte, ob die Zeit schnell oder rasch verging. Hätte sie, ging ihr durch den Kopf, einen Lippenstift dabei, würde sie ihn jetzt benutzen, sie war ja schon fast neunzehn, in einem Alter, da andere Frauen verheiratet waren und Kinder hatten. »Das sind«, hätte die Mutter auf ihre sachliche Weise gesagt, »Frauen unter unserem Stand. Bei uns wartet man auf die angemessene Partie, und das kann gut bis Mitte zwanzig oder länger dauern.«Da hatten sie Russisch gesprochen, das klang weniger geziert. So vieles musste in diesem Haushalt heimlich geschehen, wenn man eine junge Frau war. Die Brüder genossen alle möglichen Vorrechte. Das hatte sie satt, aber sie wusste jetzt, wie man die Aufmerksamkeit auf sich zog.
Um fünf vor elf kam die Schwester herein. Johanna hatte mehrfach geklopft, und Sabina hatte nicht reagiert, weil die bevorstehende Visite sie nun doch bedrückte, aber das hätte sie niemandem eingestanden.
»Es ist Zeit«, sagte Johanna. »Wollen Sie wirklich in diesem Kleid …« Sie brach ab, und Sabina nickte: »Ja. Aber du hast wohl auch keinen Lippenstift, oder?«
Johanna errötete. »Nur für den Sonntag«, brachte sie verlegen hervor. »Ich habe ihn nicht dabei.«
Sie ging voraus, Sabina folgte ihr mit absichtlich kurzen Schritten, die Schuhe passten nicht zum Kleid, die hätte sie auch wechseln müssen, die Mutter hatte doch eigentlich an alles gedacht. Sie gingen durch lange Gänge, in denen es überall ähnlich roch, nach abgestandener Luft und Gemüsesuppe, nach Bohnerwachs. Hier sollte man regelmäßig lüften, dachte Sabina. Von allen Seiten glaubte man ein Murmeln zu hören. Ja, lüften! Das war wieder eines der deutschen Wörter, die sie liebte. Sie kamen vor eine massive Tür, Johanna klopfte erstaunlich kräftig an die Tür. Es dauerte eine Weile, bis sie sich öffnete. Vor ihnen stand Doktor Jung. Er überragte die beiden Frauen um einen Kopf, beugte sich, nach einem erstaunten Blick auf Sabinas Kleid, ein wenig zu ihr herunter: »Treten Sie ein, Fräulein Spielrein. Schön, dass Sie so pünktlich sind.«
Johanna war nach einem kurzen Gruß schon wieder weg.
»Sie sind«, sagte Sabina, »sehr groß und ausgestattet mit einem breiten Brustkasten.«
Jung schaute sie verblüfft an. Dann lachte er. »Stört Sie das?«
»Nein, mich nicht. Aber Ärzte für Nervenleiden sollten nicht so großgewachsen sein. Es wirkt sonst einschüchternd auf die Patienten. Oder nicht?«
»Es kommt darauf an.« Jung lud sie mit einer Handbewegung zum Eintreten ein und wies ihr einen Sessel zu, setzte sich dann auf seinen Stuhl. Zwischen ihnen stand ein mit Papieren überladener Schreibtisch.
»Sie sprechen ausgezeichnet Deutsch, fast ohne Akzent«, sagte Jung nach einem Schweigen, das schon fast beklemmend wurde, aber vom Arzt, der wieder helle Kleidung trug, offenbar erwünscht war.
Sabina bemühte sich um Höflichkeit. »Ich liebe Sprachen«, sagte sie. »Ich möchte möglichst viele sprechen. Und in jeder etwas anderes sagen.«
Jung schaute sie forschend an. »Was denn?« Seine Stimme klang leicht belegt, das reizte sie.
»Ach, Herr Doktor« – sie rekelte sich ein bisschen –, »das sind meine Geheimnisse. Die gehen niemanden etwas an. Verstehen Sie?«
»Wie geht es Ihnen denn?«, fragte er übergangslos.
Sie tat, als überlege sie genau, flüsterte dann, wie wenn es ein Geheimnis wäre: »Mal gut, mal schlecht. Aber eigentlich weiß ich es nicht. Wissen Sie es von sich?«
Er lächelte, griff kurz an seinen Brillenrand. »Einigermaßen, mein Fräulein. Aber das ist nicht unser Thema.«
Sie versuchte, seinen forschenden Blick nachzuahmen. »Das Thema bin also ich?«
»Eindeutig. Das ist unser Arrangement, wenn Sie so wollen.«
»Und wenn ich nicht will?«
»Dann werden Sie Ihre Eltern enttäuschen.«
»Und Sie auch?«
Er lächelte wieder, ihn zum Lächeln zu bringen, war ihre Absicht gewesen. »Das weiß ich noch nicht. Aber erzählen Sie doch zunächst, warum Sie hier sind.«
»Weil meine Eltern mich dazu gedrängt haben. Und auch andere Respektspersonen, die mich nicht aushalten.«
»Hat man sie gezwungen?«
»Überredet, das ist wohl das richtige Wort.«
»Schätzen Sie Ihre Eltern?«
»Sie mich oder ich sie?«
Er stutzte, berührte einen Moment die Nase. »Ach ja, den Satz kann man so oder so verstehen.«
Jetzt war sie es, die lächelte, zugleich rieb sie ihre Hände, als ob sie sich anspornen wollte. »Ich schätze sie meistens, aber sie mich weniger, die Brüder – vor allem der mittlere, Isaak –, sie sagen manchmal, ich sei mit meinen Anfällen dem Teufel entronnen.«
»Anfällen?«
Sie schüttelte den Kopf wie eine unzufriedene Lehrerin. »Aber das hat man Ihnen doch gesagt, Herr Doktor. Ich erschrecke sie mit meinen Anfällen, die leider hin und wieder über mich kommen. Ich weiß hinterher nicht mehr viel davon.«
Jung nickte, etwas zu gravitätisch, fand sie.
»Sie sagen, dass ich schreie, bebe, mich winde, zapple. Ach, es ist fürchterlich, nicht wahr?«
Er schwieg, sein Lächeln war aber jetzt verschwunden, als habe es jemand weggewischt.
»Wollen Sie es sehen?«
Er schwieg immer noch.
Sie atmete stark und immer stärker, steigerte sich in ein fast groteskes Keuchen hinein, sie warf sich auf dem Sessel mit seinen Armlehnen hin und her, raufte sich die Haare, schrie plötzlich gellend auf, fiel fast auf den Boden, verstummte plötzlich. »Jetzt habe ich es absichtlich gemacht«, sagte sie, als sie wieder zu Atem gekommen war. »Mein Körper weiß ja, wie es abläuft. Aber sonst geschieht es einfach mit mir, und ich kann nichts dagegen tun.«
Jung nickte. »Sie wissen also doch ziemlich viel darüber?«
Sie errötete, fühlte sich ertappt und gleichzeitig ungefährdet, weil er so ruhig blieb. »Jetzt bin ich müde«, sagte sie. »Ich könnte gleich einschlafen.«
»Wie Sie wollen.«
»Werden Sie mich nicht bestrafen?«
Er schüttelte den Kopf. »Warum denn? Wir sind in einer therapeutischen Sitzung. Da ist alles möglich.«
Seine Äußerungen klangen beruhigend, sie war sicher, dass er nicht log. Ihre drei Brüder logen dauernd, auch der Vater, nur versteckte er sich besser hinter seinem Bart. Sie lehnte sich zurück, schlug die Beine übereinander, glättete den roten Rock. Dann schloss sie die Augen, blinzelte aber zwischendurch, um zu schauen, ob er sie weiterhin beobachtete. Das tat er, mit besonnener und leicht besorgter Miene; man konnte ihn wohl nicht so leicht aus der Fassung bringen. Doch genau das trieb sie seit Wochen am meisten an: Leute aus der Fassung zu bringen. Warum, das wusste sie nicht; er sollte es ihr sagen. Oder war da eher das Wort »offenbaren« am Platz?
Sie beschloss nun aber zu schweigen, er sollte nicht glauben, dass sie sich so ohne Weiteres auf ihn einließ.
Also rührte sie sich kaum noch, veränderte nur hin und wieder unmerklich die Lage der Beine auf dem unbequemen Stuhl. Aber er schwieg auch, ebenso beharrlich wie sie. Ihr schien, von ihm gehe ein leichter Tabakgeruch aus, der ihr nicht unangenehm war, auch wenn die rauchende Pfeife des Vaters sie oft gestört hatte.
Die Zeit verging nun sehr langsam. Aber sie langweilte sich nicht, ihre inneren Bilder, die hauptsächlich mit den Brüdern, den Eltern und dem Mann ihr gegenüber zu tun hatten, stolperten übereinander, ergaben keinen Sinn, auch der magere Mathematiklehrer, der sie immer so bedeutungsvoll angeschaut hatte, wurde Teil dieses Korsos, der sie erheiterte und gleichzeitig erboste. »Lasst mich doch in Ruhe!«, entfuhr es ihr plötzlich. Aber Jung reagierte nicht darauf. Sie musste wohl doch eine Weile geschlummert haben, denn seine Stimme ließ sie aufschrecken.
»Wie bitte?«, fragte sie und strich die Haare aus der Stirn.
»Die Zeit ist um«, sagte Jung ohne besondere Betonung, sie sah, dass er seine Taschenuhr, die an einer Kette hing, konsultiert hatte. »Wir sehen uns morgen wieder, um die gleiche Zeit. Auf Wiedersehen!«
Sonst kein Wort mehr, keine Bewertung, keine Interpretation ihres Verhaltens. So ging das also. Sie strich ihren Rock glatt, stand auf, nickte ihm zu und verließ das Zimmer ohne ein weiteres Wort. Schweigen konnte sie, sie hatte es schon als Kind geübt. Nun war niemand da, der sie draußen durch die Gänge lotste. Aber sie fand den Weg zu ihrem Zimmer – oder war es eher eine Zelle? – allein. Nummer 114, das hatte sie sich gemerkt, die Zahl war in eine ovale Plakette über dem Türrahmen eingraviert, sie merkte sich vieles, oft Überflüssiges. Und auch wenn die Lust sie packte, irgendeines der Zimmer unaufgefordert, als Eindringling, zu betreten, tat sie es nicht. Nicht ausgeschlossen, dass sie es ein anderes Mal tun und das Erschrecken einer überraschten Patientin auskosten würde. Wann fühlte sie sich eigentlich überlegen und sicher? Meist dann, wenn sie es war, von der die Initiative ausging. Aber bei Jung war sie damit ins Leere gelaufen. Es würde ihr bestimmt gelingen, ihn früher oder später aus der Reserve zu locken. Ja, und bei ihr, als Hysterikerin, war ja alles denkbar, eine Zwangsjacke würde ihr der Doktor Jung bestimmt nicht anlegen lassen. Damit betrat sie das Zimmer Nummer 114, die Tür stand noch offen, ihre Habseligkeiten lagen unverändert dort, wo sie sie gelassen hatte, eine prächtige Unordnung, dachte Sabina, die Mutter wäre entsetzt. Sie setzte sich aufs Bett, das eher ein Kanapee war. Der Mann, der Jung hieß, ging ihr nicht aus dem Kopf, überhaupt gingen ihr die Männer nicht aus dem Kopf, weder die nahen noch die fernen. Sie waren so verschieden, aber doch gleich in ihrer Art, sie verbargen sich hinter ihrem anerzogenen Imponiergehabe. Sie sah das ja bei ihren Brüdern. Sabina selbst verbarg sich auch, sonst verlor sie sich. Ging das den Männern ebenso? Sie würde Doktor Jung dazu bringen, seine Fassade aufzugeben, sich ihr zuzuneigen, sie zu retten, wie es doch seine Aufgabe war. Vor allem zu retten und zu schützen vor dem, was auf sie zukam. Auch was die Männer betraf. Irgendeinen würde sie ja dann heiraten müssen, das war kaum zu vermeiden. Aber wen?
Sie zog ihr blutrotes Kleid aus, das würde sie bei den kommenden Sitzungen nicht mehr tragen. Ein perlgraues, zurückhaltendes Kleid, das wäre das richtige. Oder sogar die Anstaltstracht. Da würde der hochgeachtete Herr Jung bestimmt staunen.
In ihrem luftigen Nachthemd legte sie sich hin und deckte sich zu, obwohl die Sonne durchs Fenster schien. Die merkwürdige Unterhaltung mit dem Arzt klang in ihr nach wie ein spöttisches und doch ernsthaftes Echo. Er würde wissen wollen, was sie träume, das hatte man ihr vorausgesagt. Sie dachte daran, für ihn einen besonderen Traum zu erfinden, einen mit Nachtigallen und Elefanten. Darüber musste sie lachen. Und dann schlief sie trotzdem ein, und was sie dann träumte, war ganz anders. Es hatte mit einem großen Feld zu tun, auf dem sie stand. Oder eher einer Einöde, kein Mensch zu sehen, kein Haus, kein Baum, und eine Verzweiflung wuchs in ihr, für immer allein zu sein, ihr schien auch, ihre bloßen Füße seien in den weichen Grund eingewachsen, denn als sie sich bewegen wollte, war sie gefangen, reglos, einfach ein Teil der Natur, und das wollte sie nicht, das wollte sie um keinen Preis. Jemand war plötzlich da, in ihrer Nähe. Sie schreckte auf, öffnete mit Mühe die Augen, ihr Herz klopfte wild. Es war immer noch heller Tag, vor ihr stand Johanna mit ihrer hässlichen Haube.
»Es ist schon vier Uhr, Fräulein Spielrein«, sagte sie sehr leise. »Ich habe mehrfach geklopft. Da dachte ich …«
»Schon gut«, beschied Sabina ihr unsanft und zog die Decke über sich. »Und sag du zu mir. Dieses Fräulein-Getue ärgert mich.«
Johanna zögerte. »Das ist uns untersagt …«
»Dann mach, wie du musst!« Gleich tat ihr leid, wie eingeschüchtert die Schwester jetzt wirkte, die ja fast im gleichen Alter war wie sie.
»Aber«, setzte Johanna neu an, »Sie können mich natürlich nennen, wie Sie wünschen. Da gibt es keine Vorschriften.«
Sabina zog es vor, nichts Weiteres zu sagen.
Die Schwester senkte duldsam die Augen. »Um halb sieben wird für die Insassen der höheren Klasse das Essen serviert. Sofern Sie …« Sie brach wieder ab, doch es war klar, was sie sagen wollte.
Sabina nickte. »Ja, du kannst mich holen, ich werde mich bekannt machen mit den wohlhabenden Gästen. Darum geht es doch, oder?«
Johanna nickte, wagte nun aber einen forschenden Blick zu Sabina. »Es sind nicht viele in Ihrer Klasse, nur drei, um genau zu sein. Die sind in ihrer Therapie schon weit fortgeschritten. Fühlen Sie sich dem gewachsen, Fräulein Spielrein?«
Sie hat wohl ihre Anweisungen von Doktor Jung, dachte Sabina und antwortete in hartem Ton: »Ja, das entscheide nämlich ich ganz allein, nur damit du das weißt. Du kannst mich holen, wenn es Zeit ist. Nicht zu früh, am liebsten auf die Minute genau. Hoffentlich wird nicht gebetet. Aber wir sind ja nicht in einem Kloster. Außerdem gehöre ich dem jüdischen Glauben an.« Sie hob die Hand und zeigte zur Tür. »Und jetzt kannst du gehen, meine Liebe.«
Johanna verschwand lautlos, auch die Tür, die doch leicht knarrte, gab keinen Ton von sich. Dieses Mädchen war offenbar darauf trainiert, sich unsichtbar und unhörbar zu machen, vermutlich der erfolgreiche Einfluss einer Oberschwester, die ihrerseits den Doktor Jung verehrte. Aber sie, Sabina Spielrein, wollte das nicht; sie wollte sichtbar sein, sichtbar vor allem für diejenigen, die sie gerne aus ihrem Gesichtsfeld verbannt hätten. Und sie galt offenbar nicht als schwerer Fall, sonst würde man sie nicht anderen zumuten. Das kann ja noch kommen, dachte sie mit beinahe lustvoller Vorahnung.
Die Zeit verging erneut langsam, das Licht von draußen nahm ab. Sabina lehnte sich zurück auf dem gepolsterten Sessel und mochte es, dass er sich in ihren Rücken drückte. Sie würde, dachte sie, den Kampf mit dem Doktor aufnehmen, er würde sie nicht gefügig machen, weder mit List noch mit Einschüchterung, höchstens, da stockte ihr der Atem, mit schmerzhafter Körperstrafe, aber dazu würde es nicht kommen. Nein, auch da würde sie widerstehen, sie hatte es eingeübt.
3Zürich, Klinik Burghölzli, Speisesaal
Dann war es Zeit, die Schwester – oder war es eher die Zofe? – holte sie ab und führte sie schweigend in den Speisesaal der Patienten erster Klasse. Sie beeilte sich, damit die Verspätung nicht als Absicht wirkte, sondern wie ausnehmende Pünktlichkeit. Am runden Tisch saßen schon die anderen drei, zwei Frauen in vorgerücktem Alter, ein Herr mittleren Alters. Sabina grüßte, wurde zurückgegrüßt. Weiter sagte niemand ein Wort, keine Namen wurden genannt. Eine Kellnerin schöpfte, ebenfalls wortlos, eine klare Suppe mit Einlage. Man wünschte sich in großer Höflichkeit guten Appetit, man aß, man schlürfte, denn die Suppe war heiß. Eine der Damen verzog dauernd den Mund, beinahe zu einer Grimasse, die Hand der anderen zitterte leicht, bei jedem Löffel tropfte etwas Suppe aufs Tischtuch. Der Herr legte den Löffel nach einer Kostprobe angewidert, wie es schien, zur Seite. Sabina fand die Suppe zu geschmacklos und löffelte sie trotzdem. Ich bin ja brav wie ein kleines Kind, dachte sie.
»Schmeckt es Ihnen?«, fragte sie in die Runde.
Niemand antwortete. Als die Kellnerin schon die nächste Platte auftrug, griff Sabina nach ihrem Teller, leerte sich die Suppe über die Bluse und schmetterte den Teller mit Wucht auf den Boden, es klirrte, er zersprang trotz des dicken Teppichs. Nach einer Schrecksekunde aßen die beiden Damen weiter, als ob nichts passiert wäre, eine hüstelte bloß. Der Herr indessen nickte Sabina anerkennend zu. Sie stand da wie erstarrt, konnte sich wie immer nach solchen Ausbrüchen, die sie selbst überraschten, weder bewegen noch sprechen. Aus dem Schatten im Hintergrund löste sich eine Aufseherin, sie schimpfte auf Sabina ein, während eine zweite Person schon mit Putzeimer, Schaufel und Bürste anrückte und in Kauerhaltung das Chaos, das Sabina verursacht hatte, aufwischte und zusammenkehrte. Sabina schaute ihr zu und hatte nicht im Geringsten den Eindruck, ihr helfen zu müssen, sie ahnte ja, was Therapie, Kost und Logis in ihrer Klasse kosteten. Sie ignorierte die Aufseherin, die mit ihrer Strafpredigt fortfuhr, und brach in ein überlautes Gelächter aus, das nicht höhnisch sein sollte, aber so wirkte. Ihrem Lachzwang war sie ausgeliefert, sie presste beide Hände auf den Mund, um ihn zu ersticken, und nun klang es wie Hilferufe. Die beiden Damen aßen ungerührt weiter, aber mit feindseligen Blicken, die Sabina galten. Jemand vom Personal musste einen Aufseher herbeigerufen haben, der war plötzlich da, packte Sabina von hinten und versuchte sie, ihr gut zuredend, aus dem Raum zu schaffen. Als er sie wegtrug, wehrte sie sich erst nicht, dann aber schon, und als sie draußen im Gang waren, schrie sie plötzlich so gellend und zappelte so wild, dass sich anderswo die Türen öffnete und Patienten und Personal das Schauspiel verfolgten. Jemand zischte missbilligend, das Zischen ahmten andere nach, und das machte Sabina noch zorniger. Der Mann, der nach Haarwasser roch, hielt sie fest, er umschlang sie von hinten, als wäre er ihr Liebhaber. Als ihre Kräfte nachließen, lockerte er den Griff und stellte sie irgendwo auf den Boden, der war kalt, sie hatte einen Schuh verloren. Plötzlich war auch eine Frau zur Stelle, sie redete beruhigend auf Sabina ein, die stumm, aber immer noch heftig atmend, neben dem Mann herhinkte. Die Fußsohle schmerzte sie, vermutlich war sie in eine Scherbe getreten. Selber schuld, dachte sie und machte innerlich eine kleine höhnische Melodie daraus: Selber schuld, selber schuld! Sie winkte einer Patientin zu, die ihr, wie sie genau sah, aus einem Türspalt heraus die lange Nase machte.
Der Mann, der offenbar zuständig war für Gewaltausbrüche, erreichte mit ihr Sabinas Zimmer und half ihr, erstaunlich behutsam, auf ihr Bett.
»Brauchen Sie etwas?«, fragte er beinahe mitleidig.
Sie verneinte, er ging weg. Aber kurz darauf kam eine Aufseherin, die Sabina noch nicht gesehen hatte, und brachte ihr Beruhigungstropfen. Sabina schluckte sie willig, trank hinterher lauwarmen Tee, sie wollte nun gefügig sein, eine gute Patientin, und versuchte sogar zu lächeln. Die Aufseherin lächelte zurück, dann war auch sie nicht mehr da, und Sabina hatte Zeit, an Doktor Jung zu denken und wie er auf ihren Ungehorsam reagieren würde. Mit Enttäuschung? Aber sie wollte ihn nicht enttäuschen. Was wollte sie denn?
Am nächsten Morgen um elf wurde sie wieder zu ihm geführt. Jemand hatte ein Pflaster über ihre Fußsohle geklebt, sie hatte keine Lust, all diese Gesichter voneinander zu unterscheiden, aber seines wollte sie erkunden. Dieses Mal kam er ihr nicht entgegen, sie kannten sich ja schon. Er saß hinter dem Schreibtisch, würdevoll und schweigend, nickte ihr immerhin zu. Nun gut, wenn das eine Prüfung sein sollte, würde sie nicht darauf eingehen. Sie setzte sich, dieses Mal im mausgrauen Kostüm, sie wollte die Beine übereinanderschlagen und tat es nicht, er hätte es vermutlich als Provokation aufgefasst. So saßen sie einander gegenüber, sehr lange, wie ihr schien, sie begann, die Sekunden zu zählen wie als Kind, ehe sie aufstehen musste, bewegte die Lippen, ihm zugewandt, sodass er es bestimmt sah. Die Zeit verging, aber sie hielt das Schweigen durch. Sie betrachtete ihn, sah an seiner Wange eine kleine Schnittwunde. Auch er hatte sich also geschnitten. Er wollte offenbar keinen Backenbart, sondern einen sorgsam gestutzten wie die feinen Herren von Rostow. Nun sagte er doch etwas, sehr sanft: »Man hat mir mitgeteilt, sie hätten gestern einen kleinen Skandal verursacht.« Er hielt inne und behielt sie im Auge, erwartete offenbar eine Reaktion.
Sie machte eine abwehrende Gebärde: »Ach, das, ja. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist.«
Er schwieg, sie schwieg auch, es war ein gemeinsames Schweigen.
»Sie wollen keine Klärung«, nahm er nach Minuten den Faden wieder auf.
Sabina schüttelte den Kopf, schlug nun doch die Beine übereinander, faltete die Hände darüber und legte sie aufs Knie. Wie eine Gräfin, dachte sie plötzlich, eine schweigende Gräfin.
»Fürchten Sie«, sagte er plötzlich, »dass Sie bald wieder von solchen gewalttätigen Regungen überfallen werden?«
Sie antwortete nicht. Wie sollte sie das wissen? Sie war sich ja selbst oft genug ein Rätsel. Er sollte sie enträtseln, nicht sie sich selbst. Aber sie fürchtete, dass jeden Augenblick etwas aus ihr herausbrechen könnte, sie wusste nur nicht was. Deshalb presste sie die Lippen aufeinander, das sah er mit Sicherheit, denn er wandte den Blick nicht von ihr ab.
Das Schweigen dauerte an. Der Märzhimmel hinter dem Fenster war bedeckt, mit rasch voransegelnden Wolken, in die das nackte Geäst vom Anstaltsgarten unlesbare Zeichen schrieb.
Blinzelte er überhaupt? Sie versuchte es zu erkennen, sah es aber nicht, als ob er mit Absicht genau dann die Augen schloss, wenn sie es auch tat.
So schauten sie einander an, sie zwang sich, es auszuhalten.
Dann aber war die Stunde zu Ende und war wieder ganz anders verlaufen, als Sabina gedacht hatte. Er soll mich doch heilen, dachte Sabina beinahe empört und wünschte sich, Doktor Jung wäre ein Magier wie aus dem Märchenbuch ihrer Kindheit, der sie mit einer einzigen Berührung von ihrer quälenden Unsicherheit in so vielen Dingen erlösen würde. Dazu fehlte ihm aber der lange weiße Bart, der auf den Buchillustrationen zu sehen war. Sie spottete innerlich über sich selbst und stellte sich dennoch vor, dass es ihr gelingen würde, diesen so gelassen scheinenden Mann aus seiner demonstrativen Überlegenheit aufzuschrecken. Beharrliches Schweigen forderte ihn gewiss am meisten heraus. Sie nahm sich vor, diese Taktik so lange wie möglich durchzuhalten.
Es war erst halb eins. Wie sollte sie den Tag, der noch lang war, verbringen? Wie überhaupt die kommenden Tage? Sie galt als gefährdet, das wusste sie, für sie waren die Anstaltstore zugesperrt. Und man hatte den Eltern wohl abgeraten, die missratene Tochter zu besuchen. Wo logierten sie überhaupt?
Sabina suchte ihr Notizbuch im Gepäck, schlug es, am kleinen Schreibtisch sitzend, auf und schrieb einiges hinein, was vielleicht Poesie war, aber wohl doch nicht. In der Schule hatte man ihr eine Zukunft als Schriftstellerin vorausgesagt, ihrer originellen Vergleiche wegen, Schnee wie geschlagenes Eiweiß, ein altes Gesicht wie eine verwüstete Landschaft, aber nein, sie war keine Dichterin, solche Vergleiche waren zu gesucht, sie hatte ja eher wissenschaftliche Interessen, auch was ihren eigenen Zustand betraf.
Irgendwann kam Johanna und erkundigte sich, ob das Fräulein Spielrein etwas zu essen wünsche. Man hatte offenbar die Idee schon aufgegeben, sie mit anderen Patienten in Kontakt zu bringen. Sabina schüttelte den Kopf, kein Appetit, bedeutete dies. Johanna zog sich zurück, brachte dann trotzdem, auf Anweisung der Oberschwester, wie sie sagte, eine Kanne Tee samt Gebäck.